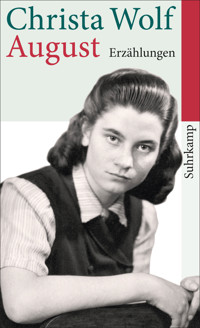8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1804 sind sich Karoline von Günderrode und Heinrich von Kleist bei einer Teegesellschaft in Winkel am Rhein begegnet – oder hätten sich zumindest dort begegnen können. Christa Wolf läßt die beiden Außenseiter aufeinandertreffen, läßt sie nachdenken über den fehlenden Freiraum, das nicht lebbare Leben und zeigt die Parallelen zu ihrer eigenen Gegenwart. Christa Wolf, geboren 1929 in Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski), lebt in Berlin und Woserin, Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen, darunter dem Georg-Büchner-Preis und dem Deutschen Bücherpreis für ihr Gesamtwerk, ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
1804 sind sich Karoline von Günderrode und Heinrich von Kleist bei einer Teegesellschaft in Winkel am Rhein begegnet – oder hätten sich dort begegnen können. In Kein Ort. Nirgends treffen die beiden Außenseiter aufeinander, kommen ins Gespräch, beide ernüchtert vom fehlenden Freiraum in der nachrevolutionären restaurativen Gesellschaft, beide der Ansicht, daß es keinen Ort gibt, an dem ein Leben zu leben wäre, das ihnen entspricht.
In ihrem faszinierenden, vielschichtigen Text erzählt Christa Wolf von zwei Künstlern, zwei Repräsentanten einer Generation, die gezwungen ist, neue Lebensmuster zu entwerfen, weil die alten nicht mehr gültig sind.
Christa Wolf, geboren am 18. März 1929 in Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski), starb am 1. Dezember 2011 in Berlin. Ihr Werk, das im Suhrkamp Verlag erscheint, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Georg-Büchner-Preis und dem Deutschen Bücherpreis für ihr Gesamtwerk. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud (st 4275).
Christa Wolf
Kein Ort. Nirgends
Suhrkamp
Die Erstausgabe von Kein Ort. Nirgends
erschien 1979 im Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar,
und zugleich im Hermann Luchterhand Verlag, Darmstadt.
Der Text, der dem 2000 erschienenen Band 6 der von
Sonja Hilzinger herausgegebenen Werke in zwölf Bänden folgt,
wurde für diese Ausgabe neu durchgesehen und korrigiert.
Umschlagfoto: Helga Paris
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2007
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-74130-6
www.suhrkamp.de
Ich trage ein Herz mit mir herum, wie ein nördliches Land den Keim einer Südfrucht. Es treibt und treibt, und es kann nicht reifen.
KLEIST
Deswegen kömmt es mir aber vor, als sähe ich mich im Sarg liegen und meine beiden Ichs starren sich ganz verwundert an.
GÜNDERRODE
Die arge Spur, in der die Zeit von uns wegläuft.
Vorgänger ihr, Blut im Schuh. Blicke aus keinem Auge, Worte aus keinem Mund. Gestalten, körperlos. Niedergefahren gen Himmel, getrennt in entfernten Gräbern, wiederauferstanden von den Toten, immer noch vergebend unsern Schuldigern, traurige Engelsgeduld.
Und wir, immer noch gierig auf den Aschegeschmack der Worte. Immer noch nicht, was uns anstünde, stumm. Sag bitte, danke.
Bitte. Danke.
Jahrhundertealtes Gelächter. Das Echo, ungeheuer, vielfach gebrochen. Und der Verdacht, nichts kommt mehr als dieser Widerhall. Aber nur Größe rechtfertigt die Verfehlung gegen das Gesetz und versöhnt den Schuldigen mit sich selbst.
Einer, Kleist, geschlagen mit diesem überscharfen Gehör, flieht unter Vorwänden, die er nicht durchschauen darf. Ziellos, scheint es, zeichnet er die zerrissene Landkarte Europas mit seiner bizarren Spur. Wo ich nicht bin, da ist das Glück.
Die Frau, Günderrode, in den engen Zirkel gebannt, nachdenklich, hellsichtig, unangefochten durch Vergänglichkeit, entschlossen, der Unsterblichkeit zu leben, das Sichtbare dem Unsichtbaren zu opfern.
Daß sie sich getroffen hätten: erwünschte Legende. Winkel am Rhein, wir sahn es. Ein passender Ort.
Juni 1804.
Wer spricht?
Weiße Handknöchel, Hände, die schmerzen, so sind es meine. So erkenne ich euch an und befehle euch, loszulassen, um was ihr euch klammert. Was ist es. Holz, schön geschwungen, Lehne eines Sessels. Der Sitzbezug schimmernd, in ungewisser Farbe, silberblau. Glänzendes Parkettmosaik, auf dem steh ich. Menschen zwanglos über den Raum verteilt, wie das Gestühl, in schöner Anordnung. Das verstehn sie, man muß es ihnen lassen. Anders als wir in Preußen. Üppiger, feiner. Geschmack, Geschmack. Sie nennens Kultur, ich Luxus. Höflich bleiben und schweigen, die kurze Zeit.
Diesen Monat, das ist ausgemacht, denkt Kleist, will ich zurück. Still doch. Wie mir zumute ist, geht keinen was an, mich selbst am wenigsten. Ein Witz, auf den ich mir was zugute hielt, wär er von mir. Gelegentlich will ich den armen Hofrat damit erschrecken.
Ich folg ihm wie ein Lamm, Widerspruch ist ein Krankheitszeichen. Reisefähig? Ei gewiß, Doktor Wedekind soll seinen Willen haben. In Gottes und in des Teufels Namen, ich bin gesund. Gesund wie jener Narr am Felsen, Prometheus. Der lebt tausend Jahre und länger. Es juckt mich, den Doktor zu fragen, wo dies Organ sitzt, das nachwächst, und ob er es mir nicht herausnimmt, die Geier zu ärgern. Keine plumpen Vertraulichkeiten mit der Götterwelt. Sterblich sein, frommer Wunsch. Faxen. Wovon diese hier, in ihrer heitern Gegend, nichts wissen. Daß ich mich nicht unter sie mischen kann. Zu Tee und Unterhaltung, hieß die Einladung. Die Wand hinter mir, gut. Diese Helligkeit. Linkerhand die Fensterreihe, weite Aussicht. Ein paar Dorfhäuser im Vordergrund, an abfallender Straße. Baumbestandenes Wiesengelände. Der Rhein dann, träger Fluß. Und fern, scharf umrissen, der flach schwingende Höhenzug. Drüber, unwissendes Blau, der Himmel.
Das Fräulein am Fenster verstellt mir den Blick auf die Landschaft.
Ja: Die unbedingte Richtigkeit der Natur. Die Günderrode, überempfindlich gegen das Licht, bedeckt die Augen mit der Hand, tritt hinter den Vorhang. Wert ist der Schmerz, am Herzen der Menschen zu liegen, und dein Vertrauter zu sein, o Natur! All die Tage über geht mir die Zeile nicht aus dem Kopf. Der verrückte Dichter. Zuspruch suchen bei einem Wahnsinnigen – als wüßt ich nicht, was das bedeutet. Schon denk ich, ich hätt im Stift bleiben solln, im gründämmrigen Zimmer, auf dem schmalen Bett, dem Kopfweh zuvorkommen, anstatt, im bös holpernden Wagen von Frankfurt her, schweigsam zu sein, abweisend, den andern die Stimmung zu stören. Man läßt mich jetzt, duldet meine Entfernung, als Grille, verlangt nichts weiter, als daß ich mich grillenhaft zeige, von Zeit zu Zeit. Doch zu Verstellung und Entgegenkommen fehlt mir ein für allemal die Lust. Ich fühle zu nichts Neigung, was die Welt behauptet. Ihre Forderungen, ihre Gesetze und Zwecke kommen mir allesamt so verkehrt vor.
Der Druck auf der Brust, seit dem Morgen schon, seit dem Traum, der jetzt wieder auftaucht. In einer Gruppe von Personen ging sie in einem kargen sanften Gelände, fremd und zugleich vertraut, in ihrem weißen fließenden Kleid, zwischen Savigny und der Bettine. Savigny hob plötzlich einen Bogen an die Wange, spannte ihn, zielte mit stumpfem Bolzen. Da sah sie: am Waldrand das Reh. Der Schreckenslaut, den sie sich ausstoßen hörte, kam wie immer zu spät, der Bolzen holte ihn ein. Das Reh, am Hals getroffen, stürzte. Die Bettine an ihrer Seite, die sie nicht aus den Augen ließ, nahm als erste das Unheil wahr. Lina! rief sie klagend. Die Günderrode wußte: Die Wunde war an ihrem Hals, sie mußte nicht nachfühlen. Der Bettine weißes Tuch färbte sich rot, daß die Günderrode staunen mußte, wie kräftig im Traum Farben sind. Es käme ihr so natürlich vor, zu verbluten. Da wuchs vor ihnen aus dem Erdboden ein niedriges Zeltdach, unter ihm gebückt ein gnomiges behaartes Wesen, das rührte in einem Topf mit einer ekelhaften, dampfenden Brühe. Und eine Hand – die einzige, die wußte, was zu tun war –, tauchte furchtlos in die Brühe, die nicht brannte, sondern linderte, und strich sie auf die Wunde an ihrem Hals. Der Zauber wirkte augenblicklich. Sie spürte die Wunde sich schließen, schwinden. Im Erwachen faßte sie nach der Stelle: zarte, unverletzte Haut. Das ist es, was ich von ihm haben kann: den Schatten eines Traums. Sie verbot sich zu weinen und vergaß den Traum und den Grund für ihre Trauer.
Jetzt sieht sie: Es war Savignys Hand.
Wieso aber am Hals? So ist es nicht ausgemacht. Sie kennt die Stelle unter der Brust, wo sie den Dolch ansetzen muß, ein Chirurg, den sie scherzhaft fragte, hat sie ihr mit einem Druck seines Fingers bezeichnet. Seitdem, wenn sie sich sammelt, spürt sie den Druck und ist augenblicklich ruhig. Es wird leicht sein und sicher, sie muß nur achten, daß sie die Waffe immer bei sich hat. Was man lange und oft genug denkt, verliert allen Schrecken. Gedanken nutzen sich ab wie Münzen, die von Hand zu Hand gehn, oder wie Vorstellungen, die man sich immer wieder vors innere Auge ruft. An jedem Ort kann sie, ohne zu zucken, ihren Leichnam liegen sehn, auch da unten am Fluß, auf der Landzunge unter den Weiden, auf denen ihr Blick ruht. Zu wünschen bliebe, ein Fremder möge ihn finden, der sich fest in der Hand hat und der schnell vergißt. Sie kennt sich, sie kennt die Menschen, ist darauf eingestellt, vergessen zu werden. Auffällige Gesten meidet sie, so lange es möglich ist. Sie hat das Unglück, leidenschaftlich und stolz zu sein, also verkannt zu werden. So hält sie sich zurück, an Zügeln, die ins Fleisch schneiden. Das geht ja, man lebt. Gefährlich wird es, wenn sie sich hinreißen ließe, die Zügel zu lockern, loszugehn, und wenn sie dann, in heftigstem Lauf, gegen jenen Widerstand stieße, den die andern Wirklichkeit nennen und von dem sie sich, man wird es ihr vorwerfen, nicht den rechten Begriff macht.
Was für eine vorzügliche Einrichtung, daß die Gedanken nicht als sichtbare Schrift über unsre Stirnen laufen! Leicht würde jedes Beisammensein, selbst ein harmloses wie dieses, zum Mördertreffen. Oder wir lernten es, uns über uns selbst zu erheben, ohne Haß in die Zerrspiegel zu blicken, welche die andern uns sind. Und ohne Trieb, die Spiegel zu zerschlagen. Dazu aber, sie weiß es ja, sind wir nicht gemacht.
Soll eine Frau so blicken?
Die Person ist Kleist nicht geheuer. Seine märkischen Fräuleins haben diesen Blick nicht, auch die Dresdnerinnen nicht, so lieb sie ihm sein mögen; nicht zu reden von den Schweizer Mädchen – soweit es ihm erlaubt ist, von dem einen, das er kennt, auf die andern zu schließen. Und die Pariserin, die die Natur verleugnet . . .
Ist diese Frau schön?
Ein unsichtbarer Kreis ist um sie gezogen, den zu übertreten man sich scheut. Es verböte sich, ihr ein Kompliment zu machen. Würde, auch Abweisung gehn von ihr aus, die zu ihrer Jugend im Widerspruch stehn, wie ihre blauen Augen zu dem glänzenden schwarzen Haar. Vom Ansehn wird sie schöner, das ist wahr, in der Bewegung, im Mienenspiel. Aber steht ihm ein Urteil über Frauenschönheit zu? Wenn es stimmt, was der spöttische junge Wieland oft behauptete: daß allein die Frauen ihren Wert untereinander ausmachen und das Urteil der Männer nur herausfordern, um deren Selbstgefälligkeit zu schmeicheln – dann nimmt das Fräulein am Fenster unter den andern reizvollen jungen Frauen einen Ausnahmeplatz ein, den keine ihr streitig macht. Bettine gewiß nicht, die Schwester des berühmten Clemens Brentano, der sich zu Kleists Verdruß gleich nach der Begrüßung mit seiner jungen Frau, der Sophie Mereau, und mit einem andern jungen Paar, den Esenbecks, an ein kleines Tischchen zurückgezogen hat. Eine Marotte, die Bettine heftig zu mißbilligen scheint; sie, ein Kind beinah noch, ungebärdig und unberechenbar, wie der Klatsch es ihr nachsagt, hält sich auf dem Sopha bei den beiden jungen Fräulein Servière, doch ihre Blicke verraten sie: Sie möchte am Fenster sein, bei der Freundin, aber sie traut sich nicht, deren Selbstvergessenheit zu durchbrechen.
Das Fräulein, dessen Namen Kleist übrigens nach der flüchtigen Vorstellung durch Wedekind wieder vergessen hat, soll nicht in den glücklichsten Verhältnissen leben, Kleist erinnert sich der unverheirateten Töchter mittelloser märkischer Adelsfamilien, ihres hilflosen Aufputzes, wenn sie in Gesellschaft gehn, ihrer huschenden hungrigen Augen, ihrer früh schon scharfen Züge. – Ulrike, die Schwester. Unwillkommener Einfall. Ulrike, das ist etwas anderes. Wieso? fragt die zweite Stimme in ihm, die er unterdrückt, wie er es eisern geübt hat. Er hat seine Lektion gefressen. So lernt man nur, wenn es ums Leben geht, in Todesangst. In der Gewalt von Mächten, die keinen Zweifel lassen, daß sie uns vernichten können, weil in uns selber etwas, das wir nicht kennen wollen, ihnen entgegenkommt. Dieser Zusammenbruch im November. Der schauerliche Winter. Diese dröhnenden, niemals abreißenden Monologe in seinem armen Kopf. Er weiß es ja, was seine Rettung wäre: die Stimme in sich knebeln, die da reizt und höhnt und weitertreibt, auf die wunden Punkte hin. Und wenn er sie zum Schweigen brächte? Eine andre Art von Tod. Woher nur die Selbstgewißheit, daß es seine Schuldigkeit ist, jenen Mächten, die mit allen Wassern, auch mit Blut, gewaschen sind, ihren Namen zu entreißen? Und woher, zu gleicher Zeit, sein Ohnmachtsgefühl und der durchdringende Zweifel an seiner Bestimmung? – Ungleicher Kampf.
Kleist gibt einen Ton von sich, vor dem man schaudern müßte, könnte man ihn für eine Art von Lachen halten. Jemand berührt ihn am Arm. Wedekind, der Arzt, in Ausübung seines Amtes.
Darf man erfahren, was Sie uns entrückt?
Er ist nicht Herr dessen, was in ihm denkt. Er muß sich Zwang antun, und für geheilt wird er gelten, wenn er die Kunst beherrscht. Wie aber soll eine Heilung dessen stattfinden, der das Gesetz verrückt, ehe er sich ihm unterwirft? Bis in den Staub unterwirft: dem verrückten, dem ungültigen Gesetz.
Und kein Richter. Kein Richter.
Kleist, in Bedrängnis, schüttelt heftig den Kopf.
Kleist! hört er den Doktor sagen.
Nichts nichts. Es ist nichts. Ich mußte denken, daß ich dies Jahr noch siebenundzwanzig werde.
Gewiß, sagt Wedekind. Und hätte das eine Bedeutung? Vortrefflich gefragt. Die Antwort ist: Nein.
Mörderische Wohltat: Meinen, was man sagt, und von der eignen Meinung zerrissen werden. Und die Freunde immer, die einem am wenigsten glauben, wenn man der Wahrheit am nächsten kommt. Wie vor langer Zeit, im vorigen Herbst, Pfuel in Paris, der das Quartier mit ihm teilte, nicht aber seine Verzweiflung. Pfuel, ich bin gescheitert! Es war die Wahrheit, weiß Gott, aber der Freund, der ihn am besten kannte; der ihn begleitet hatte, man könnte auch sagen: ihm gefolgt war; der seinen hoffnungslosen Kampf um den verfluchten ›Guiscard‹ mit angesehen: dieser Freund bestritt ihm die Folgerung aus dieser Wahrheit und verweigerte ihm die Wohltat, die Erde mit ihm gemeinsam für immer zu verlassen. Er, Pfuel, sei noch nicht so weit, sich ins Jenseits zu befördern, werde es den Freund aber beizeiten wissen lassen . . .
Herr Hofrat, fragt Kleist, Sie kennen den Hamlet?
Gewiß, sagt der – es ist sein Lieblingswort. Im Original und in der Schlegelschen Übersetzung.
Gebildeter Mann.
Soeben, sagt Kleist, sei ihm eingefallen: Der Streit, der ihn damals, in Paris, mit seinem Freunde Pfuel entzweite – er wisse doch? Wedekind nickt –, dieser Streit sei um den Monolog gegangen. ›Denn wer ertrüg der Zeiten Spott und Geißel . . .‹
›. . . des Mächtigen Druck, der Stolzen Mißhandlungen, . . .‹ Der Hofrat, in der Tat, ist im Bilde. Doch kann er nicht umhin, sein Befremden zu äußern, daß erwachsene gesittete Menschen, Freunde, aufs Blut sich streiten können um ein paar Verse. Hieße das nicht, den Respekt vor der Literatur übertreiben? Ja: Sei es nicht überhaupt unstatthaft, jene Wand zu durchbrechen, die zwischen die Phantasien der Literaten und die Realitäten der Welt gesetzt ist?
So auch Pfuel. Das war der Bruch.
Ihr Hang zum Absoluten immer, Kleist . . . Ihr Shakespeare kann der lebenslustigste Mensch gewesen sein, meinen Sie nicht?
Kleist durchfährt der Gedanke, der Arzt halte ihn für einen Komödianten, der mit Varianten spielt, darunter der tragischen. Das, wenn es zuträfe, will er nicht wissen. Er ist abhängig vom Urteil der Welt und kann es nicht ändern.
Andre wollen ein unblutiges Denken kennen. Harmonie, Mäßigung, Milde. Kleist, so übermäßig er sich anstrengt, dringt in das innere Leben der Wörter nicht ein. Von Sehnsucht verzehrt, bewege ich mich in ihrem Abglanz.
Druckreif, sagt er zu Wedekind, der wartet. Druckreife Sätze, Herr Hofrat, es ist ein Laster. Ein jeder fein scharf gemacht als Guillotine für seinen Vorgänger.
Kleist, sagt Wedekind, wenn Sie mir doch glauben wollten: Es ist nicht gut, daß der Mensch zu tief in sich hineinblickt.