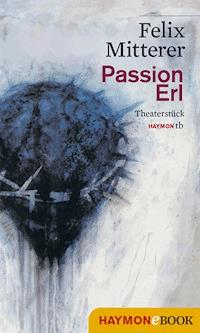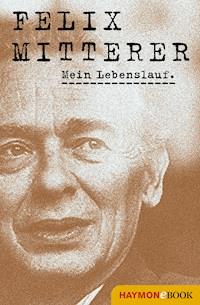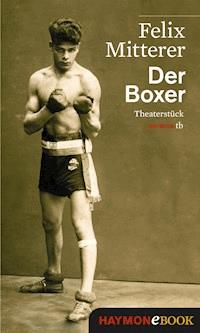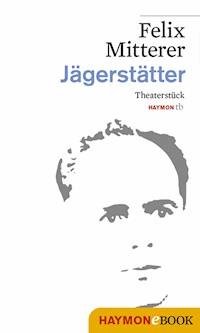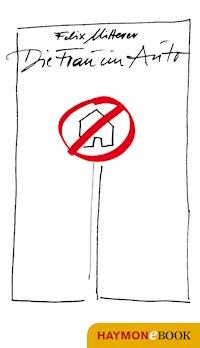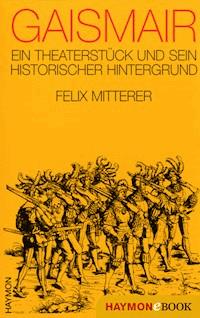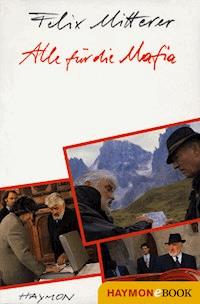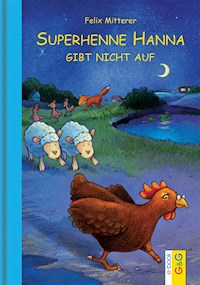Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
FELIX MITTERERS ERSTER ROMAN: ÜBER DAS LEBEN EINES AFRIKANERS AM WIENER HOF DES 18. JAHRHUNDERTS. ANGELO SOLIMAN: EIN LEBEN ZWISCHEN EMANZIPATION UND ASSIMILATION MITTE DES 18. JAHRHUNDERTS wird ein Junge von Afrika nach Europa verschleppt und fortan "Angelo Soliman" genannt. Im SIZILIANISCHEN MESSINA tauft man ihn katholisch und erzieht ihn nach höfischer Tradition. Als er schließlich als "Geschenk" an einen Fürsten geht, beginnt EIN BEISPIELLOSER LEBENSWEG: IM WIEN MARIA THERESIAS steigt er zum SOLDATEN und schließlich zum KAMMERDIENER auf, lernt mehrere Sprachen und wird in die FREIMAURERLOGE "Zur wahren Eintracht" aufgenommen, verkehrt mit KAISER JOSEPH II. und WOLFGANG AMADEUS MOZART. Doch am Ende seines Lebens steht DAS UNGEHEUERLICHE: Angelo Solimans Körper wird PRÄPARIERT und im KAISERLICHEN NATURALIENKABINETT ausgestellt – verkleidet als halbnackter "Wilder" mit Federn und Muschelkette. FELIX MITTERER LÄSST SICH VON EINEM AUFRÜTTELNDEN SCHICKSAL INSPIRIEREN Angelehnt an das faszinierende Leben Angelo Solimans ERZÄHLT FELIX MITTERER IN SEINEM HISTORISCHEN ROMAN VON EINEM AKTUELLEN THEMA MIT DRINGLICHER BRISANZ: In einer RASSISTISCHEN GESELLSCHAFT, die ihn als FETISCHOBJEKT und SYMBOL DER AUFKLÄRUNG zu vereinnahmen versucht, muss sich Angelo Soliman behaupten. RESPEKT und BEWUNDERUNG schlagen ihm entgegen, aber auch offene DISKRIMINIERUNG und die DEGRADIERUNG zum gezähmten "Wilden". Felix Mitterer – ÖSTERREICHS BELIEBTESTEM UND MEISTGESPIELTEM DRAMATIKER – gelingt es, mit viel Feingefühl das Leben und Handeln von AUSSENSEITERN und gesellschaftlich Geächteten ins Zentrum seiner Werke zu stellen. Vor dem Hintergrund einer Zeit voller Umbrüche entwickelt er in "KEINER VON EUCH" eine rasante Geschichte und verleiht einem BEMERKENSWERTEN SCHICKSAL eine kraftvolle Stimme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felix Mitterer
Keiner von euch
Roman
Inschrift unter dem Mezzotinto (46,7 x 32,2 cm) von Johann Gottfried Haid (Wien Museum, Inv. Nr. 215962):
Angelus Solimanus, Regiae Numidiarum gentis Nepos, decora facie, ingenio validus, os humerosque Jugurthae Similis. In Afr. In Sicil. Gall. Angl. Francon. Austria Omnibus Carus, fidelis Principum familiaris.
Zu deutsch: Angelo Soliman, aus der königlichen Familie der Numider, ein Mann mit schönen Zügen, großem Geist, ähnlich den Jugurtha in Gesicht und Bau, teuer allen Einwohnern Afrikas, Siziliens, Frankreichs, Englands, Frankens und Österreichs und ein treuer Gesellschafter des Fürsten.
Josephine Soliman
16. April 1801. Heute bin ich 20 Jahre alt. Es ist Frühling in Messina. Das goldene Licht der Abendsonne fällt durch das kleine, vergitterte Fenster in meine Zelle. Ich höre draußen die Vögel zwitschern. Die Orangenblüten duften zu mir herein. In der Ferne sehe ich den schneebedeckten Gipfel des Ätna. Gleich kommen sie. Ich bin verzweifelt. Aber es muss sein.
Meine weiße Novizinnentracht leuchtet im Halbdunkel. Ich habe in einem heiligen Buch ein zerbrochenes Stück Spiegel versteckt, hole es hervor, schaue hinein. Sehe mein Gesicht, das anders ist als das der anderen hier. Dunkel. Mein Taufpate – nach dem ich benannt bin – fand es schön. Viele Wiener fanden es schön. Was für ein hübsches Mohrenkind! Ich fand mich selber auch schön. Und ich sehe im Spiegel meine prächtigen schwarzen Haare, die ich unter der Novizinnenhaube streng zusammengebunden habe. Sie quellen trotzdem hervor. So stolz war ich immer auf meine Haare. Hoffart, ich weiß. Nach einem letzten Blick lege ich den Spiegel in das Buch zurück.
Ich schiebe mir das Oberkleid über die Schultern, reiße es am Rücken auseinander und nehme die neunschwänzige Katze. Knie mich vor dem großen Kruzifix hin, das neben der Eingangstür hängt. So viele blutende Wunden. Armer Mann. Es sollen Bleistücke in die Geißeln geflochten worden sein. So weit bin ich noch nicht.
Ich hole aus und beginne, meinen nackten Rücken auszupeitschen. „Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!“
Beißender, stechender Schmerz. Ganz warm fühle ich es am Rücken hinunterrinnen. Mea culpa! Recht geschieht mir.
Ich höre ihre Schritte näher kommen, die Tür öffnet sich. Ich peitsche weiter meinen Rücken, sollen sie es nur sehen.
Vier Schwestern kommen herein, die großen Flügelhauben wiegen auf ihren Köpfen, der Luftzug biegt die Ecken zurück. Man sieht kein Haupthärchen, denn alle sind sie kahlrasiert. Die Mutter Oberin ist eine strenge, kalte Frau, schon immer habe ich mich vor ihr gefürchtet. Sie trägt ein Bündel Briefe in der Hand. Schwester Teresa, die Liebe, Fürsorgliche, hält eine Schere etwas versteckt an der Seite, es ist ihr wohl peinlich. Und sie hat Mitleid, als sie sieht, wie ich mich peinige. Die eine jüngere Nonne trägt meine zukünftige Tracht samt Flügelhaube, legt sie auf den Tisch. Die andere hält eine brennende Fackel. Mutter Oberin schaut die Nonne mit der Fackel an, die geht zum Fenster, schließt es.
Auf einmal geht die Sonne unter.
Die Oberin gibt mir ein Zeichen, dass es reicht. Schwester Teresa nimmt mir die blutige Peitsche weg, legt sie mit spitzen Fingern angeekelt auf den Tisch. Ich ziehe mein Kleid über die Schultern hoch, spüre das Blut durch den Stoff sickern, der an den Wunden kleben bleibt. Es schmerzt so sehr! Ich will aufstehen, die Oberin bedeutet mir aber knien zu bleiben. Und beginnt mit der Tortur. Gegen die eine Selbstgeißelung harmlos ist.
„Bete mir nach, Josephine. – Ich bin nicht würdig, die Braut Christi zu werden.“
Ich antworte der Mutter Oberin nicht, starre zu Boden. Ich weiß – Hochmut! Ich kann nicht anders.
„Du sollst mir nachbeten, hörst du?! – Ich bin nicht würdig, die Braut Christi zu werden.“
Und da sage ich es: „Ich bin nicht würdig, die Braut Christi zu werden.“
„Ich bin die Frucht einer Todsünde, entstanden aus dem Samen eines schwarzen Dämons.“
Schon wieder. Tränen steigen mir in die Augen. Und trotzdem wiederhole ich es: „Ich bin die Frucht einer Todsünde, entstanden aus dem Samen eines schwarzen Dämons.“
Was sie dann von mir verlangt, sage ich gerne und auch freiwillig immer wieder.
„Herr, in deiner unendlichen Güte …“
„Herr, in deiner unendlichen Güte …“
„… nimm mich dennoch als deine Braut an …“
„… nimm mich dennoch als deine Braut an …“
„… denn ich bin gewillt zu büßen …“
Sie hat ja recht, aber es würgt mich trotzdem in der Kehle, ich bringe es kaum heraus: „… denn ich bin gewillt zu büßen …“
„Lauter!“, sagt sie. „Bekenne!“
„… denn ich bin gewillt zu büßen …“ Jetzt ist es gleich vorbei.
„… bis ans Ende meiner Tage.“
Und nun rinnen mir wieder die Tränen über die Wangen. Denn ich muss es ja endlich einsehen. Und dann bin ich befreit von der Schuld. In meinem Fall viel schlimmer als die Erbsünde, ich weiß. Und ich sage es: „… bis ans Ende meiner Tage.“
Die Mutter Oberin bekreuzigt sich, ich tue es ihr gleich. Sie gibt ein Zeichen und die Nonne mit der Fackel stellt einen Hocker in die Mitte des Raumes. Ich setze mich darauf, die Nonne nimmt mir die Novizinnenhaube ab und löst mein prächtiges Haar. Schwester Teresa kommt mit der nun erhobenen Schere auf mich zu, will sie ansetzen, da gebietet ihr die Mutter Oberin Einhalt. Sie nähert sich mir. Und zeigt mir das Bündel Briefe.
„Der Dämon hat dir viele Briefe geschrieben in den letzten zehn Jahren. Er wollte dich von hier weglocken. Du wirst diese Briefe jetzt verbrennen, Josephine.“
Die Oberin reicht mir die Briefe, ich schaue sie an, schaue die Mutter Oberin an. Sie hat mir zehn Jahre lang meine Briefe vorenthalten?
Auf einen Blick der Mutter Oberin will mir die eine Nonne die Fackel reichen. Aber ich nehme sie nicht, schaue nur auf den obersten Brief. Es ist ein zusammengefaltetes Blatt Papier mit einem erbrochenen Siegel – einem Pentagramm, das von zwei Kreisen umrandet ist, darin ein nackter Mann mit gespreizten Armen und Beinen.
An Frl. Josephine Soliman, Kloster der barfüßigen Büßerinnen, Messina, Sizilien.
Ich falte das Blatt auseinander:
Wien, am 5. März 1801.
Josephine, geliebte Tochter, wann kommst du endlich nach Wien? Wir warten auf dich! Mutter ist krank, sie braucht dich! Beeile dich, bevor es zu spät ist!
Dein Vater Angelo
Ich suche auf dem Blatt nach einer Absenderadresse, finde keine. Und bin voller Freude. Mein Körper wird von einer unglaublichen Freude durchflutet. Sie leben! Mutter lebt! Vater lebt!
„Verbrenn sie, Josephine! Los, mach schon!“
Die junge Nonne hält mir die Fackel hin, aber ich reagiere nicht darauf. Zu meiner Freude gesellt sich Wut. Die Mutter Oberin hat mir die Briefe vorenthalten! Ich schaue sie an. Auch sie packt die Wut: „Verbrenne den Dämon, verbrenn ihn!“
Die Vögel draußen verstummen plötzlich.
Mir fällt das auf, den anderen nicht. Ich spüre etwas herannahen.
Mutter Oberin gibt ein ungeduldiges Zeichen, die eine junge Nonne will mir die Briefe aus der Hand reißen, ich lasse es nicht zu, wir kämpfen um die Briefe, stürzen zu Boden.
Auf einmal setzt ein starkes Erdbeben ein, die Nonnen taumeln, schreien. Ich aber stehe auf, stehe wie ein Seemann breitbeinig da, schwanke zwar, aber falle nicht um. Alle Angst ist verschwunden, wie ausgelöscht.
Die Mutter Oberin wankt an die Wand neben der Tür. Über ihr das Kruzifix. Ich stecke die Briefe in meine Tracht und gehe Richtung Tür, die Oberin will sich mir in den Weg stellen, aber durch die starke Erschütterung fällt sie um. Ich will die Tür öffnen, sie klemmt. Die Mauer über der Tür ist in Bewegung, die Tür knirscht, verzieht sich, fällt in den Raum. Ich weiche vor den Trümmern zurück, gehe dann hinaus. Und sehe noch: Das Kreuz an der Wand fällt herunter, trifft den Kopf der Oberin, die aufschreit und mit dem Kreuz zu Boden geht. Sie schreit mir nach: „Hexe! Hexe!“
Da bin ich schon im Flur, im Kreuzgang, laufe Richtung Klostergarten. Schreiende Nonnen rennen mit flatternden Flügeln herum, versammeln sich im Innenhof. Mauerteile brechen aus dem Kreuzgang, erschlagen eine Nonne.
Draußen auf der Straße flüchten Menschen – zu Fuß, zu Pferd, mit Kutschen. Chaos, Schreie, Trümmer, Staub im Licht der untergehenden Sonne. Ich blicke um mich. Ein Reiter kommt heran, auf einem schwarzen Hengst, sein Pferd steigt auf, wirft ihn ab. Ich fange den Hengst ein, springe auf, reite davon.
Kurz vor dem Dom Maria Santissima Assunta sehe ich es: Der Ätna ist ausgebrochen. Die rotglühenden Lavamassen schießen weit hinauf in den Himmel.
Je dunkler es nun wird, da die Sonne untergegangen ist, umso heller wird dieser rote Schein. Der Anblick des feuerspeienden Berges ergreift mich zutiefst, ich kann die Augen nicht davon wenden. Mongibello nennt man ihn hier auf Sizilien.
Das Pferd steigt wiehernd auf, ich drücke ihm meine Fersen in die Flanken, es galoppiert los.
Als ich die Stadt hinter mir lasse, beginnt es, heiße Asche zu regnen. Aschefetzen, manchmal so groß wie verbrennende Papierblätter, die in der einsetzenden Dunkelheit immer mehr rot aufleuchten.
Der Hengst spürt schmerzlich die glühheißen Fetzen, geht schließlich voller Panik mit mir durch. Es riecht nach verbranntem Haar. Seines oder meines?
Über den Weg zum Herrenhaus verläuft ein breiter Spalt, den das Erdbeben verursacht hat, das Pferd sieht ihn im letzten Moment, springt darüber. Dann galoppieren wir durch die Allee. Mein Habit beginnt zu brennen, das Pferd wirft mich ab. Ich ersticke mit dem Unterteil der langen Tracht den Brand, richte mich wieder auf, suche das Pferd. Aber es rast schon Richtung Meer davon.
Zu Fuß eile ich weiter. Das Beben ist vorbei, kein Feuer schießt mehr vom Ätna in den Himmel, aber ich sehe ihn auch nicht mehr, die Aschewolken verdecken die Sicht. Es ist nun ganz still und dunkel, vereinzelt leuchten die Aschefetzen noch rot auf und senken sich knisternd nieder auf die Landschaft, auf mich, kühlen aber schon langsam ab.
Dem ehrwürdigen Herrenhaus ist wenig passiert, ein paar Mauersprünge und zerbrochene Fenster, außerdem sind ein Kamin und etliche Dachziegel auf die Erde gestürzt. Vor dem Haus brennt ein verlassenes Feuer. Oben am Dach sehe ich Knechte, die Wasser über die Ziegel schütten.
Meine geliebte Zofe Giulietta, die mir so viel Gutes getan hat, kommt aus dem Haus, erkennt mich sofort, obwohl sie mich zehn Jahre nicht gesehen hat, umarmt mich weinend und erleichtert. Aber ich habe keine Zeit für sie. „Wo ist die Gräfin, Giulietta?“
Sie deutet zur Terrasse. „Wir wollten sie ins Haus holen. Sie will nicht, sie will einfach nicht!“
Ich laufe auf die Terrasse. Sehe zum Meer hinunter: Der Hengst stürzt sich eben in die Brandung. In der Nähe der Balustrade sitzt neben einem Tischchen in einem Rollstuhl die nun alte Gräfin Pietrasanta, meine Großmutter. Wie immer ist sie schwarz gekleidet, mit einem schwarzen, von Asche bedeckten Spitzentuch über dem Kopf, mit Handschuhen, den Rosenkranz um die rechte Hand geschlungen, einen knotigen Stock zwischen den Beinen. Auf dem Tisch und am Boden daneben befindet sich eine Menge von Asche bedeckter Wertsachen, die meine Großmutter wohl aus Vorsicht retten ließ: Schatullen mit Schmuck und Geld, mehrere prallvolle Geldbeutel, Geschirr, Besteck, wertvolle Kandelaber, ein großes silbernes Kruzifix, mehrere Gemälde. Auch wichtige Papiere und Akten sind am Boden gestapelt. Neben dem Tisch steht ein Becken mit glühender Kohle, als ob es nicht schon warm genug wäre. Ein eiserner Schürhaken ragt in die Kohle hinein.
Die Gräfin sieht den Inhalt einer Schatulle durch, vermisst etwas, schaut auf die Sachen am Boden, schiebt mit dem Stock ein Gemälde beiseite, es fällt um. Im Rahmen auf der Rückseite steckt ein kleines Blatt. Sie beugt sich hinunter, zieht das Blatt heraus, wendet es, starrt es verbittert an. Ich stehe vor ihr.
Lange bemerkt sie mich nicht. Dann blickt sie mich an, erkennt mich sofort – und erstarrt. Ich lege den Brief meines Vaters vor ihr auf den Tisch. „Warum haben Sie mich angelogen, Großmutter? Warum?“
Die Gräfin hält mir ihre behandschuhte Hand hin, ich knie vor ihr nieder, küsse ihr die Hand.
Sie greift mir grob in die Haare, zerrt zornig daran. „Nenne mich nicht Großmutter!“
Ich stehe auf, weiche vor ihr zurück. „Warum haben Sie mir gesagt, dass mein Vater tot ist?“
„Er ist tot, dieser schwarze Teufel! Was machst du hier?“
Ich ziehe all die Briefe aus meiner Tasche, zeige sie ihr. „Er hat mir geschrieben! Er hat mir all diese Briefe geschrieben in den letzten zehn Jahren! Und ich wusste es nicht! Die Mutter Oberin hat sie mir vorenthalten!“
„Der schwarze Teufel ist tot, und deine Mutter ist davongerannt! Sie will nichts mehr von dir wissen! Finde dich endlich damit ab!“
Ich glaube ihr kein Wort. „Ihr lügt! Ihr lügt alle!“
„Diese Briefe lügen!“
„Ich muss nach Wien! Ich muss meine Eltern suchen!“
„Du gehst sofort wieder ins Kloster zurück!“
„Das Kloster ist zerstört! Und ich reise nach Wien!“
An der zerbrochenen Flügeltür des Salons erscheint Giulietta. „Kind! Es tut mir so leid!“
Die Gräfin schlägt sich mit beiden Händen die Asche vom Kopf, greift nach mir: „Josephine! Du hörst mir jetzt zu!“
Ich sinke verzweifelt auf die Knie. „Nein! Ich will nicht mehr zuhören! Ich habe lange genug zugehört!“
Die Gräfin greift nach dem Stock, schlägt ihn mir über die Schulter, ich weiche zurück. Sie schnauft auf, lehnt sich in den Rollstuhl, fasst sich. „Josephine! Dein Vater hat großes Unglück gebracht über zwei Häuser. Über meines und über das Haus Thurnstein in Wien. Und das alles, weil meine Tochter vergessen hat, woher sie kommt und was sich gehört! Meine Tochter, eine Gräfin Pietrasanta, bricht die Ehe und wirft sich einem Neger an den Hals! Einem Negersklaven! Unfassbar! Nur eine Hure macht so etwas! Nur eine Hure! Und du bist das Kind dieser Hure! Wann wirst du endlich einsehen, dass du für die Todsünde deiner Eltern büßen musst?“
Giulietta hört bestürzt zu, kommt auf mich zu und nimmt mich schützend an den Schultern. „Gräfin, das ist ein unschuldiges Gotteskind! Was kann denn sie dafür?“
„Halt den Mund, Giulietta!“
Ich stehe wütend auf. „Ich büße doch, seit Jahren büße ich schon, seit du mich ins Kloster verbannt hast! Ich weiß, dass ich eine Frucht der Sünde bin! Und ich hasse mich auch dafür, ich hasse mich! Aber jetzt, da ich weiß, dass sie leben, muss ich gehen und sie suchen! Ich habe Fragen an sie!“
Erst jetzt fällt mir das Bild auf dem Tisch auf: Es ist das Porträt meines Vaters Angelo als junger Mann.
Tränen rinnen mir über die Wangen. Oh, Vater, lieber Vater! Ich will das Porträt nehmen, doch die Gräfin wirft es in das Feuer. Als ich das Bild retten will, schlägt die Gräfin mit dem Stock nach mir. Ich greife in die Flammen, will das Bild nehmen, da zerfällt es schon. Ich berge die verbrannte Hand an meinem Leib.
Giulietta gestikuliert verzweifelt. „Gräfin, ich bitte Sie, haben Sie doch Mitleid!“
Ein dumpfes Grollen ist vom Ätna her zu hören. Die Gräfin hebt ihren Stock und ruft: „Alessandro! Vittorio!“
Zwei Knechte kommen über die Außentreppe auf die Terrasse herauf.
„Bringt sie ins Kloster zurück!“, kreischt Großmutter.
Die Knechte gehen auf mich zu, ich weiche zurück, nehme blitzschnell den glühenden Schürhaken aus dem Kohlebecken, schlage damit nach den Männern. Sie haben Angst vor mir, scheuen zurück.
Die Gräfin echauffiert sich über alle Maßen: „Macht schon! Ergreift sie!“
Die Männer drängen mich Richtung Terrassenbrüstung. Ich springe auf die Brüstung, schaue den steilen Abhang hinunter, der am Strand zum Meer hin endet. Die Männer kommen näher, ich werfe den Schürhaken nach ihnen, sie weichen aus. Mein Blick fällt auf den Ätna, der in der Ferne erneut glühende Lavamassen hochschleudert. Oh, wie schön! Wie mächtig!
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie die Knechte die Gelegenheit nutzen und wieder näher kommen. Aber trotzdem – meine ganze Aufmerksamkeit gilt jetzt dem Vulkan. Und ich schreie zu ihm, in Wándala, der Muttersprache meines Vaters. Ich habe alles von ihm gelernt, auch seine Sprache: „Göttin des Vulkans! Hilf mir! Hilf mir doch!“
Die Knechte halten irritiert inne, schauen zum Vulkan. Ja, schaut nur, das Feuer wird euch verschlingen!
Giulietta ist auf meiner Seite, war es immer. „Gräfin! Bei der heiligen Maria Mutter Gottes! Erlauben Sie ihr doch zu gehen!“
„Halt den Mund, Giulietta! Fasst sie endlich, ihr Taugenichtse!“
Diese widerwärtige Frau! Diese scheinheilige Bestie!
Ich schreie sie an: „Du willst die schwarze Hexe tot sehen, Großmutter?“
Die Männer sind nun gefährlich nahe, ich schaue noch einmal zum Ätna, entscheide mich, drehe mich um, mache mich zum Sprung in den Abgrund bereit. Ich breite die Arme aus, komme mir wie ein Engel vor, der sich zum Fliegen bereit macht.
Hinter mir höre ich Giulietta: „Josephine, nicht! – Gott wird Sie strafen, Gräfin!“
Und ich höre – wie weit entfernt – die furchtbare Greisin, die gnadenlose Großmutter: „Du willst meiner Familie noch mehr Schande zufügen?! Das würde dir so passen! Geh mir aus den Augen! Von mir aus, fahr nach Wien! Du wirst schon sehen, was du davon hast!“
Ich senke die Arme und drehe mich zur Gräfin. Fast tut es mir leid, dass ich nicht gesprungen, dass ich nicht geflogen bin.
Die Zofe kniet am Boden, bekreuzigt sich erleichtert, steht auf. Die Gräfin nimmt einen Geldbeutel vom Tisch, wirft ihn mir vor die Füße. „Du wirst schon sehen, was dich dort erwartet! Und komm nie mehr wieder!“
***
Es ist schon Ende Mai, als ich mich Wien in einer Reisekutsche nähere. Wir halten an einem Bildstock am Rande der Stadt. Der Kutscher lässt uns aussteigen und die Glieder strecken. Er erklärt uns die Geschichte des Bildstocks, den die Wiener „Spinnerin am Kreuz“ nennen. Es ist eine durchbrochene Säule, in der Christus als Gepeinigter und mit Dornen Gekrönter dargestellt ist. Zur Zeit der Kreuzzüge soll hier eine Frau Wolle spinnend 20 Jahre lang auf ihren Ritter gewartet haben, der nach Jerusalem gereist war, um das Heilige Land von den Muselmanen zu befreien. In der Nähe gab es früher eine Hinrichtungsstätte.
Nach der Fahrt durch eine unendlich lang scheinende Allee erreichen wir Wien.
Ich stehe auf der Straße, gegenüber befindet sich das große Mietshaus, in dem ich zuletzt mit meinen Eltern wohnte. Schaue hinauf zu unseren Fenstern. Vater Angelo, Mutter Clara und Kind Josephine. Eine glückliche Familie.
Unzählige Passanten, Kutschen und Fuhrwerke – ein Höllenlärm. Es verwirrt mich, bestürzt mich, habe ich doch jahrelang das Kloster nicht verlassen. Schon versucht mir ein magerer, zerlumpter Junge meine Tasche aus der Hand zu reißen, aber ich schlage sie ihm um die Ohren und er verzieht sich.
Ich will die Straße überqueren, da werde ich beinahe von einem Fuhrwerk überfahren, springe zurück. Der Kutscher schimpft lauthals mit mir: „Bist deppert, Muhrl?! Wühst, dass i mi dersteß, samt meiner Fuhr?“ Zum ersten Mal höre ich wieder den Dialekt meiner Heimatstadt. Wie unter Lebensgefahr hetze ich auf die andere Seite.
Leute bleiben stehen und starren mich unverschämt neugierig an. Und sind überhaupt nicht so freundlich wie damals, als ich ein hübsches, ordentlich gekleidetes Mohrenkind war. Jetzt trage ich die einfache Kleidung einer Köchin, die ich in Messina erworben habe.
Ein paar Kinder umringen mich, glotzen mich mit großen Augen an. Ein älterer Bub greift mir mit Daumen und Zeigefinger ins Gesicht, kneift mich und schaut auf seine Finger, um zu prüfen, ob die Farbe echt ist. Ich bin angespannt und verärgert, wehre ihn brüsk ab. Der Vater der Kinder, bürgerlich gekleidet, kommt her, gibt dem Buben einen ärgerlichen Stoß, die Kinder gehen mit ihm weiter.
Im Innenhof stehe ich an der Haustür und betätige mehrmals den Klopfer, neben mir ein Schild: Betteln und Hausieren verboten! Die Tür öffnet sich. Sofort erkenne ich den Mann vor mir, er hat schon in meiner Kindheit hier nach dem Rechten gesehen. Er ist betrunken, was früher nie vorkam, hält eine Schnapsflasche in der Hand. „Hearst, kannst ned lesen? Betteln und Hausieren verboten, steht da aufm Schild!“
„Ich bin Josephine Soliman, ich habe hier in diesem Haus gewohnt, als Kind.“
Zuerst schaut er mich verwundert an, dann dämmert es ihm: „Ah, waaß scho, die Tochter vom Gstopften!“
„Wie bitte?“
„Fesches Madel, fesches Madel! Dich tät ich schon auch gern einmal stopfen!“ Er trinkt aus der Schnapsflasche. Widerlich.
Aber so schnell gebe ich nicht auf: „Sind noch Sachen von uns da?“
„Hat die Behörde alles beschlagnahmt. Nix mehr da. Alles beschlagnahmt! In Wien wird alles beschlagnahmt! Da kennen mir nix! Du wirst jetzt auch beschlagnahmt! Und gstopft! Geh her, lass di stopfen!“
Der Hausmeister reißt mich an sich, will mich küssen, da zerkratze ich ihm das Gesicht. Er schreit auf, die Schnapsflasche zerschellt am Boden.
Meine Suche führt mich an die Eingangstür einer mir so wohlbekannten Villa. Das Hausmädchen schaut mich misstrauisch an: „Der Herr von Sonnenberg wohnt schon lange nicht mehr hier.“
„Wissen Sie, wohin er gezogen ist?“
„Nein. Aber ich hab gehört, er ist verrückt geworden.“
Es wird Abend. Und ich bin sehr müde, muss einen Ort zum Übernachten finden. Ich klopfe bei einer Pension am Spittelberg an. Ich muss sparen, wer weiß, wie lange meine Suche dauert. Niemand öffnet, ich will wieder gehen und wende mich ab.
Da geht die Tür hinter mir auf. „Die Dame suchen ein Zimmer?“
Ich drehe mich um. Eine dicke Pensionswirtin in einem schlampigen Hausmantel, mit lottriger Frisur leuchtet mir mit ihrer Öllampe ins Gesicht. Und erschrickt: „Marandjosef!“
Die Wirtin weicht zurück und schlägt die Tür zu. Wohin jetzt? Mir fallen bald die Augen zu.
Als es bereits finstere Nacht ist, gelange ich zu einem Platz, der mir bekannt vorkommt. Keine Menschen mehr unterwegs. Ich wundere mich. Dieses Gebäudegeviert kenne ich. Dort oben ist das kaiserliche Naturalienkabinett. Dort war ich schon mit meinem Vater Angelo, hier hat er lange gearbeitet, mit großem Einsatz. Plötzlich ist er mir ganz nahe, es überkommt mich eine Übelkeit. Jetzt erkenne ich auch die Augustinerkirche und die große Kuppel über dem Prunksaal der Hofbibliothek.
Aber das Reiterstandbild, das jetzt in der Mitte des Platzes steht, kenne ich nicht. An allen vier Ecken ist es von Steinpfosten umgeben, die mit Ketten verbunden sind. Wer ist der Mann auf dem Pferd? Ich schlüpfe unter der Kette durch, auf dem Sockel steht auf Latein: Kaiser Joseph II., der für das allgemeine Wohl lebte – nicht lange – aber gänzlich.
Überrascht trete ich zurück, schaue auf den Kaiser. Ja, doch, das ist er.
„Majestät … Ich bin’s, Ihr Patenkind Josephine, Ihnen zu Ehren so benannt. Im Kloster, in Sizilien, hat man sehr viele schlechte Dinge über Sie erzählt. Weil Sie die Klöster aufgehoben haben, weil Sie nicht an Gott geglaubt haben. Und jetzt sitzen Sie auf so einem hohen Ross …“
Auf der Rückseite des Denkmals, wo ich von der Straße her nicht gesehen werden kann, setze ich mich auf die oberste Stufe. Ich wickle mich in ein warmes Schultertuch und lehne mich zurück, schließe die Augen. Obwohl ich todmüde bin, kann ich nicht schlafen. Durch die großen Fenster des Kuppelsaals der Hofbibliothek scheint mattes Dämmerlicht. Mein Vater, meine Mutter … Wo sind sie?
Irgendwoher kommen schnelle Schritte. Vorsichtig blicke ich um die Ecke des Sockels. Zwei junge Leute nähern sich, wahrscheinlich Studenten, beide unrasiert, mit Brillen und in abgenutzter Kleidung. Der erste trägt eine Fahne, der zweite einen Packen Flugblätter. Obwohl ich gleich wieder zurückzucke, bemerken sie mich. Sie kommen zu mir, schauen mich an. Als sie sehen, dass ich schwarz bin, stutzen sie einen Moment, dann aber stößt der eine junge Mann den anderen an, legt den Packen ab, steigt darauf und verschränkt die Hände vor sich. Der andere steigt auf seine Schultern, zieht sich zur Reiterstatue hinauf, klettert aufs Pferd und befestigt die Fahne unter Josephs Arm. Ich stehe auf, schlüpfe unter der Kette durch und trete zurück. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit steht auf der Fahne.
Herangaloppierende Pferde sind zu hören. Schnell springt der Student vom Denkmal, der zweite fängt ihn auf und ergreift die Flugblätter. Ein Blick zu mir, und der junge Mann, der eben noch auf dem Sockel stand, hat meine Tasche in der Hand: „Schnell! Weg hier!“
Er läuft mit mir in eine Seitengasse, wir verstecken uns, schauen zum Platz. Von der Michaelerkirche her nähern sich berittene Polizisten. Der beim Denkmal zurückgebliebene Mann wirft die Flugblätter in die Luft und läuft in unsere Richtung. Die Polizisten halten ihre Pferde an, schauen sich um. Sofort klettert einer von ihnen auf das Denkmal und zündet die Fahne mit einer Fackel an – sie lodert auf, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verbrennen. Der junge Mann tritt aus unserem Versteck und schreit: „Die Fahne könnt ihr verbrennen, aber nicht die Worte! Die sind nämlich in unseren Köpfen!“ Wir rennen los, die Reiter hinter uns her. Schnell holen sie ihn ein – er erhält einen Säbelhieb über den Kopf und stürzt zu Boden. Der andere Student zieht mich in ein Haus, verriegelt die Tür. Wir jagen durch einen schmalen, miefigen Flur, dann durch die Hintertür auf eine andere Gasse.
Atemlos halten wir vor einer Spelunke, die offenbar schon lange nicht mehr in Betrieb ist: Das schmiedeeiserne, mit einem roten Hahn bemalte Schild ist verrostet, hängt schief in der Luft. Die Fenster sind von innen verhängt. Der junge Mann holt einen Schlüssel hervor und sperrt die Tür auf, immer wieder schaut er sich gehetzt um. Er schiebt mich ins Haus und sperrt hektisch die Tür hinter uns ab.
Wir sind in Sicherheit.
Was wohl einmal eine Gaststube war, ist nun eine schmutzige, heruntergekommene Druckereiwerkstatt. Im Licht eines Öllampenlusters erkenne ich eine alte Druckerpresse und Stöße von Flugblättern. Ein anderer junger Mann – mit Druckerschwärze an den Händen und im Gesicht – steht an der Presse, sieht mich verwundert an. Der Student stellt meine Tasche ab und sinkt erschöpft auf eine zerrissene Chaiselongue nieder. „Sie haben Georg erwischt.“
Der Mann schaut ihn bestürzt an, druckt dann resigniert weiter seine Flugblätter.
Mein Retter will ihn aufmuntern: „Stimmt schon, wir werden jeden Tag weniger. Aber das wird sich ändern. Bald werden auch die bisher braven Bürger aufbegehren.“ Dann schaut er mich an, steht auf und führt mich zu einem Tisch. Er deutet mir, mich zu setzen, und nimmt eine Blechkanne. „Kaffee?“
Kaffee? Ich antworte nicht.
Der junge Mann schenkt schwarzes Gebräu in zwei Blechtassen. Er reicht mir eine und setzt sich. Ich koste von dem Gebräu, es schmeckt mir überhaupt nicht, nur mit Widerwillen schlucke ich es. Da erinnere ich mich: Mein Vater trank damals auch Kaffee.
„Bitte verzeihen Sie, dass Sie wegen uns in Gefahr geraten sind.“
Ich betrachte ihn genau. Wie lange schon habe ich keinen jungen Mann mehr gesehen?
Mein Blick ist ihm unangenehm. „Haben Sie keine Unterkunft?“
„Nein.“
„Sie können dort schlafen.“
In der dunklen Ecke, in deren Richtung er jetzt deutet, liegen mehrere abgenutzte Rosshaarmatratzen. Auf einer schläft ein abgerissener junger Mann, den ich vorher nicht wahrgenommen habe und der unser Ankommen nicht bemerkt zu haben scheint.
„Das ist nur ein Kommilitone von uns. Er kann nicht nach Hause, die Polizei sucht ihn.“ Er trinkt vom Kaffee, schaut mich an. „Fremd in Wien?“
„Ja, sehr. Obwohl ich hier meine Kindheit verbracht habe.“
„Es gibt keine dunklen Menschen mehr in Wien. Die kleinen Mohren, die den Herrschaften den Kaffee serviert haben, sind aus der Mode gekommen. Die werden jetzt in Amerika gebraucht, als Sklaven, beim Baumwollpflücken.“
Der Drucker hat seine Arbeit beendet und zieht seine Jacke an. Er setzt seine Mütze auf und wickelt einen Packen Flugblätter in ein rotes Stoffstück. Grüßend hebt er die Hand, als er zur Tür geht und sie aufsperrt. Von außen sperrt er wieder ab.
Eines der Flugblätter liegt vor mir am Tisch, ich nehme es an mich und lese:
Kaiser Joseph war ein Republikaner!
Kaiser Franz ist eine Kanaille!
Hoch die Bürgerrechte!
Nieder mit dem Polizeistaat!
Ich schaue den jungen Mann an. „Sie sind für Kaiser Joseph?“
„Natürlich! Joseph hat den Feudalismus abgeschafft. Mit Franz ist der Feudalismus wieder zurückgekehrt. Und der ganze katholische Mief. Aber wir werden das ändern. Notfalls mit einer Revolution.“
„Ich bin katholisch.“
Er wirkt irritiert. „Ah ja? Sind Sie das?“
Ich senke die Augen vor seinem forschenden Blick, dann schaue ich ihn wieder an.
Dieser junge Mann gefällt mir. Irgendwie.
Aber jetzt senkt auch er schüchtern seinen Blick.
Ich kenne dieses Gesicht doch von irgendwoher! Ich kenne es! Oder täusche ich mich? Wien ist manchmal wie ausgelöscht in meinem Kopf.
Er schaut wieder auf und lächelt verlegen. Sofort komme ich mir schlecht vor.
„Entschuldigen Sie. Ich habe keinen jungen Mann mehr gesehen, seit ich erwachsen bin.“
Das scheint ihn noch mehr zu verwirren.
„Außer Jesus Christus. Ein junger Mann am Kreuz. Der mir als Bräutigam zugedacht war.“
Stille. Er kennt sich nicht aus mit mir. Kein Wunder.
Unsicher blicke ich mich im Raum um. Ein Bild an der Wand zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich schaue genauer hin, glaube etwas zu erkennen.
Fassungslos stehe ich auf und gehe zur Wand. Tatsächlich: Dort hängt ein Kupferstich mit dem Porträt meines Vaters.
Ich nehme ihn herunter und schaue ihn an. Ich muss mich setzen.
Es gelingt mir kaum, die Tränen zurückzuhalten. Mit verschwommenem Blick schaue ich den jungen Mann an, der nun noch erstaunter ist. „Entschuldigen Sie. Es überkam mich.“
Er starrt mich an, scheint auf einmal zu begreifen. „Bist du Josephine?“
Nun bin ich es, die verblüfft ist: „Woher wissen Sie …? Sie kennen meinen Vater?“
„Ach, Fini, erinnerst du dich nicht an mich?“
Woher kennt er meinen Kosenamen?
„Ich bin David! David Blumauer!“
Ich studiere sein Gesicht. – Ja, das ist er! Freilich! Bald Ende der 20 muss er jetzt sein.
„Habe ich mich so verändert?“, fragt er.
„Der Bart, die Haare …“
„Stimmt, ich habe mich etwas zuwuchern lassen. Ich werde gesucht, es gibt Zeichnungen von mir.“
„Bist du Dichter geworden? Wie du es wolltest?“
„Dichter und Demokrat. Und Student.“
„Ach, David! Dass ich auf dich treffe!“
„Woher kommst du auf einmal?“
„Aus Sizilien. Ein heiliger, feuerspeiender Berg hat mich gerettet. Der Ätna.“
David kennt sich nicht mehr aus.
„Ich bin vor zehn Jahren mit meiner Mutter Clara in ihre Heimatstadt Messina geflohen. Weil uns ein Mörder verfolgte.“
„Ich weiß das alles. Ich weiß um den ganzen Schrecken. Deshalb bin ich, was ich bin.“
Natürlich, David musste genauso büßen.
Er schaut mich an. „Und was weiter?“
„Mein Vater wollte nachkommen. Aber er kam nicht. Also reiste meine Mutter wieder nach Wien, um ihn zu suchen. Auch sie kehrte nicht mehr zurück.“
„Dein Vater ist unser großes Vorbild. Auf den Fahnen der Revolution wird sein Name stehen“, sagt David nach einer Weile.
„Der Name eines schwarzen Dämons?“
„Ein Dämon? Wie kommst du denn auf so etwas?“
„Das hat man mir immer gesagt. Er soll zwei Frauen umgebracht haben.“
„Das ist nicht wahr! Das musst du doch wissen!“
„Ich weiß nur, dass er meine Mutter verführt hat. Eine weiße Frau, eine Adelige. Deshalb musste ich büßen. Deshalb kam ich ins Kloster.“
David scheint nichts zu begreifen, blickt mich aufgewühlt an.
„Und jetzt bin ich da. Weil er mir geschrieben hat. Mein Vater.“
„Wann?“
„Der letzte Brief kam vor ein paar Monaten an.“ Ich nehme ihn aus der Tasche, reiche ihn David.
„Das kann nicht Angelo geschrieben haben“, meint er ungläubig, als er fertiggelesen hat.
„Nein?“
David gibt mir den Brief zurück, trinkt vom Kaffee. Er weicht meinem Blick aus.
„Warum nicht? Warum kann mein Vater diesen Brief nicht geschrieben haben?“
Er antwortet nicht.
Ich schaue auf das Porträt meines Vaters. „Weil er tot ist?“
David schaut mich an, wirkt sehr bedrückt.
„Antworte mir, bitte!“
Kein Wort kommt ihm über die Lippen.
„Ich kann es ertragen, David. Ich habe schon viel ertragen. Das ist Teil meiner Buße.“
Entrüstet steht er auf: „Was redest du dauernd von Buße? Das ist ja furchtbar! Du brauchst überhaupt nichts büßen! Was willst du denn büßen? Ich wäre stolz darauf, Angelo Soliman zum Vater zu haben! Der katholische Mief in Sizilien muss ja noch schlimmer sein als hier!“
„Ist er tot?!“
David setzt sich wieder. Schweigt. Es scheint eine Ewigkeit zu dauern, bis er antwortet: „Ja. Er ist tot.“
„Und meine Mutter? Clara?“
„Von Clara weiß ich leider nichts.“
Das ist ein harter Schlag. Das ist schrecklich. Ich beginne zu weinen, ganz furchtbar, ich schäme mich dafür. Im Kloster haben wir gelernt, uns in Selbstbeherrschung zu üben. Aber ich kann mich nicht mehr beherrschen. Ich schaue das Bild meines Vaters an, presse es an mich.
David weiß sich nicht zu helfen. Schließlich findet er doch noch Worte: „Es gibt da einen alten Bettler, ohne Beine. Josip mit Namen, er ist Bosniak. Schläft offenbar unter der letzten Brücke über die Wien. Vielleicht weiß der etwas über deine Mutter.“
Durch die Tür dringt plötzlich eine leise, aber hastige und befehlende Stimme. Voller Angst schaut David hin. Dann hören wir die Stimme des jungen Druckers: „David! Haut ab! Schnell! Die Scherg–“ Seine Stimme bricht mit einem gurgelnden Todesschrei ab.
Die Tür wird mit einem Vorschlaghammer krachend eingeschlagen, der getötete Student von einem Polizisten mit einem blutigen Säbel in der Hand hereingestoßen, fällt zu Boden. Mit gezogenen Säbeln stürmen die Polizisten herein, einer hält den riesigen Vorschlaghammer.
David springt blitzschnell auf, reißt mich hoch und drückt mir meine Tasche in die Hände. Dann zerrt er mich schon zu einer Hintertür, öffnet sie und stößt mich hinaus. Ich zögere kurz, schaue zurück. Der vorhin noch schlafende Student springt verschreckt von der Matratze hoch. Sofort schlägt ihn der Polizist mit dem Hammer nieder, zerschmettert seine Brust. Die anderen drei Polizisten stürzen sich auf David. Er wehrt die Säbelhiebe mit einer Eisenstange ab. Ein Hieb trifft ihn an der rechten Schulter, die Stange fällt zu Boden. Und ich fliehe endlich.
Durch den finsteren Hinterhof laufe ich davon. Zwei Polizisten verfolgen mich. Eine hohe Mauer versperrt mir den Weg. Ich drehe mich um, die Polizisten sind schon so nah – meine Situation erscheint ausweglos. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ein Polizist winkt mich mit seinem Säbel grinsend zu sich, der andere legt seine Pistole auf mich an. Ich gehe langsam auf die beiden zu, drehe mich dann aber um, nehme Anlauf, springe hinauf und ziehe mich an der Mauerkrone hoch. Ein Schuss fällt, aber trifft mich nicht. Ich lasse mich über die Mauer gleiten.
Das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich unter einer Brücke stehe.
Neben einem Lagerfeuer schlafen ein paar Bettler auf Decken und zerrissenen Matratzen. Ich trete näher und betrachte jeden einzelnen. Josip fällt mir sofort ins Auge. Obwohl er schon sehr alt aussieht, bin ich mir sicher, dass er es ist. Vater hat mir viel von ihm erzählt. Er hat eine schmutzige Pferdedecke über sich gezogen, als Kissen dient ihm eine Art Brett mit Rollen. Josip scheint meinen Blick zu spüren und öffnet die Augen. Er erkennt mich sofort und richtet sich überrascht auf: „Fräulein Josephine!“
Als er die Decke wegschiebt, sehe ich, dass ihm tatsächlich die Beine fehlen. Er schlüpft mit den Händen in zwei Holzklötze mit Lederschlaufen und benutzt sie als Stützen. Geschickt bewegt er sich mit ihnen ein Stück weg von den anderen.
Ich folge und setze mich zu ihm. Er strahlt mich mit seinen entzündeten Augen an: „Was für eine Freude!“ Er küsst meine Hand. „Was für eine Freude!“
„Ich bin nach Wien gekommen, um meine Eltern zu suchen, Herr Josip. Mein Vater ist tot, das habe ich bereits erfahren. Wissen Sie, woran er gestorben ist?“
„Schlaganfall, hat man gehört. Aber ich glaub das nicht. Er hatte Feinde.“
Deutlich hört man beim Sprechen Josips bosnischen Akzent, von dem mein Vater mir schon erzählt hat.
„Wo ist sein Grab?“
„Es gibt kein Grab“, sagt er mit betrübtem Blick.
„Es gibt kein Grab?“
Josip schaut auf einmal ganz traurig und verzagt. „Nein. Hören Sie zu, Fräulein Josephine –“
Ich bin ganz außer mir und unterbreche ihn: „Wieso gibt es kein Grab?“
„Das ist alles furchtbar! Furchtbare Dinge sind passiert! Ersparen Sie sich das, Fräulein Josephine! Reisen Sie wieder ab, ich bitte Sie!“
„Meine Mutter? Wissen Sie etwas über meine Mutter? Sagen Sie schon!“
Josip antwortet nicht, schaut mich nur an. Er zieht eine schmierige Schnapsflasche hervor, trinkt daraus, starrt vor sich hin.
Ich ziehe einen Geldbeutel aus meiner Tasche und nehme Münzen heraus. Als ich sie Josip reichen will, schiebt er meine Hand weg. „Ich hab eine Vermutung, was Ihre Frau Mutter anbetrifft. Aber wenn sie stimmt, dann sind Sie in großer Gefahr, Fräulein Josephine.“
„Sie hat mich im Stich gelassen, Herr Josip! Ich muss sie fragen, warum sie das getan hat. Weil sie sich meiner schämte? Ich will es von ihr erfahren. Sie soll es mir ins Gesicht sagen. Sie hat sich ja mit dem schwarzen Mann eingelassen! Warum soll ich allein dafür büßen?“
„Es gibt da einen, der hat für die Feinde Ihres Vaters gearbeitet. Er heißt Toni. Vor ein paar Monaten sah ich ihn aus dem Narrenturm kommen. Er trug eine Uniform.“
Ich darf bei den Bettlern schlafen. Sie behandeln mich wie ihresgleichen: gut.
***
Am nächsten Tag besorge ich einen Korb, kaufe Brot, Wein, Obst, Lebensmittel und mache mich auf den Weg zum Narrenturm. Josip folgt mir, indem er sich auf seinem rollenden Brett hockend mit den Klötzen voranschiebt. Ich kenne das Gebäude hinter dem Spital. Mein fortschrittlicher Taufpate hat nicht nur das Allgemeine Krankenhaus, sondern auch das Irrenhaus errichten lassen. Es gilt als das modernste in Europa. Einwandfreie hygienische Zustände, nur die „Wütenden“ werden noch angekettet. Als wir ankommen, sind entfernte Schreie zu hören.
Josip schüttelt den Kopf. „Sie sollten da nicht hineingehen.“
„Ich muss. Ich habe nichts zu verlieren.“
Josip begreift mein bitteres Lächeln und meine Worte nicht. „Doch, Ihr Leben, Ihr junges Leben, Fräulein Josephine.“
„Das bedeutet mir nichts, Herr Josip.“ Ich hole den Lederbeutel aus meiner Tasche, nehme ein paar Silbermünzen heraus und verstaue sie in der Tasche. „Bewahren Sie das für mich auf?“, bitte ich Josip, als ich ihm den Beutel reiche.
Josip steckt den Beutel ein. „Danke für Ihr Vertrauen.“
Ich nicke ihm zu und gehe zum Eingangstor.
„Fräulein Josephine!“
Ich drehe mich nach Josip um.
„Ich achte schon darauf, dass Ihnen nichts passiert. Das bin ich Ihrem Vater schuldig.“
Ich stehe vor einem abgesperrten Gittertor. Schon von hier aus ist zu sehen, wie sich die Zellen in mehreren Stockwerken um den Innenhof gruppieren. Von irgendwoher höre ich die Schreie eines Verrückten. Und bin entsetzt darüber, dass hier meine Mutter eingesperrt sein könnte. Ein Idiot wischt im Hintergrund die Steinplatten des Bodens auf. Ein Wärter kommt von innen auf das eiserne Gittertor zu, in der einen Hand einen Schlüsselbund, in der anderen einen Ochsenziemer. Er ist nicht mehr ganz jung, kräftig, untersetzt, hat einen leicht irren Blick, wirkt eher wie ein Insasse als wie ein Aufseher. Seine Uniform ist schmuddelig, an seinem Gürtel trägt er ein langes Messer in einer Scheide.
Durch das Gitter schaut er mich überrascht an, setzt ein Grinsen auf. Irgendwie kommt er mir bekannt vor.
„Eine Negerin, na so was! So eine fesche auch noch! Was is los, bist närrisch worden, willst herein zu uns?“
„Sind Sie der Herr Toni?“
„Immer noch derselbige. Was steht zu Diensten?“
Ich lange durchs Gitter, drücke ihm eine Münze in die Hand. „Ich möchte jemanden besuchen. Clara Soliman.“
„Clara Soliman? Die soll bei uns sein?“
Ich greife in meine Handtasche, hole drei weitere Münzen heraus, lege sie Toni auf die ausgestreckte Handfläche.
Er beißt auf eine Münze, dann steckt er sie ein. „Soliman, Soliman? Irgendwie kommt mir was …“
Ich lege noch zwei Münzen dazu, Toni grinst. Er lässt das Geld verschwinden, sperrt auf und macht eine einladende Geste. Hinter mir versperrt er das Tor wieder.
Ob ich hier jemals wieder rauskomme?
Draußen sehe ich, halb versteckt, Josip auf seinem Brett. Sein Blick wirkt besorgt.
Ich folge Toni durch den Hof zur Treppe, steige mit ihm bis zur letzten Galerie hinauf. Wir gehen die Galerie entlang, passieren zahlreiche Zellentüren. Hinter einer von ihnen beginnt ein Insasse zu singen: „Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißa, hopsassa! Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land …“
Toni reagiert ungehalten, tritt mit seinem genagelten Schuh an die Tür. „Kusch! Halt die Pappen!“
Der Sänger hört nicht auf.
Unter den Zellentüren fließen in einer Rinne Kot und Urin heraus, verschwinden in einem Rohr. Ich rutsche aus, falle beinahe über das Geländer in die Tiefe. Toni fängt mich grinsend auf: „Obacht, Fräulein!“
Erschreckt werfe ich einen Blick hinunter in den Innenhof, befreie mich von Toni. Wir gehen weiter und halten schließlich vor einer Zellentür. Toni entriegelt und öffnet sie.
„Bitte sehr, das Fräulein!“, deutet er mir in den Raum.
Ich trete ein. Es stinkt fürchterlich.
„Ich muss leider absperren, Fräulein Josephine. Einfach klopfen, wenn Sie wieder den Duft der Freiheit atmen wollen.“
„Woher kennen Sie meinen Namen?“, will ich fragen, da verriegelt er schon die Tür hinter mir.
An der Tür ist eine schmale Luke eingelassen, die sich öffnet. Von Tabakrauch gebeizte Augen schauen herein. Dann klappt die Luke zu, Tonis Schritte entfernen sich.
Durch den Fensterschlitz, der so weit oben ist, dass man nicht hinausschauen kann, dringt Licht in den Raum. Ich schaue mich um und – und erstarre. Eine Frau um die 50 – sie könnte aber auch viel älter sein – kauert in einer Ecke auf fauligem Stroh. Sie trägt eine verdreckte, zerrissene Kutte. Ihr Kopf ist kahlgeschoren, um den ganzen Kopf herum ist eine ebenmäßige Narbe zu sehen und viele weitere Narben, Krätze, Kratzwunden. Schorf und Kratzer auch im Gesicht und an den Beinen, dicke Narben am Hals und an den Pulsadern der Handgelenke. Ihre Finger- und Zehennägel müssen seit Jahren schon nicht mehr geschnitten worden sein. Am linken Knöchel sind dunkle Spuren zu sehen – von einer lange angelegten Eisenschelle?
Bis auf das Stroh und einige Eisenringe an den Wänden gibt es nichts in dem vor Dreck starrenden Raum. Und dann sehe ich es: Hier hatte jemand begonnen, etwas in die Wände zu kratzen. Einige Zeilen Text, viele Zeichnungen. Mit rotbrauner Farbe. Etwa mit Blut? Ich versuche zu lesen, zu erkennen. Da steht mein Name, ganz groß! Allmächtiger! Und die Zeichnungen … ein kleiner Junge, der von einer Klippe ins Meer springt … ein Mann, der gegen ein Heer kämpft, Türken vielleicht? Da, auf einem Pferd ein Mann, er trägt dieselbe Kleidung wie mein Vater auf dem Kupferstich. Mein Vater, das ist mein Vater! Und da, in ganz großen Buchstaben, steht ANGELO!!!
Es besteht kein Zweifel mehr: Diese gequälte, gefolterte, wohl seit Jahren in dieser Zelle eingesperrte Frau muss meine Mutter Clara sein.
„Mamá! Mamá!“, rufe ich sie an.
Meine Mutter blickt langsam auf, schaut mich mit ganz leeren Augen an, scheint mich nicht zu erkennen.
„Ich bin es – Josephine. Du musst mich doch erkennen! Mamá!“
Mutter wendet ihren Kopf ab. Ich gehe zu ihr hin, sie kriecht erschreckt in ihre Ecke zurück, hält die Hände vors Gesicht, so als hätte sie Angst, geschlagen zu werden.
Ich stelle den Korb ab und knie mich vor ihr hin. Ich rüttle sie an den Schultern. Und jetzt muss ich weinen, ich kann es nicht zurückhalten: „Mamá! Mamá! Schau mich an! Bitte!“
Aber Mutter reagiert nicht. Schluchzend berge ich mein Gesicht an ihrem Rücken. Wut überkommt mich und ich laufe zur Tür, trommle dagegen. „Was habt ihr gemacht mit ihr? Was? Was?“
Niemand kommt, niemand öffnet die Luke. Ich sinke weinend an der Tür zu Boden, schaue dann wieder zu Mutter. Sie kniet nun beim Korb, entnimmt ihm eine Wurst und ein Stück Brot, beginnt unkontrolliert zu essen, stopft sich die Trauben in den Mund, isst wieder Wurst und Brot. Dann entdeckt sie die Weinflasche mit dem losen Korken, greift nach ihr und trinkt gierig, muss husten und trinkt weiter, trinkt die Flasche halb leer. Dabei beobachtet sie mich fortwährend, als hätte sie Angst, ich würde ihr alles wegnehmen.
„Mamá! Mamá! Ich bin es doch, deine Tochter Josephine! Du musst mich doch erkennen! Schau mein Gesicht an! Es ist das Gesicht von Angelo!“
Mutter hält sich die Ohren zu, verkriecht sich.
Plötzlich entriegelt jemand von draußen die Tür. Ich springe auf und weiche an die Wand zurück. Die Tür öffnet sich, draußen steht Toni. Er schaut jemanden an, den ich von hier aus nicht sehen kann, und deutet stolz auf mich, auf seinen Fang. Eine schwarz behandschuhte Hand klopft Toni auf die Schulter. Und nun kommt er herein. Toni bleibt, mit dem Ochsenziemer spielend, in der offenen Tür stehen.
Der Ankömmling ist eine ganz und gar unheimliche Erscheinung. Er wirkt sehr heruntergekommen, ist wohl selbst auf gewisse Weise wahnsinnig, seine schwarze Kleidung speckig, schmutzig, abgewetzt, an den Ärmeln ausgefranst. Sein Rücken ist gebeugt, die Haare sind ihm ausgegangen, über seine Haut ziehen sich schlimme Pusteln und grauer Schorf, seine Augen sind blutunterlaufen. Die Hände des Mannes sind zu Klauen verzogen, die Knöchel voller Knoten, an den Fingern fehlen zum Teil die Nägel. Er steht gebeugt, auf einen Stock gestützt – den Stock meines Vaters! Ich erkenne ihn auf der Stelle. Ein schwarzer Stock aus Ebenholz, ein Löwe aus Elfenbein bildet den Knauf.
Als meine Mutter den Mann sieht, stößt sie einen entsetzten Schrei aus und krümmt sich panisch noch weiter in die Ecke.
Ich glaube, ich bin auch diesem Mann schon einmal begegnet. Nein, ich habe ihn bestimmt schon mehrmals gesehen! Aber wo? Wie? Wer ist er?
Er verbeugt sich vor mir, entblößt seine schwarzen Stumpen, die einmal Zähne waren, lächelt mich an: „Ich wusste, dass Sie kommen würden, eines Tages, Fräulein Soliman. Es hat lange gebraucht. Ich habe viele Briefe schreiben müssen. Unter dem Namen Ihres Vaters. Aber nun sind Sie da. Nun kann ich mein Werk zu Ende bringen.“
Ja, diesen Mann kenne ich. Aus einer Zeit, da er noch ganz anders ausgesehen hat.
Er betrachtet mich eindringlich von oben bis unten. „Wie schön Sie sind, Josephine … Das Abbild Ihres Vaters.“
„Professor Hoffmann?“
„Richtig, Fräulein Josephine. Der berühmte, berüchtigte Professor Ernst Hoffmann.“
„Was tun Sie hier?“
„Ich bin der Direktor … dieser Anstalt. Ihr Herr Taufpate, Kaiser Joseph, hat sie erbaut, wie Sie bestimmt wissen. Er wollte eine menschenwürdige Behandlung der Geistesschwachen. Er hatte keinen Weitblick, Ihr Herr Taufpate, leider, auch in dieser Hinsicht nicht. Die Geistesschwachen schwächen das ganze Volk. Seit ich Direktor bin, wird kein Narr sehr alt hier im Narrenturm. Ausgenommen die Freimaurer, diese Geistesgrößen, ich habe ein paar von ihnen zur Buße hier. Und natürlich ausgenommen Gräfin Clara, Ihre Mutter, sie lebt nun schon seit zehn Jahren bei uns.“
„Aber warum? Was ist passiert?“
„Das hat mit Ihrem Vater zu tun, Fräulein Soliman.“
„Was geschah mit ihm, Herr Professor? Bitte! Sagen Sie es mir!“
„Fragen Sie Ihre Mutter.“
„Sie erkennt mich nicht!“
„Das kommt schon. Wissen Sie, Ihre Mutter hat sich mir entzogen. Zuerst hatte sie versucht, sich umzubringen. Es gelang ihr nicht. So hat sie sich mir auf andere Weise entzogen. Aber nun, da Sie gekommen sind, Fräulein Soliman, wird ihr Geist wieder auftauchen aus der Dunkelheit. Und sie wird das Ende unserer gemeinsamen Geschichte bewusst miterleben können.“
Hoffmann hält den Stock nun am Griff hoch, der Knauf ist ganz deutlich zu sehen.
„Ich weiß, das ist der Stock meines Vaters.“
Hoffmann schaut ihn an, zieht den Löwenknauf ein Stück heraus, ein Florett kommt zum Vorschein. „Ich halte ihn hoch in Ehren, mein Fräulein.“ Hoffmann schiebt das Florett wieder hinein, zieht dann aus seiner Jacke ein dickes Buch hervor. Der Ledereinband ist schmutzig, blutig und abgenutzt. Er reicht es mir. „Das ist das Tagebuch Ihrer Mutter.“
Ich schlage das Buch auf, sehe ihre Handschrift.
Hoffmann schaut mich an. „Sie hatte das Bedürfnis, alles für Sie aufzuschreiben, Josephine.“ Er blickt auf die Zeichnungen an den Wänden. „Zuerst begann sie, mit ihrem eigenen Blut und den Fingernägeln an die Wände zu schreiben und zu zeichnen. Das hätte sie nicht lange durchgehalten. Das wäre Selbstmord gewesen. Also gab ich ihr das Buch. Lesen Sie es. Man kann viel daraus lernen.“
Er verbeugt sich leicht vor mir, geht hinaus, wendet sich zu Toni um: „Fräulein Soliman bleibt unversehrt. Hat Er mich verstanden?“
„Aber gewiss, Herr Professor.“
Hoffmann geht und Toni kommt herein, schließt die Tür hinter sich. Er geht auf mich zu, entreißt mir die Tasche und durchsucht sie, nimmt die restlichen Münzen an sich. Ich versuche, ihm die Tasche wieder wegzunehmen, da schlägt er mich mit dem Ochsenziemer nieder und wendet sich meiner Mutter zu. Er nimmt ihr Wurst und Brot und die Weinflasche weg, gibt alles in den Korb.