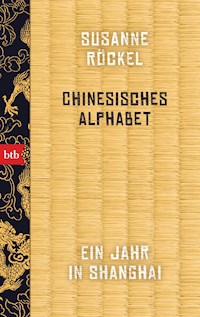Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Liebende sind halbe Wesen, sie suchen nach Ergänzung. So wie Tabea, die an der Seite ihres ewig abwesenden, omnipotenten Mannes verkümmert, bis sie sich an ihm für etwas rächt, das ihr vor langer Zeit jemand anderer angetan hat. Wie Albert, den es auf den Spuren seiner Frau, die ihm durch eine Krankheit fremd geworden ist, bevor sie ihm durch den Tod genommen wurde, an den Ort des letzten gemeinsamen Urlaubs nach Italien zieht. Oder Uta, die alleinstehende Leiterin eines Familienzentrums, das unter ihrer Führung einen Aufschwung nimmt, bis sie der Faszination für einen Flüchtling von rätselhafter Abkunft erliegt.In drei Erzählungen, die von sehr persönlichen Krisen in sehr gegenwärtigen Lebensverhältnissen handeln, begegnen wir Figuren und Motiven antiker Mythen, Sirenen und Kentauren, vergifteten Gewändern und sich in Bäume verwandelnden Frauen. Dingen aus dem Halbdunkel, die in ihrer phantastischen Uneindeutigkeit den Glauben an die Unverrückbarkeit des Bestehenden, an dem wir selten zweifeln, aber allzu oft verzweifeln, untergraben können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
© 2019 Jung und Jung, Salzburg und Wien
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung,Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehaltenUmschlagbild: Euphronios, Schalenfragment mitNessos und Deianeira,Metropolitan Museum of Art, New YorkUmschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.comeISBN 978-3-99027-170-4
SUSANNE RÖCKEL
Kentauren im Stadtpark
Drei Erzählungen
INHALT
Vorbemerkung
Das Geschenk des Nessos
Sirenen
Daphne und Apoll
VORBEMERKUNG
You can imagine the opposite, lautet der blaue Schriftzug einer Lichtinstallation an der Gartenseite des Münchner Lenbachhauses, der mir ins Auge stach, als ich dieses Buch entwarf. Der Schriftsteller kämpft gegen das Klischee, gegen das, was die Sprache zum Schema und zum Panzer werden lässt, er sucht nach dem Überraschenden, erstrebt das Offene. Gehören Mythen nicht gerade zu dem Festgelegten, Besiegelten, Erstarrten, das er so sehr fürchtet? Gibt es etwas Einengenderes als diese hanebüchenen alten Geschichten? X-fach kommentiert, interpretiert, variiert (und in unserer Zeit durch süßliche Fantasy-Soße beinahe unkenntlich gemacht), blieben sie doch in ihren Grundzügen, mehr oder weniger, über zweitausend Jahre erhalten; Sirenen und Kentauren sind nicht ganz untergegangen, und die Namen griechischer Helden und Götter sind dem durchschnittlich gebildeten Zeitgenossen noch einigermaßen geläufig. Der Witz liegt eben in dem »Mehr oder weniger«, das den Mythos kennzeichnet und ihm seine freiheitliche Bedeutung verleiht. Als eine »Rumpelkammer« hat ihn ein großer Religionshistoriker einmal bezeichnet, ein Raum des Halbdunkels, der Unordnung und Uneindeutigkeit. Die mythischen Ereignisse und Konstellationen, über die ich nachdachte, verloren ihre Wörtlichkeit. Sie glichen rätselhaften Gemälden, denen ich mit der Taschenlampe meiner unbeholfenen, eigenen, heutigen Fragen zu Leibe rückte. Was ist eigentlich der Grund für Daphnes Flucht und Verwandlung? Woran stirbt Herakles? Wovon singen die Sirenen? You can imagine the opposite! Ich weiß: Mythen lehren nichts. Aber sie können den Glauben an die Unverrückbarkeit des Bestehenden untergraben. So verstand ich sie: als Wegweiser und Werkzeug auf dem Weg zu jenem Anderen der Realität, genannt Literatur.
S. R., März 2019
DAS GESCHENK DES NESSOS
Ein Tiermensch aus der grauen Vorzeit machte mir
Einst ein Geschenk – in eherner Kapsel blieb’s verwahrt –,
Das ich, ein Kind noch, aus der dichtbehaarten Brust
Des Nessos, als todwund er hinschwand, mir entnahm.
Den tiefen Fluss, den Euenos, durchquerte er
Für Geld, nur mit den Händen bracht’ er Menschenlast
Hinüber, brauchte Ruder nicht noch Segeltuch.
Er trug auch mich, als nach des Vaters Willen ich
Die erste Reise tat als Weib des Herakles,
Auf seinen Schultern. Aber mitten in der Furt
Rührt er mit gieriger Hand mich an. Auf meinen Schrei
Dreht gleich der Sohn des Zeus sich um, schon schnellt die Hand
Den Pfeil ab, den gefiederten, der zischend ihm
Die Brust durch in die Lungen drang.
Sophokles, Die Trachinierinnen
1
Ein dreckiges Stück Stoff. Ein fleckiges, an den Säumen eingerissenes altes Männerunterhemd. Hastig zusammengerollt und ungewaschen liegt es zwischen unbrauchbar gewordenen Kleidungsstücken und Stoffresten in einer Plastiktüte in der untersten Schublade der Wäschekommode im Schlafzimmer. So wie es war, voller Blut und Sperma und noch feucht vom stinkenden Wasser des Pangu Sungai, hatte sie es zusammengeknüllt in der Hand gehalten, als die Leute kamen, die sie aufhoben und vorsichtig auf die Rückbank des hoteleigenen Kleinbusses legten. Noch Stunden später, als Roland endlich bei ihr war, hielt sie es in der Hand und wollte es nicht loslassen; als jemand ihr mit sanfter Stimme ankündigte, dass sie jetzt eine Spritze bekomme, damit sie schlafen könne, schob sie es unter ihr Kopfkissen; und am nächsten Tag, als sie erwachte – Sonnenschein und weiße Laken, Frühstück mit Tee und Blumen und Litschis auf dem Tisch, gedämpfte Geräusche planschender Kinder im Pool –, roch sie es unter dem Kissen und stand trotz der schrecklichen Schwäche, trotz der brennenden Schmerzen schwankend auf, um es in eine Plastiktüte zu stopfen und in ihrem Koffer zu verstauen, bevor Roland wach wurde.
Seit damals ist es unberührt geblieben. Als sie nach ihrer Rückkehr den Koffer auspackte, hatte sie die Plastiktüte in der untersten Schublade der Kommode versteckt. Es war damals eine andere Wohnung und eine andere Kommode, aber die Stelle hat sich nicht verändert: das dunkle Schlafzimmer, ihr gemeinsames Schlafzimmer, der Raum, in dem Roland ihr gehört. Dort wollte sie es immer in der Nähe haben, dort lag das Hemd unangetastet in der Kommode. Immer wieder, seit jener ersten Reise mit Roland vor dreißig Jahren, ihrer Hochzeitsreise, ist ihr der Geruch in die Nase gestiegen, nachts, wenn sie wachlag – dieser entsetzliche Dunst, der vom Fluss aufsteigt zu den Hütten und Haut und Haare der Menschen durchtränkt, die dort wohnen, dieser Gestank nach Dreck und Gift und Kot und Aas, der Pesthauch des Pangu Sungai –, aber sie hat sich nicht dazu entschließen können, das Hemd herauszuholen. Sie hat es weder gewaschen noch weggeworfen oder anderswo verstaut. Sie hat es nicht angerührt. Roland schlief neben ihr. Er hat nie etwas gerochen. Er merkt nichts. Er schläft wie ein Stein.
Vielleicht liegt darin das Geheimnis seines phänomenalen Arbeitsvermögens, seiner offenbar unerschöpflichen Energie. Egal wie viel er zu tun hat, egal in welcher Gemütsverfassung er ist, es gibt nichts, was sein Gehirn davon abhält, in den Erholungsmodus zu schalten, wann immer er es für notwendig hält. Er kann überall und zu jeder Zeit schlafen. Im Geländewagen auf einer Staubpiste in irgendeinem fernen Winkel der Welt, im Flugzeug, auf der Liege im Büro oder zu Hause im Schlafzimmer – er braucht sich nur die Schlafbrille über die Augen zu schieben, und kurz darauf hebt und senkt sich seine breite Brust in tiefen, regelmäßigen Atemzügen. Es ist ein unerschütterlicher Lebensmut, der darin zum Ausdruck kommt, ein ewigjugendliches Vertrauen darauf, dass ihm die Zukunft sicher ist und der Tod ihn noch lange verschont. In dieser ganzen Zeit hat er nie geahnt, dass das Hemd keine zwei Meter von seinem Bett entfernt in der untersten Schublade der Kommode liegt. Tamans Hemd, das sie seit damals nicht mehr in Händen hielt – bis heute.
Spätsommer. Gläserne Luft, kein Hauch. Woher der unruhige Glanz des Ahorns vor dem Fenster? In der licht gewordenen Krone zeigen sich schon büschelweise gelbe Blätter, täglich werden es mehr. Kaum ein Auto zu hören. Kein Geschrei auf dem Hof, Lärm nicht einmal von der Baustelle, nur gelegentlich, wie geträumt, Glockenklänge von einer fernen Kirche. Die Sonne gleißend hell, doch nicht mehr heiß, an einem Himmel von unbestimmbarer Farbe.
Wie schnell es geht, jedes Jahr, im Nu ist der Herbst da.
Roland ist auf Reisen. Eine Woche hat er bleiben wollen. Sieben Wochen wartet sie nun schon auf ihn. Sieben Wochen. Und heute Abend kommt er zurück.
Wenn sie etwas zu tun hätte! Etwas Richtiges, etwas, was zählt. Was ablenkt. Aber sie hat nichts zu tun. Das Literaturcafé, in dem sie gelegentlich aushilft, ist in der Ferienzeit geschlossen. Der Chor, in dem sie singt, trifft sich erst in drei Wochen wieder. Sie hat die Küche aufgeräumt, die Fenster geputzt. Sie sitzt da und betrachtet ihr Gesicht in der blanken Scheibe. Sie legt den Kopf in die Hände, spürt ihren Schädel unter der dünnen Haut. Was ist übrig von der Frau, die sie einmal gewesen ist? Doch, ihr Körper funktioniert noch, erstaunlich gut sogar. Man macht ihr Komplimente wegen ihres Aussehens. Ihre Beine sind noch ganz passabel, und sie wird nicht dick, aber die Haut an Hals und Händen und Oberarmen sieht schrecklich aus, dazu die Falten und Augenringe im Gesicht, die braunen Flecken auf den Handrücken … Merkmale jenes unaufhaltsamen Prozesses des Welkens und Schwindens, den sie immer wieder überrascht, gelegentlich bestürzt an sich wahrnimmt. Kann man sich je damit abfinden? Allerdings bleibt sie ihrem Grundsatz treu, nicht mit absurden Mitteln gegen das Alter anzukämpfen, keinen Cent für künstliche Glättungs- und Straffungsmaßnahmen auszugeben. Ihre Anziehungskraft lässt nach, das ist nicht zu ändern. Jede Jüngere sieht besser aus. Dennoch gibt sie nicht klein bei, achtet peinlich auf ihr Äußeres und merkt, dass sie durch Frisur, Make-up und Kleidung durchaus gewinnen und unter geeigneten Umständen immer noch Lust in Roland erregen kann.
Wenn sie miteinander schlafen, geht es um seine Befriedigung. Sie hat von der Bedeutung der Sexualität für die Ehe im Alter gelesen. Sie spürt, wie wichtig es ihm ist, in regelmäßigen Abständen Erregung zu spüren, die ihm beweist, dass er ein Mann ist und immer noch über die Kraft eines geübten Liebhabers verfügt. Eine rein biologische Sache. Ihre eigene Lust ist ungreifbar geworden, zersetzt und aufgelöst im Alltag. Sie spürt sie ganz unvermittelt, manchmal, wenn sie lange schwimmt oder läuft, und auch mit Roland – – manchmal – selten. Das Gefühl ihrer Unansehnlichkeit ist stärker. Alles sträubt sich in ihr, wenn sie sich vor Roland auszieht. Im dunklen Schlafzimmer tut sie es trotzdem, aus Vernunftgründen, um seinetwillen, um ihrer Ehe willen.
Eine Ehe kann das Alter nur überleben, wenn sich jugendliche Verliebtheit in die abgeklärte und geduldige Freundschaft von Erwachsenen verwandelt – ist es nicht so? Jedenfalls hat sie bisher daran geglaubt. Und ist Roland nicht ihr bester Freund, ihr engster Vertrauter, ihr bevorzugter Gesprächspartner? Nichts geht ihr über die langen Juniabende, die sie zusammen auf der Dachterrasse verbringen. Mit fast kindlichem Ernst erzählt er ihr von seinen Labs, von den deprimierenden Zuständen in den Städten, die er bereist, von seiner Sorge, keine Geldgeber zu finden, die Erwartungen seiner Mitarbeiter zu enttäuschen, nicht genug zu tun gegen vergiftete Böden, verseuchtes Wasser, die verheerenden Auswirkungen von Unwissen und Habgier und letzten Endes nichts auszurichten gegen die herrschende Gleichgültigkeit. Das Alter schreckt ihn nicht. »Ich werde den Lehrstuhl erst abgeben, wenn ich meine Aufgabe erfüllt habe«, verkündet er gern (besonders gegenüber Neidern und Konkurrenten, die immer wieder versuchen, ihm Gelder abspenstig zu machen), ohne zu erwähnen, dass es sich um eine Aufgabe handelt, die übermenschliche Kräfte und mehr als ein einzelnes Leben verlangt. Sie macht sich keine Illusionen. Einen Ruhestand wird es für ihn nicht geben. Doch wenn er neben ihr sitzt, von der letzten Reise berichtet und begeistert über seine neuesten Pläne spricht, kann auch sie nicht umhin, ihn zu bewundern. Seine Standhaftigkeit und Courage, seine Empörung über die ungerechten Verhältnisse, die ihm überall ins Auge fallen, rühren sie. Wenn sie ihm zuhört, verschwindet das Gefühl ihrer eigenen Wertlosigkeit, das so oft an ihr nagt, und sie sagt sich, dass auch sie schließlich eine Aufgabe habe: für ihn da zu sein und dafür zu sorgen, dass er tun kann, was er sich vorgenommen hat. Wie oft haben sie in diesem Sommer nebeneinander auf der Dachterrasse gesessen. Eine Flasche Wein auf dem Tisch, teurer Wein, den er sich aus Frankreich liefern lässt. Er braucht ihn und kann viel davon trinken, ohne dass man ihm etwas anmerkt. Wenn er getrunken hat, kommt er ins Reden, und sie hört zu und hört das Rauschen des Ahorns vor dem Haus und denkt, dass sie nur zusammen ein Ganzes bilden: er der Stamm, die Äste und das Laub und sie die Wurzeln, die dafür sorgen, dass der Baum grünt.
In der Küche stellt sie Wasser auf. Tee trinken, nicht den Kopf verlieren, wir sind doch zivilisierte Leute. Sie merkt, dass ihr Tränen über die Wangen laufen, doch Erleichterung stellt sich nicht ein. Heute Abend kommt er zurück. Ein unbeständiger, treuloser, frech lügender Ehemann, der sich mit einem Mädchen vergnügt, das seine Tochter sein könnte. Sie beneidet dieses Mädchen: Cindy. Sie beneidet jede andere. Sie ist eine alte Frau, nutzlos, einsam. Was soll sie tun, wenn ihm einfiele, sich scheiden zu lassen?
Der Dampf aus dem Wasserkocher steigt ihr ins Gesicht. Der heiße Atem des Tiermenschen. Maßloser Schreck, der den Atem stocken lässt, plötzliche Erkenntnis einer unbeschreiblichen, unvordenklichen Gewalt, die keinen Gedanken mehr zulässt, den Körper zerreißt. Angst vor der Zerstörung alles Bekannten, dem Verlust des Bodens, dem Sprung ins Nichts. Wo ist Roland? Warum kommt er nicht, um sie zu retten? Ein vertrautes Gefühl steigt in ihr auf und zieht sie dorthin, ins dunkle Schlafzimmer, wo das Hemd liegt, Tamans Hemd. Sehnsucht? Verlangen?
Der Geruch … dieser schreckliche Gestank, der von dem giftigen Wasser aufgestiegen war, der Pesthauch des Pangu Sungai. Das Schlafzimmer. Das Ehebett, Bücher und Zeitschriften rechts und links, Kleidungsstücke über einem Stuhl. Sie beugt sich hinunter, zieht die Schublade auf und holt die alte Plastiktüte heraus. He will always love you. Das Blut rauscht ihr in den Ohren, als sie sie in Händen hält, und sie zittert am ganzen Körper, als sie das Hemd, Tamans Hemd, auf dem Bett ausbreitet.
Die Flecken sind verblasst, die eingerissenen Säume kaum zu erkennen. Es ist nicht mehr ganz weiß, aber im Halbdunkel des frühen Morgens wird auch das kaum wahrnehmbar sein. Roland wird aus dem Bad kommen, nackt und gutgelaunt, und das Unterhemd vom Stapel nehmen, ohne hinzusehen. Das Anziehen muss schnell gehen, wie alles am Morgen. Noch im Bett konsultiert er seinen Terminkalender, liest die nachts eingegangenen Nachrichten, schreibt die ersten Mails. Dann duscht er, rasiert sich, hört Radio dabei. In Gedanken ist er schon längst im Institut, bereitet einen Redebeitrag vor, rekapituliert den Text einer Vorlesung. Er wird nichts merken.
Sie hört ein Geräusch. Vielleicht ein an den Rahmen schlagendes Fenster – oder etwas anderes. Das Klatschen von nasser Wäsche am Ufer. Das Gackern von Hühnern. Unablässig picken die Hühner Löcher in die Erde, scharren und scharren und legen die Knochen frei. Die Erde ist voller Knochen. Ein Totenfeld. Sie hat Angst, den Boden mit den Sohlen zu berühren, Angst einzusinken, hinuntergezogen zu werden in die schwammige, schillernde, stinkende Tiefe. Wo ist Roland, warum kommt er nicht?
Die Stimme der Alten, ihr gelbliches, runzliges Gesicht, das plötzlich im dunklen Winkel der Hütte auftauchte. Die Berührung ihrer harten Hand. Ein Liebeszauber. A gift.
Tabea zieht die oberste Schublade auf. Sie faltet das Hemd zusammen. Tamans Hemd. Sie legt es zwischen die frischgewaschenen Unterhemden ihres Mannes in die Kommode. Sie zupft den Stapel säuberlich zurecht. Sie schließt die Schublade.
2
Vor sieben Wochen, am Morgen nach ihrem neunundfünfzigsten Geburtstag, hatte er sich strahlend von ihr verabschiedet, wie immer, wenn irgendwo ein neues People’s Lab eröffnet wurde. Trotz des nicht unbeträchtlichen Rotweinkonsums bei dem kleinen Essen am Abend zuvor war er ausgeschlafen, voller Energie, von unverwüstlicher Zuversicht. Roland, der Tausendsassa. Der Gewinner. »Mit vierundsechzig immer noch ein Herkules«, wie ein Journalist es ausdrückte, der ihn vor Kurzem interviewte. Zwölf People’s Research Laboratories in zwölf Ländern. Zwölf mit Spendengeldern finanzierte unabhängige Institute, in denen junge Forscher nach seinen Vorgaben unkonventionelle Lösungen für die drängendsten Umweltprobleme ihrer Länder suchen. Zwölf Inseln offenen, unvoreingenommenen Denkens und Experimentierens in Ozeanen rücksichtslosen Wirtschaftens, im Tumult jener Stadtmoloche voller Elend und Korruption, die niemand mehr in den Griff bekommt. Sein Lehrstuhl in Deutschland bringt der Universität weltweites Ansehen. Seine Vorlesungen und Workshops werden überrannt. Sein Kalender ist mit Terminen gespickt: Verhandlungen, Konferenzen, Talkshows, Empfänge. Wie soll Tabea hoffen können, dass er sich ihr erklärt? Und wenn er in diesen ersten hektischen Semesterwochen doch eine halbe Stunde Zeit für ein Gespräch mit ihr fände – wie soll sie ihm noch glauben?
Sie hat keine Chance. Ebenso wenig wie seine frühere Ehefrau eine Chance hatte, als er beschloss, sich von ihr zu trennen, und wie jede andere Frau, die so töricht wäre, ihn ganz für sich zu beanspruchen, je eine Chance haben würde. Immer wieder hatte er Affären gehabt, die er nach einer gewissen Zeit brüsk beendete. (Anne-Kathrin, die sommersprossige Praktikantin, und Greta und Emma und Véronique, die Dolmetscherin, die behauptet hatte, das Baby auf dem Foto sei von ihm … mit einer großzügigen Überweisung brachte er sie zum Schweigen …) Wenn sie ihm die Beweise präsentierte, hatte er sich reumütig gezeigt und versichert, dass seine Liebe zu ihr, Tabea, durch keine dieser flüchtigen Eskapaden beeinträchtigt werden könne. Seit einigen Jahren schien sich sein unersättlicher Appetit auf Frauen gelegt zu haben, seit Falks Auszug vor drei Jahren hatte es keine Seitensprünge mehr gegeben – aber wie konnte sie dessen so sicher sein? In Wahrheit hatte er nur gelernt, besser zu lügen! Wie dumm sie ist! Anzunehmen, dass dieser Mann dazu bereit wäre, seine überbordenden Gelüste zu zügeln! Anzunehmen, dass er ihr zuliebe irgendetwas unterlässt, was Vergnügen verspricht! Wie viele Frauen hat es gegeben, von denen sie nichts weiß?
Sie hat ihm Nachrichten geschickt, die er nicht beantwortete. Oder er schrieb in munterem Ton zurück: »Hab noch zu tun, bin bald zurück. Frag Moni.« Wie oft hat sie das schon gehört? Frag Moni! Die unverheiratete und offenbar alters- und bedürfnislose Sekretärin dient ihm seit Jahrzehnten unterwürfig. Sie managt den Lehrstuhl, bucht seine Flüge, vereinbart Termine, wimmelt unangenehme Leute ab. Sie weiß Bescheid. Weiß sie auch, dass Roland sich über ihre Frisur und ihre Schuhe und über die mit billigem Aufschnitt belegten Brote lustig macht, die sie mittags hinunterschlingt, um ihre Arbeit nicht unterbrechen zu müssen? Wahrscheinlich würde auch das ihrer Verehrung keinen Abbruch tun. Nein, von Moni hätte Tabea nie etwas erfahren, Moni hält dicht. Es war der Zufall, der ihr zu Hilfe kam. Eine kleine Unachtsamkeit beim Eintippen der Adresse, eine E-mail, die zu schnell gesendet wurde, wie es so häufig passiert, wenn man ungeduldig, zerstreut oder müde ist.
Cindy. Natürlich heißt sie in Wahrheit ganz anders, aber die jungen Frauen, die sich für die Laboratories bewerben, geben immer europäische Namen an, weil sie wissen, dass kein Europäer ihre Namen richtig aussprechen oder gar sich merken könnte. Ein dünnes Mädchen in Shorts und Glitzertop, lange schwarze Haare und blendend weiße Zähne. Aber sehen in jener Weltgegend nicht alle Mädchen so aus? Auf dem Gruppenfoto, aufgenommen vor der nüchternen Fassade des Instituts mit der Aufschrift PEOPLE’S RESEARCH LAB HYDERABAD, stand sie in der zweiten Reihe und wäre Tabea ohne Rolands unfreiwilligen Hinweis nicht aufgefallen. Selbst das zweite Foto im Anhang hätte sie kaum beachtet, wenn ihr nicht plötzlich klar geworden wäre, um welchen Ort es sich handelte – vor welchen Felsen sich dieser halbnackte Frauenkörper präsentierte, von welchem Wasser er sich lachend bespritzen ließ.
»Hier siehst Du«, lautete Rolands E-mail, die nur an Moni gerichtet sein konnte und die er versehentlich an Tabeas Adresse schickte, »warum ich den Termin mit F. und M. beim besten Willen nicht einhalten kann. Es bleibt dabei: Stockholm fällt aus. Du wirst es ihnen auf Deine bewährte Art beibringen. Cindy leistet phänomenale Arbeit, wahrscheinlich werde ich ihr bald die Leitung in Hyderabad übertragen. Wir gönnen uns diesen kleinen Urlaub« – an dieser Stelle war ein Smiley mit Sonnenbrille eingefügt –, »bevor ich mich leider wieder auf die Heimreise machen muss. Ruf A. an (am besten Dienstagnachmittag) und kümmere Dich um die Doktoranden. Der Siemens-Vortrag wird ganz bestimmt nachgeholt, mit den neuesten Erkenntnissen von hier und anderswo, sie sollen schon mal einen Terminvorschlag machen. Alles andere wie besprochen. R.«
Er würde es nicht abstreiten, aber er würde abstreiten, dass es irgendeine Bedeutung hatte. Natürlich. Cindy ist weit weg und würde weit weg bleiben. Ein Abenteuer, eine unwichtige kleine Affäre. Übrigens war sie es, Cindy, die das unbedingt gewollt hat. Ein ehrgeiziges Mädchen. Wenn so eine es darauf anlegt, kann man als Mann nichts machen. Aber man vergisst es auch gleich wieder. Also, wozu das Theater? Weißt du, wie du aussiehst, wenn du dich so aufregst, wegen einer Lappalie?
Und der Ort – dieser Ort – unser Ort! –, warum hat er sie ausgerechnet dorthin mitgenommen?
Unser Ort? Du tust ja gerade so, als wäre es ein Heiligtum. Nur weil wir einmal dort waren – vor dreißig Jahren! Curuk Island, ein Ort wie andere seiner Art, immer noch nicht allzu überlaufen trotz seiner berühmten Wasserfälle, seines angenehmen Klimas, seiner diskreten Hotels mit westlichem Standard, von den großen Flughäfen aus bequem zu erreichen. Warum sollte man nicht noch einmal dort hinfliegen? Mit Cindy, weil Cindy gerade zur Hand war. Warum nicht?
Aber der Wasserfall! Dieser Wasserfall …
Wovon redest du, Tabea? Bist du verrückt geworden? Du weißt doch, wie dumm und kleinlich es ist, eifersüchtig zu sein!
Woher soll er wissen, was ihr der Wasserfall bedeutet? Sie hat ihm ja nie erzählt, was sie dort erlebte. Es hatte mit den dunklen Dingen zwischen Mann und Frau zu tun; es schien der Liebe zu entstammen, die sie mit Roland erlebte, und war doch davon verschieden; es hatte ihr Leben an seinem tiefsten Grund berührt und ist ihr bis heute unbegreiflich. Damals, vor dreißig Jahren, hatte sie sich vor seinem Spott gefürchtet. Ein Kentaur? Soll das ein Witz sein? Er ist nur fünf Jahre älter als sie, aber es war ihr vorgekommen, als hätte sie bis zu ihrer Heirat nichts erlebt, als wäre sie ein Kind neben diesem selbstsicheren, weltgewandten Ehemann, mit dem sie ihre erste und einzige große Reise unternahm. Der Wasserfall war ihr Geheimnis geblieben. Und doch schien jene unerklärliche, beseligende Begegnung auf Curuk Island nicht denkbar zu sein ohne das Schlafzimmer, in dem Roland ihr gehörte.
Aber er gehört ihr nicht mehr …
Komm zur Vernunft, Tabea! Wie soll es eine Cindy mir dir aufnehmen? Schau dich um. Hast du’s nicht gut? Wir sind doch zivilisierte Leute. Denk nicht mehr dran. Endlich, nach sieben Wochen, die Nachricht: »Ankunft 22 Uhr. Wahrscheinlich Verspätung. Bin hundemüde, Fahrdienst holt mich ab.« Fahrdienst heißt Moni. Und es heißt, dass er gleich ins Bett gehen wird, nicht mehr reden, nichts mehr hören und sehen will. Dass es keine Erklärung geben wird, jedenfalls nicht heute und auch nicht in den nächsten Tagen, denn natürlich wird er nach so langer Abwesenheit gleich jede Menge Termine haben. Er wird von einer Sitzung zur nächsten hetzen und abends mit irgendwelchen Drittmittelgebern und Forschungsbeauftragten essen gehen müssen. Jetzt nicht, Tabea, wird es heißen. Vielleicht am Wochenende. Frag Moni. Aber im dunklen Schlafzimmer, unter dem Stapel der frischen Wäsche in der Kommode, liegt jetzt das Hemd, Tamans Hemd, und ein vertrautes Gefühl steigt in ihr auf, wenn sie daran denkt. Sehnsucht? Verlangen? Hass. Alter Hass, stark und kalt und zersetzend wie tödliches Gift.
3
Ihre Schwester Ebba hat ihr wie jedes Jahr zum Geburtstag einen Brief geschickt. Ebba hat MS und lebt in Amerika, und obwohl sie sich selten sehen und oft monatelang nichts voneinander hören, hat sich das Gefühl ihrer geschwisterlichen Verbundenheit nie abgeschwächt. Tabea liest den Brief in diesen sieben Wochen mehrmals. Neben dem Brief steckt eine Bildkarte in dem Umschlag. Darauf zwei abstrahierte männliche Figuren aus glattem, dunklem Metall, ein Mensch und ein etwas kleinerer Kentaur, einander gegenüberstehend und mit den Armen berührend.
»Liebe Tabea«, schreibt Ebba in ihrer krakeligen und dennoch schwungvollen und wohlprortionierten Handschrift, »als ich kürzlich in einer Ausstellung diese kleine Bronzegruppe sah – sie stammt aus Griechenland und ist fast dreitausend Jahre alt –, dachte ich sofort an Dich. Weißt Du noch, wie wir damals über Kentauren sprachen und was Du mir von diesem Wasserfall erzählt hast? Es ist bestimmt ewig her, ich habe kein Zeitgefühl mehr und die Erinnerung ist eine komische Sache. Manchmal sind lange Zeitabschnitte völlig verschwunden, und dann taucht plötzlich irgendwas auf, woran ich Jahrzehnte nicht mehr gedacht habe, so deutlich, als wäre es gestern passiert. Es wird mir immer stärker bewusst, dass ich gar nichts richtig zu fassen kriege, dass meine Gedanken Bruchstücke sind, dass ich überhaupt nur halb bin und nur die Hälfte der Welt sehe. Wo ist die andere Hälfte? (Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen, und ist doch rund und schön. Der liebe alte Claudius!)
Vielleicht gehören Kentauren zu den Wesen, die vollkommener sind als wir (und die uns deshalb etwas zu lehren haben). Neulich stand ich vor dem Bücherregal in unserer Klosterbibliothek und mein Blick fiel auf ein Buch, dessen Titel mir bekannt vorkam. Du hast mir doch damals erzählt, dass Du auf dieser Reise mit Roland auf Blackwoods Centaur gestoßen bist? Siehst du, wir haben offenbar immer noch denselben Geschmack, denn ich war genauso begeistert davon wie Du. Die Kentauren, die er heraufbeschwört, sind mit den Riesen aus der Urzeit verwandt, und wenn sie dort in ihrem paradiesischen Rhododendrenwald erscheinen, kann man die ›schreckliche Freude‹ nachempfinden, die der Protagonist bei ihrem Anblick fühlt. We have called you! Come …! Mir lief es kalt den Rücken hinunter, als ich das las.
Weißt Du noch, unsere Reise nach Neapel? Wie wir da im Museum herumwanderten und uns über die vielen Mischwesen wunderten, die es bei den Alten gab? Es kam uns auf einmal seltsam vor, dass wir Heutigen nur uns selber gelten lassen.
Jetzt komme ich zu der kleinen Bronzegruppe, die ich neulich in der Ausstellung sah. Da ist der Kentaur zwar besiegt (der Pfeil, mit dem Herakles ihn tötet, steckt in seinem Pferdeschenkel), aber man hat den Eindruck, dass etwas ganz anderes gedacht und dargestellt ist als Streit, Sieg, Unterwerfung, Triumph, wie in den späteren Kentaurenkämpfen, die so viele griechische Vasen und Friese schmücken. Man spürt in den ausgestreckten Händen seines menschlichen Gegenübers noch etwas von der Scheu, der zarten, frommen Ehrfurcht, mit der die ersten Menschen sich den Kentauren näherten. Denn ich glaube, sie haben sie nicht als bloße Tiermenschen verachtet, sondern im Gegenteil sich selbst ihnen gegenüber als halb und unvollständig erkannt.
Du kennst doch die Nessos-Geschichte? Ich erinnere mich an das Geschenk des Kentauren, das blutgetränkte Gewand, das er der Frau des Siegers Herakles mitgibt, bevor er endgültig von ihm bezwungen wird und stirbt. Es soll als Liebeszauber wirken, stellt sich aber als Todbringer heraus. Herakles, der starke Hans, der scheinbar unverwundbare Held der Zivilisation wird viele Jahre nach dem bereits entschiedenen Kampf auf heimtückische Weise von dem haarigen, tierischen Unterling Nessos zur Strecke gebracht. Wer ist denn dieser Nessos? Und ist in dem Ambivalenten und Doppelten seiner Gabe nicht noch ein Fünkchen des alten Bewusstseins der Halbheit enthalten, das uns inzwischen so fremd geworden ist?
Vielleicht ist meine Krankheit schuld daran, dass die Kentauren mir nicht aus dem Kopf gehen. Mein Körper verhält sich nämlich überhaupt nicht zivilisiert und galoppiert mir ständig auf die aberwitzigste Art davon. Du siehst ja, wie schwer mir das Schreiben fällt. Und alles andere auch. Nach dem Essen ergreift mich unbändige Müdigkeit, und ich kann nicht mehr aufhören zu schlafen. Die Kraft rinnt aus mir heraus, jeden Tag ein bisschen mehr. Weißt Du noch, wie stark ich war, Tabea? Die Handstände, die ich gemacht habe! Fünf Minuten konnte ich auf den Händen stehen, als ich zwanzig war, und tausend Meter kraulen, wie nichts, und über vier Meter weit springen! So einen Körper hatte ich, und wie herrlich das ist, fiel mir in meiner jugendlichen Blödheit damals gar nicht auf. Ich hielt es einfach für selbstverständlich (wie ich überhaupt so vieles für selbstverständlich hielt, ohne das Selbstverständlichste zu wissen: dass alles verlorengeht). Und heute fangen alle meine inneren Litaneien mit dem Seufzer an: Wenn ich nur gesund wäre! Aber es gibt auch andere Momente. Da ist mir klar, dass nicht die Halbheit der Fehler ist, sondern die seltsame Annahme, als könnten Menschen etwas anderes sein als halbe Wesen.
Danke für Deinen letzten Brief. Warum klingst Du so verzagt, Tabea? Ich empfehle Dir: Geh wieder mal schwimmen! Ich denke an die Stelle, wo wir früher im Sommer trainiert haben. (Oder haben sie das alte Vereinsheim inzwischen in irgendeine schicke Location umgewandelt? Oder gleich den ganzen See zugeschüttet und ein Parkhaus darauf gebaut?) Vielleicht gibt es doch letzten Endes nichts Besseres als die körperlichen Freuden. Jedenfalls erfreue ich mich meines Restkörpers immer noch gern im Wasser, weil er nur im Wasser seine anmaßende Schwere verliert.