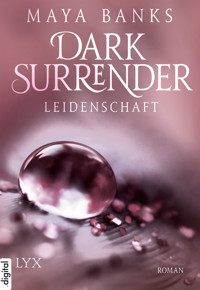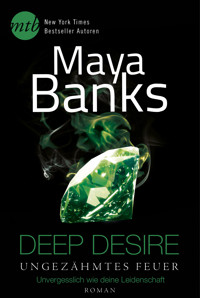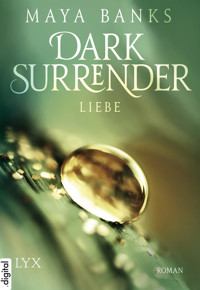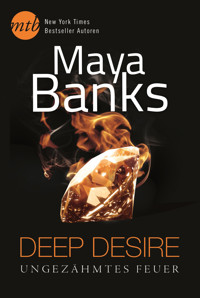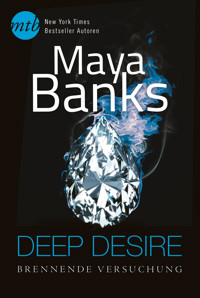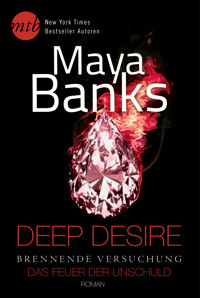9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: KGI-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
KGI-Teamleiter Jackson Steele ist vor allem für eins bekannt: seine eisige Fassade, die nichts und niemand durchbrechen kann. Nur eine einzige Person vermochte bislang, einen Blick dahinter zu erhaschen, und Steele setzt alles daran, dass es bei diesem einen Mal bleibt. Doch die Funken, die zwischen ihm und der jungen Ärztin Maren Scofield sprühen, kann er nicht ignorieren. Und als sie in Lebensgefahr gerät, muss er eine Entscheidung treffen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmung12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243EpilogDie AutorinDie Romane von Maya Banks bei LYXLeseprobeImpressum
MAYA BANKS
Stählerne Gefahr
Roman
Ins Deutsche übertragen vonKatrin Mrugalla und Richard Betzenbichler
Zu diesem Buch
Steele, Chef des KGI-Teams, wird nicht umsonst »der Eismann« genannt: Er ist hart, unnachgiebig und ein Buch mit sieben Siegeln, in dem nicht einmal seine Teamkollegen lesen können. Gefühle zeigt er grundsätzlich nicht, und niemand kann seine eisige Mauer durchdringen. Niemand außer Maren Scofield, einer Ärztin, die KGI schon mehrfach geholfen hat. Steele ist wild entschlossen, Maren nicht über seine schwer bewachte Mauer zu lassen. Aber als die schöne Ärztin in Gefahr gerät, will er ihre Rettung auf keinen Fall einem anderen überlassen. Maren verbirgt etwas, da ist Steele sich sicher. Und doch trifft ihn die schockierende Wahrheit unvorbereitet. Genau wie die Tatsache, dass sie sein Leben unwiderruflich verändern wird. Er muss eine Entscheidung treffen: alles abblocken und Maren für immer aus seinem Leben ausschließen? Oder sich dem mächtigsten Feind stellen, dem er je begegnet ist: der Liebe.
Für meinen Vater
Für all die Softballspiele, Basketballspiele und Tennisturniere, bei denen du dabei warst.Dafür, dass du mir einen Softballschläger und meinen ersten Tennisschläger gekauft hast.Dafür, dass du immer da warst und nie etwas Wichtiges versäumt hast.
Du sollst wissen, dass ich jetzt für dich da bin.
1
»Status«, sagte Steele leise.
Der Empfänger in seinem Ohr knisterte. P. J. Rutherford antwortete umgehend.
»Bis jetzt kein Schuss. Wiederhole: noch keine freie Schussbahn. Ich brauche zwei Minuten, um neue Position einzunehmen. Den kriege ich.«
Ungeduldig begutachtete Steele die Wachtürme. Das Team hinkte dem Plan schon fünfzehn Minuten hinterher, und der Bergungshubschrauber würde in fünfundvierzig Minuten landen. Ihnen blieb kaum noch Zeit hineinzustürmen, das Mädchen zu schnappen und abzuhauen.
Er war sich nicht ganz sicher, ob die Kleine überhaupt abhauen wollte, aber ihre Eltern bezahlten KGI ein Vermögen dafür, sie aus Matteo Garzas Klauen zu befreien. Seit drei Tagen überwachten sie das Objekt nun schon rund um die Uhr, und Steele hatte nicht einen Hinweis entdecken können, dass Christina Westlake irgendwie in Schwierigkeiten stecken könnte. Sie stolzierte in Bikini, Stringtanga und Stöckelschuhen mit fünfzehn Zentimeter hohen Absätzen herum, sie lachte und lächelte und wirkte auf eine selbstgefällige Weise zufrieden. Er konnte nur hoffen, dass sie wenigstens heute vernünftige Schuhe trug, denn in Stilettos zu laufen wäre nicht ganz einfach, und sie musste einen festen Tritt haben.
»Beeil dich, P. J.«, knurrte Steele. »Die Zeit ist knapp.«
»Mach dir mal nicht in die Hose, Boss«, meldete sich Cole. »Mein Mädchen kriegt das schon hin.«
Steele verdrehte die Augen. Er wusste, dass P. J. gerade das Gleiche tat. Wenn die Mission abgeschlossen war, konnte er sich gleich auf weiteres Gezänk unter den Jungvermählten gefasst machen. Für diese Bemerkung würde P. J. Cole die Eier abreißen.
»Irgendein Zeichen von unserer Zielperson?«, funkte Dolphin dazwischen. »Ich habe sie seit einer halben Stunde nicht mehr gesehen. Ich dachte, sie nimmt um die Zeit immer ein Sonnenbad.«
Miss Westlake hatte einen regelmäßigen Tagesablauf. In Steeles Augen war das wenigstens etwas Positives. Dolphin, Baker und Renshaw hatten sich freiwillig für die Nachmittagsschicht gemeldet, damit sie die langbeinige Blondine in ihrem Tanga bewundern konnten. Nicht zu vergessen, dass sie beim Sonnenbad auch immer das Oberteil des Bikinis abnahm.
Sie sah gut aus, kein Zweifel, Steele allerdings machte sie überhaupt nicht an.
»Sie ist spät dran«, grummelte Baker. »Wir müssen sie also erst finden, wenn wir drinnen sind.«
»Ich hole sie«, sagte Renshaw, und sein Grinsen war ihm anzuhören.
»Ruhe«, befahl Steele. »Funkstille, bis ich was anderes befehle. Such dir endlich freie Schussbahn, P. J. Wir warten nur noch, bis du die Wachen ausgeschaltet hast, dann legen wir los.«
»Alles erledigt«, erwiderte P. J. kurz angebunden. »Die beiden vorderen Türme sind sauber. In die Sättel, Cowboys. Lasst uns die Ziege an die Leine legen und abdampfen.«
Coles Glucksen hallte in Steeles Ohr wider. »Braves Mädchen.«
»Vorwärts«, bellte Steele. »Und keine Komplikationen.«
Steele verließ den behelfsmäßigen Sichtschutz, schulterte sein Gewehr und kroch durch das dichte Gebüsch, das den palastähnlichen Prunkbau umgab.
Normalerweise bevorzugte er bei einer Rettungsmission den Schutz der Nacht, um ungesehen vorzudringen, schnell und gnadenlos zuzuschlagen und wieder zu verschwinden. Garza hatte allerdings nachts die Wachen verdoppelt, fast als würde er mit einem Überfall rechnen. Tagsüber beschäftigte er nur wenige Sicherheitsleute, und die waren auch noch faul und unaufmerksam. Das sollte eigentlich ein Kinderspiel werden.
Eigentlich.
Seine Erfahrung hatte ihn gelehrt, dieses Wort nie laut auszusprechen, obwohl er mit Aberglauben absolut nichts am Hut hatte.
Er schlich auf kürzestem Weg zur Rückseite des Gebäudes. Plötzlich wurden Gewehrschüsse abgefeuert.
»Verfluchter Mist, was ist los?«, knurrte er in sein Mikrofon.
»Entschuldigung, Boss«, meldete sich Dolphin verärgert. »Ließ sich nicht umgehen. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind.«
Dem Gekreische nach zu urteilen, das mittlerweile zu hören war, wusste das auch Christina Westlake. Sie hatte sicher keine Ahnung, dass sie gekommen waren, um sie zu retten. Sie hörte nur die Schüsse und sah das Blut.
»P. J., Cole, gebt uns Deckung«, befahl Steele. »Ich hole das Mädchen.«
»Der Weg ist bereits frei«, antwortete P. J. »Die werden glauben, die Königin von England sei im Anmarsch.«
Über diese geistreiche Bemerkung konnte Steele nur den Kopf schütteln. Rasch überwand er die Steinmauer und erreichte die Terrasse beim Swimmingpool. Jenen Pool, wo Christina Westlake gerade ein Sonnenbad nehmen sollte. Musste die Frau ausgerechnet heute ihren Stundenplan ändern?
Erneut zerriss ein Kreischen die Luft. Steele drehte sich in die Richtung, aus der der ohrenbetäubende Lärm kam, und rannte gleichzeitig auf die Treppe zu, die zum Balkon im ersten Stock führte. Kaum oben angelangt, wich er einem Messer aus und rammte den gedrungenen Burschen, der ihm aufgelauert hatte, mit der Schulter.
Schmerz schoss durch seinen Arm. Er biss die Zähne zusammen. Die Klinge hatte seinen Arm aufgeschlitzt.
Als sein Angreifer zurücktaumelte, riss Steele sein Gewehr herum und knallte dem Wachposten den Kolben gegen das Kinn. Dieser stürzte zu Boden und rührte sich nicht mehr. Mit einem Blick erfasste Steele die Lage. Ein neues Geräusch jenseits der zweiflügeligen Glastüren erregte seine Aufmerksamkeit.
»Dumme Kuh! Aus dem Weg mit dir!«
»Du darfst mich nicht verlassen, Matteo.«
Der gellende Schrei ließ Steele zusammenzucken. Offenbar hing Matteo nicht so sehr an Christina wie sie an ihm. Der dachte nur daran, wie er entkommen konnte. Aber an Matteo hatte Steele kein Interesse. Garza konnte es sich selbst leicht oder schwer machen. Steele hätte das Blutvergießen gern auf ein Minimum beschränkt, er war jedoch auf alles vorbereitet.
Erfülle den Auftrag. Koste es, was es wolle.
Dieses Credo hätte seinen Teamkollegen beinahe erheblichen Schaden zugefügt, als P. J. ausgestiegen war und ihren einsamen Rachefeldzug gestartet hatte.
Das war Gott sei Dank Schnee von gestern, jetzt konzentrierten sie sich wieder auf das, was sie am besten konnten. Als Team zusammenarbeiten. Gnadenlos zuschlagen. Den Auftrag erfüllen.
Steele schob sich zur Tür vor und gab ihr einen Tritt. Sie flog auf, und Steele, das Gewehr in der Rechten, zog mit der Linken die Pistole.
Matteo Garza wirbelte herum und ließ die Tasche fallen, in die er alles Mögliche aus seinem Wandtresor hineingestopft hatte. Seine Augen funkelten wild und wirr. Christina duckte sich und versuchte, sich zwischen Matteo und die Wand zu drücken, doch der ließ das nicht zu. Er zog das schreiende Mädchen vor sich und legte ihr den kräftigen Arm um den Hals.
»Was willst du?«, krächzte er.
Steele musterte ihn angeekelt. Das Mädchen als Schutzschild zu benutzen. Kein Mann machte so etwas.
»Das Mädchen«, erwiderte Steele ruhig. »Von dir wollen wir nichts. Rück sie raus, und wir lassen dich in Frieden.«
Misstrauisch kniff Garza die Augen zusammen. Dann schaute er höhnisch Christina an.
»Hast du das angeleiert?«, knurrte er ihr ins Ohr.
»Nein!«, quiekte sie. »Matteo, ich habe keine Ahnung, wer dieser Kerl ist. Das musst du mir glauben.«
»Ihre Eltern haben mich geschickt«, sagte Steele. »Jetzt lass sie gehen, dann bist du mich los. Solltest du nicht kooperieren, nehme ich dich auseinander. Die Entscheidung liegt bei dir.«
Garza gab Christina einen Stoß, sodass sie auf Steele zutaumelte. Blitzschnell schwang der das Gewehr über die Schulter, damit er sie auffangen konnte, allerdings mit dem verletzten Arm. Der Schmerz schoss ihm durch alle Muskeln.
Dennoch achtete er darauf, die Pistole weiterhin auf Garza zu richten, während er die sich windende, protestierende Frau an sich riss.
»Lass mich los«, schrie die Kleine. »Ich will nicht weg. Ich bin hier glücklich. Matteo, du lässt doch nicht zu, dass er mich einfach mitnimmt, oder?«
Sie wirkte verletzt und verwirrt. Garza hingegen zeigte keinerlei Gefühlsregung.
»Nimm die puta mit«, spuckte er schließlich aus. »Die interessiert mich einen Dreck.«
»Lügner«, kreischte Christina. »Du hast gesagt, dass du mich liebst. Du hast gesagt, du willst für immer mit mir zusammen sein.«
Die Frau wehrte sich mit Händen und Füßen gegen Steeles Griff, der sich nur umso fester um sie schloss. Verfluchter Mist! Sein Arm tat ihm verteufelt weh. Er wusste noch immer nicht, wie schwer die Verletzung war.
»Dolphin, schieb gefälligst deinen Arsch hier rauf. Erster Stock. Zutritt über Balkon. Im Laufschritt«, rief er ins Mikrofon.
»Schon unterwegs«, meldete sich Dolphin.
Steele wich zur Tür zurück und drehte sich dabei so, dass er sowohl die Zimmertür als auch Garza im Blick behielt. Als der Mann sich bewegte, blieb Steele sofort stehen und richtete die Waffe auf ihn.
»Keine Dummheiten«, warnte Steele ihn. »Ich habe, was ich wollte. Dich umzulegen liegt nicht in meinem Interesse. Gib mir keinen Anlass, meine Meinung zu ändern.«
»Die puta kann mir gestohlen bleiben«, erwiderte Garza bissig. »Aber dass du bei mir eingedrungen bist und meine Leute umgebracht hast, das lasse ich mir nicht bieten.«
»Tu dir den Gefallen und vergiss deinen Stolz«, fuhr ihm Steele über den Mund. »Mach mir keine Schwierigkeiten, sonst wird es dir leidtun.«
Garza bebte vor Wut wegen dieser Demütigung.
Dolphin kam die Treppe hochgerannt, und in dem Moment trat Christina mit dem spitzen Absatz zu und traf Steele genau ins Knie. Sie fuhr wie eine Wildkatze herum, stach mit ihren Fingernägeln in Richtung seiner Augen und wich anschließend zurück.
Steele war gezwungen, sie loszulassen, sonst hätte er sie vermutlich verletzt. Als sie zu Garza hinlief, zog der Blödmann eine Pistole und zielte auf Steele. Christina wirbelte herum und sah, wie Dolphin eine Waffe auf Garza richtete. Sie übertraf Garzas Dummheit, überhaupt eine Waffe zu ziehen, noch und warf sich schützend vor ihn. Und zwar genau in dem Moment, als Dolphin abdrückte.
Vor Schmerz schrie sie auf, Garza wurde gegen die Wand geschleudert, aus seiner Brust sprudelte Blut. Christina wurde kreidebleich und taumelte kurz umher, ehe sie das Bewusstsein verlor und zu Boden fiel, Garza direkt vor die Füße.
»So eine Scheiße«, fluchte Dolphin. »Was hat sie sich bloß dabei gedacht?«
Steele rannte zu ihr hin und drehte sie auf den Rücken. Als er sie mit den Fingern abtastete, blieb Blut an seiner Hand kleben. Es war nur ein Kratzer. Gott sei Dank. Ihre Eltern würden nicht sehr begeistert sein, wenn ihre Tochter dank KGI mit einem Einschussloch nach Hause kam.
Dolphin kauerte sich neben Steele hin und fühlte Garzas Puls.
»Die Zeit für unseren Rückzug ist hiermit knapper geworden«, sagte er grimmig. »Garza ist tot. Die Polizei in der Gegend steckt mit ihm unter einer Decke. Die Kacke ist voll am Dampfen. P. J. und Cole haben alles im Griff und schalten reihenweise Arschlöcher aus. Baker und Renshaw haben die Rückseite mit Sprengstoff gepflastert. Vorne können wir nicht mehr raus. Wir haben drei Minuten, bis das Zeug hochgeht, dann müssen wir so schnell wie möglich von hier weg, Boss.«
»Sie wollte nicht mitkommen«, sagte Steele kopfschüttelnd. »Er hat sich einen Scheiß für sie interessiert und sogar versucht, sie als Schutzschild zu missbrauchen.«
»Was für ein Arsch«, sagte Dolphin angewidert.
»Allerdings, und trotzdem hat sie sich seinetwegen in die Schussbahn geworfen.«
Dolphin schaute Steele an und runzelte die Stirn. »Du blutest ja. Was ist passiert?«
»Messerattacke«, antwortete Steele kurz angebunden. »Schnapp dir das Mädchen. Du wirst sie tragen müssen. Ich gebe euch Deckung.«
»Scheiße auch, so können wir sie nicht zu Hause abliefern. Ihre Eltern kriegen die Krise.«
Steele seufzte. Sie hatten es nicht weit zu Maren Scofield. Unangemeldet bei der blonden Ärztin auftauchen war allerdings das Letzte, das er wollte.
Sie machte ihn nervös, irritierte ihn. Jedes Mal, wenn er sie sah, kribbelte alles. Als kröchen Ameisen unter seiner Haut auf dem Weg ins Freie.
»Sobald wir beim Hubschrauber sind«, stieß er hervor, »gibst du dem Piloten Bescheid, dass wir einen außerplanmäßigen Zwischenstopp machen.«
Dolphin schlang sich das Gewehr über die Schulter, schob die Pistole in das Holster und hob vorsichtig die ohnmächtige Frau hoch.
»Bleib dicht bei mir«, befahl Steele. »Wenn irgendwas ist, wirf dich zu Boden. Spiel nicht den Helden, solange du das Mädchen trägst. Wenn sie stirbt, sind wir am Arsch. Ich habe noch nie eine Zielperson verloren und werde jetzt ganz bestimmt nicht damit anfangen.«
»Aye, aye, Käpt’n.«
Steele verdrehte angesichts Dolphins Respektlosigkeit die Augen. Neu war dessen Einstellung nicht, und Steele würde lieber sterben als zugeben, dass ihm Dolphins Haltung und seine Fähigkeit, so gut wie jede Situation mit seinem verschrobenen Humor zu entschärfen, sehr gefielen. Steele wurde von seinem Team ständig wegen seiner Humorlosigkeit aufgezogen, aber wozu brauchte er Humor, wo er doch Dolphin, P. J. und Cole hatte? Die drei führten sich eher wie eine Zirkustruppe auf als wie ein militärisches Einsatzkommando. Aber sie erledigten ihre Jobs, und das war alles, was in seinen Augen zählte.
Sie mussten sich tagtäglich mit Dingen herumschlagen, die andere sich nicht einmal in ihren schlimmsten Fantasien ausmalen konnten. Wenn das ihre Art war, damit umzugehen und bei Verstand zu bleiben, waren ihm ihre Faxen recht. Auch wenn sie ihn bewusst in Rage brachten.
Er übernahm die Führung und trat auf den Balkon hinaus, ging dort sofort in Deckung und gab Dolphin ein Zeichen, es ihm gleichzutun. Dann suchte er die Umgebung nach möglichen Gefahren ab.
»Neun Uhr«, sagte er. »Runter mit dir.«
Steele hob die Waffe und zielte zwischen den Stäben des Geländers hindurch, drückte zwei Mal ab und erledigte zwei Männer, die die Veranda beim Pool durchquerten. Dann scheuchte er Dolphin hoch, und beide eilten die Treppe hinunter.
»Status«, rief er in sein Mikrofon. »Dolphin und ich kommen auf der Rückseite raus. Haben Zielperson. Brauchen Deckung. Schießt Weg frei und zwar ein bisschen plötzlich.«
»Sind dir längst voraus, Boss«, antwortete Baker. »P. J. und Cole haben das Haus gesichert. Renshaw und ich haben Position am hinteren Tor. Bereit für Sprengung. Lass uns dreißig Sekunden. Haltet Position, bis alles in die Luft fliegt.«
Steele und Dolphin duckten sich und schirmten mit den Körpern die Frau ab. Langsam krochen sie zum Ende der Stufen und nutzten die Hauswand als Schutz vor den Trümmern, die nach der Explosion angeflogen kämen.
Wie versprochen erfolgte ein gigantischer Knall. Der Boden erzitterte, und Metallteile und Steinbrocken regneten wie ein Hagelschauer auf sie herab.
»Mann, die wissen, wie man so einen Bau in Schutt und Asche legt«, murmelte Dolphin. »Sie haben es wohl ein bisschen mit dem C-4 übertrieben.«
»Meinst du?«, entgegnete Steele trocken. »Los jetzt.«
Hustend rannten sie durch die Wolke aus Staub und pulverisiertem Beton auf das Loch in der Mauer zu, die den Poolbereich umgab.
»Ich hoffe bloß, die anderen sind bereits in Position, damit wir auf der Stelle verschwinden können«, zischte Steele.
»Mach dir nicht in die Hose«, meldete sich P. J. »Wir sind ja schon dabei.«
Steele schüttelte den Kopf. Temperamentvolle Frau. Wenigstens das hatte sich nicht geändert. Gott sei Dank. Sie war wieder da, wo sie hingehörte. Er hatte sich nie darüber geäußert – diese Art Geringschätzung oder mangelndes Vertrauen in ihre Fähigkeit würde er ihr niemals zumuten –, aber der Rachefeldzug, auf den sie sich allein begeben hatte, war für ihn durchaus Anlass zur Sorge gewesen. Abgesehen davon, dass sie sich von vielen Verletzungen hatte erholen müssen, waren ihre emotionalen und psychischen Traumata enorm. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sie ein paar Monate länger beurlaubt. Doch davon hatte sie nichts wissen wollen, und wenn er sie aus dem Team genommen hätte, wäre er gleichzeitig Cole losgeworden. Eine Operation mit zwei Leuten weniger hätte er keinesfalls in Angriff genommen.
»Freut mich, dich alten Griesgram wieder dabeizuhaben«, sagte Steele in einem untypischen Anfall von Humor.
Im Funkgerät herrschte völlige Stille. Dann: »Heiliges Kanonenrohr, hat er tatsächlich gerade einen Witz gemacht?«, fragte Baker perplex.
»He, sie heißt jetzt Coletrane«, beschwerte sich Cole. »Sie hat mich geheiratet. Schon vergessen? Im Pass steht jetzt jedenfalls Penelope Jane Coletrane.«
»Wenn ich dich in die Finger kriege, kannst du was erleben«, funkte P. J. dazwischen.
»Penelope Jane?«
Steele konnte nicht unterscheiden, wer das gesagt hatte, weil es mehrstimmig aus seinem Kopfhörer klang, sofort gefolgt von Gejohle, Gelächter und Sticheleien. Herr im Himmel. Sie waren noch nicht einmal aus dem Gröbsten heraus, und sein komplettes Team führte sich auf, als säßen sie gemütlich in einer Bar.
»Jetzt haltet alle endlich die Klappe und rückt zum Treffpunkt mit dem Hubschrauber vor«, schnauzte Steele sie an. »Zanken könnt ihr euch später.«
Er gab beim Laufen ein rasches Tempo vor, achtete aber auch darauf, dass Dolphin samt seiner Last direkt bei ihm blieb, damit er die beiden abschirmen konnte. Baker und Renshaw schlossen sich ihnen an und nahmen Dolphin in die Mitte.
Bakers Gesicht war blutüberströmt. Regelmäßig fielen Tropfen zu Boden und hinterließen eine gut sichtbare Spur.
»Wie schlimm ist es?«, rief Steele Baker zu, ohne die Umgebung aus den Augen zu lassen.
»Ich blute wie ein Schwein. Keine Ahnung«, schnauzte Baker zurück. »Im Moment spüre ich nichts, dafür klingelt es in meinen Ohren wie verrückt.«
»Ich habe dem Blödmann gesagt, er soll weiter zurückgehen«, murmelte Renshaw. »Ich hatte keine Zeit, die richtige Menge Sprengstoff genau zu berechnen, da habe ich mehr angebracht, als vermutlich nötig gewesen wäre.«
Steele fluchte. Schon wieder ein Mann außer Gefecht, nachdem er sein Team gerade erst wieder vollständig beisammen hatte. Die beiden Monate Anfängertraining hatten ihn zu Tode gelangweilt. Mehr davon brauchte er wirklich nicht.
»Wir machen einen Zwischenstopp bei Dr. Scofield. Sie kann dich und die Frau untersuchen. Wir müssen sicher sein, dass es nichts Ernstes ist, danach sehen wir zu, dass wir nach Hause kommen und den Gehaltsscheck abholen.«
Renshaw schloss zu Steele auf und schaute kurz auf dessen Arm. »Dich kann sie gleich mit untersuchen, Boss. Sieht aus, als hättest du auch ein Wehwehchen.«
»Mir fehlt nichts«, murmelte Steele unwillig.
Renshaw zuckte mit den Schultern. »Tja, wenn du dich von der hübschen Ärztin nicht durchchecken lassen willst – selbst schuld. Baker hat da bestimmt nichts dagegen.«
Steele warf ihm einen Blick zu, der seinen Teamkollegen umgehend zum Schweigen brachte. Wenn dieses verdammte Mädchen sich nicht vor eine Kugel geworfen hätte, noch dazu wegen eines Arschlochs, das sich einen Dreck um sie scherte, wäre ein Treffen mit Dr. Scofield gar nicht nötig gewesen. Und jetzt musste er sich auch noch um Baker Sorgen machen.
Er richtete den Blick auf ihn, aber Baker schüttelte den Kopf. Blut lief ihm über die Wange und tropfte auf den Boden. Offensichtlich hatte er etwas Probleme mit der Orientierung, ansonsten schien ihm aber nichts Gravierendes zu fehlen. Das hieß natürlich nicht, dass er keine Gehirnerschütterung oder eine innere Verletzung erlitten hatte, aber Steele blieb optimistisch, dass es sich lediglich um ein paar Schnitte und Kratzer handelte und Baker nicht krankgeschrieben werden musste.
Ausfallzeiten hatte Steele mittlerweile mehr als genug. Er war scharf auf Aufträge, am liebsten mit seinem kompletten Team.
Sie brachen durch dichtes Unterholz auf eine Lichtung, wo der Hubschrauber auf sie wartete. P. J. und Cole waren bereits da. P. J. starrte finster drein, und Cole grinste. In P. J.s Nähe tat er kaum noch etwas anderes. Während er sich früher strikt professionell ihr gegenüber verhalten hatte, war seit der Heirat von dieser emotionalen Distanz bei ihren Missionen nicht mehr viel zu spüren.
Steele verkniff sich das Lächeln. Sonst würden die beiden noch glauben, er sei übergeschnappt. Immerhin sorgten sie in angespannten Situationen regelmäßig für ein befreiendes Lachen durch ihre komischen Einlagen.
»Alle rein und nichts wie weg«, rief Cole. »Wir sind startklar.«
»Ich funke den Jetpiloten an und gebe ihm Bescheid, dass wir uns verspäten«, sagte Renshaw. »Mit dem Hubschrauber können wir ganz in der Nähe von Marens Dorf landen.«
Steele nickte.
»Was ist denn mit dir passiert, Baker?«, fragte P. J.
»Sprengstoff«, murmelte dieser, während er ein Ohr betastete und drückte, als wolle er etwas herausschütteln.
»Das erklärt alles«, sagte P. J.
Dolphin, der das Mädchen trug, ging voraus. P. J. riss die Augen auf. »Will ich das überhaupt wissen?«
»Nein«, antwortete Steele kurz und knapp. »Rein jetzt alle, damit wir endlich abhauen können.«
2
Maren Scofield tätschelte das Kind, drückte Watte auf die Stelle am Arm, wo sie Blut entnommen hatte, und lächelte es aufmunternd an. Sie nickte, als die Eltern sich bedankten, und gab ihnen Ratschläge mit auf den Weg, wie sie es zu Hause weiter versorgen sollten.
Als die drei die Klinik endlich verließen, streckte Maren seufzend ihren schmerzenden Rücken durch. Es war ein langer Tag gewesen. Schon bei Sonnenaufgang hatte der erste Patient an ihrer Haustür geklopft. Die Bewohner des Dorfes wussten natürlich, wo sie sie finden konnten, wenn die Klinik geschlossen war, und sie zögerten auch nicht, sie dort wegen aller möglichen Krankheiten und Verletzungen aufzusuchen.
Ein Arbeiter hatte sich den Arm gebrochen und war zu ihr gekommen. So hatte der Tag begonnen. Und genau so war er dann in der Klinik auch weitergegangen. Eine lange Schlange von Patienten hatte sich erst langsam aufgelöst, als die Sonne schon wieder unterging.
Müde schleppte Maren sich auf den Ausgang zu, um den kurzen Heimweg anzutreten. Sie konnte es kaum erwarten, sich eine heiße Tasse Tee zu machen und eine Weile die Beine hochzulegen. Nachdem sie überprüft hatte, dass die Untersuchungszimmer und die Räume mit dem tragbaren Röntgengerät und anderen teuren Geräten abgesperrt waren – nicht dass die Schlösser einen Einbrecher abgehalten hätten –, war sie nun bereit, das Gebäude zu verlassen.
Zwei Mal schon war ihre Ausrüstung gestohlen und die Klinik verwüstet worden. Gott sei Dank wurde sie von ihren Eltern und ihrem Bruder tatkräftig unterstützt. Beide Male hatten sie sich dafür eingesetzt, dass ihr neue Geräte gespendet wurden.
Kein Wunder – schließlich waren ihre Eltern und ihr Bruder ebenfalls Ärzte und verstanden, worum es ihr ging. Ihren Drang, Unterprivilegierten, die Hilfe benötigten, medizinische Versorgung zu geben. Ihre Eltern waren deswegen auch um den Globus gereist, ehe ihr Bruder und sie auf die Welt gekommen waren. Die ersten Jahre ihrer Kindheit hatten ihre Mom und ihr Dad dann in den Staaten verbracht und als Hausärzte gearbeitet. Aber als sie und Kevin, ihr älterer Bruder, den Strampelhosen entwachsen waren, hatten ihre Eltern sie gepackt und sich erneut aufgemacht, um in entlegenen Gegenden bedürftige Menschen zu versorgen.
Ihre Kindheit war abwechslungsreich und alles andere als langweilig gewesen.
Mittlerweile waren ihre Eltern in Rente, lebten in Florida und vergnügten sich mit Einkaufstouren und Golfspielen. Einmal pro Jahr kamen die beiden zu Besuch nach Costa Rica, und Maren versuchte ebenfalls, sie ab und zu in Florida zu besuchen. Sie skypten regelmäßig und sandten sich wöchentlich E-Mails. Ihr Bruder war momentan im Auslandseinsatz in Saudi-Arabien. Ein Jahr schon hatte sie ihn nicht mehr gesehen, und er fehlte ihr.
Sie waren nur zwei Jahre auseinander und hatten immer ein enges Verhältnis zueinander gehabt. Ihre ganze Kindheit hindurch waren sie nie lange genug an einem Ort geblieben, um Wurzeln zu schlagen und Freundschaften zu schließen. Das hatte sie zusammengeschweißt.
Nach der Tasse Tee würde sie Kevin und ihren Eltern eine E-Mail schreiben. Vielleicht lag es an der Müdigkeit oder einfach an ihrer Stimmung, aber sie verspürte Heimweh. Ein wenig Ruhe und Kontakt zur Familie würden das im Nullkommanichts beheben.
Als sie die Tür öffnete, um die Klinik zu verlassen, sah sie sich plötzlich einer riesigen Gestalt gegenüber. Instinktiv trat sie zurück. Ihr stockte der Atem, und ihr Puls beschleunigte sich rasant. Sie wollte die Tür zuschlagen, obwohl sie wusste, dass die keinen echten Schutz bot, wenn tatsächlich jemand eindringen wollte.
Ein Stiefel schoss vor und blockierte die Tür.
Panik erfasste sie. Sie schaute sich nach einer möglichen Waffe um, nach etwas, mit dem sie sich verteidigen konnte.
Ein großer Mann, breit wie ein Schrank, kam herein und hob die Hände, um sie zu beruhigen.
»Señorita, ich will Ihnen nichts Böses antun. Ich bin gekommen, um Ihnen was von Javier Mendoza auszurichten.«
Maren kniff die Augen zusammen und wich vorsichtshalber einen weiteren Schritt zurück. Javier Mendoza war, freundlich ausgedrückt, eine zwielichtige Figur. Die Einheimischen fürchteten ihn, wagten aber nicht, unhöflich zu sein. Er wurde von allen, einschließlich La Fuerza Pública, der Polizei, umschmeichelt, besänftigt und auf jede andere erdenkliche Weise beschwichtigt.
Ihr Misstrauen wurde lediglich gespeist von zufällig aufgeschnapptem Klatsch und Spekulationen. Wenn sein Name genannt wurde, dann nur geflüstert, als hätten die Leute Angst, er könne plötzlich wie aus dem Nichts auftauchen.
Näheres wusste Maren nicht über den Mann, aber sie wusste, dass es nichts Gutes bedeuten konnte, wenn er zu dieser späten Stunde jemanden zu ihr geschickt hatte.
»Ich schließe die Klinik gerade«, sagte sie und bemühte sich um einen geschäftsmäßigen, forschen Tonfall. »Es ist ein langer Tag gewesen. Morgen früh stehe ich wieder zur Verfügung.«
Der Mann lächelte, was sie keineswegs beruhigte.
»Es handelt sich nicht um ein gesundheitliches Problem, señorita. Señor Mendoza würde Sie gern zu sich nach Hause zum Abendessen einladen. Er weiß, dass sie heute sehr lange gearbeitet haben, und bietet Ihnen seine Gastfreundschaft an.«
Obwohl er mit Akzent sprach, war sein Englisch tadellos. Jedes Wort war sorgfältig gewählt. Er sah wie ein Straßenschläger aus, redete aber wie ein Gentleman. Ihr lief es eiskalt über den Rücken.
»Bitte übermitteln Sie Señor Mendoza mein Bedauern«, sagte sie mit fester Stimme. »Ich danke für die Einladung, aber ich bin sehr müde und möchte nur noch nach Hause, damit ich mich ausruhen kann. Mein Tag beginnt ziemlich früh und dauert, wie Sie sehen können, sehr lang.«
Der Laufbursche – oder eher: Laufhüne – schien nicht erfreut über ihre Absage, deshalb fügte sie rasch hinzu: »Vielleicht ein andermal.«
Nicht, dass sie auch nur die geringste Absicht gehabt hätte, dieser Einladung je Folge zu leisten. Aber wenn sie diesen geschliffen daherredenden Neandertaler auf diese Weise aus dem Weg schaffen konnte, würde sie ihm so gut wie alles auftischen.
Er verzog das Gesicht, trat jedoch, zu ihrer Erleichterung, den Rückzug an. An der Tür drehte er sich noch einmal um und blickte sie an.
»Ich werde Señor Mendoza von Ihrer Weigerung in Kenntnis setzen.«
Die unterschwellige Drohung ließ Maren verstummen. Sie fror plötzlich und hatte Mühe zu atmen. Wie erstarrt blieb sie stehen, während der Mann in die Nacht verschwand und sie allein in der stillen Klinik zurückblieb.
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich erholt und den Lähmungszustand überwunden hatte. Zögernd trat sie ins Freie und schloss die Tür hinter sich. Nervös schaute sie nach links und rechts, weil sie irgendwie das Gefühl nicht loswurde, dass Mendoza, wie die Einheimischen glaubten, aus dem Nichts erscheinen könne.
Schließlich schüttelte sie den Kopf. Was war sie doch für eine Idiotin. Sie hatte sich schon in weit gefährlicheren Situationen befunden. Zum Beispiel in Afrika. Dank Sam Kelly und KGI war sie unversehrt davongekommen, wofür ihre Eltern und ihr Bruder ausgesprochen dankbar waren. Im weitesten Sinn waren sie dafür verantwortlich, dass sie nicht dorthin zurückgekehrt war. Sie hatten Maren angefleht, sie möge sich einen sichereren Ort suchen.
Jetzt fragte sie sich, wie viel sicherer Costa Rica war.
Seufzend machte sie sich auf den kurzen Weg zu ihrem Häuschen, während sie Lockerungsübungen gegen die Verspannungen in ihren Schultern und dem Nacken machte. Es war schwül, die Abendluft trieb ihr Blumenduft in die Nase. Die Blumen blühten bei der Klinik und ihrem Haus wie verrückt, dank der Einheimischen, die sie quasi adoptiert hatten und ihr bei der Pflege halfen.
Beim Gedanken, dass ihr die Frauen Essen brachten, musste Maren lächeln. Die Männer kamen regelmäßig vorbei und erkundigten sich, ob es etwas zu reparieren gab. Viele ihrer Patienten hatten kein Geld, um für die Behandlung zu zahlen. Daher suchten sie nach anderen Möglichkeiten, sie für ihre Dienste zu entlohnen. Die Menschen hier akzeptierten, mochten und achteten sie. Und bis heute Abend hatte sie keinen Grund gehabt, sich zu fürchten.
Mendoza hatte nie das geringste Interesse an ihr gezeigt, dabei lebte sie bereits vier Jahre hier. Was hatte sich geändert? Dass er ihre Anwesenheit bis heute nicht mitbekommen hatte, daran glaubte sie keine Sekunde. Dem entging garantiert nichts. Er kannte mit Sicherheit alles und jeden im gesamten Bereich, in dem er seinen Geschäften nachging. Was für Geschäfte das auch immer sein mochten …
Sie sperrte die Tür zu ihrer winzigen Behausung auf, schloss sie hinter sich und sperrte ab. Auch hier war ihr bewusst, dass das Schloss niemanden abhalten würde, der entschlossen war einzudringen. Zumindest vermittelte es ihr aber ein gewisses Gefühl von Sicherheit.
Im Haus herrschte ziemliche Unordnung. Sie war keine Reinlichkeitsfanatikerin, und für nebensächliche Dinge blieb ihr kaum Zeit. Ihre ganze Konzentration galt der Arbeit; der Rest musste irgendwie nebenbei funktionieren.
Ihr Zuhause war klein, aber gemütlich. Tagsüber schien die Sonne durch die vielen Fenster und tauchte die Zimmer in freundliches Licht. Ihre Pflanzen gediehen prächtig, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wie sie ihre Nachlässigkeit überlebten.
Sie nahm die Brille ab und legte das Stethoskop auf das Kaffeetischchen. Dann schlurfte sie in die Küche und setzte Wasser für den Tee auf. Sie musste etwas essen, hatte aber keinen rechten Appetit, und die Vorstellung, sich etwas zubereiten zu müssen, überforderte sie.
Tee und Kekse reichten völlig. Danach würde sie sich ins Bett legen und hoffentlich früh einschlafen.
Plötzlich schreckte Maren auf, noch ganz benebelt. Verwirrt schaute sie sich um. Es dauerte eine Weile, bis sie sich zurechtfand. Auf dem Kaffeetisch entdeckte sie die noch halb volle Tasse Tee und die Schachtel Kekse, die sie kaum angerührt hatte.
Nicht lange, nachdem sie sich auf die Couch gesetzt hatte, war sie offenbar eingedöst. Nicht einmal den Tee hatte sie ausgetrunken.
Erneut klopfte es an der Tür. Als ihr dämmerte, was sie geweckt hatte, fuhr sie herum. Jemand stand draußen.
Sie tastete nach ihrer Brille, schob sie sich auf die Nase und schaute auf die Uhr. Sie runzelte die Stirn. Es war fast Mitternacht.
Sie stand auf und ging zur Tür. Es war nicht unüblich, dass sie bei Notfällen aus dem Bett geholt wurde, heute Nacht aber war sie wegen des unerwarteten Besuchs und der Einladung von Javier Mendoza nervös.
Sie wischte sich über das Gesicht, um den letzten Rest Schlaf zu vertreiben, dann öffnete sie vorsichtig die Tür einen Spalt und spähte hinaus.
»Dr. Scofield?«
Überrascht versuchte sie, die Gestalt ihr gegenüber einzuordnen. Die Stimme kannte sie. Oft hatte sie sie noch nicht gehört, da der Mann kaum jemals sprach. Aber den Klang hatte sie gespeichert.
»Steele«, murmelte sie.
Dann riss sie die Tür auf, trat hinaus und sah sich suchend nach den anderen um. Wenn es um KGI ging, gab es immer »andere«. Sie hatte die Jahre über schon zahlreiche Mitglieder dieser Elitegruppe zusammengeflickt, aber das war auch in Ordnung so. Es war ihre Art, ihnen zu danken, dass sie noch am Leben war und als Ärztin praktizieren konnte.
»Wir haben ein Problem«, sagte Steele und holte sie barsch in die Gegenwart zurück.
»Natürlich.«
Er schwieg einen Moment, und sie hätte schwören können, dass er aus irgendeinem Grund leicht unruhig war, doch es war zu dunkel, um seinen Gesichtsausdruck zu erkennen.
»Wir haben eine junge Frau geborgen. Sie ist verletzt. Baker ist ebenfalls verletzt. Wie schwer, kann ich nicht sagen. Er hat es mit ein bisschen Sprengstoff aufgenommen.«
»Dann ist es ja kein Wunder«, murmelte sie.
»Könnten Sie sich die beiden mal anschauen?«, fragte er ungeduldig.
Sie gewann den Eindruck, schon ihre bloße Anwesenheit beleidige ihn. Jedes Mal, wenn sie sich begegnet waren, hatte er sie behandelt, als wäre sie Luft. Das hier war das erste Mal, dass er sie direkt angesprochen hatte. Ansonsten war er immer in Begleitung der Kellys hier aufgetaucht, dann hatten Sam und Garrett das Reden übernommen.
Eigentlich schade, denn der Mann faszinierte sie in gewisser Weise. Vielleicht lag es daran, dass er sich so distanziert gab. Vielleicht reizte sie gerade das an ihm.
»Gehen Sie schon mal zur Klinik vor. In einer Minute komme ich nach«, antwortete Maren.
Schon war Steele verschwunden, mit der Dunkelheit verschmolzen, und ließ sie verblüfft an der Tür zurück. Kopfschüttelnd kehrte sie in ihr Haus zurück, um das Stethoskop und den restlichen Tee zu holen. Letzteren konnte sie in der Klinik aufwärmen. Sie würde ihn brauchen. Dies würde eine lange Nacht werden.
3
Es überraschte Maren nicht im Geringsten, dass sich Steeles Team überall breitgemacht hatte, als sie in ihre Klinik kam. P. J. und Cole saßen in dem kleinen »Wartebereich«, die Gewehre zwischen den Knien, die Läufe nach oben gerichtet. Cole lächelte Maren freundlich an, und P. J. rief leise Hallo.
»Ist das schön, Sie zu sehen, P. J.«, sagte Maren aufrichtig.
Ein Schatten huschte über P. J.s Gesicht, obwohl sie den Gruß erwiderte. Maren beschloss, erst mal nicht nachzuhaken. Sie begrüßte die anderen und ging weiter, am Wartebereich vorbei den Gang entlang zu den kleinen Behandlungszimmern.
Im ersten Raum stand Baker über das Waschbecken gebeugt. Renshaw reichte ihm gerade Handtücher, damit er sich das Blut aus dem Gesicht schrubben konnte.
»Lassen Sie das schön bleiben«, rief Maren von der Tür her. »Ich sehe es mir lieber erst mal an, bevor Sie alles noch schlimmer machen.«
Baker drehte sich um und schnitt eine Grimasse, und beim Anblick der bereits lila angelaufenen Schwellungen an Kiefer, Kinn und den beiden Augen zuckte Maren zusammen. Sie stieß einen leisen Pfiff aus. »Wenn Sie was in die Luft jagen, dann aber gründlich, wie?«
Renshaw gluckste und schlug Baker auf die Schulter. »Ich wette, das passiert ihm nicht noch mal.«
»Halt bloß dein blödes Maul!«, murmelte Baker.
Dann blickte er zu Maren hoch. »Kümmern Sie sich erst mal um das Mädchen. Mir fehlt weiter nichts.«
Maren nickte und ging zum nächsten Raum, wo Dolphin gerade ein leise vor sich hin schluchzendes Mädchen tröstete. Steele stand mit versteinerter Miene und verschränkten Armen am Kopfende des Bettes. Maren konnte gut verstehen, dass die junge Frau so aufgewühlt war, und Steele machte die ganze Sache nicht besser. Die Frau dachte vermutlich, dass sie vom Regen in die Traufe geraten war, als die Jungs von KGI sie gerettet hatten. Falls sie zu dem Zeitpunkt überhaupt geglaubt hatte, gerettet worden zu sein.
Ja, Steele war mal wieder ganz er selbst, dachte Maren. Was würde sie nicht darum geben, ihn ein Mal aus der Ruhe zu bringen. Nur ein einziges Mal. Sie fragte sich, ob ihn überhaupt irgendetwas jemals erschütterte. Überrumpelte. Oder überraschte.
Sie hatte von Sam das eine oder andere darüber gehört, was P. J. durchgemacht hatte. Offenbar hatte P. J. sich daraufhin vom Team abgesetzt, was bei Steele und den anderen gar nicht gut angekommen war. Sam hatte angedeutet, dass Steele ganz uncharakteristische Gefühlsregungen gezeigt hatte. Um das zu sehen, würde sie glatt was zahlen.
Sie holte tief Luft, und genau in diesem Augenblick hob Steele den Kopf und sah sie an. Sein stechender Blick durchbohrte sie, sodass sie sich plötzlich nackt und verletzlich fühlte. Es war, als könne er direkt in sie hineinschauen. Das war ein dämlicher Gedanke. Und noch dämlicher war es, diesem Mann übermenschliche Kräfte zuzuschreiben. Er war auch bloß ein Mensch. Fehlbar. Sein selbstbewusstes Auftreten war allerdings verdammt überzeugend. Und was auch immer er war oder nicht war, er brachte es absolut glaubwürdig rüber, mit jedem Blick, jedem unausgesprochenen Wort. Mit jeder seiner Handlungen.
Ihre Schultern sackten herab, und sie hatte das Gefühl, kaum noch Luft zu bekommen, wenn er sie so anstarrte.
Sie riss sich zusammen, zog ihr Untersuchungslämpchen aus der Kitteltasche und trat an das Bett.
»Was ist passiert?«, fragte sie kurz angebunden.
Das Mädchen sah Maren nervös an und sank tiefer in die Kissen. Es zitterte am ganzen Leib, und in Maren regte sich Mitgefühl. Die Arme verlor vor lauter Angst fast den Verstand.
Sie nahm die Hand des Mädchens und drückte sie. »Jetzt wird alles gut. Versprochen. Diese Jungs hier sehen zwar Furcht einflößend aus, aber sie sind die Guten. Sie werden dich zurück nach Hause bringen, dorthin, wo du hingehörst.«
»Ich wollte Matteo nicht verlassen«, schniefte das Mädchen. »Sie haben mich dazu gezwungen.«
Steeles Miene wurde noch finsterer, und Dolphin seufzte.
»Sie hat versucht, eine Kugel abzufangen, die für jemand anderen bestimmt war.«
»Auch eine Methode«, stellte Maren trocken fest.
Als sie kurz zu Steele hochschaute, hätte sie schwören können, dass seine Mundwinkel ganz leicht zuckten. Beinahe so, als wäre der Mann doch tatsächlich kurz davor gewesen, zu lächeln. Das war ein derart absurder Gedanke, dass sie ihn umgehend als Einbildung abtat und die Aufmerksamkeit ihrer Patientin zuwandte.
»Nur ein Streifschuss«, fuhr Dolphin fort. »Aber sie ist umgekippt wie ein gefällter Baum. Ist gerade erst wieder zu sich gekommen.«
»Vielleicht lassen uns die Gentlemen einfach mal für einen Moment allein, damit ich sie untersuchen kann. Hier wie Axtmörder rumzulungern, ist nicht gerade hilfreich.«
Dolphin zuckte mit den Achseln. Steele schien zu zögern, bis Maren sich umdrehte und ihn niederstarrte. Schließlich gab er nach, und Dolphin und er zogen sich zurück, wenn auch nicht weiter als bis direkt vor die Tür.
»Also«, sagte Maren und wandte sich wieder dem Mädchen zu. »Wie heißt du?«
»Christina«, antwortete sie mit zittriger Stimme.
»Ich werde dich jetzt untersuchen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist.«
Dem Mädchen stiegen Tränen in die Augen. »Aber es ist überhaupt nichts in Ordnung, und das ist ganz allein deren Schuld. Matteo hat gesagt, er will mich nicht. Aber wie auch, wenn die mit ihren Waffen hereinplatzen und Leute abknallen. Jetzt wird er glauben, ich wäre hierfür verantwortlich. Ich liebe ihn und will einfach nur bei ihm sein.«
Maren wischte ihr eine Träne von der Wange. »Ich weiß, im Augenblick ist alles schrecklich. Aber wenn KGI damit beauftragt wurde, dich zu retten, dann war Matteo kein guter Mann. Du bist ohne ihn viel besser dran. Steele bringt dich zurück zu deinen Eltern. Und nach ein paar Wochen wirst du sehen, dass alles wieder in Ordnung kommt.«
»Er macht mir Angst«, murmelte sie.
Maren lachte. »Er macht jedem Angst. Aber er ist nicht halb so gefährlich, wie er aussieht. Er ist ein guter Mann, Christina. Der Allerbeste. Ich würde mich in jeder miesen Situation voll und ganz auf ihn verlassen.«
Christina beruhigte sich, sah aber nicht glücklich aus.
Maren unterzog sie einem schnellen Check-up, überprüfte ihren Puls und beide Pupillen. Abgesehen von dem Kratzer, wo die Kugel sie gestreift hatte, wies sie keinerlei Anzeichen weiterer Verletzungen auf. Maren konnte die Wunde nähen, aber für ein gebrochenes Herz konnte sie nichts tun. Das würde nur die Zeit heilen.
Doch die Jugend war zäh. Schätzungsweise würde Christina schon kurze Zeit nach der Rückkehr zu ihrer Familie wieder auf die Beine kommen und einsehen, dass ein Mann nicht der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens war und dass das Ende einer Beziehung nicht das Ende der Welt bedeutete.
»Das Nähen dauert nur ein paar Minuten, und dann gebe ich dir etwas, damit du ein bisschen zur Ruhe kommst.«
»Danke«, sagte Christina leise. »Sie sind wirklich nett.«
Maren lächelte. »Die anderen sind auch nett. Du hast sie eben bloß im Kommando-Modus erlebt. Sie würden jeden in Angst und Schrecken versetzen, wenn sie sich auf einen Einsatz konzentrieren.«
Maren vernähte zügig die Wunde und gab der jungen Frau dann eine Spritze gegen die Schmerzen, die es ihr zudem ermöglichen würde zu schlafen. Bereits wenige Augenblicke nach der Injektion begannen Christinas Augenlider zu flattern, und der Schlaf übermannte sie. Steele und Dolphin standen noch immer vor der Tür, als Maren in den Flur trat. »Sie wird wieder. Ich habe ihre Wunde genäht und ihr ein Antibiotikum verabreicht, damit sie keine Infektion bekommt. Sobald sie zu Hause ist, sollte sie zur Weiterbehandlung zu ihrem Arzt gehen. Der kann ihr dann auch die Fäden ziehen.«
Steele nickte, und als Maren den Blick senkte, bemerkte sie, dass er Blut am Arm hatte.
»Stammt das Blut von ihr oder von Ihnen?«, fragte sie leise.
Steele schaute kurz auf seinen Arm, dann sah er sie abweisend an. »Von mir.«
»Meinen Sie nicht, ich sollte mir das mal ansehen?«, fragte sie.
Er schüttelte den Kopf und blieb stumm. Sie seufzte. Was für ein sturköpfiger Idiot. Ganz offensichtlich verstieß es gegen seinen persönlichen Ehrenkodex, verletzt zu sein oder eine Auszeit zu brauchen.
»Verarzten Sie einfach nur Baker, damit wir hier wegkommen«, sagte Steele.
»Ich versuche, es nicht allzu persönlich zu nehmen, dass Sie mich möglichst schnell loswerden wollen«, erwiderte sie trocken.
Dolphin räusperte sich und trat verlegen von einem Bein aufs andere. Maren lächelte, um ihren Worten die Schärfe zu nehmen.
»Machen Sie es sich doch in Christinas Zimmer gemütlich und haben Sie ein Auge auf sie. Sie müsste eigentlich noch eine Weile schlafen, aber wenn sie wach wird, weiß sie vielleicht nicht, wo sie ist. Sie braucht ein freundliches Gesicht, und mit Steeles Gesicht ist in Sachen Freundlichkeit ja nun nicht gerade ein Blumentopf zu gewinnen. Ich schaue derweil bei Baker vorbei. Schließlich will ich seine Hoheit nicht aufhalten, wenn er was Besseres vorhat.«
Dolphin nickte. »Wird gemacht.«
Er warf Steele einen vorwurfsvollen Blick zu, was den allerdings nicht die Bohne juckte. Er starrte Maren weiterhin an, als ob er sich wünschte, sie bereits vor fünf Minuten von hinten gesehen zu haben. Sie holte tief Luft. Wem machte sie eigentlich etwas vor? Von als ob konnte hier wohl keine Rede sein.
Maren schüttelte den Kopf und ging zu dem Raum zurück, in dem Baker wartete. Er hockte auf der Untersuchungsliege. Renshaw, der an der Wand saß, schaute auf, als sie hereinkam.
»Okay, dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben«, sagte Maren mit munterer Stimme. »Wie wäre es, wenn Sie sich hinlegen würden, dann könnte ich mir nämlich Ihren Kopf anschauen.«
Behutsam tastete sie ihn ab, während Baker leise vor sich hin murrte und sich unter ihren Fingern wand, als sie die Wunden reinigte. Sie nähte zwei seiner Kopfverletzungen und verband den Rest.
»Morgen werden Sie sich richtig beschissen fühlen«, warnte sie, als sie fertig war.
»Ich fühle mich ja jetzt schon beschissen«, grollte er.
»Soll ich Ihnen ein Schmerzmittel spritzen?«
Er zögerte und schüttelte dann den Kopf. »Falls wir die Zelte heute Nacht noch abbrechen, muss ich voll da sein.«
»Hey, Baker«, sagte Cole, der an der Tür stand. »Nur zu deiner Info, wir hängen hier bis morgen früh um acht fest. Der Pilot hat sich gerade gemeldet. Es hat irgendwelche Probleme mit der Mechanik gegeben, sodass er heute Nacht nicht fliegen kann. Also lass dir ruhig eine Spritze verpassen. Maren, haben Sie was dagegen, wenn wir solange hier campieren?«
»Natürlich nicht. Mi casa es su casa. Oder vielmehr meine Klinik. Kann sein, dass Sie morgen früh Besuch bekommen. Die Einheimischen sind oft schon vor mir hier und warten darauf, dass ich aufmache. Erschießen Sie mir bloß niemanden, okay?«
Cole grinste. »Wir werden uns bemühen.«
Sie drehte sich wieder zu Baker um. »Was ist jetzt mit dieser Spritze? Die Ruhe würde Ihnen sicher guttun.«
Er seufzte ergeben, dann rollte er sich auf die Seite und drehte ihr den Hintern zu, während er gleichzeitig an seiner Uniformhose zerrte. Sie lachte. »Ich nehme das mal als ein Ja.«
Nachdem sie ihm das Schmerzmittel verabreicht hatte, sagte sie zu Renshaw: »Bei Ihnen ist alles in Ordnung? Gibt es irgendwas, das ich mir anschauen sollte?«
»Nein, Ma’am. Ich bin schlau genug, um einen Bogen um Sprengstoff zu machen.«
»Arschloch!«, knurrte Baker.
Sie lächelte. »Dann nehme ich mir mal Steeles Verletzungen vor. Wenn Sie nicht sofort weitermüssen, bleibt es ihm nicht erspart, dass ich ihn ebenfalls zusammenflicke.«
Renshaw schnaubte. »Na, dann viel Glück!«
Sie streckte ihren Kopf in den Behandlungsraum, in dem Dolphin und Steele noch immer um das Mädchen herumstanden. »Steele? Könnten Sie kurz mit nach nebenan kommen?«
Steele runzelte die Stirn – natürlich –, aber er nickte und folgte ihr in den nächsten Behandlungsraum. Sie suchte in den Schränken, bis sie alles beieinanderhatte, was sie brauchte.
»Was gibt’s?«, fragte er kurz angebunden.
Sie drehte sich zu ihm um und deutete auf die Untersuchungsliege. »Setzen Sie sich.«
Er sah sie stirnrunzelnd an.
»Hören Sie«, sagte sie entnervt. »Sie sind kein Übermensch, ganz gleich, was Sie uns gewöhnliche Sterbliche glauben machen möchten. Setzen Sie sich auf Ihre vier Buchstaben und lassen Sie mich einen Blick auf Ihre Verletzungen werfen. Cole hat gesagt, Sie hängen alle bis morgen früh um acht hier fest.«
Der Ausdruck auf Steeles Gesicht war unbezahlbar. Er sah allen Ernstes … überrumpelt aus. Sie hätte gern triumphierend in die Luft geboxt, wenn das nicht so unglaublich plump gewesen wäre. Also starrte sie ihn nur weiterhin seelenruhig an, ohne sich beirren zu lassen, während sie darauf wartete, dass er ihrer Aufforderung nachkam.
Er war es gewöhnt, Befehle zu erteilen, nicht, sie entgegenzunehmen, und sie musste zugeben, dass es ihr diebische Freude bereitete, die Oberhand zu haben.
Er warf ihr einen missmutigen Blick zu, dann ließ er sich auf die Liege plumpsen und zog sein Hemd aus, wobei er durchtrainierte Bauchmuskeln und einen breiten, muskulösen Oberkörper mit ein paar vereinzelten blonden Haaren auf der Brust entblößte. Ihre Hand zuckte, weil Maren gerne überprüft hätte, ob sie eventuell sabberte. Aber auch das wäre wieder viel zu offensichtlich gewesen.
»Bringen wie es hinter uns«, brummte er.
Sie bedachte ihn mit einem Blick, der ihm, wie sie wusste, nicht gefallen würde.
»Wozu die Eile? Cole hat gesagt, vor morgen früh um acht müssen Sie nirgendwohin.«
Sie strich ihm über den Arm bis hinauf zu dem Schnitt, aus dem noch immer Blut quoll. Seine Muskeln zuckten unter ihren Fingern, bevor sie sich verhärteten. Sie meinte, ein plötzliches Luftholen zu hören, aber vielleicht hatte sie sich das auch nur eingebildet.
»Nicht allzu schlimm«, murmelte sie. »Ein paar Stiche und etwas antibiotische Salbe. So schnell wird Ihnen der Arm nicht abfallen.«
»Sage ich doch«, entgegnete er. »Da braucht man kein großes Tamtam drum zu machen. Klatschen Sie einen Verband drauf, und gut ist es.«
Ihre Mundwinkel zuckten. »Ich fange an zu glauben, dass Sie mich nicht leiden können, Steele. Und ich frage mich warum? Niemand sonst von KGI scheint ein Problem mit mir zu haben. Sie schon, oder?«
Ihre Blicke trafen sich, und er kniff die Augen zusammen. »Ich habe nie behauptet, dass ich Sie nicht leiden kann.«
»Taten sagen mehr als Worte«, gab sie trocken zurück.
»Was zum Teufel soll diese Unterhaltung überhaupt?«, herrschte er sie an.
Sie zuckte mit den Schultern und machte sich dann daran, die Umgebung des Schnitts zu betäuben. Schweigend und konzentriert widmete sie sich ihrer Aufgabe, die Wunde zu vernähen. Nachdem sie den letzten Faden verknotet hatte, hob sie den Kopf und dehnte ihre verspannten Nackenmuskeln. Sie schob ihre Brille hoch und stieß einen kleinen Seufzer aus. So viel zu einem ruhigen Abend zu Hause, mit einer Tasse Tee und dem Plan, früh ins Bett zu gehen.
»Langer Tag?«, fragte Steele mitfühlend.
Überrascht hob sie den Blick. Er fing nie von sich aus eine Unterhaltung mit ihr an. Normalerweise schwieg er in ihrer Gegenwart eisern.
»Ja, aber da scheine ich ja nicht die Einzige zu sein.«
Er rutschte auf der Liege herum, als wolle er aufstehen. Ihr Blick wanderte nach unten und fiel auf die Erektion, die seine Armeehosen ausbeulte. Verblüfft riss sie die Augen auf, und als sie aufschaute, trafen sich ihre Blicke. Ertappt. Auf frischer Tat ertappt. Ihm war vollkommen klar, dass sie es mitbekommen hatte.
Sie trat einen Schritt zurück und erklärte hastig: »Es kommt vor, dass Männer, äh, nach einem Kampfeinsatz, eine durch das Adrenalin hervorgerufene Erektion bekommen. Das ist bereits dokumentiert worden. Ich bin mir sicher, es gibt tonnenweise wissenschaftliche Studien, die das untermauern.«
Oh Gott, sie klang wie eine komplette Idiotin. Ihre Wangen waren feuerrot, und eilig trat sie einen weiteren Schritt zurück.
Steeles Gesichtszüge verhärteten sich, und seine Lippen bildeten einen grimmigen Strich. Er sprang auf und beugte den Kopf gerade so weit hinunter, dass sich sein Mund direkt an ihrem Ohr befand.
»Wenn du glaubst, mein Ständer hat nichts mit dir zu tun, dann bist du auf dem Holzweg.«
Ihr klappte der Unterkiefer herunter. Steele drängte sich an ihr vorbei und marschierte aus dem Zimmer.
»Ohh-kay …«, murmelte sie.
Sie war bei diesem Mann ja auf einiges gefasst gewesen. Aber auf diese Äußerung nun wirklich nicht.
4
Maren schloss ihr Haus auf, schlüpfte hinein und machte leise die Tür hinter sich zu. Ihr Blick wanderte durch den Raum, und als sie Steele entdeckte, der sich auf ihrer winzigen Couch fläzte, schrie sie überrascht auf
»Verdammt, haben Sie mich erschreckt«, hauchte sie.
Er setzte sich auf und musterte sie eindringlich. Sie zitterte, und auf einmal hatte sie einen Kloß in der Kehle. Die Art, wie er sie ansah, war … anders.
»Gehen Sie immer ganz allein zu Ihrem Haus zurück?«, wollte er wissen.
Sie zog eine Augenbraue hoch. »Wie zum Kuckuck sollte ich wohl sonst nach Hause kommen?«
»Lassen Sie es mich anders formulieren. Von den Zeiten einmal abgesehen, wenn wir Sie mitten in der Nacht oder in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett holen, gehen Sie für gewöhnlich nach Einbruch der Dunkelheit allein zurück in ihr Haus?«
»Wissen Sie, ich glaube, so viele Worte am Stück haben Sie noch nie von sich gegeben«, sagte Maren nachdenklich.
Steele fuhr sich durch die Haare und knurrte. Knurrte im wahrsten Sinne des Wortes! Dann, zu ihrem Schrecken, kam er auf sie zu und zerrte sie an seine Brust. Es gab einen leisen Aufprall, als sie dort landete, und im nächsten Moment legte er ihr die eine Hand unter das Kinn und die andere in den Nacken, sodass sie sich nicht bewegen konnte. Als hätte sie das überhaupt gewollt!
»Steele?«, flüsterte sie nervös.
»Klappe«, murmelte er, gerade als seine Lippen auf ihre trafen.
Sein Kuss durchfuhr sie wie ein Stromstoß. Elektrisierend. Wild. Fordernd. Seine warme Zunge glitt samtweich über ihre Lippen, Einlass begehrend. Sobald sie nachgab, vertiefte er seinen Kuss, drängte in ihren Mund, schmeckte sie, ließ sie ihn schmecken.
Sie zitterte am ganzen Körper. Ein nicht enden wollendes Beben, das ihr die Knie weich werden ließ.
Sein Griff war stark und besitzergreifend. Sie stieß einen Seufzer aus, den er einfach verschluckte. Das hier war doch verrückt. Der helle Wahnsinn. Steele war in ihrem Wohnzimmer und küsste sie. Ein Mann, der noch niemals freiwillig das Wort an sie gerichtet hatte. Und doch fand er sie offensichtlich anziehend. Die Erektion von vorhin. Seine Küsse jetzt. Ja, irgendwas war da, ganz eindeutig, und sie hatte bestimmt nicht die Absicht, es allzu genau zu hinterfragen.
Oder er stieg nach einer Mission mit jeder x-beliebigen Frau in die Kiste, um wieder runterzukommen.
Der Gedanke versetzte ihrer Hochstimmung einen Dämpfer. Sie verhielt sich ganz still, während sie über diese durchaus wahrscheinliche Möglichkeit nachdachte. Nähe war definitiv ein Faktor. Steele und sein Team hatten gerade einen harten Auftrag hinter sich. Auf sie war geschossen worden, sie hatten Stichverletzungen und Gott weiß was sonst noch alles davongetragen. Sie saßen die Nacht über hier fest, und sie war ein halbwegs attraktives weibliches Wesen mit sämtlichen Attributen, die notwendig waren, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Er trat zurück und starrte sie fragend an.
»Stimmt was nicht?« Auf seiner Stirn hatte sich eine steile Falte gebildet
Sie hätte gelacht, war aber zu sehr aus der Bahn geworfen. Und so konnte sie nichts anderes tun, als ihn einfach nur anzustarren.
»Sie haben mich gerade geküsst und fragen mich, ob irgendwas nicht stimmt?«
Er runzelte die Stirn. »War es so schlecht?«
Dieses Mal lachte sie tatsächlich. »Ich glaube, Sie wissen, dass es nicht schlecht war. Warum haben Sie mich geküsst, Steele? Was zur Hölle ist hier los?«
»Ich will, dass wir Sex haben«, sagte er, ohne sich mit irgendwelchen Feinheiten aufzuhalten.
Sie blinzelte wie eine Eule, weil ihre Brille durch die Kuss-Hitze beschlagen war, und starrte ihn sprachlos an.
»Also gut«, begann sie langsam. »Sie wollen Sex mit mir. Sie wollen Sex mit einer Frau, mit der Sie noch nie mehr als ein paar Worte am Stück gesprochen haben. Sagen Sie mir eins, Steele, ist das eine von den Gelegenheiten, wo Sie mit der erstbesten Muschi vorliebnehmen? Ist das hier so eine Männersache? Von einem Einsatz kommen und sein Ding im nächstgelegenen Brunnen versenken?«
Ihre derbe Ausdrucksweise schien ihn aus der Fassung zu bringen. Sogar zu überraschen. Dann schien ihm zu dämmern, dass er möglicherweise gerade beleidigt worden war.
»Ich schlafe nicht in der Gegend herum«, knurrte er. »Ich bin sauber. Ich benutze Kondome. Ich habe seit einem Jahr keinen Sex mehr gehabt.«
»Na dann«, sagte sie, mehr als verblüfft von seinem Bekenntnis. »Das war vielleicht etwas zu viel an Informationen.«
»Falls du mit mir schläfst, musst du das wissen.«
Das stimmte. Aber, stopp, würde sie denn mit ihm schlafen? Dachte sie darüber nach, mit ihm zu schlafen? Ihr Hirn kam nicht mehr mit. Ein Mann, der unzählige Male durch ihre Fantasien gegeistert war, stand hier in ihrem Wohnzimmer und diskutierte seelenruhig mit ihr über Sex, als würden sie in schöner Regelmäßigkeit miteinander ins Bett gehen. Nicht dass sie damit ein Problem hätte. Aber sie hatte definitiv ein paar Fragen, denn das hier entwickelte sich gerade zum wohl bizarrsten Tag seit langer, langer Zeit.
»Warum?«, fragte sie leise. »Sie mögen mich noch nicht mal, Steele. Sie können schon meine bloße Anwesenheit kaum ertragen.«
Er zog sie wieder an sich und hielt sie in seinen Armen gefangen, während sich sein Blick in ihre Augen bohrte. »Und was glaubst du wohl warum, Maren? Du bist eine intelligente Frau. Du hast meinen Ständer vorhin doch gesehen. Zähl eins und eins zusammen, dann hast du die Antwort.«
»Du findest mich attraktiv«, flüsterte sie.
Lange stand er da und schwieg. Als er das Schweigen schließlich brach, zuckte ein Muskel an seiner Wange. Er fühlte sich eindeutig nicht wohl in seiner Haut. Der coole, unerschütterliche Steele war aufgewühlt.
»Du gehst mir unter die Haut. Ich kann dich nicht vergessen. Manchmal, wenn ich schlafe … kann ich dich riechen«, gestand er. »Ich kann deine Augen sehen und die niedliche Brille, die du trägst. Und ich frage mich, wie es wohl wäre, mit den Fingern durch dein Haar zu fahren.«
Heilige Scheiße. Das war ja … der Hammer. Das hier … Es gab noch nicht einmal eine Beschreibung dafür, was das hier war. Das war unfassbar!
Sie hob die Hand und schob verunsichert ihre Brille zurecht. »Du findest meine Brille niedlich?«
Er stieß einen Seufzer aus, und dann, zu ihrer großen Verblüffung, entspannte er sich. Seine Schultern sackten ein winzig bisschen nach unten, und ein Lächeln zog ihm die Mundwinkel nach oben.
»Ja. Niedlich.«
»Und du willst Sex mit mir?«, wiederholte sie.
»Ich glaube, das habe ich gesagt.«
»Wow! Und, ähm, was dann?«
Seine Augen verengten sich. »Du machst mich verrückt. Ich muss dauernd an dich denken. Ununterbrochen. Das kann ich nicht gebrauchen. Du lenkst mich ab, und ich kann mir keine Ablenkungen leisten. Also haben wir Sex, und dann kann ich aufhören, mir auszumalen, wie das ist.«
»Ich muss schon sagen, das ist ja wohl der mieseste Aufreißspruch, den ich jemals gehört habe.«
Steele zuckte mit den Schultern. »Ich bin eben kein sensibler Typ, na und? Willst du jetzt ficken oder nicht?«
Sie hielt sich die Ohren zu. »Aufhören! Das wird ja immer schlimmer!«
Er zog ihre Arme herunter, legte ihr zwei Finger unter das Kinn und hob es ganz leicht an, bevor sein Mund sich wieder auf ihren legte. Sie sank in seine Arme und schloss verzückt die Augen. Wenn der Mann den Mund hielt – und sie hatte beschlossen, dass es ein wahrer Segen war, dass er bisher immer so maulfaul gewesen war –, war er sündhaft sexy. Sein Schweigen war sexy. Bislang hatte er mit seinen Aussprüchen nicht gerade punkten können. Eloquenz zählte nicht zu seinen Stärken.
»Du willst mich«, sagte er barsch, während er sie küsste. »Du willst mich mindestens ebenso sehr, wie ich dich will.«
»Tja«, murmelte sie.
Er löste sich von ihr und sah sie triumphierend aus seinen eisblauen Augen an. Doch statt der Kälte in seinem Blick spürte sie nur sengende Hitze.
»Das Team übernachtet in der Klinik. Wir haben ungefähr sechs Stunden, bevor wir uns wieder auf die Socken machen. Ist dein Bett groß genug für uns beide?«
Sie nickte langsam.
Ohne ein weiteres Wort hob er sie hoch. Sie prallte gegen seinen Körper. Seine Arme schlossen sich um sie, und er ging auf ihre Schlafzimmertür zu.
Ihr Puls hämmerte in den Adern, und ihr Herz schlug so schnell, dass ihr schwindlig war. Das hier passierte wirklich. Steele wollte Sex mit ihr. Er trug sie in ihr Schlafzimmer. In ein paar Minuten würden sie beide nackt im selben Zimmer sein. Heilige Muttergottes!
Sie machte sich auf eine harte Landung gefasst, da sie sich sicher war, dass er sie einfach auf das Bett plumpsen lassen würde. Aber er überraschte sie, indem er sie sanft auf die Matratze sinken ließ. Dann trat er einen Schritt zurück und fing an, sich auszuziehen. Sie konnte den Blick nicht von all der männlichen Herrlichkeit losreißen, die er enthüllte. Lecker.
Geschmeidig. Muskulös. Fest. Nirgends das kleinste Gramm zu viel an seinem Körper. Ein flacher Bauch mit einem durchtrainierten Sixpack. Breite Schultern und Brust, kräftige Muskeln an den Oberarmen. Seine Oberschenkel ähnelten Baumstämmen. Dick und robust.
Maren griff nach ihrer Brille und warf sie in Richtung Nachttisch. Die Fakten waren auch so klar erkennbar. Sie musste die Brille ohnehin nicht dauernd tragen. Bloß zum Lesen und wenn sie sich wirklich auf eine Verletzung konzentrieren musste. Oder auf Laborberichte.
Sie hielt die Luft an, als er sich seine Unterwäsche herunterriss. Seine Erektion schoss ruckartig in die Höhe, prall und steif, die Eichel von einem dunklen Pflaumenblau. Sie konnte die dicke Vene sehen, die sich der Länge nach darüber zog. Was für ein schöner Anblick! Plötzlich wurde ihr siedend heiß bewusst, dass sie als Nächste mit Ausziehen dran war, und sie hatte keinen Körper wie er. Nicht mal annähernd.
Zu weich an Stellen, die fester hätten sein sollen. Ihre Brüste waren nicht straff. Kein Hängebusen, noch nicht, Gott sei Dank, aber auch nicht gerade fest. Um den Bauch herum ein wenig pummelig, weil sie nicht genug Sport trieb und viel zu gerne naschte. Wenigstens hatte sie keine breiten Hüften, was allerdings zur Hebung ihres Selbstbewusstseins nicht sonderlich viel beitrug. Sie war nicht dick, aber sie war auch keine von diesen superschlanken Frauen oder eine von den kurvigen, die üppig und schön aussahen. Sie war bloß irgendwas dazwischen … lahmer Durchschnitt eben.
»Ein Penny für deine Gedanken«, murmelte Steele.
»Ich bin so durchschnittlich«, platzte es aus ihr heraus.
Dann schloss sie die Augen. Ihre Sozialkompetenz ließ wirklich zu wünschen übrig. Das kam davon, wenn man in einer völlig isolierten Gegend aufwuchs, weitab vom Schuss, und keine Freunde hatte oder Umgang mit anderen Leuten pflegte. Dann verwandelte man sich beim ersten Versuch, sich einem anderen Menschen intim zu nähern, in einen kompletten Vollidioten.
»Durchschnittlich?«
Die Ungläubigkeit in seiner Stimme legte sich wie Balsam auf einen Teil ihrer blank liegenden Nerven.
»Ja, einfach so lala. Du bist umwerfend, ich meine, perfekt. Und ich bin einfach nur total durchschnittlich. Wir passen nicht gerade toll zusammen«, sagte sie ernsthaft. »Umwerfende männliche Wesen wie du haben keinen Sex mit Durchschnittsfrauen. Darauf sind sie nicht angewiesen. Sie können Sex mit umwerfenden weiblichen Wesen haben. Also warum sollten sie sich mit bloßem Mittelmaß zufriedengeben?«
Er verzog kurz den Mund, und dabei sah er so entnervt aus, als würde er sich als Nächstes die Haare raufen. »Du verarscht mich doch, oder?«
Ernst schüttelte sie den Kopf.
»Du bist eine Idiotin«, murmelte er.
»Man nennt eine Frau nicht Idiotin, wenn man vorhat, mit ihr zu schlafen«, gab sie zurück.