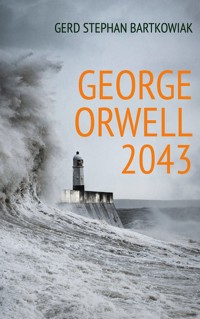Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kinder-und Jugendjahre in Ostdeutschland
- Sprache: Deutsch
Es sollte alles so schön werden. Vater, Mutter zwei Mädchen und das jüngste Kind Robert. Eine glückliche Familie, nur wenige Wochen, dann kam der II. Weltkrieg. Mutter allein, mit drei Kindern. Ausgebrannt, alles verloren aber wir leben, sagte Mutter und haben ein Dach über den Kopf, in einer Kleinstadt in der Niederlausitz, weit im Osten Deutschlands. Unsere Wohnung liegt in einem durch den Krieg verletzen Haus. Im Straßenkampf wurde durch eine Granate ein Teil der unteren Etage getroffen. Es gibt Wasser und Stadtgas. Die oberen, Fenster noch ohne Glas in unserem Wohnzimmer hat der Hausmeister mit Igolith, einen nur wenig lichtdurchlässigen Kunststoff vernagelt. Täglich kommen Menschen irgendwo her irgendwo an. Flüchtlinge suchen eine Bleibe, ob vorübergehend oder für immer, wer weiß das schon. Der Roman schildert für einen Millionsten Teil am Schicksal einer Familie in der jungen DDR. Roberts Kinderjahre stellen erlebnisreich den sozialistischen Alltag dar. Der Roman beschreibt ausführlich die zwischenmenschlichen Beziehungen und Verhaltensweisen mit kritischen Auseinandersetzungen in den gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten. Wird sich Roberts Traum, einmal Pilot zu werden, erfüllen? Lesen Sie im Band 2, "Von der Spree bis an die Moldau", wie Robert mit einem selbstgebauten Fluggerät seine Flucht in die Freiheit vorbereitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Robert, heute machst du die Hausordnung!“ „Ich… schon wieder?“ „Ja du!“ Erwidert Mutti streng. „Du bist zehn also hilf mir bei der Hausarbeit.“ Robert sieht aus dem Wohnzimmerfenster in den Frühlingsmorgen. Hinter dem angrenzenden Hof versperrte viele Jahre eine von Bomben getroffene Haustrümmer die Aussicht. Der Staub der brechenden Mauerreste ist längst verflogen. Das Quietschen der Kipp-Loren-Räder der Gleisbahn auf den schmalen Schienen zum Abtransport, die mit Hämmern geschlagenen Mauersteine, befreit vom Zement der Vergangenheit, übertönte viele Wochen das Morgenlied der Amsel auf dem grauen Schornstein der Remise. Jetzt ist dort ein freier Platz. Im zartem Grün kräuseln aus den erwachenden Knospen der über hundert Jahre alten Lindenbäume, samtweiche Blattspitzen hervor. Der blaue Himmel, die milden Sonnenstrahlen der aufgehenden Sonne, treffen auf die Fensterscheibe unseres zweigeschossigen Wohnhauses. Ich liebe die Frühlingssonne, die in wenigen Stunden schlafende Maikäfer wärmt, bevor sie sich in Schwärmen, hungrig auf die zarten Lindenblätter stürzen. Vor vier Monate knirschte noch der Schnee unter meinen Schuhsohlen in der Silvesternacht, in der das Jahr 1953 seinen letzten Nachthimmel zeigte.
„Robert, Schluss mit der Träumerei, an die Arbeit!“ ruft meine Mutti energisch. Natürlich ist Hausarbeit nicht mein Ding aber der Treppenaufgang mit den vielen Stufen, bis in den Keller Fegen, Aufwischen kann ich nicht ausstehen. Mit meiner Bemerkung, dass so wieso alles wieder schmutzig wird, ergab ich mich meinem Schicksal und wartete nicht auf die Antwort. Es dauerte einige Zeit bis ich mit der Treppenreinigung so weit war, das Mutti mit dem Zeigefinger die Ecken auf Schmutzreste kontrollierte. Ich bestand die Kontrolle und ging durch die Küche auf den angrenzenden Balkon. Hier aus meiner neuen Position kann ich das Nachbargrundstück gut einsehen. Ein Bäckergeselle schiebt Regale mit frischem - dampfendem Brot auf den Hof, bevor sie im Bauch eines Kleintransporters verschwinden. Ich kenne diese Backstube genau. Herr Miethe mit seinen streng nach hinten gekämmten glatten, schwarzen Haaren und den gutmütigen braunen Augen, seine durch den Mehlstaub heisere, aber immer freundliche Stimme. Manchmal verdiene ich mir mit kleinen Besorgungen etwas Taschengeld. Gern mache ich den Weg zum Fleischer. Für die fünfzig Brötchen, die ich dem Fleischer in die Stadt bringe, bekomme ich von der Kräftigen Fleischers Frau immer einen ganzen Ring Pommersche.
Zweimal im Jahr kommt das große Kohlenauto. Das ist für uns Kinder in der Nachbarschaft immer ein besonderer Tag. Wie fleißige Bienen machten wir uns mit den kleinen Händen über die Kohlen her und warfen sie durch das geöffnete Kellerfenster der Bäckerei. Verschwitzt und schwarz verschmiert stellten wir uns, den Fußweg von allen Kohlenresten gesäubert, zur Lohnzahlung, in Reihe auf. Es gab immer fünf Mark. Manchmal waren wir nur zu zweit, dann hatte jeder Zweimarkfünfzig. Das war eine Menge Geld.
Mit einem leisen knarren öffnet Jemand von innen die Kellertür zum Hof. Ein kleiner schmaler Mann tritt heraus. In der rechten Hand trägt er einen Eimer. Mit langsamen Schritten steuert er auf die Abfalltonnen zu. Er stellt den Eimer auf den Boden, nimmt ein welkes Kohlblatt heraus, zerreißt es in kleine Stücke und steckt diese einzeln durch Zaunmaschen vom Nachbargrundstück, wo immer hungrig, Pitricks Hühner warten. Deutlich höre ich das Gackern, der sich um jeden Bissen zankender Hühner. Ich stelle mir vor, wie sie, schutzsuchend in dem viel zu engen Käfig, mit einem zu großen Bissen im Schnabel von einer Ecke zur Anderen laufen, um doch noch ihren erhaschten Brocken herunter zu schlingen. Oft habe ich diesem Treiben zugesehen, habe in den Morgenstunden Regenwürmer gesammelt und sie dann Wurm für Wurm durch die Zaunmaschen geworfen. Herr Müller nimmt sich nicht die Zeit die Futterjagd der Hühner zu beobachten. Er schüttet die Braunkohlenasche in die Mülltonne, die den braunen Staub wieder ausspuckt, als wollte sie ihr Unbehagen zum Ausdruck bringen. Er öffnete zum Nachbargrundstück ein kleines blaues Lattentürchen und verschwindet in seinem sich selbst angeeigneten Garten.
Müllers waren die Ersten, die zu dritt, mit Frau und einer schon erwachsenen Tochter in dieses halb zerstörte Haus einzogen. Es hieß immer, sie sind Flüchtige und wurden aus Sommerfeld vertrieben. Seit dieser Zeit ist er der selbsternannte Hausmeister und Gartenbesitzer. Trotz seiner Kleinwüchsigkeit aber besonders durch seinen schwarzen Oberlippenbart gilt er als eine Respektperson.
Im zweiten Stock, direkt über Müllers, wohnt die Familie Noack. Herr Noack, ist ein Geschäftsmann mit seiner Frau und einem wild um sich beißenden, laut bellenden Foxterrier, mit dem Namen „Loni“. Der Name war völlig überflüssig, denn er hörte auf nichts und Niemanden.
Herr Noack besitzt zwei Autos, die wenn es Abend wird, auf der Straße vor unserem Hauseingang parken. Über unserer Haustür, an der Wand hat Herr Noack einen Glaskasten anbringen lassen. Auf gelben Scheiben steht mit schwarzer Schrift: „Autovermietung Noack, Taxi“. Abends leuchtet eine Glühlampe aus diesem Glaskasten und hilft dem matten Licht der Gaslaternen am Straßenrand ein wenig der nächtlichen Dunkelheit zu trotzen. Ich finde es aufregend und interessant, dass ein Unternehmer in unserem Haus wohnt. Oft kommen gut gekleidete Leute in unser Haus. Manchmal wird auch bis in die späte Nacht gefeiert. Dann geht es laut zu. Meine Mutti bekommt in diesen Nächten kein Auge zu. Sie liegt dann wach und lauscht, bis der letzte Gast endlich das Haus verlassen hat. Schimpfend steht sie dann auf, zieht ihren grauen Straßenmantel über und verschließt die Haustür.
Besonders lenkt sich mein Interesse auf die Autos. Sehnsüchtig schaue ich ihnen nach, wenn sie davon fahren. Zu gern säße ich auf den weichen Ledersitzen und ließ mich durch die Stadt fahren aber dafür hatten wir kein Geld und Herr Noack für meine Träume keine Beachtung, glaubte ich jedenfalls, bis ich eines Tages Herrn Noack beobachtete, als er nachdenklich um sein Auto herumging, sich auf den Fahrersitz setzte, das Licht ein und aus schaltete, die Winkerarme aus den Winkertaschen pendelten, erst rechts, dann links. Dann schaute er suchend in die Umgebung. Unsere Blicke trafen sich. Er winkte mir zu. „Möchtest du dich mal ans Steuer setzen?“ „Ich?“ Fragte ich ungläubig und drehte mich um, vergewisserte mich ob ich auch wirklich gemeint war. Mein Herz machte einen Freudensprung. „Ja!“. Dann setze dich auf den Fahrersitz und drehe wenn ich sage, das Lenkrad kräftig hin und her“. Herr Noack stieg aus, hob mich mit seinen kräftigen Armen auf den weichen Sitz. Vor dem Auto kniend, ruft er: „Jetzt drehe kräftig am Lenkrad“ Ich griff zum Lenkrad und drehte so kräftig hin und her, das es mich aus dem Sitz hob. „Ist gut!“ Rief er mir zu. „Nun noch einmal aber nur links.“ Wieder steckte ich alle Kraft in das Lenkrad. „Halt!“ Hörte ich ihn rufen. Herr Noack stand auf, putzte seine Hosenknie sauber und kam zu mir. „Das hast du gut gemacht. Möchtest du mal ein Stück mitfahren?“ Aufgeregt erwiderte ich: „Ja, na klar!“ „Na gut, dann machen wir eine Probefahrt.“Komm setze dich rüber“ und er zeigte auf den Beifahrersitz. Herr Noack stieg ein, schloss die Tür und ließ den Motor an. Er stellte an einem Hebel an der Lenksäule und ab ging die Fahrt. Ich setzte mich ganz gerade, damit ich auch etwas sehen konnte und hoffte von Schülern unserer Klasse gesehen zu werden. Vielleicht noch von dem Angeber Ralf. Zu dumm, ich konnte kein bekanntes Gesicht entdecken. Herr Noack bog links in die Dresdener Straße ein und dann links in die Sikkinger und machte mit der nächsten Einbiegung unserem Ausflug ein Ende. Wir waren einmal um die Wohnblöcke gefahren. Es verging viel zu schnell. Herr Noack öffnete die Beifahrertür mit den Worten: „Bitte mein Herr“ Stolz ließ ich mich vom Sitz gleiten.
Auf unserem Hof wurde es laut. Stimmen, Hämmern. Zwei Männer mit gelben Mützen schlagen Eisenstäbe in das Hofpflaster. Anschließend spannen sie ein rot-weißes Band zu einem Viereck. Stimmt, heute sollte ja der Dachdecker kommen. Es dauerte nicht lange und schon segelten die ersten Holz- Dachschindeln aus schwindelnder Höhe in das dafür abgesperrte Viereck. Es klatschte und splitterte, dass ich zuerst die Augen zusammen kniff. Nach wenigen Minuten war der Hof mit einem Berg Holzbrettchen bedeckt. Ich bemerkte nicht, dass inzwischen Herr Müller aus seinem Garten kam und auch dem Schauspiel zusah. Herr Müller warf mir einen Blick zu, näherte sich unserem Balkon. „Ihr könnt euch heute Abend auch Bretter holen. Sage deiner Mutti Bescheid“. Ich nickte zustimmend und bedankte mich. Herr Müller verschwand wieder hinter der Kellertür.
Ich gehe in die Küche zurück, nehme meine Brotbüchse vom Tisch und stecke diese in meine Schulmappe, betrete den frisch gesäuberten Hausflur, ziehe die Wohnungstür ins Schloss und verlasse, die vier Stufen in einem Schritt nehmend, das Haus.
Zur Schule benötige ich normalerweise nur fünfzehn Minuten. Normalerweise war für mich eine Ausnahme, denn häufig verweilte ich beim Beobachten der Ameisen oder ich prägte mir den Aufbau einer Blumenblüte ein, die vielleicht gerade von einer Biene besucht wurde. Heute mache ich keinen Umweg, der sonst durch den kleinen Stadtpark führte, nein heute benutze ich den kürzesten Weg über die Gartenstrasse und biege in die Lutherstrasse ein. Ich spüre wie mich die erwachende Natur mit den blühenden Sträuchern und Bäumen mit ihren süßlichen Wohlgerüchen in eine glückliche Stimmung versetzt. Endlich können die Maulbeersträucher hinter dem Gefängniszaun wieder frische Luft atmen. Seit zwei Wochen sind die russischen Panzer abgezogen, die wie auf eine Kette gereiht, viele Monate das Gefängnis bewachten. Täglich mussten die Russen die Motoren anlassen und dicker, schwarzer Qualm umhüllten die grünen Maulbeerbäume, deren Blätter für die Seidenraupen als Nahrung dienen.
Heute muss ich mich beeilen. Etwa fünfzig Meter vor mir erkenne ich meine Klassenlehrerin. Ihre schlanke ja fast dünne Figur und ihre immer eiligen Schritte lassen keine Verwechslung zu. Die sichersten Merkmale waren jedoch die vier Einkaufstaschen, die sie verteilt auf dem linken angewinkelten Unterarm und die mit den Schulakten in der rechten Hand trug. Ich machte mir nie Gedanken darüber warum Fräulein Heinze sich mit so vielen Taschen abschleppte. Erst viel später erfuhr ich, dass sie ihre alte Mutter und ihre kranke Schwester versorgte. Fräulein Heinze war besonders fürsorglich zu mir. Jeden Sonntag trafen wir uns beim Gottesdienst. Ihre klare Sopranstimme konnte man deutlich von der Empore heraushören. Wenn sie mich im Unterricht aufrief sprach sie meinen Nachnamen mit derart falscher Betonung, dass ich mich anfangs nicht angesprochen fühlte. Dann folgte ein lautes: „ Robert! Schläfst du?“ „Nein Fräulein Heinze, “ erwiderte ich und fügte kleinlaut: „Ich habe sie nicht verstanden, “ hinzu. „Setzen!“ Befahl sie energisch und las weiter den Text im Lesebuch. Ich wurde von Fräulein Heinze immer etwas bedauert. Es war mir unangenehm und ich empfand es wie eine Behinderung ein Halbwaise zu sein. Die Einstufung, Halbwaise ermöglichte mir jedoch kostenlose Schulspeisung. Von Montag bis Sonnabend wurde in einem dafür hergerichteten Kellerraum, aus grünen Thermokübeln das Schulessen ausgegeben. Mein zwei Liter Aluminiumtopf füllten die „Essenfrauen“ immer bis zum Rand.
Ich versuche den Abstand zwischen meiner Klassenlehrerin und mir zu verkleinern. Dafür lege ich ein paar Laufschritte ein. Fräulein Heinze verschwindet im Lehrerzimmer. Der Schülerordnungsdienst sitzt noch an einem blanken Holztisch vor der Eingangstür der Schule. An der Tür unseres Klassenzimmers angekommen, höre ich Toben und Schreien, dass mich auf eine neue Überraschung vorbereitet.
Es war ja niemals leise aber solch einen Lärm, das war schon ungewöhnlich. Langsam, auf alles vorbereitet, öffne ich die Tür. Wie ein Bienenschwarm um ihre Königin, sehe ich alle Schüler um einen Punkt versammelt. Sie schreien durcheinander. Keiner bemerkt mein Kommen. Neugierig versuche ich etwas von dem Ereignis mitzubekommen. Endlich kann ich etwas erkennen. Ich sehe im Mittelpunkt des Geschehens, den Neubert auf seinen Platz sitzen. Sein Kopf puterrot. Er trägt eine schwarze dicke Lederjacke mit zahlreichen Reißverschlüssen auf der Brust und an den Seiten. Der breite Kragen besteht aus einem dicken Schaffell. Als erwachsener Mann in der Winterzeit hätte es zu keiner Erregung geführt aber jetzt im Frühling und diese halbe Portion in dieser Jacke ist schon ein großer Spaß. Jeder zerrt an dieser Jacke und Neubert versucht krampfhaft sie an seinem Körper zu halten. Ich bemühe mich, Kalle, meinen Sitznachbarn zu fragen, was denn eigentlich los ist. Doch Kalle kann mich nicht hören. Plötzlich wird der Lärm von einer hohen Sopranstimme übertönt. Fräulein Heinze kommt in das Klassenzimmer gestürmt. Schnell füllen sich die Bankreihen. Fräulein Heinze geht mit ernster Miene auf Neubert zu. „Neubert, aufstehen!“ Befielt sie erregt, wobei sie immer ein wenig mit ihrem Kopf wackelt. Neubert erhebt sich von seinem Sitz. Jetzt wo er steht, kann ich ihn erst richtig sehen. Seine zu große Lederjacke habe ich ja schon entdeckt aber die Stiefel an seinen Füßen, die kaum zwischen Tisch und Bank passen, fallen mir jetzt erst auf. Stolpernd versucht Neubert die zu großen Stiefel auf den Gang zu steuern. Nur mit Mühe bleibt er auf den Beinen. Fräulein Heinze mustert ihn von oben bis unten. Deutlich unterdrückt sie ein lautes Lachen, das letztlich in ein leises Prusten mündet. Nach wenigen Sekunden setzt sie wieder eine ernste Miene auf. „Wo hast du diese Sachen her? Neubert!“ Fragt sie mit lauter Stimme. „Die sind von meinem Vater“, flüstert Neubert mit gesenktem Kopf. „Und warum trägst du diese Sachen?“ „Ja, das ist so“, stammelt Neubert, unsicher. „Mein Vater ist Jagdflieger und da hatte er die Sachen immer an. Als er auf Urlaub kam, schenkte er mir diese Uniform. Er zeigte mir, wie man die Stiefelheizung einschaltet und erklärte mir alles. Jetzt haben wir lange nichts mehr von ihm gehört. Wir wissen nicht wo er ist. Es wurde mäuschenstill. Fräulein Heinze wurde nachdenklich. Sie holte tief Luft und erwidert mit warmer Stimme: „Hast du ein Bild von deinem Vati?“ Neubert hebt seinen Kopf und strahlte über das ganze Gesicht. „Ja! Habe ich!“ „Dann mache ich dir folgenden Vorschlag: Gehe in der nächsten Pause nach Hause, ziehe dir andere Sachen an und bringe ein Bild von deinem Vati mit. Stecke es in deine Brusttasche, dann hast du deinen Vati immer bei dir.“ Neubert ist sichtbar erleichtert. Er hat mit einer Bestrafung gerechnet und nun das, er darf sogar außerhalb der Pausen nach Hause gehen. Die Unterrichtsstunde, das heißt der Rest der Stunde verging sehr ruhig.
In der Pause auf dem Schulhof war es wie immer. Die Jungen der kleineren Klassen tobten, rannten und schupsten sich herum. Die Mädchen spazierten in Gruppen oder zu zweit um das Schulgebäude. Sie kicherten und warfen ab und zu ein verstecktes Lächeln zu diesem oder jenen Jungen. Die Großen der achten Klasse standen am Schulhofzaun. Es war immer derselbe Platz. Stellte sich mal ein kleinerer Schüler nur in Hörweite, so wurde er mit den Worten: „He Ikiegel, verschwinde hier!“ Vertrieben. Genau so funktionierte das Zusammenleben. Die Rangordnung musste eingehalten werden.
Der Schultag wollte für mich heute nicht vergehen. Mit Ungeduld erwartete ich das letzte Klingelzeichen. Die Dachschindeln auf unserem Hof erlaubten keinen Aufschub. Um meine Freizeit nach der Schule zu verlängern, hatte ich mir angewohnt, schon in den Pausenzeiten zwischen den Schulstunden, einen Teil meiner Hausaufgaben zu erledigen. In der letzten Schulstunde stand heute Musik auf dem Stundenplan. Ich mochte Musik und Herrn Günther unseren Musiklehrer, besonders. Er konnte den größten Teil unserer Klasse für Musik begeistern. Bis auf Einige, die mit den Tönen auf dem „Kriegsfuß“ standen, gelang es ihm einen Chor aufzustellen. „Ihr müsst nur den Mund aufmachen, der Rest kommt ganz allein“, sagte er uns über das Singen und machte es auch vor. Und alles sah so leicht aus. Herr Günther war auch in der Kirche aktiv. Er begeisterte die Gemeinde mit seiner schönen Stimme und spielte Bach und Händel an der alten Silbermann-Orgel. Weihnachten organisierte er das Kindersingen. Wer Lust hatte konnte ein Musikinstrument erlernen. Es kostete nichts und so entschloss ich mich für das Flügelhorn. Einmal wöchentlich übten wir in den Räumen der Lutherkirche, in einem zwölfköpfigen angehenden Blasorchester, bestehend aus Trompete, Posaune, Oboe und zwei Flügelhörnern.
Heute Nachmittag hatte ich keine außerschulischen Verpflichtungen. Als endlich das langersehnte Klingelzeichen ertönte verließ ich eilig das Schulgelände, überquerte die Hauptstraße und rannte nach Hause. Ich war noch allein. Meine beiden Schwestern sitzen noch in der Schule. Die Schulmappe abgelegt, nahm ich den Kellerschlüssel vom Schlüsselbrett, lief in den Keller und suchte mir den größten Weidenkorb aus. Ich betrat den Hof. Vor mir ein hoher Berg mit vielen kleinen, nach Carboneum riechenden Holzbrettchen. Ich umkreiste den Schindelberg und wunderte mich über die vielen Frauen und Kinder, die mit flinken Händen, Eimer, Körbe und Schubkarren, ja auch in Schürzen, an den Enden fassend, das Brennholz einsammelten. „Wo kommen denn nur diese vielen Menschen her“, dachte ich. Die können doch nicht alle in unserem Haus wohnen. Hastig warf ich die Schindeln in meinen Korb. Jetzt fehlen meine Schwestern. Wenn man sie mal braucht sind sie nie da, schoss es mir verärgert durch den Kopf. Mein Korb war schnell voll. Ich schüttete alles in die Mitte unseres kleinen Kellers. Mit schnellen Schritten durch den Kellergang, mit zwei Stufen Schritt passierte ich die Treppe zum Hof. Ich suchte mir einen anderen Platz, dort wo es nicht so eng war. Neben mir fiel mir eine Familie auf, die ich hier noch nie sah. Eine Frau, mit einem schwarzen Kopftuch, nach hinten geknotet, einem Mädchen und zwei Jungen. Der eine Junge, vermutlich der große Bruder, ja schon fast ein junger Mann. Das Mädchen und der andere Junge, weckten mein Interesse, denn ich stufte sie in meine Altersklasse ein. Wie alle, füllten sie auch ihre Körbe. Die Mutter und der große Bruder trugen die vollen Körbe in den zweiten Kellereingang unseres Eckhauses. Vermutlich hatte ich durch meine Beobachtung, die Neugier des kleinen Jungen geweckt. Während er die Schindelbrettchen mit der einen Hand in seinen Korb warf, drehte er seinen Kopf zu mir und bemerkte nicht, dass seine Mutter in diesem Augenblick den Korb wegzog. Seine Brettchen fielen daneben. Überrascht suchte er den Korb, blickte zu mir und lachte laut los. Auch ich fand das lustig und musste lachen. Langsam rutschte ich meinen Korb in seine Nähe und setzte meine Arbeit fort. Als ich damit beschäftigt war, die besten Brettchen aus dem Haufen zu ziehen, hörte ich wie etwas in meinen Korb fiel. Ich schaute hoch und sah in ein lustiges Kindergesicht, mit dunkelblondem glattem Haar. „Soll ich dir helfen?“ Fragte er mich. „Wenn du möchtest.“ „Ja!“ „ Wenn meine Mutti und mein Bruder im Keller sind, dann habe ich Zeit und kann dir helfen.“
Der Berg in unserem Keller wurde rasch größer. „Wie heißt du?“ Fragte ich. „Ich heiße Jürgen und du?“ „ich bin der Robert, ich habe dich hier noch nie gesehen.“ Fügte ich hinzu. „Wohnst du hier?“ „Ja vor zwei Tagen sind wir hier eingezogen. Wir wohnen dort oben, “ Jürgen zeigt mit dem Finger auf einen Balkon in der zweiten Etage, im anderen Flügel des Eckhauses. „Wo hast du früher gewohnt?“ Wollte ich wissen. „Wir kommen aus Schlesien, wir mussten dort weg. Ab morgen gehe ich in die 8. Schule. Mein Vati hat mich schon angemeldet.“ „Ich gehe auch in die 8-te.“ Erwiderte ich erfreut. „In welche Klasse gehst du?“ „Ich soll mich in der 5b melden.“ „Ach schade! Ich bin in der 4a.“ „Aber das macht ja nichts, wir können uns ja auf dem Weg zur Schule und nach der Schule treffen.“
Der Holzhaufen war bis auf ein paar vereinzelte Brettchen vom Hof verschwunden. Unsere nach innen aufgehende Kellertür stand breit auf und bog sich unter der Last der Schindeln zur Wand. „Was machst du, wenn du hier fertig bist?“. Fragte mich Jürgen. „Ich muss den Haufen in unserem Keller aufschichten.“ „Gut!“ Meinte Jürgen. „Wenn du willst, helfe ich dir.“
So saßen wir anfangs, dicht unter der Kellerdecke auf dem Schindelberg. Nach einer Stunde war die Arbeit getan. „Wollen wir morgen gemeinsam zur Schule gehen?“ Ja!“ Stimmte Jürgen zu. „Wir treffen uns um halb acht an der Straßenecke“, schlug Jürgen vor. Der Weg aus dem Keller führte uns in den Kellereingang Kochstrasse, der zu meinem Eingang gehört. Bei dieser Gelegenheit zeigte ich Jürgen die vielen Eingänge und Durchgänge unseres Hauses. Als das Licht durch das Flurfenster auf unsere Gesichter fiel, hatte der Kellerstaub uns einen schwarzen Schnurrbart angemalt. „Komm!“ Forderte ich Jürgen auf. „Ich zeige dir einen geheimen Weg, der zu eurer Wohnung führt.“ „Wirklich?“ „Ja! Pssst!“ Mit meinem Zeigefinger machte ich Jürgen verständlich, leise auf Zehenspitzen mir zu folgen. Jürgen verstand und folgte mir leise. In der zweiten Etage hielt ich inne. Ich flüsterte: „ Herr Müller unser Hausmeister macht ein großes Spektakel, wenn er uns hier erwischt. Ein Glück an seiner Wohnung sind wir vorbei!“ Vorsichtig öffne ich die Tür zum Dachboden. Wie zwei Katzen schlüpfen wir durch den schmalen Türspalt. Auch für mich zeigt sich ein neuer Anblick. Das Dach ist nur bis zur Hälfte mit neuen roten Tonziegeln gedeckt. Vier Dachdecker sitzen in schwindelnder Höhe auf den Dachlatten und legen Ziegel neben Ziegel auf die Leisten. Ab und zu kleckst etwas Mörtel auf die grauen Dielen. Niemand hat uns bemerkt. Wir überqueren den Dachboden und erreichen eine weitere Tür. Nach dieser Tür gelangen wir in das Treppenhaus der Gartenstraße. „So nun sind wir bei dir. Noch zehn Stufen abwärts und wir stehen unmittelbar vor deiner Wohnungstür.“
Ich nehme denselben Weg, den wir gekommen sind. In unserem Treppenhaus schwinge ich mich auf das Treppengeländer und erreiche fast lautlos das Erdgeschoss. Natürlich ist diese Talfahrt auf dem Geländer verboten. Zum Glück hat mich Herr Müller nicht erwischt. Einmal rutschte ich direkt in seine Arme. Das kostete mich eine Tag Stubenarrest. Ich schloss die Wohnungstür auf und sah das Mutti von der Arbeit zurück ist. Ich küsste sie und erzählte ihr von meinem neuen Freund und das wir gemeinsam die Schindeln in unserem Keller aufgeschichtet haben. „Du hast ihn doch nicht mit in unseren Keller genommen?“ „Natürlich! Wie soll er mir denn beim Aufschichten helfen, wenn er nicht in unseren Keller darf? Es ist doch nicht schlimm!“ Mutti schaute mich nachdenklich an, unterbrach für einen Atemzug ihre Arbeit, strich mir über meinen Lockenkopf und sagte: „gehe dich erst einmal waschen und später sehe ich mir eure Arbeit an.“ An diesem Tag ist Mutti nicht mehr in den Keller gegangen. Sie putzt unsere Zwei-Zimmerwohnung mit Besen und Staubtuch. Meine Schwester Maria liegt auf dem Sofa und liest wie so oft einen Liebesroman, eine „Schwarte“ wie immer meine Mutti sagt. Sie liest diese Hefte in jeder freien Minute. Selbst mit ihrer Freundin sitzen sie lesend im Zimmer oder wo auch immer. Einmal traf ich Beide in einem naheliegenden Park auf einer Bank. Ihre Nasen steckten in Bücher. Ich konnte das nie verstehen. Wenn ich mit meinem Freund zusammen bin, wollen wir uns unterhalten.
Die Sonne war längst untergegangen. Mutti kam mit einem Weidenkorb, den Ausbesserungskorb, in das Wohnzimmer. Sie setzte sich in ihren Sessel, schaltet die schwarze Stehlampe an und stopfte und nähte bis alles wieder in Ordnung war. Ich ließ mich auf mein Eisengitterbett nieder und dachte nach. Einen Moment später rief sie energisch: „gehst du mit den Sachen vom Bett!“ Mit weinender zitternden Worten fügte sie hinzu: „ich weiß nicht wie ich die ganze Arbeit schaffen soll.“ Ich sprang vom Bett auf und setzte mich auf einen weißgestrichenen Holzstuhl. „Hast du nichts zu tun? Sind deine Hausaufgaben fertig?“ „Ja Mutti, schon lange!“ Versicherte ich. „Na dann lass mal sehen!“ Ach du meine Güte, jetzt geht das wieder los, schoss es mir in den Kopf. Ich legte alle Schreibhefte aufgeschlagen auf den Tisch. Mutti rückte ihre Brille zurecht, machte schmale Lippen. Ich kannte diesen Gesichtsausdruck. Er versprach nichts Gutes. Da meine Buchstaben mal nach rechts und mal auf die andere Seite kippten und zu allem Übel der Federhalter mit der gedrehten Glasfeder auch noch zum Klecksen anfing, drohte mir heute Abend noch ein „strenges Gewitter.“ Mutti las die Hausaufgaben durch, schüttelte den Kopf. „Schön ist das ja gerade nicht! Die Schrift muss besser werden und über die Buchbeschreibung hättest du einige Sätze mehr schreiben können. Was ist das für ein Buch? Ich habe von diesem Buch noch nie etwas gehört.“ „Ich auch nicht.“ Wieso du auch nicht?“ Habt ihr das nicht in der Schule gelesen?“ Fragte sie mich mit ihren großen braunen Augen ansehend. „Nein!“ Erwiderte ich „Wir sollen ein Buch beschreiben. Es ist egal welches und da ich kein Buch gelesen habe und wir die Arbeit morgen abgeben müssen, habe ich einfach, ein Buch erfunden.“ „Ob das mal gut geht“, gab sie zu bedenken und versuchte mir ihr Lächeln zu unterdrücken. Sie setzte sich wieder zurück in ihren Korbsessel und nahm den Strumpf mit dem Stopfpilz in die Hand und führte die Nadel, wie bei einem Webstuhl, mit auf und nieder durch die Garnfäden, bis das Loch kunstfertig verschwand. Schnell räumte ich alle Hefte in meine Schulmappe zurück. Es klingelte an der Haustür. Es war meine Schwester Marianne, sie kam vom Volkstanz. Marianne ist in unserer Familie der „Wirbelwind.“ Sie spielt am liebsten mit den Jungen auf der Straße und träumt wiederum ein großer Filmstar zu werden. Mit zusammengebissenen Zähnen übt sie im Korridor Spagat. Täglich prüft sie mit dem Lineal den Abstand bis zum Boden. Auch heute führt sie uns den neu einstudierten Tanz vor. Leider bekam sie nicht den erhofften Beifall. Mutti unterbrach ihre Flickarbeit und bereitete das Abendessen vor. Das Holzfeuer in der Kochmaschine schimmerte rötlich durch die gusseisernen Ringe. Auf dem Herd stand ein schwerer schwarzer Tiegel aus dickem Stahl. Die Margarine pruzelte spritzend aus dem heißen Tiegel. Es gab Küchlein. handtellergroße Fladen aus gekochten Kartoffeln, mit etwas Quark, Mehl und Salz, beidseitig in heißem Fett, braun gebacken. Mit Zucker bestreut, roch es appetitlich von einem großen Teller. Alle vier setzten wir uns an den großen wackligen Küchentisch, der schon vor unserem Einzug in der Küche stand. Der Abend verging wie immer. Maria, meine älteste Schwester, machte sich zum Ausgehen fertig. Sie flocht noch mal ihre beiden langen Zöpfe, die mit ihren Spitzen bis zum Gürtel ihres roten Rockes reichten, zog eine Jacke über und verließ die Wohnung. Marianne, die immer von selbst ihre Hausaufgaben machte, paukte russische Vokabeln. Wenn sie laut die russischen Worte vorsprach, hörte ich aufmerksam zu und behielt einige Worte im Gedächtnis. Es kann ja nie schaden, dachte ich mir. Mutti hatte ihre Flickwäsche zur Seite gelegt und ein kleines blaues Heft aufgeschlagen. Sie machte ihre tägliche Buchhaltung. Sie legte ihre Geldtasche auf den Tisch. Diese Abrechnung war für mich immer mit einer gewissen Unruhe verbunden. Mutti schreibt jeden Abend in ihr Abrechnungsheft was sie an diesem Tag an Geld ausgegeben hat. Sie ist auch bei dieser Abrechnung, wie bei allen Arbeiten, sehr genau. Sie verglich den ausgegebenen Geldbetrag mit dem vorhandenen Restgeld. Hatte aber Mutti mal eine Position vergessen, was schon mal vorkam, begann das große Raten, Schimpfen und Stöhnen. Einmal fehlten acht Pfennig. Mutti rechnete rauf und runter, zählte wieder und wieder das Restgeld und wusste keinen Rat mehr. Sie tat mir sehr leid. Diese Situation erweckte in mir den Wunsch, mal viel Geld zu verdienen, um dann für Mutti zu sorgen. An diesem Abend wurden die acht Pfennig nie gefunden. Mutti beendete dann die Suche mit den Worten, das sie jemand beim Wechselgeld betrogen hat.
Es wurde Zeit zu Bett zu gehen. Geschlafen wurde in unserem Wohnzimmer, denn es war der größte Raum. Im Ehebett, an der langen Wand schlafen Mutti und meine beiden Schwestern. Gegenüber steht ein altes Sofa, daneben ein hoher Kleiderschrank mit drei Türen. In der Mitteltür befindet sich ein Spiegel so groß wie die gesamte Tür. Vor dem Kachelofen stehen ein Esstisch mit vier Stühlen und dicht daneben ein Korbsessel, Muttis Korbsessel. Marianne und ich sind schon zu Bett gegangen. Mutti sitzt noch am Tisch, die Stehlampe weit nach unten gedrückt. Das runde Lichtauge trifft so nur die abgegriffenen Seiten eines dicken Buches. Es ist die Bibel. Jeden Abend las sie mit gefalteten Händen die Texte der Bibel. Oft bat sie Gott um Hilfe. Er möge doch für das Essen der nächsten Tage sorgen und meinen Vati, der noch nicht aus dem Krieg zurück ist, beschützen und recht bald wohlbehalten zurückbringen. Täglich kamen Heimkehrer aus der ganzen Welt zurück, doch mein Vati war nicht dabei. Auch ich habe heute meinen Vati in mein Gebet eingeschlossen und mir gewünscht, er möge doch endlich aus der französischen Gefangenschaft zurückkommen. Es war still. Nur der Wecker schepperte im gleichmäßigen Takt. Dann war ich wohl eingeschlafen, als ich von lauten Stimmen wach wurde. Draußen noch tiefe Nacht. Ich stand auf und taumelte halbwach zur Tür. Mutti, Maria und Marianne standen in Straßenkleidung im Korridor. Ich hörte wie Maria zu Marianne sagte“: Das sind Russen!“ Ich hatte keine Ahnung was los war, bis ich deutlich hörte, dass jemand gegen unsere Wohnungstür schlug. Wir wagten nicht zu atmen. Wie versteinert standen wir dicht zusammengedrängt und hofften dass sie bald fortgehen. Es kam noch schlimmer. Mit einem harten Gegenstand schlugen sie jetzt gegen die Tür. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann sie zerbricht oder das Schloss aufspringt. Wieder gab es einen Grund Gott um Hilfe zu beten. Die Hiebe wurden schwächer, bis sie plötzlich ganz aufhörten. Hatte uns tatsächlich Gott erhört? Russische Worte und Schritte in schweren Stiefeln entfernten sich von der Haustür, über den Flur nach draußen. Dann war es nächtlich still. Erleichtert verlangsamte sich unser Herzschlag. Maria schlich als erste zur Wohnungstür, zog den Schlüssel, der von