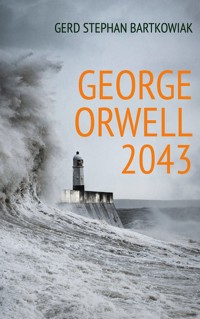Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kinder- und Jugendjahre in Ostdeutschland
- Sprache: Deutsch
Ein Leben lang in dem größten Gefängnis der Welt, hinein geboren ohne Schuld, dieser Gedanke bereitet Robert eine Gänsehaut. Er stützte seine Ellbogen auf den Schreibtisch, hielt den Kopf in seinen Händen, massierte mit den Daumen seine Kopfhaut, um einen klaren Gedanken für einen Fluchtplan zu entwerfen. Robert sucht nach Antworten und findet keine Erklärungen für das Warum und das Wie. Es muss einen Weg geben, dem zu entkommen. pocht es in seinen Schläfen. Aus dem Gefängnis mit wenigen Quadratmetern Lebensraum, ohne Menschenwürde, mit dem Ziel der Umerziehung, der Erschaffung eines neuen Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In das Wohnzimmer mit dem großen Fenster, das bis zur Zimmerdecke reicht und nach Norden zeigt, hat die Sommersonne nie einen Blick gewagt. Die tägliche Dunkelheit, im Schatten der Sonne und auch im Schatten des Lebens, füllt den Raum und drückt aufs Gemüt.
Die sonst so kleine Zwei-Zimmer-Wohnung mit den glänzend rotbraun gestrichenen Holzdielen erschien mir jetzt viel größer, nachdem Marianne, meine große Schwester nun auch mit dem Medizinstudium begonnen hat. Den Platz neben dem wärmenden tannengrünen Kachelofen gleich neben der Tür teilte ich an den kalten Abenden nur noch mit Mutter. Das Singen und Streiten meiner Geschwister, welches oft schon im Hausflur hörbar wurde, lag einige Monate zurück. Roberts 20-zigster Geburtstag! Ein Tag mit Streuselkuchen, so groß wie ein Tisch, wie immer gebacken im Backofen der Bäckerei gleich nebenan, roch appetitlich. Wir bekamen keinen Besuch, da der Geburtstag auf einen Wochentag fiel. Ich saß mit Mutter im Wohnzimmer und begann das Gespräch auf meine berufliche Zukunft zu lenken. Vor vier Wochen war ich bei der Musterung für die Volksarmee.
„Ja, ich weiß, und?“, wunderte sich Mutter. Ein Offizier hatte mich gefragt, welche Waffengattung mich in der Armee interessierte. Ich gab ihm zu verstehen, dass mich Flugzeuge begeistern. Daraufhin hatte er mich für das fliegertechnische Personal registriert. Er sagte, ich könnte Flugzeugingenieur werden und am Boden viele interessante technische Aufgaben für die Armee erfüllen. „Ich denke, das wäre –nachdem ich nun als politisch unzuverlässig eingestuft wurde und nicht mehr Pilot werden darf- ein schöner Beruf. Was meinst du?
„Ach Junge“, stöhnte Mutter gequält, allein gelassen in ihren täglichen Sorgen. „Ich habe keine Ahnung, was aus dir werden soll. Mache erst einmal deinen Dienst an der Waffe, danach weißt du mehr.“ Da ich der Wehrpflicht nicht entkommen konnte und sonst auch keinen anderen Plan hatte, war das Thema, wie ich damals glaubte, ohne einen hilfreichen Rat von Mutter zu bekommen, beendet. Ich wollte mehr über die Vergangenheit der Generation meiner Mutter erfahren. Ich schwieg für ein paar Minuten, sah Mutter bei der Flickarbeit zu. Ich wusste aus vielen Versuche, wenn ich etwas zu erfahren suchte, was der Vergangenheit angehörte, dann wich sie immer meinen Fragen aus und blockierte sofort jedes weitere Gespräch zu diesem Thema. Wenn sie aber doch einmal etwas von sich preisgab, dann kullerte nur eine Träne über ihre Wange und folgte dem bereits ausgetrockneten Tränenbach der Erinnerungen. Trotzdem war es mir nie klar, wann Mutter bereit war, zum Thema Vergangenheit zu sprechen und worüber man etwas erfahren konnte. Heute siegte mein Wissensdurst mit der Frage:
„Wie war das eigentlich damals mit Hitler und so?“ Überrascht ließ sie die Stopfnadel in der Socke, die den hölzernen Stopfpilz umspannte, stecken, drehte ihren Dutt fester, der sich trotz der Haarnadeln oft widerspenstig zu einem kleinen Pferdeschwanz auflöste, sah in meine Richtung, aber mit fernem Blick an mir vorbei, machte eine kurze Pause. „Ich habe bis zum Schluss an den Endsieg geglaubt“, sagte sie dann mit leiser Stimme. „Und jetzt, was glaubst du heute? fragte ich gespannt. „Ich glaube nur noch an Gott und sonst an sehr wenig, aber ich bin froh, hier im Sozialismus zu leben.“ „Und warum? wollte ich wissen. „Ich war als junges Mädchen in Stellung, weißt du, was Stellung ist?“ Als ich bejahte, holte sie tief Luft, sah auf ihre von schwerer Arbeit gezeichneten Finger, hielt mit der linken Hand den Stopfpilz umklammert. Die rechte Hand, deren Zeigefinger von einem unbehandelten Bruch gekrümmt war, ruhte in ihrem Schoß. Leise fuhr sie nun fort: „Das bedeutete, Dienstmädchen für die reichen Herrschaften zu sein. Wir waren weniger wert als ein Hund, der zu den Herrschaften gehörte. Unser Lohn bestand aus freier Kost und einem Bett zum Schlafen. Nein, jetzt habe ich Arbeit und wir müssen nicht hungern. Und meinst du, dass wir im Kapitalismus für deine beiden Schwestern das Medizinstudium bezahlen könnten? Hier ist alles frei, und die Kinder der Arbeiter bekommen noch eher einen Studienplatz, als die aus der Klasse der Doktoren und reichen Unternehmer. Wo gibt’s das schon?“ „In der UdSSR“, warf ich ein. „Ja klar, auch dort wird der“, sie stockte einen Moment, „Kommunismus aufgebaut.“ Sie machte erneut eine kurze Pause, zog ihre Stirn kraus. „…oder der Sozialismus? Ist ja auch egal, du weißt schon, was ich meine.“
Nur wenige Monate vergingen nach unserem Gespräch, als ich meinen kleinen braunen Koffer mit den notwendigsten Kleidungsstücken packte, um von nun an dem Sozialismus als Soldat zu dienen.
Ordnung und Disziplin hatte ich zuhause, nach häuslichem Drill, ausreichend gelernt. In dieser Beziehung drohten mir beim Militär keine Probleme. Die Grundausbildung, damit meine ich das Exerzieren, dauerte für mich und noch weitere vier Kameraden nur zwei Wochen. Das war außergewöhnlich, denn es wurden dringend Funker und Fernschreiber gesucht, die sofort mit der Funker-Ausbildung beginnen sollten. Ich meldete mich sofort, vermutete schon, dass eine Extrawurst auf mich wartet. Täglich lernte ich das Morsealphabet, während die anderen Soldaten weiter das Übungsgelände mit ihrem Schweiß tränkten. Es wurde Herbst und die Funker-Prüfungen abgelegt, das Qualifikationsabzeichen feierlich übergeben. Gleichzeitig hatten wir professionelles Zehn- Finger-Schreibmaschine schreiben gelernt, denn die Fernschreiber, die auch von uns bedient werden mussten, waren mit der gleichen Tastatur ausgestattet wie eine ganz normale Schreibmaschine. Unsere Kaserne befand sich unweit vom Berliner Stadtrand. An einem Morgen im Mai, ich hatte gerade meinen täglichen Fünftausend-Meter- Lauf beendet, der Morgen lag noch in der Dämmerung, erschien mir unser Exerzierplatz wie von einer Schneedecke bedeckt, wie weiß lackiert im Licht der Laternen. Ich machte jeden Tag meinen zusätzlichen Fünftausend-Meter-Lauf, den mir der Kompaniechef zusätzlich genehmigt hatte und sah, dass die Schneedecke aus vielen kleinen Papierzetteln bestand. Ich hob einen Papierstreifen auf und erkannte eine Schriftzeile. Ich las: „Neckermann macht‘s möglich.“ Wie von einer Tarantel gestochen, warf ich das Papier weg, erkannte sofort die politische Prägnanz, sah mich um wie ein ertappter Dieb und lief mit schnellen Schritten in den Block meiner Kompanie zurück. Mir war klar, ich durfte niemandem von dem eben Erlebten erzählen.
Nach dem Acht- Uhr- Fahnenapell, der jeden Morgen vor unserem Kompanieblock stattfand, marschierten wir zum Frühstück. Unser Weg führte uns am Exerzierplatz vorbei, und ich war gespannt auf die Reaktion meiner Kameraden und vor allem auf das Verhalten der Offiziere. Meine Spannung verpuffte, als ich sah, dass der Exerzierplatz blank gefegt und kein Schnipsel von den Flugblättern mehr auf dem Zementboden lag.
In meiner Dienstzeit arbeitete ich hauptsächlich als Fernschreiber. Wir erhielten sehr wichtige Schreiben von der sowjetischen Armee über die Lage des Luftraumes und deren Überwachung. Diese Schreiben wurden dann an den Armeegeneral mit höchster Dringlichkeitsstufe weitergeleitet. Der Armeegeneral saß unweit unseres Sicherheitstraktes. Ich erkannte, dass ich mich an einer sehr verantwortungsvollen Stelle befand und für die Luftraumüberwachung der DDR eine wichtige Bedeutung hatte. Es machte mich ein wenig stolz.
Wir konnten an einer großen, durchsichtigen Scheibe aus Plexiglas die Daten über Höhe, Geschwindigkeit und Nationalität der Flugzeuge identifizieren und bis achtzig Kilometer in den Luftraum der angrenzenden Länder einsehen.
Oft wurde Alarm ausgelöst, weil Flugzeuge mit fremder Kennung sich unserem Luftraum näherten. Dann starteten zuerst die MIG’s der sowjetischen Staffel. Einmal näherten sich fast fünfhundert Flugzeuge, aus Richtung Bonn kommend, unserem Luftraum. Wenige Flugkilometer vor unserer Landesgrenze änderte dieses Geschwader seinen Kurs und drehte kurz vor der Grenze ab. Eine gewollte Provokation. Somit war nicht alles Lüge, was unsere „Aktuelle Kamera“ in den Nachrichten berichtete.
Ich versuchte, mir mit meinem bei der Armee Erlebten ein Weltbild zu erstellen. Manchmal glaubte ich, es gefunden zu haben und dann kam der obligatorische Politunterricht. Hier stellte ich unserem Politoffizier Fragen, die mir aber nur Schwierigkeiten einbrachten. Ich wollte nicht provozieren, sondern suchte nur nach Antworten, wie zum Beispiel, warum die Soldaten an der Grenze mit dem Gesicht in die DDR schauen und nicht zum Klassenfeind gerichtet sind. Diese kritische Frage brachte mir zur Strafe zusätzliche Arbeit in der Küche beim Kartoffelschälen ein.
Nach einem Jahr merkte ich, dass ich für den Soldatendienst, bei dem man keine eigene Meinung haben durfte, nicht taugte.
Die große berufliche Hoffnung auf eine fliegertechnische Laufbahn stellte sich als eine Lüge heraus, denn die Offiziere in der Musterung lockten mit ihren falschen Versprechen die Unterschriften für eine zwölfjährige Verpflichtung in der Armee aus den jungen Männern heraus.
Ich war selbst darauf reingefallen, konnte mich aber auf Nichteinhaltung der Versprechen berufen und wurde somit nach dem gesetzlichen Wehrdienst aus der Armee entlassen.
Wieder einmal zerbröselte ein weiterer Berufswunsch, für den ich mich entschlossen hatte, wie Sand zwischen den Fingern.
Nach dem Soldatendienst hatte ich noch 2 Wochen Ferien, die ich in Berlin bei meiner Schwester Maria verbrachte. „Und was willst du jetzt machen?“, fragte mich meine kluge Schwester.
„Ich weiß nicht. Ich suche mir hier in Berlin eine Arbeit.“ entgegnete ich. „Du brauchst aber für Berlin eine Sondererlaubnis, um hier zu leben“, gab sie zu bedenken. Aber ich hatte mich inzwischen informiert. „Das gilt für mich nicht, als ehemaliger Soldat.“ „Ja, da hast du Recht, du kannst dich hier ganz normal anmelden und dir Arbeit suchen“, überlegte Maria. „Genau das habe ich vor.“
Ich schlenderte durch die Berliner Straßen, blieb vor einem großen Gebäude stehen.
Ein Riesenkasten, mit unzähligen Fenstern, dachte ich, da muss doch auch ein Eingang sein? Auf dem emaillierten Straßenschild an der Hausmauer stand, Taubenstraße. Ja, hier war der Eingang. Eine große verglaste Drehtür warf gerade einen Besucher wieder auf die Straße zurück. Ich machte mich schlank und folgte der Drehrichtung einwärts. Hinter einem meterlangen dunkelbraunen Empfangstisch saßen zwei junge Frauen. „Guten Tag“, begann ich, auf die Dame mit der Brille zugehend. „Guten Tag“, erwiderte sie mit einer recht dunklen Stimme, „was möchten Sie?“
„Ich möchte zur Kaderabteilung, ich suche eine Arbeit“, trug ich meine Bitte vor. „Einen Moment bitte!“, brummelte die Dame und griff zum Telefonhörer. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Teilnehmer am anderen Ende der Leitung fragte sie nach meinem Namen. „Ich heiße Robert Hammer“, stellte ich mich vor. „Gut, Herr Hammer, gehen Sie bitte in die 2. Etage in das Zimmer 207 und melden Sie sich dort. „Ich bedankte mich und als ich mich suchend nach der Treppe umschaute, zeigte die Dame zu einem Fahrstuhl, genannt Paternoster. Sie lächelte und erkannte sofort, dass ich noch nie mit einem Paternoster gefahren war. Ich sah, es war nur ein Fahrstuhl, der nie anhält. Ich konzentrierte mich auf die kommende Fahrstuhl-Plattform und sprang mit Schwung hinein. Geschafft! Etage Nr. 1, dann Etage Nr. 2, hier abspringen. Das hatte geklappt.
Zimmer 207, hatte die Dame gesagt. Ich klopfte an die Tür und wartete auf das Herein. Als ich noch einmal etwas lauter klopfte, kam endlich die Aufforderung einzutreten.
Ein freundlicher Mann mit lockigem, schwarzem Haar reichte mir die Hand. „Guten Tag, Herr Hammer!“ Wir setzten uns an einen runden Tisch, umgeben von vier, mit schwarzem Leder bezogenen Polsterstühlen, die auf hochglanz-verchromten Beinen ruhten. „Sie suchen Arbeit? Wo haben Sie bis jetzt gearbeitet? Was sind Sie von Beruf?“, begann der nette Herr das Gespräch. „Ich bin Agrotechniker und komme gerade aus der Armee“, gab ich Auskunft zu den Fragen. „Was haben Sie bei der Volksarmee gemacht?“, wollte er nun wissen. „Ich war Funker und Fernschreiber.“ „Hmm, Fernschreiber? Können Sie Schreibmaschine schreiben?“ Als ich antwortete: „Ja, ich schreibe 120 Anschläge in der Minute“, erhellte sich sein Gesicht und er erwiderte: „Oh, das klingt gut!“ Der Kaderleiter überlegte für einen kurzen Moment. „Wir benötigen jemanden für die Fakturierung. Trauen Sie sich das zu?“ „Ja klar“, antwortete ich, ohne zu wissen was Fakturierung bedeutete und ohne Kenntnis darüber, in welcher Firma ich mich beworben hatte. Die Einstellung war in wenigen Minuten abgeschlossen, und der Arbeitsvertrag beinhaltete die Anzahl der Urlaubstage, das Gehalt und die Bezeichnung der Funktion. Es war ein kleines DIN-A5- Blatt, zweiseitig beschrieben, mit dem Hinweis, als „Dokumentenbearbeiter“ eingestellt zu sein. Ich war glücklich und begann meine Arbeit gleich am nächsten Tag. Frau Peuker, eine schlanke, durch tägliche Diät etwas nervöse Frau, war meine Chefin. Ich schrieb acht Stunden täglich Rechnungen auf einer elektrischen Schreibmaschine, deren Farbband ständig stehenblieb und die Buchstabentypen zwar gehorsam auf das Papier schlugen, aber ohne die gewünschte Farbspur zu hinterlassen. Eine leichte, aber sehr eintönige Arbeit. Nach etwa sechs Monaten betrat ein Mann von großer Gestalt das Schreibbüro. Ich schätzte ihn auf mindestens zwei Meter, er war sehr schlank. Er sprach mit Frau Peuker und hinterließ einen angenehmen Parfümgeruch. Ich hatte keine Ahnung, dass dieses Gespräch mit meiner Chefin mich betraf. Es war an einem Freitag und das Wochenende lag vor mir. Kurz vor Arbeitsschluss kam meine Chefin an meinen Schreibtisch, legte mir einen Zettel vor und ich verstand nicht sofort, was sie wollte. „Hier sind das Kontor und das Zimmer aufgeschrieben“, und sie zeigte mit ihrem rotlackierten Zeigefingernagel auf den Papiertext, „wo sie ab Montag arbeiten werden.“ Ich nahm den Zettel und las: „ Kontor 13, PuV, TC, Zimmer 310.“ Ich schaute sie fragend an. „Sind Sie nicht zufrieden mit mir?“ Sie legte ihre Hand auf meine Schulter und lächelte gönnerhaft: „Keine Angst, Sie steigen auf“.
Ich hatte nicht nur in eine höhere Etage meinen Schreibtisch gewechselt, sondern meine Tätigkeit wurde tatsächlich anspruchsvoller, vom Koordinator für Vertragsstrafen und Überwachung der Bankakkreditive und deren Realisierung bis zum Exportkaufmann für Schiffsdieselmotoren, Pumpen und Verdichter sowie für galvanotechnische Anlagen. Bis dahin waren Jahre vergangen und die Aufnahme eines Studiums zum Außenhandelskaufmann lag in dieser Zeit.
Ich war nun der Meinung, jetzt geht es nur noch aufwärts, insbesondere beruflich und finanziell. Nichts fehlte mehr zum Glücklich Sein. Ich hatte es geschafft bis zu einem eigenen Büro, einer Sekretärin, die ständig Gallenkoliken bekam und sogar zu internationalen Kontakten mit Käufern aus der ganzen Welt. Sprachen waren für mich kein Problem. Außer für die russische Sprache, die jeder lernen musste, besaß unser Unternehmen eine große Dolmetscherabteilung. Besuchte eine Delegation aus Afrika oder auch aus China unser Unternehmen, so genügte ein Anruf in der Dolmetscherabteilung und in wenigen Minuten stand ein Übersetzer in der gewünschten Sprache zur Verfügung. Eines Tages rief mich mein Chef - dieser große Mann, der mich damals aus dem Schreibbüro geholt hatte - in sein Zimmer. Er war mir sehr sympathisch, in der Arbeit sehr genau im Detail und er erkundigte sich auch über das Befinden seiner Mitarbeiter und deren Familien. Er fragte mich, ob ich Interesse hätte, in ein TKB nach Paris zu gehen. Ich wusste inzwischen, dass TKB’s –Technisch-Kommerziell-Büros bedeutete, da ja die DDR international als selbstständiger Staat nicht anerkannt wurde und so diese als Ersatz-Botschaften im kapitalistischen Ausland bestanden. „Wenn Sie dem zustimmen, dann werden wir Sie sofort zum Intensivkurs für Französisch delegieren“, hörte ich ihn nun sagen. „Ja“, antwortete ich, überrascht über dieses Angebot und dankte meinem Chef für das Vertrauen.