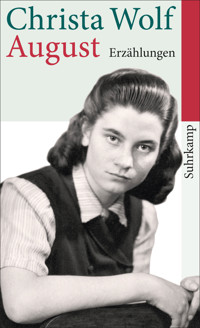17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie versetzt man sich in die eigene Kindheit zurück, wie stellt man die eigene Lebensgeschichte dar? In Kindheitsmuster entwickelt Christa Wolf eine neue Art des autobiographischen Schreibens. Sie erzählt von Nelly Jordan, die in den Jahren zwischen 1933 und 1947 heranwächst und Krieg und Flucht erlebt, aber auch von der erwachsenen Frau, die Jahrzehnte später an einem heißen Sommertag ihre nun polnische Heimatstadt besucht und sich an das Kind erinnert, das sie einmal war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 764
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts wächst Nelly Jordan in einer kleinen Stadt jenseits der Oder heran. Gemeinsam mit ihrer Familie erlebt sie Krieg und Flucht, die Ankunft in einem mecklenburgischen Dorf, die Anstrengungen, den Alltag zu organisieren. Jahrzehnte später begibt sich die erwachsene Frau an einem heißen Sommertag auf eine Reise in ihre nun polnische Heimatstadt, um sich an das Kind zu erinnern, das sie einmal war.
Wie versetzt man sich in die eigene Kindheit zurück, wie erzählt man die eigene Lebensgeschichte? In Kindheitsmuster entwickelt Christa Wolf ein autobiographisches Schreiben, das sich der Frage stellt, wie Erinnerung in die Ordnung der Sprache übertragen werden kann.
Christa Wolf, geboren am 18. März 1929 in Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski), starb am 1. Dezember 2011 in Berlin. Ihr Werk, das im Suhrkamp Verlag erscheint, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Georg-Büchner-Preis und dem Deutschen Bücherpreis für ihr Gesamtwerk. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud (st 4275).
Christa Wolf
Kindheitsmuster
Suhrkamp
Die Erstausgabe von Kindheitsmuster erschien 1976 im Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar.
Der Text, der dem 2000 erschienenen Band 5 der von Sonja Hilzinger herausgegebenen Werke in zwölf Bänden folgt, wurde für diese Ausgabe durchgesehen und korrigiert.
Umschlagfoto: Wolfgang Mallwitz
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2007
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-74140-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
1 In der dritten Person leben lernen. Ein Kind erscheint
2 Wie funktioniert das Gedächtnis? Familienbilder
3 Alles ist verkehrt. Glitzerwörter. Wie Scheu entsteht
4 Realitätssinn. Wiedererlangen der Sehkraft. Eine Hochzeit wird gestiftet
5 Die Verstellten sind verstummt. Das neue Haus
6 Erinnerungslücken. »Friedenszeiten«. Einübung in Haß
7 Nachrichtensperre. Vorkrieg. Das weiße Schiff
8 »Mit meiner verbrannten Hand ...« Entblößung der Eingeweide: Krieg
9 Wie sind wir so geworden, wie wir heute sind? Hörigkeit
10 Verführung zur Selbstaufgabe. Gedächtnisverlust. Die Lehrerin
11 Betroffene und Nichtbetroffene. Endlösung
12 Ein herausfallendes Kapitel. Hypnose
13 Strukturen des Erlebens – Strukturen des Erzählens. Flucht wider Willen
14 »Verfallen« – ein deutsches Wort. Familientreck
15 Die verunreinigte Wahrheit. Der Satz des KZlers
16 Überlebenssyndrom. Das Dorf
17 Ein Kapitel Angst. Die Arche
18 Der Stoff der Zeiten. Die Krankheit. Genesung
Wo ist das Kind, das ich gewesen,
ist es noch in mir oder fort?
Weiß es, daß ich es niemals mochte
und es mich auch nicht leiden konnte?
Warum sind wir so lange Zeit
gewachsen, um uns dann zu trennen?
Warum starben wir denn nicht beide,
damals, als meine Kindheit starb?
Und wenn die Seele mir verging,
warum bleibt mein Skelett mir treu?
Wann liest der Falter, was auf seinen
Flügeln im Flug geschrieben steht?
Pablo Neruda
Buch der Fragen
Für Annette und Tinka
Alle Figuren in diesem Buch sind Erfindungen der Erzählerin. Keine ist identisch mit einer lebenden oder toten Person. Ebensowenig decken sich beschriebene Episoden mit tatsächlichen Vorgängen. Wer Ähnlichkeiten zwischen einem Charakter der Erzählung und sich selbst oder ihm bekannten Menschen zu erkennen glaubt, sei auf den merkwürdigen Mangel an Eigentümlichkeit verwiesen, der dem Verhalten vieler Zeitgenossen anhaftet. Man müßte die Verhältnisse beschuldigen, weil sie Verhaltensweisen hervorbringen, die man wiedererkennt.
C. W.
1
Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Frühere Leute erinnerten sich leichter: eine Vermutung, eine höchstens halbrichtige Behauptung. Ein erneuter Versuch, dich zu verschanzen. Allmählich, über Monate hin, stellte sich das Dilemma heraus: sprachlos bleiben oder in der dritten Person leben, das scheint zur Wahl zu stehen. Das eine unmöglich, unheimlich das andere. Und wie gewöhnlich wird sich ergeben, was dir weniger unerträglich ist, durch das, was du machst. Was du heute, an diesem trüben 3. November des Jahres 1972, beginnst, indem du, Packen provisorisch beschriebenen Papiers beiseite legend, einen neuen Bogen einspannst, noch einmal mit der Kapitelzahl I anfängst. Wie so oft in den letzten eineinhalb Jahren, in denen du lernen mußtest: die Schwierigkeiten haben noch gar nicht angefangen. Wer sich unterfangen hätte, sie dir der Wahrheit nach anzukündigen, den hättest du, wie immer, links liegenlassen. Als könnte ein Fremder, einer, der außen steht, dir die Rede abschneiden.
Im Kreuzverhör mit dir selbst zeigt sich der wirkliche Grund der Sprachstörung: Zwischen dem Selbstgespräch und der Anrede findet eine bestürzende Lautverschiebung statt, eine fatale Veränderung der grammatischen Bezüge. Ich, du, sie, in Gedanken ineinanderschwimmend, sollen im ausgesprochenen Satz einander entfremdet werden. Der Brust-Ton, den die Sprache anzustreben scheint, verdorrt unter der erlernten Technik der Stimmbänder. Sprach-Ekel. Ihm gegenüber der fast unzähmbare Hang zum Gebetsmühlengeklapper: in der gleichen Person.
Zwischenbescheide geben, Behauptungen scheuen, Wahrnehmungen an die Stelle der Schwüre setzen, ein Verfahren, dem Riß, der durch die Zeit geht, die Achtung zu zollen, die er verdient.
In die Erinnerung drängt sich die Gegenwart ein, und der heutige Tag ist schon der letzte Tag der Vergangenheit. So würden wir uns unaufhaltsam fremd werden ohne unser Gedächtnis an das, was wir getan haben, an das, was uns zugestoßen ist. Ohne unser Gedächtnis an uns selbst.
Und die Stimme, die es unternimmt, davon zu sprechen.
Damals, im Sommer 1971, gab es den Vorschlag, doch endlich nach L., heute G., zu fahren, und du stimmtest zu.
Obwohl du dir wiederholtest, daß es nicht nötig wäre. Aber sie sollten ihren Willen haben. Der Tourismus in alte Heimaten blühte. Zurückkehrende rühmten die fast durchweg freundliche Aufnahme durch die neuen Einwohner der Stadt und nannten Straßenverhältnisse, Verpflegung und Unterkunft »gut«, »passabel«, »ordentlich«, was du dir alles ungerührt anhören konntest. Was die Topographie betreffe, sagtest du, auch um den Anschein wirklichen Interesses zu erwecken, könntest du dich ganz auf dein Gedächtnis verlassen: Häuser, Straßen, Kirchen, Parks, Plätze – die ganze Anlage dieser im übrigen kaum bemerkenswerten Stadt war vollständig und für immer in ihm aufgehoben. Eine Besichtigung brauchtest du nicht. Trotzdem, sagte H. Da fingst du an, die Reise gewissenhaft vorzubereiten. Der visafreie Reiseverkehr war zwar noch nicht eingeführt, aber schon damals wurden die Bestimmungen lax gehandhabt, so daß der nichtssagende Vermerk »Stadtbesichtigung«, in die dreifach auszufertigenden Antragsformulare unter der Rubrik »Begründung« eingetragen, anstandslos durchging. Zutreffende Angaben wie »Arbeitsreise« oder »Gedächtnisüberprüfung« hätten Befremden erregt. (Besichtigung der sogenannten Vaterstadt!) Die neuen Paßfotos fandet ihr – im Gegensatz zu den Angestellten der Volkspolizeimeldestelle – euch unähnlich, eigentlich abscheulich, weil sie dem Bild, das ihr von euch hattet, um den entscheidenden nächsten Altersschritt voraus waren. Lenka war, wie immer, gut getroffen, nach eurer Meinung. Sie selbst verdrehte die Augen, um sich zu ihren Fotos nicht äußern zu müssen.
Während die Anträge auf Ausreise und bei der Industrie-und Handelsbank die Gesuche um Geldumtausch liefen, bestellte Bruder Lutz in der Stadt, die in deinen Formularen zweisprachig, unter verschiedenen Namen auftauchte, als »Geburtsort« L. und als »Reiseziel« G., vorsichtshalber telegrafisch Hotelzimmer, denn ihr kennt in deiner Heimatstadt keine Menschenseele, bei der ihr hättet übernachten können. Fristgerecht konntet ihr sowohl die Anlagen zum Personalausweis als auch die dreimal dreihundert Zloty in Empfang nehmen, und du verrietest dich erst am Vorabend des geplanten Reisetages, als Bruder Lutz anrief und mitteilte, er habe es nicht geschafft, seine Papiere abzuholen: Da machte es dir nicht das geringste aus, eine ganze Woche später zu fahren.
Es war dann also Sonnabend, der 10. Juli 1971, der heißeste Tag dieses Monats, der seinerseits der heißeste Monat des Jahres war. Lenka, noch nicht fünfzehn und an Auslandsreisen gewöhnt, erklärte auf Befragen höflich, ja, sie sei neugierig, es interessiere sie, doch, ja. H., sowenig ausgeschlafen wie du selbst, setzte sich ans Steuer. An der verabredeten Stelle beim Bahnhof Schönefeld stand Bruder Lutz. Er bekam den Platz neben H., du saßest hinter ihm, Lenkas Kopf auf deinem Schoß, die, eine Gewohnheit aus Kleinkindertagen, bis zur Grenze schlief.
Frühere Entwürfe fingen anders an: mit der Flucht – als das Kind fast sechzehn war – oder mit dem Versuch, die Arbeit des Gedächtnisses zu beschreiben, als Krebsgang, als mühsame rückwärts gerichtete Bewegung, als Fallen in einen Zeitschacht, auf dessen Grund das Kind in aller Unschuld auf einer Steinstufe sitzt und zum erstenmal in seinem Leben in Gedanken zu sich selbst ICH sagt. Ja: am häufigsten hast du damit angefangen, diesen Augenblick zu beschreiben, der, wie du dich durch Nachfragen überzeugen konntest, so selten erinnert wird. Du aber hast eine wenn auch abgegriffene Original-Erinnerung zu bieten, denn es ist mehr als unwahrscheinlich, daß ein Außenstehender dem Kind zugesehen und ihm später berichtet haben soll, wie es da vor seines Vaters Ladentür saß und in Gedanken das neue Wort ausprobierte, ICH ICH ICH ICH ICH, jedesmal mit einem lustvollen Schrecken, von dem es niemandem sprechen durfte. Das war ihm gleich gewiß.
Nein. Kein fremder Zeuge, der so viele unserer Erinnerungen an die frühe Kindheit, die wir für echt halten, in Wirklichkeit überliefert hat. Die Szene ist legitimiert. Die Steinstufe (es gibt sie ja, du wirst sie nach sechsunddreißig Jahren wiederfinden, niedriger als erwartet: Aber wer wüßte heutzutage nicht, daß Kindheitsstätten die Angewohnheit haben zu schrumpfen?). Das unregelmäßige Ziegelsteinpflaster, das zu des Vaters Ladentür führt, Pfad im grundlosen Sand des Sonnenplatzes. Das Spätnachmittagslicht, das von rechts her in die Straße einfällt und von den gelblichen Fassaden der Pflesserschen Häuser zurückprallt. Die steifgliedrige Puppe Lieselotte mit ihren goldblonden Zöpfen und ihrem ewigen rotseidenen Volantkleid. Der Geruch des Haares dieser Puppe, nach all den Jahren, der sich so deutlich und unvorteilhaft von dem Geruch der echten, kurzen, dunkelbraunen Haare der viel älteren Puppe Charlotte unterschied, die von der Mutter auf das Kind gekommen war, den Namen der Mutter trug und am meisten geliebt wurde. Das Kind selbst aber, das nun zu erscheinen hätte? Kein Bild. Hier würde die Fälschung beginnen. Das Gedächtnis hat in diesem Kind gehockt und hat es überdauert. Du müßtest es aus einem Foto ausschneiden und in das Erinnerungsbild einkleben, das dadurch verdorben wäre. Collagen herstellen kann deine Absicht nicht sein.
Vor dem ersten Satz wäre hinter den Kulissen alles entschieden. Das Kind würde die Regieanweisungen ausführen: man hat es ans Gehorchen gewöhnt. Sooft du es brauchtest – die ersten Anläufe werden immer verpatzt –, würde es sich auf die Steinstufe niederhocken, die Puppe in den Arm nehmen, würde, verabredungsgemäß, in vorgeformter innerer Rede darüber staunen, daß es zum Glück als die echte Tochter seiner Eltern, des Kaufmanns Bruno Jordan und seiner Ehefrau Charlotte, und nicht etwa als Tochter des unheimlichen Kaufmanns Rambow von der Wepritzer Chaussee auf die Welt gekommen ist. (Kaufmann Rambow, der den Zuckerpreis von achtunddreißig Pfennig für das Pfund um halbe oder ganze Pfennige unterbot, um die Jordansche Konkurrenz am Sonnenplatz auszustechen: Das Kind weiß nicht, wie seine Beklemmung vor Kaufmann Rambow entstanden ist.) Aus dem Wohnzimmerfenster hätte die Mutter nun das Kind zum Abendbrot zu rufen, wobei sein Name, der hier gelten soll, zum erstenmal genannt wird: Nelly! (Und so, nebenbei, auch der Taufakt vollzogen wäre, ohne Hinweis auf die langwierigen Mühen bei der Suche nach passenden Namen.)
Nelly hat nun hineinzugehen, langsamer als gewöhnlich, denn ein Kind, das zum erstenmal in seinem Leben einen Schauder gespürt hat, als es ICH dachte, wird von der Stimme der Mutter nicht mehr gezogen wie von einer festen Schnur. Das Kind geht am Eckschaufenster des väterlichen Ladens vorbei, das mit Kathreiner-Malzkaffee-Päckchen und Knorr’s Suppenwürsten dekoriert sein mag und das heute (du weißt es seit jenem Julisonnabend des Jahres 71) zu einer Garageneinfahrt erweitert ist, in der vormittags um zehn, als ihr ankamt, ein Mann in grünem Arbeitshemd mit aufgekrempelten Ärmeln sein Auto wusch. Ihr zogt den Schluß, daß alle die Menschen, die jetzt am Sonnenplatz wohnen – auch jene aus den neugebauten Häusern –, im Genossenschaftsladen unten an der Wepritzer Chaussee kaufen, ehemals Kaufmann Rambow. (Wepritz heißt Weprice, wie es vermutlich auch früher geheißen hat, denn selbst in deiner Schulzeit wurde zugegeben, daß Ortsnamensendungen auf -itz und -ow auf slawische Siedlungsgründungen hindeuten.) Das Kind, Nelly, biegt um die Ecke, steigt die drei Stufen hoch und verschwindet hinter seiner Haustür, Sonnenplatz 5.
Da hättest du es also. Es bewegt sich, geht, liegt, sitzt, ißt, schläft, trinkt. Es kann lachen und weinen, Sandkuten bauen, Märchen anhören, mit Puppen spielen, sich fürchten, glücklich sein, Mama und Papa sagen, lieben und hassen und zum lieben Gott beten. Und das alles täuschend echt. Bis ihm ein falscher Zungenschlag unterliefe, eine altkluge Bemerkung, weniger noch: ein Gedanke, eine Geste, und die Nachahmung entlarvt wäre, auf die du dich beinahe eingelassen hättest.
Weil es schwerfällt, zuzugeben, daß jenes Kind da – dreijährig, schutzlos, allein – dir unerreichbar ist. Nicht nur trennen dich von ihm die vierzig Jahre; nicht nur behindert dich die Unzuverlässigkeit deines Gedächtnisses, das nach dem Inselprinzip arbeitet und dessen Auftrag lautet: Vergessen! Verfälschen! Das Kind ist ja auch von dir verlassen worden. Zuerst von den anderen, gut. Dann aber auch von dem Erwachsenen, der aus ihm ausschlüpfte und es fertigbrachte, ihm nach und nach alles anzutun, was Erwachsene Kindern anzutun pflegen: Er hat es hinter sich gelassen, beiseite geschoben, hat es vergessen, verdrängt, verleugnet, umgemodelt, verfälscht, verzärtelt und vernachlässigt, hat sich seiner geschämt und hat sich seiner gerühmt, hat es falsch geliebt und hat es falsch gehaßt. Jetzt, obwohl es unmöglich ist, will er es kennenlernen.
Auch der Tourismus in halbversunkene Kindheiten blüht, wie du weißt, ob dir das paßt oder nicht. Dem Kind ist es gleichgültig, warum du diese Such- und Rettungsaktion nach ihm startest. Es wird unbetroffen dasitzen und mit seinen drei Puppen spielen (die dritte, Ingeborg, ist eine Babypuppe aus Zelluloid, ohne Haar, mit einem himmelblauen Strampelanzug aus Flanell). Die Hauptmerkmale der verschiedenen Lebensalter sind dir geläufig. Ein dreijähriges normal entwickeltes Kind trennt sich von der dritten Person, für die es sich bis jetzt gehalten hat. Woher aber dieser Stoß, den das erste bewußt gedachte ICH ihm versetzt? (Alles kann man nicht behalten. Warum aber dies? Warum nicht, zum Beispiel, die Geburt des Bruders, kurze Zeit später?) Warum sind Schreck und Triumph, Lust und Angst für dieses Kind so innig miteinander verbunden, daß keine Macht der Welt, kein chemisches Labor und gewiß auch keine Seelenanalyse sie je wieder voneinander trennen werden?
Das weißt du nicht. Alles Material, aufgehäuft und studiert, beantwortet solche Fragen nicht. Doch sage nicht, es war überflüssig, wochenlang in der Staatsbibliothek die tief verstaubten Bände deiner Heimatzeitung durchzusehen, die sich, zu deinem und der hilfsbereiten Bibliothekarin ungläubigen Staunen, tatsächlich im Magazin befunden hatten. Oder im »Haus des Lehrers« zu jenem streng versiegelten Raum vorzudringen, wo bis an die Decke die Schulbücher deiner Kindheit gestapelt sind, als Gift sekretiert, nur gegen Vorlage einer Sonderbeschreibung entleihbar: Deutsch, Geschichte, Biologie.
(Erinnerst du dich, was Lenka sagte, nachdem sie die Seiten im Biologiebuch der zehnten Klasse betrachtet hatte, auf denen Vertreter niederer Rassen – semitischer, ostischer – abgebildet sind? Sie sagte nichts. Sie gab dir wortlos das Buch zurück, das sie heimlich genommen hatte, und äußerte kein Verlangen, es noch einmal zu haben. Dir kam es vor, als betrachte sie dich an diesem Tag anders als sonst.)
Erinnerungshilfen. Die Namenlisten, die Stadtskizzen, die Zettel mit mundartlichen Ausdrücken, mit Redewendungen im Familienjargon (die übrigens nie benutzt wurden), mit Sprichwörtern, von Mutter oder Großmutter gebraucht, mit Liedanfängen. Du begannst Fotos zu sichten, die nur spärlich zur Verfügung stehen, denn das dicke braune Familienalbum wurde wahrscheinlich von den späteren Bewohnern des Hauses an der Soldiner Straße verbrannt. Nicht zu reden von der Unzahl von Zeitinformationen, die einem, wenn man darauf achtet, aus Büchern, Fernsehsendungen und alten Filmen zufließt: Umsonst war das alles sicher nicht. Wie es nicht umsonst sein mag, gleichzeitig den Blick für das, was wir »Gegenwart« nennen, zu schärfen. »Massive Bombenangriffe der USA-Luftwaffe auf Nordvietnam.« Auch das könnte ins Vergessen sinken.
Auffallend ist, daß wir in eigener Sache entweder romanhaft lügen oder stockend und mit belegter Stimme sprechen. Wir mögen wohl Grund haben, von uns nichts wissen zu wollen (oder doch nicht alles – was auf das gleiche hinausläuft). Aber selbst wenn die Hoffnung gering ist, sich allmählich freizusprechen und so ein gewisses Recht auf den Gebrauch jenes Materials zu erwerben, das unlösbar mit lebenden Personen verbunden ist – so wäre es doch nur diese geringfügige Hoffnung, die, falls sie durchhält, der Verführung zum Schweigen und Verschweigen trotzen könnte.
Sowieso bleibt zunächst vielerlei Unverfängliches zu beschreiben. Nimm bloß den Sonnenplatz, dessen alten Namen du, nicht ohne Rührung, ins Polnische übersetzt auf den neuen blauen Straßenschildern wiederfandest. (Alles, was verwendbar geblieben war, freute dich, besonders Namen; denn zu vieles, Namen wie Adolf-Hitler-Straße und Hermann-Göring-Schule und Schlageterplatz, war unverwendbar für die neuen Bewohner der Stadt.) Mag sein, der Platz war auch früher schon ein bißchen schäbig. Stadtrand eben. Zweistöckige Wohnblocks der GEWOBA (ein Zauberwort, dessen Entschlüsselung als GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT Nelly enttäuschte), Anfang der dreißiger Jahre in den weißen Flugsand der Endmoräne gesetzt, die die Wepritzer Berge, geologisch gesehen, darstellten. Eine windige Angelegenheit – dies die Ausdrucksweise der Mutter –, denn die Sandwüste war so gut wie immer in Bewegung. Bei jedem Sandkorn, das dir zwischen die Zähne gerät, schmeckst du den Sand vom Sonnenplatz. Nelly hat ihn oft zu Kuchen verbacken und gegessen. Sand reinigt den Magen.
An jenem glutheißen Sonnabend des Jahres 71: Kein Hauch. Kein Stäubchen, das sich gerührt hätte. Ihr kamt, wie auch früher immer, von »unten«, das heißt von der Chaussee her, wo unter mächtig erstarkten Linden die Linie I der Städtischen Straßenbahn endet, auf der immer noch die alten rot-gelben Wagen ihren Dienst versehen. Das Auto hattet ihr an der Straße, vor der Südflanke der Pflesserschen Häuser abgestellt, die – mögen sie heute heißen, wie sie wollen – als riesiges Quadrat von zweihundert Meter Seitenlänge einen sehr großen Innenhof umschließen, in den ihr, den Sonnenweg hinaufgehend, den gewohnten Einblick durch Torbögen hattet: Alte Leute sitzen auf Bänken und sehen Kindern beim Spielen zu. Feuerbohnen und Ringelblumen.
Wie einst – als in diesen Häusern, die ungestört um fast vierzig Jahre gealtert waren, Bruno Jordans schlecht zahlende Kundschaft wohnte – galt das Verbot, einen dieser Torbögen zu durchschreiten, einen dieser Höfe zu betreten. Daß kein GEWOBA-Kind seinen Fuß ungestraft auf Pflesserschen Grund setzte, war ein für allemal ausgemacht durch ein ungeschriebenes Gesetz, das keiner verstand und jeder hielt. Der Bann war gebrochen, der Haß zwischen den Kinderbanden vergangen. Doch an Stelle der Pfiffe und Steinwürfe der »Pflesserschen« bewachten die stummen Blicke der Alten auf den Bänken ihre Höfe vor Fremden. Die alte Sehnsucht, einmal auf einer von diesen Bänken zu sitzen, über die Jahre hin lebendig geblieben, war heute so unerfüllbar wie einst, mochten die Gründe dafür gewechselt haben.
Merkwürdig, daß Bruder Lutz, der um vier Jahre Jüngere, diese Scheu nicht nur verstand, sondern zu teilen schien, denn er war es, der Lenka zurückhielt, als sie unbefangen durch den Torweg gehen wollte, der Beat-Musik nach, die von den Höfen kam, gezogen von der Lust auf Gleichaltrige. Laß, sagte Lutz, bleib hier. – Aber warum denn bloß? – Besser so. Im Weitergehen rechnetest du ihm vor, daß er mit genau vier Jahren den Sonnenplatz verlassen und ihn, da kein Anlaß vorlag, später nicht wieder besucht habe. Ja, sagte er, ohne sich zu einer Erklärung dafür herbeizulassen, woher er wußte, daß man die Pflesserschen Höfe nicht betreten darf.
Nicht daß es an Aufforderungen dazu gefehlt hätte. Nelly hätte an der Seite ihres Vaters, der sie, anders als die Mutter, gerne beizeiten in die »Usancen« des praktischen Lebens einführte, sonntagvormittags, wenn er mit seinem dicken schwarzen Kontobuch Schulden eintreiben ging, in jeden der übelriechenden Hausflure und in jeden beliebigen feuerbohnenbewachsenen Hof eintreten können. Aber aus übertriebenem Schamgefühl, das sie, wie alle Jordans fanden, von ihrer Mutter hatte, weigerte sie sich glatt, den Vater auf diesen Gängen zu begleiten; wie sie auch dem Ansinnen, bei Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen im Kundenkreis Blumentöpfe und Gratulations- beziehungsweise Beileidskarten auszutragen, dickköpfig Widerstand entgegensetzte.
Gedächtnis. Im heutigen Sinn: »Bewahren des früher Erfahrenen und die Fähigkeit dazu.« Kein Organ also, sondern eine Tätigkeit und die Voraussetzung, sie auszuüben, in einem Wort. Ein ungeübtes Gedächtnis geht verloren, ist nicht mehr vorhanden, löst sich in nichts auf, eine alarmierende Vorstellung. Zu entwickeln wäre also die Fähigkeit des Bewahrens, des Sich-Erinnerns. Vor deinem inneren Auge erscheinen Geisterarme, die in einem trüben Nebel herumtasten, zufällig. Du besitzt die Methode nicht, systematisch durch alle Schichten durchzudringen bis zum Grund. Energie wird verpulvert, ohne einen anderen Erfolg als den, daß du müde wirst und dich am hellerlichten Vormittag schlafen legst.
Da kommt deine Mutter und setzt sich, obwohl sie ja tot ist, zu euch allen in das große Zimmer, ein insgeheim erwünschter Vorgang. Die ganze Familie ist versammelt, Lebende und Tote. Du bist die einzige, die die einen von den anderen unterscheiden kann, mußt aber selber in die Küche gehen, den großen Abwasch machen. Die Sonne scheint herein, aber du bist traurig und verschließt die Tür, damit niemand kommen und dir helfen kann.
Plötzlich ein Schreck bis in die Haarspitzen: Auf dem Tisch im großen Zimmer das Manuskript, auf dessen erster Seite in großen Buchstaben nur das Wort »Mutter« steht. Sie wird es lesen, wird deinen Plan vollständig erraten und sich verletzt fühlen ...
(Damit beginnen, riet H. Du weigertest dich. Mag sich ausliefern, wer will. Es war der Januar 1971. Du gingst in alle Sitzungen, Beiräte, Präsidien und Vorstände, die sich in jedem neuen Jahr zu fieberhafter Tätigkeit getrieben fühlen. Der Staub auf dem Schreibtisch blieb liegen, natürlich kam es zu Vorwürfen, die du nur zurückweisen konntest: mit dem Hinweis auf unabweisbare Verpflichtungen.)
Der Sonnenplatz ist, soviel du weißt, in deinen Träumen niemals vorgekommen. Nie hast du im Traum vor diesem Eckhaus Nummer 5 gestanden, das heute, sachlich den Tatsachen Rechnung tragend, diese seine Nummer zweimal bekanntgibt: durch die altbekannte, verwitterte, mit Zement an die Hauswand gespritzte 5 und gleich daneben durch das neue weiße Emailleschild mit derselben Zahl in Schwarz. Nie hast du von den roten Geranien geträumt, die heute wie damals vor fast allen Fenstern blühen oder blühten. Ungewohnt nur die weißen Sonnenlaken hinter den Scheiben. Charlotte Jordan hatte für ihr Wohnzimmerfenster die modernen Gitterstores angeschafft. Keine Erinnerung an die Gardine des Elternschlafzimmers. Im Kinderzimmer hing jener blau-gelb gestreifte Vorhang, der das Morgenlicht so filterte, daß Nelly lustvoll erwachte. Wenn nicht, wie einmal in Nellys fünftem Lebensjahr, sich in eben diesem Dämmerlicht ein Mörder in das Zimmer geschlichen hat, ein buckliges Männchen (»Will ich in mein Stüblein gehn, will mein Müslein essen, steht ein bucklig Männlein da, hat’s schon halber gessen«), sich über das Kopfende von Brüderchens Holzgitterbett beugt, ein blankes Messer in der Hand hält, dessen Spitze sich schon gegen das Herz des Bruders richtet und es durchbohren wird – es sei denn, Schwester Nelly höre in letzter Sekunde auf, sich schlafend zu stellen, fasse Mut (o mein Gott, sie tut es!) und schleiche sich unendlich langsam, unendlich vorsichtig hinter dem Rücken des Mörders hinaus in den Flur, alarmiere die Mutter, die im Unterrock, ungläubig, aus dem Badezimmer kommt und lachend mit einer Hand den Kleiderhaufen zusammenstukt, der sich auf der Stuhllehne an des Bruders Bett zu einem Kapuzenmännchen aufgetürmt hat. (Sollte das die erste Erinnerung an den Bruder sein?)
Nicht erzählt wird, daß die Mutter Nellys Wange tätschelt, sie halb mitleidig »brav« nennt, weil sie so an dem Brüderchen hängt, sich so ängstigt; daß Nelly in Tränen ausbricht, obgleich jetzt »alles gut« ist. Wie konnte alles gut sein, wenn sie selbst nicht gut war.
In das Haus seid ihr nicht hineingekommen. Ohne ersichtlichen Grund bliebst du links von der Treppe stehen, an den neuen achteckigen Peitschenmast gelehnt, dicht neben dem verfallenden niedrigen Lattenzaun, hinter dem ein Rest von Vorgarten sich erhält. Die Frau mit dem Kind auf dem Schoß, die auf der obersten Treppenstufe saß, hätte euch den Eintritt nicht verwehrt. Sie mag sich gedacht haben, warum ihr, halblaut in der ihr fremden Sprache miteinander redend, ein paar Fotos machtet, auf denen du jetzt, so scharf sind sie, die Stufen vor der rotbraunen Haustür nachzählen kannst: Es sind fünf. Du kannst auch, wenn es darauf ankäme, das Kennzeichen des Autos feststellen, das in dem zur Garage erweiterten ehemaligen Schaufenster gewaschen wird: ein alter Pobeda mit der Nummer ZG 8461; und – wenn auch die Bildschärfe im Hintergrund nachläßt – du kannst auf dem an der Hauswand angebrachten Straßenschild die polnische Schreibweise des Wortes »Sonnenplatz« erahnen: Plac Słoneczny, was du ohne Vermittlung durch das Russische kaum entziffert hättest.
Insgeheim arbeitest du, während du scheinbar unbeweglich dastehst, an der Zimmereinteilung der Wohnung im Hochparterre links, von der sich trotz angestrengter Konzentration nur eine lückenhafte Vorstellung herstellen will. Orientierung in Räumen ist deine starke Seite nie gewesen. Bis dir »zufällig« – Zufall nie anders als zwischen Anführungszeichen – jener bucklige Brudermörder erschien und dich einschleuste in das Kinderzimmer, in dem rechts neben der Tür also des Bruders Bett steht, links der weiße Schrank, an dem Nelly sich vorbeidrückt, hinaus in den Korridor, auf den aus der Badezimmertür schräg gegenüber das gelbe Licht fällt.
Und so weiter. Die Frau auf der Treppe – wie grüßt man auf polnisch? – wirst du nicht behelligen müssen. Ungesehen kannst du dich in die vergessene Wohnung einschleichen, ihren Bauplan ausspionieren, indem du dich den alten unplanmäßig ausbrechenden Leidenschaften noch einmal überläßt. So wirst du sehen, was das drei-, fünf-, siebenjährige Kind sah, wenn es vor Angst, Enttäuschung, Freude oder Triumph bebte.
Die Probe: Das Wohnzimmer. Am Ende des Flurs, das ist gesichert. Vormittagslicht. Die Wanduhr rechts hinter dem hellbraunen Kachelofen. Der kleine Zeiger rückt auf die Zehn. Das Kind hält die Luft an. Als die Uhr zu schlagen anhebt, ein helles, eiliges Schlagen, schneidet Nelly ihre gräßlichste Fratze; hofft und fürchtet, Frau Elste möge recht behalten mit ihrer Drohung: daß einem »das Gesicht stehenbleibt«, wenn die Uhr schlägt. Der Heidenschreck, den alle kriegen würden, voran die Mutter. Auf einmal würde man sie um ihr richtiges Gesicht anflehn; dann, wenn alles nichts half, steckte man sie wohl ins Bett und telefonierte nach Doktor Neumann, der so geschwind wie der Wind in seinem kleinen Auto vorfuhr und seine riesenlange Gestalt über ihr Bett beugte, um überrascht das stehengebliebene Gesicht zu betrachten, dem Kind das Fieber zu messen und Schwitzpackungen zu verordnen, die das Gesicht wieder auftauen sollten: Kopf hoch, Homunkulus, das kriegen wir. Jedoch sie kriegten es nicht, und man mußte sich daran gewöhnen, daß ihr weiches, liebes, gehorsames Gesicht gräßlich blieb. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagte Frau Elste.
Die Uhr hat zu Ende geschlagen, Nelly rennt zum Flurspiegel und glättet mühelos das Gesicht. (Da stand also schon die weiße Flurgarderobe mit dem viereckigen Spiegel.) Der Antwort auf die brennende Frage, ob Liebe wirklich um kein Stück kleiner wird, wenn man sie unter mehrere aufteilt, ist sie nicht nähergekommen. Dummchen, sagt die Mutter, meine Liebe reicht doch für dich und das Brüderchen. Die Butter, die sie im Laden verkaufte, reichte auch nicht für alle, denn Lieselotte Bornow aß Margarinestullen.
Jetzt steht Nelly am Küchentisch (die einzige Gelegenheit, einen Blick in die Küche zu werfen, auf den mit grünem Linoleum bezogenen Tisch vor dem Fenster), beißt in das große gelbe Butterstück, fühlt den Klumpen im Mund schmelzen und als mildes fettiges Bächlein durch die Kehle rinnen, noch einmal, lutscht den Rest aus der Hand und leckt und schluckt, bis nichts mehr übrig ist.
Da war das Glück schon vorbei. Sie wurde nicht groß und stark und sofort erwachsen. Ihr war übel. Die herrliche gelbe Gier wurde ihr als Fettmangel ausgelegt und in viele widerwärtige Butterbrote zerstückelt. Die mußte sie aufessen, während Frau Elste am Kinderzimmertisch die Wäsche bügelte und ihr beibrachte, wie man Herrentaschentücher zusammenlegt: So, so, so und so – fertig. Wenn Frau Elste sang: Morgenrohot, Morgenrohot, leuchtest mir zum frühen Tohod, quollen ihre sanften braunen Augen gegen ihren Willen beängstigend hervor, und die tennisballgroße Geschwulst an ihrem Hals vollführte die merkwürdigsten, auch für Frau Elste selbst unvorhersehbaren Bewegungen.
Die Lage der Räume hinter jenen drei Fenstern im Hochparterre ist so gut wie aufgeklärt, ewig kann man sowieso nicht hier stehenbleiben. Langsam setzt ihr euch in Richtung Wepritzer Berge in Bewegung. Blindschleichen! Hat jemand Blindschleichen gesagt? In den Wepritzer Bergen soll es vor Blindschleichen nur so gewimmelt haben, wenn man Frau Busch glauben wollte. (Die Buschen! Zum erstenmal seit sechsunddreißig Jahren erscheint die redselige Mutter von Ella Busch aus den Pflesserschen Häusern, verzieht mokant den Mund: Aber Mädel, Blindschleichen sind doch nicht blind!) Doch entging den Leuten, daß sie niemals eine einzige von all den Blindschleichen zu sehen, geschweige denn zu fassen kriegten. Die einzige Erklärung dafür lag auf der Hand: Die Blindschleichen waren verwunschene Königskinder, die sich versteckt hielten, zierliche goldene Krönchen auf ihren fingerschmalen Schlangenköpfchen balancierten und mit gespaltener Zunge lispelnd nach ihren ebenfalls verwunschenen Geliebten riefen.
Daß sie sich für blind ausgaben, bewies nichts als ihre verzweifelte Lage. Unsichtbar, das blieben sie allerdings, und das war nur allzu verständlich. Denn Nelly selbst sehnte sich inständig nach einer Tarnkappe, die ihr helfen könnte, Ungeheuern, bösen Menschen, Zauberern und Hexen zu entkommen, vor allem aber der eigenen aufdringlichen Seele. Die – bleich, blinddarmähnlich, sonst in Magennähe placiert – würde, des Körpers beraubt, allein, nackt und bloß in der Luft schweben, so daß man sie schadenfroh betrachten konnte.
Vielleicht käme die Feuerwehr, wie bei Frau Kaslitzkis entflohenem Wellensittich, um die unstete Seele einzufangen. Alle Welt würde sich auf die Suche nach dem Körper machen, in den die Seele gehörte. Nelly aber würde ihre Seele zu den verwunschenen Blindschleichen schicken und sie dort ihrem überaus öden Schicksal überlassen, während sie selbst, wie eben jetzt, in ihrem Bett liegen und unangefochten grelle, wilde, verbotene Gedanken denken konnte. Nichts würde von nun an in ihr zucken, wenn sie log, nichts sich vor Angst zusammenziehn können oder sich winden, wenn sie sich selbst so leid tun mußte, weil sie womöglich doch ein vertauschtes Kind war: Fundevogel, heimatlos, ungeliebt trotz aller Beteuerungen. (Auch wenn sie im Märchenbuch die Seite überschmiert hat, auf der die Eltern von Hänsel und Gretel den Plan aushecken, ihre Kinder in den Wald zu führen: Wort für Wort steht das ungeheuerliche Gespräch in ihrem Innern, so daß sie abends lauschen muß, wenn das wirkliche Leben der Erwachsenen beginnt, was im Wohnzimmer gesprochen werden mag.)
Ja: Der eigenen Seele ledig sein, der Mutter dreist in die Augen blicken können, wenn sie abends am Bett sitzt und wissen will, ob man ihr alles gesagt hat: Du weißt doch, daß du mir jeden Abend alles sagen sollst? Frech zu lügen: Alles, ja! Und dabei heimlich zu wissen: Niemals mehr alles. Weil es unmöglich ist.
Das vernünftige Kind vergißt seine ersten drei Jahre. Aus dem mit leuchtenden Figuren besetzten Dickicht der Märchen tritt es mit ehrpusseligem Gesicht vor die Fotolinse. Irgendwann hat es erfahren, daß Gehorchen und Geliebtwerden ein und dasselbe ist. Entstellt durch jene Frisur, die man »Schlummerrolle« nennt, mit dem roten Bleyle-Pullover angetan, neben dem Kinderwagen des Bruders aufgebaut. Ein dümmliches Grinsen, Grimasse für Schwesternliebe. Das Gedächtnis, auf die rechte Weise genötigt (das heißt, nicht mit Strafe, nicht einmal mit Schuldgefühl bedroht), liefert Indizien für Bruderzwist, Bruderverrat und Brudermord, rückt aber ums Verrecken kein Bild der schwangeren Mutter heraus, keins von dem neuen Kind an der Mutter Brust. Keine Erinnerung an die Geburt des Bruders.
Da kommt ja auch Schneidermeister Bornow über den Sonnenplatz. Die neuen Häuser sind wie weggeblasen, dafür die alte unkrautbewachsene Einöde, Trampelpfade, Sandkuten. Kinder und Betrunkene haben einen Schutzengel, Schneidermeister Bornow fällt nicht hin. Er verliert auch seine schwarze Schirmmütze mit der Kordel nicht. Über dem Platz ist ein Gesang, der entweicht Schneidermeister Bornow. Durchaus falsch wäre es, zu sagen, Schneidermeister Bornow singt. Denn auf seinem Schneidertisch und auch sonst im Familienkreis singt er niemals, das wäre nicht vorstellbar, Nellys Freundin Lieselotte Bornow gibt es widerwillig zu. König Alkohol ist es, der ihn singen macht, und zum Gespött der Menschheit, sagt die Mutter. Nelly hat ihre eigene Vorstellung. Jeden Sonnabend, denkt sie, wartet der Gesang unten an der Chaussee vor der Eckkneipe auf den Schneidermeister, um sich auf ihm, nur auf ihm, niederzulassen, sobald er aus der Tür tritt – ein großer, schwerer Vogel, dessen Last Herrn Bornow torkeln und schwanken macht und immer ein und dasselbe Lied aus ihm herauspreßt: »Du kannst nicht treu sein, nein nein, das kannst du nicht, wenn auch dein Mund mir wahre Liebe verspricht.« Eine Klage, die Nelly zu Herzen geht und dieses Lied für immer unter die tragischen Gesänge einreiht. Die Sonne schien auf Herrn Bornow, weißt du noch, und er begann laut zu reden und zu schimpfen, und Lieselotte Bornow kam aus Nummer 6 gerannt, mit ihren dünnen, steif abstehenden Zöpfen, und zog ihren Vater am Ärmel ins Haus, ohne die Freundin eines Blickes zu würdigen. »In deinem Herzen, da ist für viele Platz«, sang Lieselottes Vater, und die Trauer, die ihn pünktlich jeden Sonnabendnachmittag ins Wanken brachte, zog sich auch über Nelly zusammen.
Nein, Lenka kann sich an ihren ersten Betrunkenen nicht erinnern. Ihr nähert euch dem Ende der kurzen GEWOBA-Häuserreihe, dem Rand der bewohnten Welt, damals wie heute. Du erkennst die Empfindung wieder, die jedesmal in Nelly aufkam, wenn sie den Fuß über diesen Rand setzte: ein Gemisch aus Verwegenheit, Neugier, Furcht und Einsamkeit. Du fragst dich, ob Nelly etwas abgegangen wäre, wenn sie in einer Mitte aufgewachsen wäre; hätte sie sich, weil sie diese Empfindung brauchte, ihren Weltrand gemacht? Lieselotte Bornow ist das erste Kind, das sich seines Vaters schämt, zu stolz ist, es zuzugeben, das launisch wird, anmaßend, gierig nach unmäßigen Freundschaftsbeweisen, um im Augenblick, da Nelly sie liefert, die Freundschaft aufzukündigen, dann darunter leidet, wie Nelly, aber nichts daran ändern kann. – Meine erste Erinnerung? Lenka erinnert sich, wie entsetzt sie war, als sie ihr Gesicht im Hohlspiegel ihres Kinderlöffels kopfstehen sah und kein Versuch, es wieder umzudrehen, helfen wollte. H. – das wird eine Umfrage nach den frühesten Erinnerungen deiner Begleiter – H. will sich nicht festlegen. »Am ehesten« häusliche Morgenszenen, Streitigkeiten zwischen den Eltern um zu hart gekochte Eier und verlegte Kragenknöpfe, das Aufatmen der Mutter, wenn der Vater aus dem Hause war und sie sich an die Nähmaschine setzen konnte. Bruder Lutz, nicht gewohnt und nicht gewillt, seinem Gedächtnis auf den Grund zu gehen, sagt nur ein Wort: Masern.
Aber da warst du schon dreieinhalb, sagtest du – und Nelly hat sich die Masern von dir geholt, und es war kurz nach dem Richtfest am neuen Haus, und du mußt doch irgendwas anderes, noch Früheres behalten haben. Tut mir leid, sagte Lutz. Gefühlvolle Einzelheiten könne er seiner Frau Schwester nicht bieten.
Hier, sagtest du dann, fangen also die berühmten Wepritzer Berge an, und du legtest genau so viel Ironie in den Satz, wie nötig war, jeden anderen daran zu hindern, ironisch zu werden. Heute führt unpassenderweise ein Stück Betonpiste direkt zu der nahen Hügelkette, wo irgendein »Objekt« steht und das Profil des Horizonts leider verändert hat. Es hatte wohl keinen Sinn, in die Sandhügel hineinzustiefeln. Ginster gibt es auch anderwärts. Man hatte genug gesehen. Dir ging es auch bloß um die drei Akazien: Ob die drei Akazien noch dastehen. Robinien, vermutete H. auf gut Glück, weil hierzulande Robinien immer für Akazien gehalten werden. Akazien! sagtest du. Sie sollten noch dasein.
Das da vielleicht?
Von den drei Akazien, unter denen Nelly ihre Puppen erzogen und ihr erstes englisches Lied gelernt hat, steht eine, und es ist eine Robinie, worüber H. kein Wort verlor. Die Zeiten, da er mit seinen Naturkenntnissen auftrumpfte, waren lange vorbei. Gleichzeitig zwei sehr unterschiedliche Dinge aus verschiedenen Zeiten: Wie süß der Saft ist, den man als Kind aus den Trichtern der Akazienblüten saugt, und dein beleidigtes Schweigen auf einem frühen Spaziergang mit H., weil er dich, die sich etwas zugute hielt auf ihre Vorliebe für märkische Kiefernwälder, bei einer Verwechslung von Kiefer und Fichte ertappt hatte.
Gesagt hast du zu Lutz, daß deine ersten Erinnerungen an ihn alle mit Unrecht, Mord und Zank zu tun haben.
Da kann man nichts machen, sagte er, erinnerte dich nun aber an die große Szene, die unter der Überschrift: Wie Lutz verlorenging und wiedergefunden ward in die Familienchronik eingegangen ist. Jene entsetzliche Stunde, da Nelly, zuerst allein, dann mit der Mutter im wehenden weißen Ladenmantel, schließlich inmitten einer Schar von Nachbarskindern und -frauen, auf der Straße, auf dem Sonnenplatz, in den GEWOBA-Höfen, endlich bis in die Wepritzer Berge hinein den Bruder suchte, alle Stufen von Unruhe über Angst bis zu Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erfuhr und sich immer den einen Satz wiederholen mußte: Wenn er tot ist, bin ich schuld.
(Dies als erster überlieferter Fall von »Schwarzsehen« bei Nelly, eine Anlage, welche die Mutter ihr vererbt hatte; Bruno Jordan, dem das Bedürfnis abging, verstand darunter die innere Vorwegnahme zukünftiger unglücklicher Vorkommnisse und verwies es seiner Frau zeit ihres Lebens, immer so schwarzzusehen. Wenn du doch bloß nicht immer so schwarzsehen müßtest!)
Nach einer geschlagenen Stunde erst kam jemand auf die Idee, im Kinderzimmer den Tisch vom Sofa wegzurücken, und da lag denn der Bruder in seinen roten Strickhosen, und alle konnten herbeiströmen und sich über den schlafenden Lutz kaputtlachen, der von all dem Lärm nicht wach wurde und der nichts davon hatte, daß die Nachbarn mit Schnaps und die Kinder mit Brause auf sein Wiedererscheinen anstießen. Nelly aber lachte nicht und trank nicht, ihr unverwandt unglückliches Gesicht fing die anderen zu stören an, sie schlich sich weg und heulte, als die Mutter erklärend gesagt hatte, das Mädel hänge nun mal so an dem Jungen, es sei nun mal so gewissenhaft. Daß der Bruder gesund und glücklich war, anstatt tot zu sein, schaffte aber die Tatsache nicht aus der Welt, daß eine Schwester über ihren Schularbeiten den Bruder vergessen konnte, daß sie ihm, kaum von den Büchern aufsehend, ein gleichgültiges »Geh schon raus!« hingeworfen hatte, er aber nicht, wie jeder annahm, eigenmächtig davongeschlichen war.
Doch das Geständnis, das aus der liebevollen, gewissenhaften Schwester ein kleines Ungeheuer gemacht hätte, würde nie über ihre Lippen kommen, soviel wußte sie schon. Und deshalb weinte sie. »Ich bin klein, mein Herz ist rein« wollte sie am Abend nicht mehr beten. Sie bestand auf »Müde bin ich, geh zur Ruh« – jenem Lied, das Heinersdorf-Großmutter zu singen pflegte, wenn sie ihr langes weißes Nachthemd angezogen, ihren dünnen grauen Zopf heruntergelassen und ihre Zähne in ein Wasserglas gelegt hatte. In der zweiten Strophe gab es die Zeilen, auf die es Nelly nun ankam: »Hab ich Unrecht heut getan, sieh es lieber Gott nicht an.« – Denn mehr, wahrhaftig, durfte sie nicht hoffen.
Nelly im Schulkindalter, ein Vorgriff. Doch irrt sich, wer hofft, das Thema Brudermord könne ein für allemal verlassen werden. Später wird es keine Rolle mehr spielen: Vielleicht – aber das mag eine abwegige Vermutung sein – hatte es sich erledigt, als es Nelly gelungen war, den Bruder zu verletzen, als die Erwachsenen ihre Tat endlich ernst nehmen mußten: Lutz, dessen rechter Arm in Kissen gepackt war, leise jammernd, Nelly ihm gegenüber, ihn leise anflehend, doch keine Schmerzen mehr zu haben. Die Mutter, im weißen Ladenmantel wie bei allen Unglücksfällen der Kindheit, die wortlos die Schere nimmt und Pullover und Hemd von des Jungen Arm herunterschneidet, das anschwellende Ellenbogengelenk freilegend. Die dann zum Telefon stürzt, verhandelt, wobei das fürchterliche Wort »Krankenhaus« fällt, das Nelly aus dem Kinderzimmer ins Wohnzimmer treibt, wo sie sich bäuchlings über das Sofa wirft und sich die Ohren zuhält. Die Mutter tritt ein, klopft ihr hart mit zwei Fingern auf die rechte Schulter und sagt einen jener übertriebenen Sätze, zu denen sie damals schon neigt: Du bist schuld, wenn sein Arm steif bleibt.
Schuld ist seitdem: eine schwere Hand auf der rechten Schulter und das Verlangen, sich bäuchlings hinzuwerfen. Und eine mattweiße Tür, hinter der die Gerechtigkeit – die Mutter – verschwindet, ohne daß du ihr folgen, Reue äußern oder Verzeihung erlangen kannst.
Damit wäre die letzte Lücke, die Anordnung der Zimmer in der GEWOBA-Wohnung betreffend, geschlossen: Das Schlafzimmer der Eltern, an das sich keine Erinnerung wecken läßt, ist vom Wohnzimmer aus zu erreichen, durch eben jene Tür, hinter der die Mutter sich hastig für die Fahrt ins Krankenhaus fertigmacht und neben der nun auch die Glasvitrine mit den leise klirrenden Sammeltassen auftaucht. Das Gedächtnis, wehrlos, wenn man seinen wunden Punkt getroffen hat, liefert das ganze Wohnzimmer aus, Stück für Stück: schwarzes Büfett, Blumenständer, Anrichte, hochlehnige schwarze Stühle, Eßtisch und gelbseidene Lampe darüber – unnötiger Aufwand für ein Kind, das nur den einen Stuhl brauchte, um einen Nachmittag lang darauf zu sitzen und zu beten, des Bruders Arm möge nicht steif bleiben, da es nicht ertragen könnte, sein Lebtag lang schuldig zu sein.
Doch folgenlose Schuld ist keine Schuld.
Am gleichen Abend noch soll Nelly Tränen lachen. Die erleichterte, gutgelaunte Mutter ahmt die Redeweise des jungen Krankenhausarztes nach, der mit zwei, drei geübten Griffen des Bruders Arm eingerenkt und sie, Charlotte Jordan, fortwährend mit »gnädige Frau« angeredet hat. An Ihnen ist wirklich eine Krankenschwester verlorengegangen, gnädige Frau. Ein wilder Bengel, der Herr Sohn. Kein Wort von der Urheberin der Verrenkung. Nelly ist mit der Gnade der Eltern allein. Für die Angst, die sie ausgestanden hat, belohnt man sie mit Kakao und Eierbrötchen, während Lutz, das abwesende Opfer, zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben muß. Gelernt soll werden: Sich freuen an falschem Lob. Die Lehre wird angenommen.
Hier, unter den drei Akazien, hat Anneliese Waldin, des Oberwachtmeisters Waldin älteste Tochter, Nelly gönnerhaft ihr erstes Lied in englischer Sprache beigebracht, das du zu Lenkas Erstaunen noch immer auswendig kannst und in kindlichem Ton mit falscher Aussprache vorsingst: Baba bläck schiep, häw ju änni wuhl, jes, master, jes, master, srie bäcks fuhl.
Das Lied geht noch weiter. Weiß Lutz eigentlich, daß die Mutter sich immer danach gesehnt hat, Ärztin zu werden? Oder wenigstens Hebamme? Er weiß es, sie hat es bis in ihre letzten Jahre wiederholt: Irgendwas Medizinisches, das wär mein Fall gewesen, und ich freß einen Besen drauf, daß ich mich dazu geeignet hätte. – Sie hätte sich geeignet, da wart ihr euch immer einig. Der Vater natürlich verwies ihr die Sehnsucht: Daß du nie zufrieden sein kannst. – So mach’s doch! hat keiner von euch gesagt. Kinder wollen nicht, daß ihre Mutter ihr Leben ändert. 45, da wäre vielleicht eine Gelegenheit gewesen. 45 hätten sie auch eine nicht mehr junge Frau zur Hebamme ausgebildet. Auf dem Dorf? sagt Lutz. – Das ist es eben.
Unter den drei Akazien ist Nelly zum erstenmal verraten worden, und zwar, wie es sein muß, von ihrem besten Freund Helmut, dem jüngsten Sohn des Polizeioberwachtmeisters Waldin, Sonnenplatz 5, erster Stock rechts. Das Thema »Freundschaft und Verrat« interessiert auch Lenka, sie hat Fragen, durch die sie sich bloßstellt. Seit Wochen läßt ihre Freundin Tina sich nicht mehr blicken, meidet Lenka alle Anlässe, sie zu treffen, aber besorgt bist du erst, seit sie nicht mehr zum Reiten geht, da sie doch Pferde mehr liebt als alles. Daß sie direkte Fragen niemals beantworten wird, wenn sie es nicht will, hast du lernen müssen und hoffst nun heimlich, auf dem Umweg über Nelly etwas über Lenka zu erfahren.
Der Verräter, wenn es ein Kind ist, braucht diejenigen, die ihn zum Verrat anstiften. Ja, sagt Lenka. Die haben nichts davon als vielleicht einen Spaß für zehn Minuten, das ist rätselhaft, nicht wahr. Lenka schweigt. Im Falle von Helmut Waldin waren es seine drei großen Brüder. Wozu hätten die – wenn es mehr war als Spaß – den Beweis gebraucht, daß der Mensch niederträchtig ist?
Es fing ganz harmlos an. Franz warf den Stein, der zufällig den kleinen Bruder traf, ebensogut aber Nelly hätte treffen können, die dicht neben Helmut auf der karierten Decke hockte, mit ihren Puppen, denn sie spielten hier immer Vater Mutter Kind. Als Helmut aufschrie und, genötigt von seinen Brüdern, den Grund für seinen Schrei nennen mußte, waren die maßlos verblüfft: Ein Stein! Von ihnen hatte ja keiner einen Stein nach dem kleinen Bruder geschmissen. Wenn der aber doch an der Schulter getroffen war; wenn aber doch ein kleiner Feuerstein als Beweisstück auf der Decke lag, erhob sich die Frage: Wer hatte ihn geworfen? Es konnte nur jemand sein, der in der Nähe war – logisch, nicht? Wer aber ist, außer uns natürlich, noch in der Nähe, Kleiner? Niemand? Langer, der ist blind, borg ihm mal deine Brille! – Blind? Glaub ich nicht. Der ist bloß ein bißchen schwer von Kapeh. Dem muß man beibringen, wer ihm fast die Bonje eingeschmissen hat.
Lenka scheint voll und ganz zu verstehen, daß Nelly nicht weglief. Aus persönlicher Erfahrung scheint sie zu wissen, daß man gewisse Vorkommnisse erst glaubt, wenn man sie mit eigenen Augen gesehen hat. Nelly muß also mit ansehen, wie seine drei großen Brüder ihren Freund Helmut knuffend und lachend auf die dritte Akazie zutreiben, bis er mit dem Rücken gegen den Stamm steht, während sie ihn – aus Spaß natürlich, denn sie lachen ja die ganze Zeit – immerzu fragen, wer denn außer ihnen noch in der Nähe sei. Aber es ist ja nur noch sie selbst in der Nähe, Nelly, und sie hat ja den Stein nicht geschmissen, das wissen sie doch alle, und Helmut weiß es auch. Also ist es Spaß.
Lenka sagt, nach ihrer Meinung ist es manchmal der pure Neid, wenn sie Verräter brauchen. Du wechselst einen leicht erstaunten Blick mit H., den sie registriert. Inzwischen hält einer der Brüder – das ist jetzt Kutti, der jüngere – dem Helmut die Spitze eines Stöckchens gegen die Kehle, damit er mit dem Getue aufhört. Sie wollen doch ihrem kleinen Bruder nicht zu nahe treten, er soll ihnen doch bloß den Namen sagen. Na? Na? Da hört Nelly, ungläubig, wie Helmut den Namen nennt: Es ist ihr eigener Name. Er weint dabei, sagt ihn aber: Nelly.
Irgendwann hört jeder seinen Namen wie zum erstenmal. Und als nun das Stöckchen von seiner Kehle wegkommt, da ruft Helmut diesen Namen gleich noch mal, denn nun lautet die Frage seiner Brüder, wer ihn also mit Steinen beworfen habe? Nelly! schreit Helmut, weinend zuerst, dann aber, als seine Brüder ihm freundschaftlich in die Seite boxen – na siehst du, Kleiner! –, brüllt er unverlangt immer weiter Nelly, fünfmal, zehnmal. Beim letzten Male lacht er schon.
Lenka schien zu wissen, wie sie lachen, wenn sie verraten haben. Gehen wir, sagtest du. Den Weg zurück, den Nelly damals heulend gerannt ist. Vorbei an dem Stückchen fensterloser Hauswand, an dem Nelly eisern Zehnerball trainierte, bis sie unschlagbar war und sich vor den Wettbewerben an Klopfstange und Kellergeländer – Klimmzug und Bauchaufschwung – drücken konnte, ohne an Ansehen zu verlieren. Vorbei, diesmal ohne Aufenthalt, an der Nummer 5, wo Nelly lange vor euch angekommen ist und nach Herrn Waldin ruft, der schließlich über seine roten Geranien herunterblickt und sich dabei den Uniformrock zuknöpft, aber gleich das Fenster wieder zuknallt, als Nelly seine Söhne bei ihm verklagen will.
Dafür öffnete sich im Hochparterre links das Kinderzimmerfenster, Charlotte Jordan rief ihre Tochter herein und erwartete sie mit dem Ausklopfer hinter der Tür und schlug sie, ohne sie anzuhören, zum verhängnisvollen ersten und einzigen Mal in ihrem Leben (hin und wieder eine Ohrfeige, die rechnet nicht), schrie dabei ganz außer sich – während Nelly stumm blieb, wie immer, wenn ihr Unrecht geschah –, wer ihr das Petzen beigebracht habe, wer denn bloß, wer? Ließ sich dann auf einen Stuhl fallen, brach in Tränen aus, schlug die Hände vors Gesicht und sagte weinend: Mußt du uns ausgerechnet den zum Feind machen?
Was weiter? Die Perle.
(Verständliche, aber vielleicht gefährliche Lust auf Zusammenhänge, vor denen H. von Anfang an warnt, weniger durch Worte als durch seinen Gesichtsausdruck. Er mißtraut allem, was sich fügt.
Auf dem Weg zum Briefkasten, nach dem Abendbrot, saht ihr am sternklaren Himmel den Großen Wagen und den Orion, und du mußtest zugeben, daß das Gefühl, die Sternbilder bezögen sich in irgendeinem Sinn auf dich, dir noch nicht vollständig geschwunden sei. H. wollte dir einreden, eben das steigere deine Schwierigkeiten, Strukturen zu finden, in denen sich heute noch reden läßt: ernüchtert bis auf den Grund, in Verhältnissen, da Verzweifeln eher komisch wirke. – Nach Mitternacht ein dummer Anruf eines Menschen, der sich als Student vorstellt und in aufdringlichem, frechem Ton nach einem »neuen Werk« fragt. Du legtest den Hörer auf, zogst das Telefonkabel heraus, konntest aber vor Erbitterung nicht einschlafen. Auf einmal bildeten sich Sätze, die du als brauchbaren Anfang ansahst; jemand war also mit »du« anzureden. Der Tonfall hatte sich eingestellt. Du wolltest nicht glauben, daß du noch einmal von vorne anfangen solltest, aber am Morgen hatten die Sätze sich erhalten – wurden natürlich später getilgt –, der Tonfall war geblieben. Immer noch ungläubig, begannst du von neuem. Dir war, du hättest nun die Freiheit, über den Stoff zu verfügen. Schlagartig war dir auch klar, daß nicht ein schnell zu machendes Ergebnis zu erwarten war, sondern eine lange Zeit von Arbeit und Zweifel. Daß es nicht beim nächsten Buch Ernst würde, sondern bei diesem. Schön eigentlich, dachtest du.)
Kurz nach dem Zwischenfall mit Helmut Waldin muß Nelly sich die Perle in die Nase gesteckt haben, wovor sie oft und dringlich gewarnt worden war. Eine kleine gelbe Holzperle, wie man sie Kindern schenkt, zum Kettenaufziehn, die aber, einmal im Nasengang, durch kein Pusten und Schnauben wieder herauszubefördern ist, die immer höher zu wandern schien, womöglich bis dahin, wo die Mutter die Gehirnwindungen vermutete und von wo aus es für eine Perle kein Zurück mehr gab. Nelly setzte den für Katastrophenfälle üblichen Mechanismus in Gang: Frau Elste, die Mutter im weißen Kittel, fliegende Finger, Telefon, die Straßenbahn. Eine Frau ihr gegenüber trieb die Geschmacklosigkeit so weit, dem lieben Gott dafür zu danken, daß dieses Kind sich keine Erbse in die Nase gesteckt hatte, die alsbald ins Quellen gekommen wäre, und dann ade, du mein lieb Heimatland!
Nelly hätte den lieben Gott gern aus dem Spiel gelassen. Es lag ihr nicht daran, daß er die Gedanken in ihrem von der Perle bedrohten Gehirn ablas und unter ihnen eine Art Wunsch vorfinden würde: den sträflichen Wunsch, die eigene Mutter zu Tode zu erschrecken, indem man schädigte, was ihr das Liebste war: sich selbst.
Der Arzt, ein Doktor Riesenschlag, nicht imstande, sich die verzwickte Bosheit dieses Kindes vorzustellen, ließ sie auf einem Lederhocker Platz nehmen, klapperte widerwärtig mit Metallinstrumenten auf Emailleschalen, bis er sich entschloß, eines dieser Instrumente in Nellys rechtes Nasenloch einzuführen, wo es sich, angeblich nach dem Regenschirmprinzip, auszudehnen begann und den Innenraum der Nase erweiterte, bis der Perle nichts übrigblieb, als mit einem Blutstrahl zusammen herauszuschießen und auf des Doktors glänzendes Linoleum zu fallen, wobei es »klick« machte, was mit einem gleichmütigen »Na also!« quittiert wurde. Nein, nach Hause nehmen wollte die Mutter diese Unglücksperle nicht, das fehlte noch, aber sie hoffte von Herzen, daß die ganze Kalamität dem Kinde eine Lehre sein werde. Eine Hoffnung, der Doktor Riesenschlag sich in sachlicher Freundlichkeit anschloß, nachdem er einen Zehnmarkschein entgegengenommen und eine Warnung vor kleinen Knöpfen, Bohnen, Linsen, Erbsen, Blumensamen und Kieselsteinen an Mutter und Tochter gerichtet hatte. Besichtigen wollten sie aber seine Sammlung derartiger aus Ohren und Nasen geförderter Fremdkörper – der nun Nellys Perle auch beigefügt würde – keinesfalls.
Eine Ohrfeige, ein scharfes Wort, sogar ein stummer Nachhauseweg wären nach Nellys Empfindungen jetzt am Platze gewesen. Statt dessen erfuhr Nelly, sie habe sich tapfer gehalten. Nicht geklagt, nicht geweint, nichts. Der Mutter schien es wohlzutun, ihre Tochter »tapfer« zu nennen. Es lag ihr nicht daran, zu erfahren, wie sie in ihrem innersten Innern war. Nelly hatte das trostlose Gefühl, daß auch der liebe Gott selbst an dem tapferen, aufrichtigen, klugen, gehorsamen und vor allem glücklichen Kind hing, das sie tagsüber abgab. Wörter wie »traurig« oder »einsam« lernt das Kind einer glücklichen Familie nicht, das dafür früh die schwere Aufgabe übernimmt, seine Eltern zu schonen. Sie zu verschonen mit Unglück und Scham. Die Alltagswörter herrschen: iß und trink und nimm und bitte danke. Sehen hören riechen schmecken tasten, die gesunden fünf Sinne, die man beisammen hat. Ich glaube, daß fünf Pfund Rindfleisch eine gute Brühe geben, wenn man nicht zuviel Wasser nimmt. Alles andere ist Einbildung.
Während ihr zum Auto gingt, fiel dir noch das Spiel ein, das Nelly Lieselotte Bornow aufzwang, lange vor ihrem späteren Zerwürfnis. Sie nannten es »Selbstverzaubern«, und es bestand darin, im hellen gelben Sand des Sonnenplatzes sich auf ein Kommando hin in ein ekles Wesen zu verwandeln: Frosch, Schlange, Kröte, Käfer, Hexe, Schwein, Molch, Lurch. Niemals höhere Lebewesen, immer Ungetier, das in Schmutz und Schlamm lebt und einander rücksichtslos bekämpft. Zerkratzt und dreckig kamen sie abends nach Hause, ertrugen Vorhaltungen und Verbote. Auch die Eltern des Froschkönigs hatten erleben müssen, wie ihr feiner blondhaariger Prinzensohn sich mir nichts, dir nichts – und ganz gewiß nicht ohne seine heimliche Zustimmung – vor ihren Augen in einen glitschigen eklen Frosch verwandelt hatte. Das gab es eben.
Lenka begrüßt euer Auto, das euch vor Rambows ehemaligem Laden erwartet, mit einem dankbaren Blick. Als Nelly vor sechsundzwanzig Jahren und sechs Monaten, am 29. Januar 1945, auf der gleichen Straße ihre Stadt auf der Flucht vor den näher rückenden feindlichen Truppen schnurstracks in westlicher Richtung verließ, hat sie, soviel du weißt, im Vorbeifahren nicht einen Gedanken an den Sonnenplatz und an jenes Kind gewendet, das damals unter der dünneren Schicht von Jahresringen vielleicht tiefer verborgen war als heute, da es sich, unabhängig von gewissen Anweisungen, zu regen beginnt. Zu welchem Ende? Die Frage ist so unheimlich wie berechtigt. (Laßt die Toten ihre Toten begraben!) Ein Gefühl, das jeden Lebenden ergreift, wenn die Erde unter seinen Füßen sich bewegt: Furcht.
2
Wer gäbe nicht viel um eine glückliche Kindheit?
Wer Hand an seine Kindheit legt, sollte nicht hoffen, zügig voranzukommen. Vergebens wird er nach einer Dienststelle suchen, die ihm die ersehnte Genehmigung gäbe zu einem Unterfangen, gegen das der grenzüberschreitende Reiseverkehr – nur als Beispiel – harmlos ist. Das Schuldgefühl, das Handlungen wider die Natur begleitet, ist ihm sicher: Natürlich ist es, daß Kinder ihren Eltern zeitlebens dankbar sind für die glückliche Kindheit, die sie ihnen bereitet haben, und daß sie nicht daran tippen. – Danken? Die Sprache verhält sich, wie erwartet, und läßt »denken«, »gedenken«, »danken« aus ein und derselben Wurzel kommen. So daß nachforschendes Gedenken und das dabei unvermeidlich entstehende Gefühl – für das eine Benennung allerdings zu suchen wäre – im Notfall doch auch als »Äußerung dankbarer Gesinnung« gelten können. Nur eben fehlt wieder ausgerechnet jene Instanz, die den Notfall bescheinigen würde.
Über die Handlungsweise von Nellys Mutter im Januar 1945, bei der »Flucht«, in letzter Minute nicht das Haus, wohl aber die Kinder im Stich zu lassen, hast du natürlich oft nachdenken müssen. Fragen muß man sich, ob sich wirklich in derartig extremen Lagen zwangsläufig und zwingend herausstellt, was einem das Wichtigste ist: durch das, was man tut. Wenn aber der Betreffende nicht vollzählig die Informationen hätte, die ihm erlaubten, seine Entscheidung genau den Umständen anzupassen? Wenn Charlotte Jordan nicht erst nach der Abfahrt des Lastwagens, auf dem nicht nur ihre Kinder, sondern auch die übrige Verwandtschaft die Stadt verließen, die Gewißheit gehabt hätte: Ja, der Feind hat sich auf Kilometer der Stadt genähert; ja, die Garnison rückt im Eilmarsch ab, in Richtung Westen: Wäre sie nicht die erste gewesen, ihre Kinder selbst in Sicherheit zu bringen? Ferner: Hätte sie, Charlotte, es auch nur im entferntesten für möglich gehalten, daß sie ihr Haus nicht mehr betreten, kein Stück seines Inventars je wiedersehen würde – hätte sie dann nicht das dicke braune Familienalbum eingepackt, an Stelle des ganzen Plunders, den sie doch nach und nach aufgaben, abstießen, verloren, bis Nelly an einem schönen Sommermorgen nur noch Schlafanzug und Mantel besaß, die sie natürlich beide am Leibe trug? Um vier Uhr nachmittags die ersten Schüsse vom Stadtrand her (Städtisches Krankenhaus), da ist das Führerbild aus dem Herrenzimmer schon im Zentralheizungsofen verbrannt (das hat mir wohlgetan, sag ich euch), da ist schon entschieden, daß sie, Charlotte, mit nichts als einer Einkaufstasche, in der ein paar gut belegte Brote, eine Thermosflasche mit heißem Kaffee, einige Päckchen Zigaretten (zu Bestechungszwecken) und eine dicke Brieftasche mit Papieren sind, ihr Haus abschließen und weggehen wird. Das braune Album muß entweder bei den Plünderungen verlorengegangen sein, welche die ehemaligen Nachbarn natürlich in den verlassenen Häusern und Wohnungen unternahmen (und zuallererst verständlicherweise in einem Lebensmittelladen), oder es wurde von den späteren polnischen Bewohnern des Hauses verbrannt. Klar, daß ihnen die Erinnerungen ihrer Vorgänger lästig sein mußten.
Doch Fotos, die man oft und lange betrachtet hat, brennen schlecht. Als unveränderliche Standbilder sind sie dem Gedächtnis eingedrückt, es ist bedeutungslos, ob man sie als Beweisstück vorlegen kann. Jenes Foto, dein Leib-und-Magen-Foto, steht dir auf Abruf zur Verfügung, und zwar bis in Einzelheiten (die kleine, leicht nach links geneigte helle Birke am Rande der dunkleren Kiefernschonung, die den Bildhintergrund abgibt): Nelly, dreijährig, splitterfasernackt, als Bildmittelpunkt, Pagenkopf und Körper mit Eichenlaubgirlanden umkränzt, ein Eichenlaubsträußchen in der Hand, mit dem sie in die Kamera winkt. Je kleiner, desto glücklicher – vielleicht ist doch was dran. Vielleicht aber kommt der Reichtum der Kindheit, den jeder empfindet, zustande, indem wir diese Zeit unaufhörlich anreichern durch das Über-Denken, das wir ihr widmen?
Familienleben.
Das Bildchen – vermutlich von Onkel Walter Menzel bei einem Familienausflug nach Altensorge am Bestiensee geknipst, denn Jordans besaßen keine Kamera – bringt Bewegung in das System der Nebenfiguren, dessen Gesetze dir geläufig sind und einleuchtender als die Mechanik der Himmelskörper, die dir im Vergleich mit jenen zufällig erscheint. So daß du eine Ungeduld über die Konfusion von H., der immer wieder fragen muß: Wer ist das nun wieder? und die?, kaum unterdrücken kannst. Beispielsweise hieltest du es für angezeigt, H. und Lenka auf jener Fahrt durch das frühere L. am zweiten Wochenende des Juli 71 alle Wohnungen deiner sämtlichen Verwandten vorzuführen, die in dieser Stadt gelebt hatten. Lenka und H. kannten die neunzehn Personen – wenn man nur Verwandte ersten und zweiten Grades nimmt – nicht einmal alle dem Namen nach. Das Unternehmen endete mit einem Fehlschlag: Ermüdung, Unlust, Langeweile, Familiendschungel, sagte Lenka.
(Sie gab sich einfach keine Mühe, die Übersicht zu behalten. Es kam dann dahin, daß du ihr eine Art Stammbaum in dein Notizbuch kritzeltest, das war gestern, wir schreiben Dezember 72. Nach Weihnachtsbesorgungen, in deren Strudel ihr doch wieder hineingerissen wart, saßet ihr im Café am Nauener Tor, das um diese Zeit von Studenten der Pädagogischen Hochschule besetzt ist, die Lenka nachzuahmen suchte. Sie bestand darauf, auch einen Wermut zu bekommen wie der Student an eurem Tisch, und bemühte sich, ihn mit dem gleichen düsteren Gesichtsausdruck hinunterzukippen. Wenn sie nämlich ihre Großtanten und Großonkel, die alle im Westen leben, persönlich kennen würde, käme ihr der Familienstammbaum weit weniger albern vor, sagtest du, denn dir lag daran, daß sie sich später zurechtfand. Geh doch von den Großeltern aus, batest du sie: Die Menzels – Auguste und Hermann, Schnäuzchen-Oma und Schnäuzchen-Opa; und die Jordans – Marie und Gottlieb, Heinersdorf-Oma und Heinersdorf-Opa. Deren jeweils älteste Kinder, Charlotte und Bruno, werden das Ehepaar Jordan, als Großeltern bekannt. Und dazu, wie üblich, Geschwister und Geschwisterkinder: Liesbeth und Walter Menzel, Olga und Trudchen Jordan. Hör auf, sagte Lenka. Bis vor kurzem habe sie sich noch alle Erwachsenen als gleich alt, alle Leute über fünfzig als uralt vorgestellt. Sie ist sechzehn.)
Wen interessieren diese Leute? Der Vorgang der Namensgebung setzt ihre Bedeutung voraus, verleiht aber auch Bedeutung. Anonym sein, namenlos, ein Alptraum. Die Macht, die du dir über sie nimmst, indem du ihre richtigen Namen in die wirklichen verwandelst. Jetzt sollen sie sich näherkommen können, als es ihnen im Leben gelingt. Jetzt sollen sie ihr eigenes Leben führen dürfen. Onkel Walter Menzel, Charlotte Jordans jüngerer Bruder, der immer noch seine Kodak gezückt hält, gegen Nelly, seine Nichte. Direkt neben ihm wird Tante Lucie gestanden haben, glückstrahlend mit Walter verlobt – wir schreiben das Jahr 32 –, obwohl ihr Vater, Hausbesitzer und Rentier, seine Tochter partout keinem einfachen Schlosser hat geben wollen. Dann zieh ich eben so mit Waltern zusammen! soll sie geäußert haben, ein Ausspruch, den die Menzels nun wieder nur mit gemischten Gefühlen aufnehmen konnten. Einerseits zeigte sich, wie sehr sie an Walter hing; andererseits sprach aus solcher Redeweise doch auch ein gewisser Leichtsinn, wie ja überhaupt Lucie passabel war, adrett und flink, aber in mancher Hinsicht eben ein bißchen frei. Natürlich konnte sie froh sein, daß sie Walter bekam, aber dann wieder rieb sie ihren hübschen kleinen ondulierten Kopf in aller Öffentlichkeit an seinem Polohemd ... Jetzt steht sie also und winkt Nelly mit ihrem weißen Taschentuch: Guck hierher, Nellychen! Hier in den schwarzen Kasten, gleich fliegt ein Vögelchen raus!