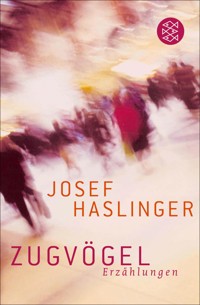9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Klasse Burschen, die Österreicher. Fröhlich verkünden sie den Glauben an das Gute in der Welt und zeigen stolz ihre Berge, Burgen und Barockkirchen her. Ein verantwortlicher Umgang mit seiner Geschichte aber fällt dem Land schwer. »Obzöner hat ein Land in Zeiten des Friedens noch nicht ausgesehen.« Zu dieser Überzeugung gelangt Josef Haslinger in seinen Essays, in denen er die gesellschaftliche und politische Lage Österreichs analysiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Ähnliche
Josef Haslinger
Klasse Burschen
Essays
FISCHER E-Books
Inhalt
Im Bett von Jörg Haider
Nach dem Regierungsantritt der schwarzblauen Koalition gab es in Wien zuerst täglich, dann wöchentlich Demonstrationen. Am 12. Februar 2000 versammelten sich etwa 15000 Menschen vor dem Karl-Marx-Hof. Dort war 66 Jahre zuvor die österreichische Armee mit Panzern und Granatwerfern gegen bewaffnete Arbeiter vorgegangen. Während der Kundgebung telefonierte meine Frau mit einer 78-jährigen Tante, die an diesem Platz wohnte. Durch das Telefon waren Sprechchöre, Pfeifen und Trommeln zu hören. Die Tante sagte: »Dieser Lärm auf der Straße macht mich ganz nervös. Jetzt geht das wieder los. Du, ich glaube ich habe einen Schlaganfall. Ich kann nicht mehr reden.« Das waren ihre letzten Worte. Ein paar Stunden später starb sie im Krankenhaus.
Ich will mich nicht zu der These versteifen, dass die Tante meiner Frau das letzte Opfer des österreichischen Bürgerkriegs war, aber sie war alt genug, um zu wissen, was Lärm vor dem Karl-Marx-Hof bedeutet hat. Und sie hatte Angst, dass etwas, das überwunden zu sein schien, wieder aufbrechen könnte – die nie geheilte historische Wunde Österreichs.
Die derzeitige politische Situation mit dem Bürgerkrieg in Verbindung zu bringen mag auf den ersten Blick etwas Abstruses haben. 1934 standen die Arbeiter geschlossen hinter der Sozialdemokratischen Partei, im Oktober 1999 hingegen haben 46 Prozent der wahlberechtigten (und das heißt staatsbürgerlich inländischen) Arbeiter für die Partei von Jörg Haider gestimmt. Aber gerade das hat auch mit einer historischen Kontinuität zu tun, die auf den Bürgerkrieg zurückgeht. Die ÖVP hätte, selbst mit einem Jörg Haider als Obmann, niemals 46 Prozent der Arbeiterstimmen erhalten.
Nicht wenige in Österreich fragten sich, warum schon wieder wir? Wir haben den Waldheim ausgesessen und haben uns mit Zweidrittelmehrheit dazu entschlossen, ein Teil der Europäischen Union zu sein – warum fallen schon wieder alle über uns her? Wir sind doch nicht so viel anders als die andern. Warum dürfen die französischen Rechtsextremen Bürgermeister stellen, die italienischen Neofaschisten ein paar Jahre in Regierungsverantwortung sein, aber die FPÖ und jeder, der sich mit ihr zusammentut, wird geächtet, als hätte er sich dem Teufel verschrieben. Wo war denn der europäische Aufschrei, als Bruno Kreisky gleich fünf Ehemalige in die Regierung nahm: den SS-Mann Karl Öllinger, die NSDAP-Mitglieder Otto Rösch, Oskar Weihs, Erwin Frühbauer und Josef Moser. Hat das damals überhaupt jemanden in Europa interessiert?
Es gab Menschen, die das interessiert hat. Mitglieder von Opferverbänden und Lagergemeinschaften, Aktivisten der jüdischen Gemeinden und den einen oder anderen Alt- und Jungsozialisten. Muss das sein?, fragten sie Kreisky. Und seine Antwort war: Ja, das muss sein. Kreisky leitete eine Minderheitsregierung, und er brauchte politische Hilfe. Er fand sie im damaligen Obmann der FPÖ, Friedrich Peter, einem ehemaligen Mitglied der Waffen-SS. Im Streit um solche Bündnispartner ließ Kreisky sich hinreißen, Simon Wiesenthal zu beleidigen und unterschwellig der Nazi-Kollaboration zu bezichtigen. Er war bereit, seine Exnazi-Minister und Exnazi-Verbündeten als anständige Menschen zu verteidigen, solange ihnen nicht eine konkrete Schuld, ein konkretes Verbrechen zur Last gelegt werden konnte.
Kein europäischer Aufschrei. Den gab es erst nach Kreisky, Anfang 1985, als der damalige FPÖ-Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager dem Kriegsverbrecher SS-Obersturmbannführer Walter Reder, der aus italienischer Haft in der Festung Gaeta freigelassen worden war, einen Staatsempfang bereitete. Ich erinnere mich an das blasse Gesicht des jungen Verteidigungsministers, an sein Stottern. Für ein, zwei Tage verstand er die Welt nicht mehr. Bisher hatte sich nämlich eine ganze Reihe von Politikern für die Freilassung Walter Reders eingesetzt, ja man hatte ihm während seiner Haft sogar die österreichische Staatsbürgerschaft zuerkannt, die er am Beginn seiner SS-Karriere in Deutschland freiwillig abgelegt hatte. Frischenschlager fiel gleichsam nur die Ernte dieser vielseitigen Bemühungen zu. Aber plötzlich war alles anders. Irgendwo musste, vom offiziellen Österreich unbemerkt, in die europäische Geschichte ein anderer Gang eingelegt worden sein.
Tatsächlich war Österreich in diesen Jahren drauf und dran, von der europäischen Entwicklung abgehängt zu werden. François Mitterrand hatte vor dem Deutschen Bundestag gesprochen und in Helmut Kohl einen Verbündeten für die europäische Einigung gefunden. Im Juni 1984 hatten in zehn Ländern der Europäischen Gemeinschaft bereits die zweiten Direktwahlen zum Europäischen Parlament stattgefunden. Man sprach in Brüssel und Straßburg nicht mehr ausschließlich über die Landwirtschaft, man strebte eine politische Union an. Frankreich begann sich, in Vorbereitung des Prozesses gegen den Kriegsverbrecher Klaus Barbie, ernsthaft der Schattenseite der eigenen Geschichte, der Kollaboration, zu stellen und brachte damit eine Lawine ins Rollen, die sich in der Folge auch auf andere von der Deutschen Wehrmacht besetzte Staaten ausdehnte – und letztlich sogar auf die neutralen Länder Schweden und Schweiz.
Frischenschlager, der später die FPÖ verließ, war ein paar Tage verschreckt, aber dann klug genug, die Zeichen zu erkennen. Er entschuldigte sich in aller Form vor dem Parlament und in Israel. Damit rief er den Unmut von Jörg Haider hervor, der immer schon ein Problem mit Entschuldigungen hatte. Das, was Walter Reder getan habe, nämlich das Massaker an der Zivilbevölkerung von Marzobotto, »hätte ja schließlich und endlich dem Vater von jedem von uns passieren können«, so wetterte damals der Aufsteiger aus Kärnten.
Ein Jahr später der nächste Aufschrei. Kurt Waldheims NS-Mitgliedschaft wurde enthüllt. Der Präsidentschaftskandidat verteidigte sich mit den Worten, er habe schließlich nichts anderes getan als Hunderttausende andere Österreicher auch, nämlich in der Deutschen Wehrmacht seine Pflicht erfüllt. Doch die internationale Kritik wollte nicht verstummen. Jetzt erst recht, plakatierte die ÖVP. So mancher ÖVP-Grande witterte eine Verschwörung des Weltjudentums und der Sozialistischen Internationale. Waldheim wurde Bundespräsident, in Schutz genommen auch von einem prominenten Juden und Sozialisten, von Bruno Kreisky.
Die ÖVP wählte mit Erhard Busek einen hellhörigen Obmann, der die Partei aus dem Sumpf des Waldheim-Wahlkampfs herausführen wollte. Seine Bemühungen blieben lange unbedankt. Das politisch-emotionale Erbe dieses Wahlkampfs lag brach.
Wenn in den letzten fünfzehn Jahren in Österreich etwas politisch brachlag, war Haider zur Stelle. Seine Aussprüche von der »ordentlichen Beschäftigungspolitik des Dritten Reiches« bis zur Kennzeichnung der Konzentrationslager als »Straflager« begleiteten das politische Leben wie ein unabstellbares Echo aus dem braunen Gebirgsmassiv unserer Geschichte. Auch als er längst eine neue politische Brache entdeckt hatte, die EU-Gegner, konnte er es nicht lassen, noch einmal vor Veteranen der Waffen-SS aufzutreten und ihnen zu bescheinigen, dass sie »liebe Freunde« und »anständige Menschen« seien. »Ein Volk«, so Haider, »das seine Vorfahren nicht in Ehren hält, ist sowieso zum Untergang verurteilt.«
Während man in ganz Europa von der Überwindung des Erbes der Vorfahren sprach, sprach Haider von deren Ehre. Da hatte sich einer, der schon seit Jahren auf der Watchlist des europäischen Journalismus stand, noch einmal kräftig ins europäische Mediengewitter hinausgelehnt. Es sollte nur ein Probelauf sein.
Tony Judt wies in der New York Review of Books darauf hin, dass ähnliche Sprüche im Deutschland der 50er Jahre gang und gäbe waren. Aber eben nicht in den neunziger Jahren. Österreich lebe in einer Art Zeitverschiebung. Aber wie kam es bloß zu dieser Zeitverschiebung, zu diesem Nachtrotten Österreichs auf Geleisen, die anderswo gerade abgerissen wurden?
Als ich neulich in Mailand in einem Hotel abstieg, sagte der Portier zu mir, gestern sei ein anderer Österreicher abgereist, Jörg Haider. Da ich das für einen Scherz hielt, erklärte er mir, Jörg Haider habe von seiner Frau zum fünfzigsten Geburtstag einen Abend in der Scala geschenkt bekommen. Der Mann, der sich seit seiner ersten Rede als Parteiobmann, in der er gegen Thomas Bernhard zu Felde zog, immer wieder als Rabauke gegen Künstler hervorgetan hat, der Mann, der sich gerade bei einem Almfest mit versammeltem Kärntner Musikantenstadl beim Lied »In die Berg bin i gern« zur alpenländischen Dativschwäche bekannt hat, mimt hier den weltläufigen Bildungsbürger?
Als ich spät nachts zu Bett ging, konnte ich nicht einschlafen. Lag ich im Bett von Jörg Haider? Natürlich wäre ich mir blöd vorgekommen, das durch einen Anruf in der Rezeption zu klären, aber der Gedanke hatte etwas Beunruhigendes. Und ich erinnerte mich, dass ich schon einmal in einer ähnlichen Situation war. Damals, in Chicago, hatte mir der Gastgeber erklärt, der Letzte, der in meinem Bett geschlafen habe, sei Bruno Kreisky gewesen. Auch damals hatte ich nicht einschlafen können. Aber ich hatte dann im Bücherregal Kreiskys eben erschienene Autobiographie entdeckt und darin bis in die Morgenstunden gelesen.
Kreisky war nicht nur im Hohen Haus mit Nazis zusammen gewesen, sondern, so erfuhr ich in Kreiskys Bett, auch dreieinhalb Jahrzehnte zuvor, im niedrigsten Haus, im Wiener Gefangenenhaus. Inhaftiert hatten ihn die Christlich-Sozialen, von Kreisky zeit seines Lebens schlicht »Die Bürgerlichen« genannt. Die Bürgerlichen hatten sich des Parlaments entledigt und gingen, als der sozialdemokratische Schutzbund sich zaghaft zum bewaffneten Widerstand entschloss, mit der Armee gegen die Gemeindebauten vor. Innerhalb von ein paar Tagen wurde das mit dem Duce vereinbarte Programm der Niederschlagung der österreichischen Arbeiterbewegung verwirklicht. Kommunistische und sozialdemokratische Organisationen wurden verboten, bald darauf, nach der Ermordung von Dollfuß, auch nationalsozialistische. Kreisky, ein Funktionär der Sozialistischen Arbeiterjugend, fand sich mit einem Nazifunktionär in einer Zelle. Die beiden hatten nicht viel gemeinsam, aber eines gewiss. Ihre größten Feinde waren diejenigen, die sie ins Gefängnis gesteckt hatten: die zum Faschismus konvertierten Christlich-Sozialen, die Bürgerlichen.
Als vier Jahre später die Nazis in Österreich einmarschierten, war, wie der prominente Sozialist und Anschlussbefürworter Karl Renner später schrieb, »ein großer Teil der Arbeiterschaft über die Beseitigung ihrer Verfolger von 1934 nicht gar zu erbittert«. Der erste Häftlingstransport nach Dachau bestand aus 151 Personen, darunter bereits die ersten Wiener Juden. Aber das Gros der Häftlinge wurde von christlich-sozialen Funktionären gebildet, von Ministern, höheren Beamten des Bundeskanzleramts und der Polizeidirektion. Unter ihnen war auch der vom Ständestaat eingesetzte Wiener Bürgermeister Richard Schmitz. Ausgerechnet an jenem Tag, am 1. April 1938, an dem der Transport in Dachau ankam, hielt der nationalsozialistische Nachfolger von Richard Schmitz, Herrmann Neubacher, vor den wieder eingestellten roten Arbeitern im Elektrizitätswerk Simmering eine Rede. Er sagte: »Ehemalige Schutzbündler, wir verstehen euch: Ihr habt einen Glauben gehabt; wir auch. Ihr seid dafür eingestanden, wir haben es durch bittere Jahre hindurch getan, bis zum Siege. Ihr wart Revolutionäre; wir sind es auch. Ihr wurdet durch die Gefängnisse und die Konzentrationslager des Systems geschleift – wir und ich auch. Heute reichen wir euch die Hände.«
Es soll nicht verschwiegen werden, dass in einem zweiten Aufräumen auch die sozialistischen Funktionäre, soweit sie noch nicht geflüchtet waren, verhaftet und nach Dachau geschickt wurden und dass es viele Sozialisten gab, die keineswegs die Nazis für das kleinere Übel hielten. Dennoch, der sozialdemokratischen Bewegung Österreichs war die Erinnerung daran, dass sie nicht von den Nazis, sondern von den Bürgerlichen zerschlagen wurde, für Jahrzehnte ins Gedächtnis eingraviert.
Und nun muss man sich Folgendes vorstellen: 1945 wurde das Land von den Befreiern zwei Parteien anvertraut, die bei ihrem letzten offiziellen Zusammentreffen, elf Jahre zuvor, aufeinander geschossen hatten. Die Führer dieser Parteien waren sich über zwei Dinge im Klaren. Erstens: Wir dürfen nicht über den Nationalsozialismus reden, denn sonst müssten wir auch über den Bürgerkrieg reden. Und das wäre für die neue Republik verhängnisvoll. Zweitens: Wir dürfen die Parteikader, in deren Knochen noch der Bürgerkrieg saß, nicht öffentlich aufeinander loslassen.
Und so erfanden sie ein System der Hinterzimmerpolitik, in dem die Staatsmacht und das öffentliche Leben fein säuberlich zwischen den beiden Parteien aufgeteilt wurden. Bis heute ist dieses System des Proporzes ein, wenngleich brüchig gewordener, Teil der politischen Identität des Landes. Aber alles konnte nicht in den Hinterzimmern ausgetragen werden, es gab schließlich auch Wahlen. Wenn man sich heute die Wahlplakate der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte ansieht, könnte man meinen, die beiden Parteien wollten nicht für eine Wahlentscheidung, sondern für einen neuen Bürgerkrieg rüsten.
Beim ersten Votum, im November 1945, waren die registrierten Nationalsozialisten, immerhin mehr als eine halbe Million Österreicher, zur Wahl noch nicht zugelassen. Die Wähler entschieden sich mit absoluter Mehrheit für die ÖVP, die ehemals Christlich-Sozialen. Die Kommunisten, eine unwägbare Größe vor allem im bevölkerungsreichsten sowjetischen Besatzungsteil des Landes, wurden mit fünf Prozent abgefertigt und schieden, zum Glück des Landes, aus dem Rennen um die Macht aus. Aber da gab es noch die registrierten Nazis, die sich unter der Führung des ehemaligen NS-Journalisten Herbert Kraus im »Verband der Unabhängigen« (VdU) organisierten. Der Großteil von ihnen war nicht für die Sozialistische Partei abzuwerben. Und so intervenierten sozialistische Spitzenfunktionäre bei den Alliierten für die Zulassung des VdU als eigene Partei. Sie erhielt 1949 auf Anhieb zehn Prozent der Stimmen. Die absolute Mehrheit der ÖVP war gebrochen.
Aus dieser Nazisammelpartei ging 1956 die FPÖ hervor, die, gleichsam als Dank für die einstige Hilfe, die Minderheitsregierung von Kreisky stützte und unter Kanzler Fred Sinowatz eine Koalition mit den Sozialdemokraten einging. Damals gab es in der SPÖ die Hoffnung, die FPÖ würde aus dem Nazi-Fahrwasser herauskommen und zu einer liberalen Partei werden. Doch dann kam Jörg Haider, und das ideologische Kalkül jener Sozialisten, die sich bei dieser Koalition nie ganz wohl gefühlt hatten, war wie eine Seifenblase zerplatzt. Übrig geblieben war ein unerfreuliches Kapitel sozialistischer Machtpolitik.
Heute will Schüssel die FPÖ zivilisieren. Die Aufgabe wird nicht leicht sein, denn die blauen Minister wissen, dass nicht sie, sondern Jörg Haider zur zweitstärksten politischen Instanz des Landes gewählt wurde. Vom Kärntner Landeshauptmann abzurücken kann, wie dies im FPÖ-Postenkarussell von Haiders Gnaden gängige Praxis ist, von heute auf morgen das politische Aus bedeuten. Wenn sich Haider zurückmeldet, kann Schüssel seine Memoiren schreiben.
Bruno Kreisky ist als großer und weitsichtiger Politiker in die Geschichte eingegangen. Es liegt mir keineswegs daran, seine Verdienste zu schmälern. Ich gehöre einer Generation an, die von den in der Kreisky-Ära durchgeführten sozialen Reformen und der Liberalisierung des Landes am meisten profitiert hat. Kreisky war kein Nazifreund. Aber er war ein Kind des Bürgerkriegs. Und als solcher stand er auch für eine Politik, die den Aufstieg der FPÖ in Österreich begünstigt hat. Als sein Nachfolger, Franz Vranitzky, die Notbremse zog, war es zu spät.
Vranitzky hatte die Zeichen der Zeit erkannt. Aber er war kein Mann der Arbeiterklasse. Er fand endlich die richtigen Worte zur österreichischen Nazi-Vergangenheit, während hinter seinem Rücken, in den Gemeindebauten, die roten Fahnen gegen blaue ausgetauscht wurden. Die politischen Folgen des Bürgerkriegs sind den Sozialdemokraten zur Falle geworden. In den neunziger Jahren hörte man es in der Sozialdemokratischen Partei gar nicht gerne, wenn Jörg Haider nicht Hitler, Franco oder Mussolini, sondern ausgerechnet Bruno Kreisky als Vorbild nannte. Später nannte er Tony Blair. Seither verstehen auch die Briten, dass die Haider-Partei eine europäische Angelegenheit geworden ist.
Das endlose Land
Österreich fünfzig Jahre nach der Befreiung
Die österreichische Parallelaktion zur intellektuellen Selbstdemontage vollzog in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre eine überraschende Kehrtwendung. Während der Skeptizismus der Wiener Jahrhundertwende bei den Postmodernen weltweit in Konjunktur kam, standen die zeitgenössischen Wiener vor der Notwendigkeit, in ihrem geschichtlichen Scherbenhaufen endlich einmal etwas zu fixieren.
Die österreichische Geschichte des 20. Jahrhunderts legte es noch dem verstocktesten Traditionalisten nahe, sich auch ein gerüttelt Maß an Skeptizismus zu bewahren. Zu viele Wahrheiten haben sich hier abgewechselt. Keine hat lange gehalten. Aber das Eigenartige ist, dass keine auch jemals wirklich zugrunde gegangen ist. Österreich kann einem als ein Land erscheinen, in dem es unmöglich ist, etwas zu beenden, einen Irrweg abzubrechen, ein historisches Kapitel zu schließen. Manches mag zwar von der Oberfläche verschwinden, weil es unbequem geworden ist, inopportun, aber plötzlich stehen rassistische Menschenverachtung und herrschaftsgläubige Erwartungen wieder in einer Unschuld vor uns, als habe sich nie jemand ernsthaft mit ihnen auseinander gesetzt.
Ob man in der Ersten Republik katholisch, rechts und antisemitisch war oder atheistisch, links (und oft ebenfalls antisemitisch), resultierte in den seltensten Fällen aus einer bewusst überlegten Entscheidung. Normalerweise hing es schlicht davon ab, wo man wohnte und welchem Beruf man nachging. Österreich war in der Barockzeit so ausgiebig mit dem katholischen Pflug beackert worden, bis das letzte Reformpflänzchen seinen Geist ausgehaucht hatte. Ende des 16. Jahrhunderts waren achtzig Prozent der Wiener protestantisch gewesen, hundert Jahre später war die Sünde der Auflehnung ausgemerzt. Die katholische Hegemonie hielt zwei weitere Jahrhunderte lang auch das politische Zepter in der Hand. Die gescheiterte Revolution von 1848 war ein Vorgeschmack auf die kommende große Herausforderung. Sie erwuchs dem System aus der Kultur der Arbeiterbewegung.
Die nach dem Ersten Weltkrieg ausgerufene Republik hatte keinerlei Erfahrung, wie man auf demokratische Weise mit gegensätzlichen Gesinnungen umgehen kann. Der Versuch eines bewaffneten Generalstreiks im Februar 1934 endete damit, dass die Arbeiterwohnheime von der Artillerie beschossen wurden. Die sozialdemokratischen Führer flüchteten, die Linke wurde verboten.
Vier Jahre später war die sozialdemokratische Schadenfreude darüber, dass die katholische Diktatur den braunen Horden nicht standhielt, nicht nur eine klammheimliche. So manche rote Fahne wurde mit dem Hakenkreuzemblem auf Vordermann gebracht. Und die braunen Horden, so stellte sich auf katholischer Seite erst recht heraus, waren längst in den eigenen Reihen. Sie eilten dem Glaubensgenossen aus Braunau entgegen, als wäre Gottvater persönlich erschienen.
Ihm wurde fleißiger gedient als je einem Dienstherrn zuvor. Die katholische Glaubens- und die nationalsozialistische Rassenlehre umarmten sich in Österreich so intensiv, dass viele meiner Landsleute, denen man im Allgemeinen ja nicht nachsagt, dass sie unter Arbeitswut leiden, in einen bisher unbekannten historischen Tatendrang verfielen. Bei der Vertreibung und Vernichtung jener Mitbewohner, die sie für »minderwertig« hielten, wurden sie zur eifrigsten Bevölkerung des Dritten Reiches. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass 1938, als die österreichischen Nazis endlich mitmachen durften, die politischen Posten schon vergeben waren. In der sich entwickelnden Mordmaschinerie hingegen gab es für »tüchtige« Ostmärker noch jede Menge Karrieremöglichkeiten. Und was hatten sie davon? Sieben Jahre später, als das Land auf seine Ausgangsgröße zurückgekämpft war, konnten sie davon nicht einmal erzählen.
Österreich war das erste Opfer des Naziregimes. So hieß die neue Glaubensformel. Sie wurde für unser Land zur stabilsten Wahrheit des Jahrhunderts. Über vierzig Jahre lang log man sich das vor. Bis einer, den die Welt kannte, in Argumentationsnotstand darüber kam, warum die Opfer aufseiten der Täter ihre Pflicht erfüllten.
Der bilanzierende Blick zurück findet in der ersten Hälfte des Jahrhunderts eine Aufeinanderfolge von Glaubensverlusten, in der zweiten Hälfte die relativ lange Stabilität einer Lüge. Die nur für einen kleinen, noch dazu wenig geachteten Teil der Bevölkerung gültige Aussage, Hitlers erstes Opfer gewesen zu sein, wurde in der Zweiten Republik wie eine schützende Decke über das ganze Land gezogen. Wenn irgendwo der Wind hineinfuhr und sie zu heben drohte, griffen gleich tausend Hände danach, um sie wieder herabzuziehen.
Warum, so muss man sich fragen, waren die Österreicher so krampfhaft bemüht, diese Decke absolut dichtzuhalten. Die Antwort ist einfach und wurde doch in vielen Debatten über unser Problem mit der Vergangenheit zu wenig beachtet: weil darunter der Bürgerkrieg versteckt lag. Man konnte nicht über den Nationalsozialismus sprechen, weil man sonst über den Bürgerkrieg von 1934 hätte sprechen müssen. Der war nämlich die Ursache dafür, dass in Österreich der organisierte Widerstand im Großen und Ganzen eine Angelegenheit der Kommunisten blieb.
Man muss sich das vorstellen: Die Linke, die in einigen Industriegegenden und Städten, vor allem natürlich in Wien, seit langem die Mehrheit gestellt hatte, war 1934 vom Militär gleichsam aus dem Parlament geschossen worden – und es wurde nie wieder darüber gesprochen. Die Linke hatte keine Gelegenheit, sich am militanten Katholizismus zu rächen. Das ist wohl einer der Hauptgründe für die notorischen Verdrängungsmechanismen der österreichischen Politik. Als sich, nach der Befreiung, erstmals die Möglichkeit zur Revanche geboten hätte, war das ganze Land so kompromittiert – und außerdem von den Alliierten besetzt –, dass es ratsam war, nicht dort fortzufahren, wo man 1934 aufgehört hatte. Die verspätet nachgetragene Rache wäre des demokratischen Neuanfangs, den man eigentlich nicht erkämpft hatte, sondern in den man mehr hineingestolpert war, nicht würdig gewesen.
Die Sozialdemokraten liefen zwar jedem Nazi nach, den sie kriegen konnten, selbst ehemalige SS-Mitglieder waren willkommen, aber warum sie sich so verhielten, warum sie in einem Nazi ein geringeres Übel sahen als in einem »Bürgerlichen«, wurde nie offen ausgesprochen. Die öffentliche Rede war ein Konglomerat von parteilichen Phrasen und diplomatischen Sprachregelungen. Noch während der sozialdemokratischen Alleinregierung wurde in den Schulbüchern die Entstehung des »Ständestaates« – so lautete das offizielle Wort für die austrofaschistische Diktatur – mit der »Selbstausschaltung des Parlaments« erklärt, einem quasi gemeinsamen Versagen der damaligen Abgeordneten und der von ihnen gewählten Parlamentspräsidenten.
Damit hatten die Hauptmotive des politischen Verhaltens der Parteien die öffentliche Sprache verloren. Politik wurde zu einem heimlichen Gemauschel unter der Decke der Lüge vom gemeinsamen Naziopfer. Ich wuchs in einer Republik auf, in der Jugendliche, die sich erste politische Gedanken machten, mit den Worten zurechtgewiesen wurden: »Tuts nicht politisieren!« Über Politik zu reden galt als etwas Negatives, Unheilvolles, ja Gefährliches. Die Befreiung hatte – so gesehen – tatsächlich nie stattgefunden. Die Menschen spürten, dass »politisieren« auch bedeuten kann, eine Büchse zu öffnen, deren Inhalt man nicht gewachsen ist, weil er zur Tabuzone des Staates gehört.
So wurde nichts abgeschlossen, nichts ausgetragen, ja nicht einmal ausgesprochen. Es entstand eine Konfliktscheu, die in Westeuropa ihresgleichen sucht. Die relevanten politischen Kräfte trafen sich zur Klausur in den Räumen der Sozialpartnerschaft und versuchten für möglichst alle Gesetze schon im vorparlamentarischen Rahmen Einstimmigkeit zu erzielen. Wenn eine Zeitschrift «Rotfront« hieß und die Abschaffung des bürgerlichen Rechtsstaates zum erklärten Ziel hatte, wurde sie von den Sozialdemokraten genauso subventioniert wie ein monarchistischer Verein oder der Kameradschaftsbund. Und selbstverständlich wurden den katholischen Privatschulen, obwohl sie Schulgeld kassierten, die Lehrer vom Staat bezahlt. Alles und auch das Gegenteil davon sollte gleichzeitig möglich sein, wenn es nur nicht zum Konflikt kommt. Das andere, das Fremde, das war in Österreich immer etwas Feindliches. Anderes und Fremdes sollte es nach Möglichkeit gar nicht geben. Zu deutlich gemahnte es an die überfällige Antwort auf den eigenen Herzenskonflikt. Wer bin ich? Wo stehe ich nun wirklich?
Wir fühlten uns dem Westen zugehörig, sagten es aber nicht zu laut, schließlich machten wir gute Geschäfte mit dem Osten. Neutralität nannten wir das. Wir lieferten Waffen an den Irak und lieferten sie, damit uns keiner der Einseitigkeit zeiht, heimlich auch gleich an den Iran. Dass die beiden Staaten zu dieser Zeit zufällig Krieg gegeneinander führten, konnte den Geschäften nur nützlich sein. Offen sagen durfte man es halt nicht. Wir hatten eine Uns-ist-alles-recht-außer-Widerspruch-Mentalität entwickelt.
Dieses System währte bis 1986, bis zu jenem Tag, an dem in Profil und New York Times die SA-Mitgliedschaft von Kurt Waldheim enthüllt wurde. Waldheims Unfähigkeit, sich von seiner eigenen Lebenslüge zu verabschieden, brachte die Lebenslüge eines ganzen Landes auf die Tagesordnung. Ereignisse, die fünfzig Jahre zurücklagen, brachen mit einer Heftigkeit ins öffentliche Bewusstsein, als wären sie vorige Woche geschehen. Dazwischen lag nichts als ein Vakuum von Phrasen. Und was taten die Intellektuellen, die sich gerade darauf eingestimmt hatten, dass politische Ideologien überholt und moralische Kategorien obsolet sind? Sie hielten Österreich eine Moralpauke nach der anderen.
Emphatisch ausgedrückt könnte man sagen, den Intellektuellen des Landes fiel erstmals nach langer Zeit wieder eine historische Rolle zu. Sie wurden zu einer wichtigen Stimme in der Herausarbeitung einer Epoche. Das freilich ist etwas, was sich erst im Nachhinein beurteilen lässt, wenn die Epoche zu Ende gegangen ist. Und diese Epoche ist zu Ende gegangen. Sie dauerte ziemlich genau zehn Jahre: vom Waldheim-Wahlkampf 1986 bis zum Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995.
Es war ein Jahrzehnt des Kampfes um die Wahrheit der österreichischen Geschichte. Nie zuvor wurde in Österreich so viel über Identität gesprochen. Eine Lüge, zusammengekleistert aus privater Bequemlichkeit, staatlicher Räson und parteipolitischer Taktik, war – mit starker ausländischer Nachhilfe – zerbrochen. Aber was war hinter dieser Lüge versteckt? Von ihrer Formulierung bis zur Waldheim-Affäre war so viel Zeit vergangen, dass der Rachegedanke mit jenen Politikern bestattet worden war, die mittlerweile am Wiener Zentralfriedhof ihr Ehrengrab gefunden hatten. Und so war für viele auch gar nicht mehr einsichtig, wie es überhaupt zu diesem beharrlichen Festhalten an einer Geschichtslüge – samt aller damit verbundenen Demütigungen für die wirklich Verfolgten – hatte kommen können. Als man schließlich zögernd und Stück für Stück die Decke wegzog, fand man an jener Stelle, wo einst die Eiterbeule des Bürgerkriegs war, nichts als ein ausgetrocknetes schwarzes Loch.
Zu Beginn des Jahrhunderts zerbrach ein multiethnisches Staatsgebilde am deutschnationalen Wahn. Österreich wurde auf eine Größe reduziert, die es zuletzt vor einem halben Jahrtausend hatte. Mangels Kaiser war es nun obsolet, Monarchist zu sein. Aber Böhmen, Mähren, Galizien, Siebenbürgen, Bukowina, das waren klingende Namen einer verlorenen Größe, von der alte Menschen, wie meine Großmutter, noch in der Zweiten Republik schwärmten – auch wenn sie in der Monarchie nur ein Dienstmädchen gewesen war.
In den achtziger Jahren tauchten diese Namen in den intellektuellen Debatten um Mitteleuropa plötzlich wieder auf. Schriftsteller und Bürgerrechtler aus diesen Landstrichen legten uns nahe, dass die Folgen dessen, was 1918 geschehen ist, noch lange nicht ausgestanden seien. Der Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie habe ein Machtvakuum hinterlassen, dessen sowjetische Füllung man durchaus als vorläufig betrachten könne. Denn von ihren kulturellen Traditionen her gehörten diese Regionen keineswegs zum Osten.
Österreichische, deutsche, italienische und französische Publizisten hielten Nachschau in Przemysl, Czernowitz und im Banat, dem Geburtsland von Nikolaus Lenau. Ihr Befund: Nicht dass es hier von Kaiserfreunden wimmelte, aber so verrottet wie unter dem Kommunismus seien die Zustände im Reich der europäischen Mitte, in der K&K-Monarchie, nicht gewesen. In Österreich wurde eine neue, mitteleuropäische Integrationsaufgabe gepredigt. Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaftssysteme in Osteuropa, mit dem Zerfall der Ordnung von Jalta, bekam das Ende der k.u.k.-Monarchie eine völlig neue Gewichtung für die Geschicke Mitteleuropas. Die Folgen des Versagens des österreichischen Liberalismus um die Jahrhundertwende waren plötzlich spürbarer als die Folgen des Zweiten Weltkriegs. Der Text aus der österreichischen Bundeshymne, »… liegst dem Erdteil du inmitten, / einem starken Herzen gleich«, schien nun mehr als eine geographische Einordnung zu sein. Es klang wie eine neue Aufgabe. Bloß waren dem Land unter der Hand die Mitteleuropäer entschwunden.
Die Integration in die (west)europäische Gemeinschaft versprach ökonomisch mehr als die Öffnung zum Osten. Nicht dass das Land nun eine neue Identität gefunden hätte. Aber es hat das Unterfangen, einen eigenständigen Weg zu gehen, abgebrochen. Und das war gut so. Denn jenes Herrenmenschentum, das sich seit der Öffnung des Eisernen Vorhangs in Österreich breit machte, war seinen historischen Vorbildern noch so unverblümt nahe, dass die Einbindung in den westeuropäischen Hegemonieprozess einem Zivilisierungsversuch, einer Rettungsaktion aus einem Jahrzehnte währenden Versäumnis, gleichkommt.
Klasse Burschen
Zum 55. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen gab es ein Gedenkkonzert mit den Wiener Philharmonikern. Da dieses Orchester mit der eigenen Geschichte in etwa dieselben Probleme hat wie das ganze Land mit der seinen, war es nicht von vornherein abwegig, die Philharmoniker in diese Gedenkveranstaltung mit einzubeziehen und ihnen Gelegenheit zu einer Benefizveranstaltung für KZ