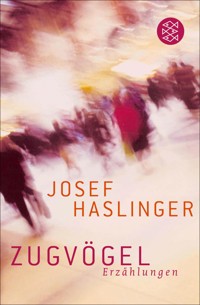8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Sie begegnen sich zufällig: der Verleger und die Tänzerin. Er sucht Heilung im alten Kurhotel von Jáchymov und stößt dabei auf das Grauen dieses Ortes. Die Tänzerin beginnt ihm eine Geschichte zu erzählen, die sie ihr Leben lang begleitet hat. Es ist die Tragödie ihres Vaters. Als Torwart der tschechoslowakischen Eishockey-Nationalmannschaft seit den 1930er Jahren ein Star, konnten ihn seine Erfolge nicht vor der Willkürherrschaft des kommunistischen Regimes schützen. Dann wurde er verhaftet. Man deportierte ihn in die Arbeitslager von Jáchymov, einem Uranbergwerk in einem Tal des Erzgebirges. Nach fünf Jahren wird er amnestiert und als Todkranker entlassen. Seiner Familie bleibt nichts, als ihm beim langsamen Sterben zuzusehen. Die Tochter wird zur Chronistin einer ungewissen Erinnerung, der sie nicht mehr entkommen kann. Josef Haslinger erzählt in seinem neuen Roman eine Familiengeschichte, verstrickt in die Tragödien des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Ähnliche
Josef Haslinger
Jáchymov
Roman
Fischer e-books
Sie haben sich von der Räudigkeit der Nazis anstecken lassen, ohne sich dessen bewusst zu sein.Radka Denemarková
Die kleine Propellermaschine landet auf einer roten Sandpiste, mitten in der Steppe. Am Ende der Landebahn holt uns eine Staubwolke ein und legt sich über die Wellblechhalle, vor der die Maschine anhält. Der Pilot schiebt die Haube hoch. Er hilft mir beim Aussteigen. Dann öffnet er eine Rumpfklappe und zieht meinen Koffer hervor. Zum Abschied reicht er mir die Hand.
Die Tür zur Wellblechhalle ist herausgebrochen. Unter einer Fensteröffnung liegen Glasscherben. Ich soll vom Chauffeur der Farm abgeholt werden, aber da ist niemand. In der Halle steht nur ein verstaubtes Flugzeug, auf dem ein Vogel spazieren geht. Er schaut mich misstrauisch an und weicht zurück, als ich näher komme. Das Schiebetor am anderen Ende der Halle ist halb geöffnet, dahinter die Steppe. Auf dem Zufahrtsweg steht ein verlassener Jeep. Ich gehe auf ihn zu.
Taxi, Mam!
Das sagt jemand hinter mir. Ein Mann sitzt im Schatten der Halle und raucht eine Zigarette.
Sind Sie der Chauffeur, frage ich.
Taxi, Mam, ist alles, was er sagt. Er wiederholt es, bis ich einsteige. Der Sitz ist zerfetzt, die Scheibenwischer sind abgebrochen. Bevor er losfährt, springe ich aus dem Wagen und laufe davon. Aber der Jeep folgt mir. Mit hoch gerafftem weißem Kleid haste ich über die ausgetrocknete Erde, das kniehohe Gras zerkratzt mir die Beine. Ich ducke mich hinter ein Distelgewächs, um einen Moment zu verschnaufen. Ich trage nur Sandalen und weiße Ringelsocken. Wie bei der Erstkommunion, denke ich und ziehe ein paar Dornen aus den Socken. Ich höre das Motorengeräusch und sehe die Staubfahne auf mich zukommen. Heiliger Thaddäus, mächtiger Fürsprecher, blicke herab auf mich!
Ich springe auf und laufe weiter. In meinen Sandalen verfängt sich Gestrüpp, das ich mitschleife. Der Jeep kommt näher. Nach kurzer Zeit muss ich die Richtung ändern, denn vor mir tut sich ein tiefer Graben auf, ein Abgrund, in dem ganz unten ein ausgetrocknetes Flussbett liegt. Die Böschung ist zu steil, um hinabsteigen zu können. Ich laufe an diesem Graben entlang. Hier wachsen die Sträucher höher und üppiger, und ich kann mich besser verstecken. Der Fahrer hat keinen freien Blick mehr auf mich. Ich laufe von Gebüsch zu Gebüsch und suche nach einer Stelle, an der ich ins Flussbett hinabsteigen kann. Ich finde keine. Trotzdem fasse ich neuen Mut, denn in der Ferne sehe ich eine Brücke, eine Fachwerkkonstruktion aus vielen ineinandergefügten Baumstämmen. In der Mitte der Brücke stehen zwei Menschen. Sie tragen lange Kleider und gestikulieren. Ich nehme alle meine Kraft zusammen und laufe auf sie zu. Es sind Männer mit Bärten. Sie heben die Arme, ich glaube sie auch rufen zu hören, beeil dich, aber ich bin nicht sicher, mein Atem ist laut und hinter mir das Motorengeräusch. Die vielen Büsche machen es dem Jeep schwerer, mir zu folgen. Gleich werde ich ihn ganz abschütteln können, denn die Brücke ist zu schmal für ein Fahrzeug. Ich erreiche sie, bevor der Jeep mich einholen kann.
Die bärtigen Männer, auf die ich keuchend zugehe, haben runzlige Gesichter. Sie scheinen sich nicht für mich zu interessieren, sie scheinen mich nicht einmal wahrzunehmen. Ihre Hände, mit denen sie unentwegt gestikulieren, sind knochig und ausgetrocknet.
Es ist seine Konstruktion, sagt der eine und holt zu einer weiten Armbewegung aus. Ihm gebührt alle Ehre.
Seit es diese Brücke gibt, sagt der andere, ist unser Leben viel einfacher geworden. Ihm gebührt alle Ehre.
Und nun erhebt der Erste die Hände zum Himmel und sagt: Herr, du bist Zeuge, er hat uns die Brücke geschenkt, ohne dass wir ihm dafür etwas gegeben haben. Belohne seine Kinder mit Glück.
Und nun erhebt der Zweite die Hände zum Himmel und sagt: Herr, du bist Zeuge, es ist eine schöne Brücke, eine stabile Brücke, kein Sturm kann sie wegblasen. Danke es seinen Kindern mit Glück.
Ich bin vor den beiden Männern stehen geblieben, und ich weiß, dass sie von meinem Vater reden. Er hat diese elegante Brücke gebaut. Aber mich nehmen sie nicht wahr, auch nicht, als ich langsam an ihnen vorbeigehe. Ich höre sie noch weitersprechen. Er hat uns das Leben erleichtert. Er ist ein großer Architekt. Glück seinen Kindern.
An dieser Stelle brach die Geschichte ab. Es folgte eine Bleistiftskizze, ein Rechteck, das mit Dreiecken ausgefüllt war, so als wollte die Erzählerin ein Bild davon vermitteln, wie die Fachwerkbrücke ausgesehen haben könnte. Anselm Findeisen blätterte um. Während er weiter las, zog er aus seiner Westentasche ein Silberdöschen, öffnete es und nahm eine Tablette heraus, die er mit einer routinierten Handbewegung im Mund verschwinden ließ. Die Erzählerin hatte sprunghaft den Schauplatz gewechselt, sie beschrieb nun ein städtisches Ambiente, den Gastgarten eines Künstlerklubs in Prag.
Ich esse eine Mehlspeise, stand da, trinke eine Melange und genieße die Frühlingssonne. Am Tisch gegenüber sitzt eine junge Frau, die mir zulächelt. Ihre kurzen schwarzen Haare, ihre lange Nasenspitze, ihre bogenförmigen Augenbrauen, ich kann gar nicht aufhören hinzuschauen. Und sie schaut zurück. Wir lächeln uns an, blicken verlegen zur Seite und lächeln uns wieder an. Was für ein Tag, sagt sie. Was für ein Tag, antworte ich. Und nach einer Weile sagt sie wieder, was für ein Tag, langsam und mit spitzem Mund. Wir sitzen da und schauen uns auf die Lippen. Wir warten darauf, dass eine von uns sie bewegt. Wenn es geschieht, ist das ein Geschenk. Aber wir gehen sparsam um mit den Geschenken. Und dann sagt sie: Du musst gehen! Und mir fällt plötzlich ein, dass ich einen Auftritt habe. Ich springe auf und verlasse den Gastgarten. Beeil dich, ruft mir die Frau nach. In der hereinbrechenden Dunkelheit laufe ich durch die Straßen der Altstadt zur Oper. In der Garderobe merke ich, dass ich mich schon daheim geschminkt habe und mir jetzt nur noch das Kostüm anziehen muss. Ich komme hinter der Bühne an und werde sofort ins Scheinwerferlicht hinausgeschickt. Mein Vater sitzt oben auf dem Balkon in der ersten Reihe, ich sehe ihn, ohne dass ich hinschauen müsste. Ich drehe Pirouetten, ich springe und schwebe. Beim Applaus mache ich einen Knicks zu ihm hinauf. Da ist sein strahlendes Gesicht, da sind seine brünetten, gescheitelten Haare, und ich weiß, dass er jetzt so selig ist wie ich.
Ich will sagen, so fuhr die Tänzerin, der Anselm Findeisen in Jáchymov begegnet war, fort, dass Schreiben am Anfang für mich wie Träumen war. Ich kam ständig vom Weg ab, aber es endete immer bei meinem Vater. Es sollte dort enden. So hatte ich etwas, das mich am Leben hielt, oder besser, das mich beim Tod hielt. Ich wollte ja bei meinem Vater bleiben.
Am Abend nach seinem Begräbnis sperrte ich mich ins Zimmer ein und schrieb in ein Schulheft: Mein Vater ist emigriert. Und dann legte ich mich ins Bett und hörte nicht mehr auf zu weinen. Emigrieren hieß damals für immer weg sein. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, den Satz zu schreiben, mein Vater ist gestorben. Am nächsten Morgen fügte ich eine Zeile hinzu. Die hatte ich in der Nacht geträumt. So fing ich an zu schreiben. Zunächst entstanden Gedichte. Sie waren nicht zum Herzeigen gedacht, sondern nur für mich. Andere Mädchen meines Alters gingen aus oder träumten davon auszugehen, ich schrieb oder träumte davon zu schreiben. Das ließ sich nicht so genau unterscheiden. Manchmal träumte ich es nur und war am nächsten Morgen enttäuscht, dass es nicht auf dem Papier stand. Dann schrieb ich es noch schnell vor dem Frühstück auf, oder ich dachte den ganzen Tag daran, damit ich es nicht vergaß und am Abend aufschreiben konnte. Manchmal schrieb ich auch einfach auf, was mir gerade einfiel, und träumte dann in der Nacht, wie es weiterging.
Ich war im dritten Jahrgang am Konservatorium. Den ganzen Tag freute ich mich auf das Schreiben. Wenn ich die Treppe zu unserer Wohnung hinaufging, wusste ich, dass ich bald an meinem Schreibtisch und das hieß, bei meinem Vater sein werde. Ich sprach ein paar nette Worte mit der Mutter, dann gab es das Abendessen. Es begann immer mit einem stillen Gedenken. Wir haben einfach eine Weile geschwiegen und jeder ist seinen Erinnerungen nachgehangen. Bis heute mache ich das so. Bis heute beginne ich kein Essen, ohne davor kurz innezuhalten und an meinen Vater zu denken. Vielleicht ist Ihnen das bei unserer Begegnung in Karlsbad aufgefallen. Aber in Ihrer höflichen Art haben Sie mich nicht darauf angesprochen.
Was war das jetzt? Anselm Findeisen klammerte die letzten beiden Sätze ein und schrieb an den Korrekturrand mit Bleistift ein Deleaturzeichen. Offenbar hatte die Tänzerin seinen Rat auf die Frage, wo sie anfangen solle, ganz wörtlich genommen. Verhalten Sie sich so, als würden Sie mir das alles in einem Brief mitteilen, hatte er geantwortet. Er las weiter.
Ich brächte keinen Bissen hinunter, wenn ich vor dem Essen nicht an meinen Vater denken würde. So wie andere auf das Tischgebet nicht verzichten können. Damals, nach dem Tod meines Vaters, schlang ich das Essen einfach in mich hinein. Die Hälfte ließ ich stehen und verschwand in meinem Zimmer. Heute genieße ich das Essen, auch wenn ich immer noch die Hälfte stehen lasse. Das haben Sie sicher bemerkt. Gleich ein weiteres Deleatur an den Rand.
Meine Gedichte verwilderten. Sie streiften den Reim ab, die Strophenform, die regelmäßigen Betonungen. Und dann waren es auch keine Gedichte mehr, sondern Geschichten. Eigentlich waren sie von Anfang an verpuppte Geschichten gewesen. Sie mussten sich nur erst herausarbeiten aus der Schale der strengen Form. Meiner Mutter machte es Angst, dass ich mich so beharrlich zurückziehe. Was machst du dort im Zimmer, rief sie.
Ich lese, antwortete ich, ich ruhe mich aus, ich übe, ich probiere den Ballerinenrock für morgen. Aber ich habe ihr nie gesagt, dass ich Gedichte schreibe und Geschichten ausbrüte.
Anselm Findeisen hätte gerne noch weiter gelesen, doch er hielt es nicht mehr aus in seinem Stuhl. Es war elf Uhr vormittags, hoch an der Zeit, die Übungen zu machen. Er zog die obere Schreibtischlade auf, in der der Morbus-Bechterew-Gymnastik-Kalender lag. Heute war Mattentag. Er wählte die Nummer 300, sagte zu Birgit, in der nächsten halben Stunde bin ich nicht zu sprechen, zog die Bodenmatte aus der mittleren Schublade, an die er, ohne die Wirbelsäule zu verbiegen, gerade noch herankam, hielt sie an die Tischkante und öffnete den Schnappverschluss. Die Gymnastikmatte machte einen Satz auf den Boden. Jetzt kam der schwierigste Teil, das Aufstehen. Er stemmte seine Hände auf die Armlehnen und hob seinen Körper langsam aus dem Schreibtischstuhl, ohne dabei die Stellung von Lendenwirbeln und Becken zu verändern, weil es sonst schmerzhaft werden würde. Am leichtesten ging es, wenn er sich gleichzeitig nach vorne beugte. Gekrümmt wie die Hexe in den Illustrationen zu Grimms Märchen, schlurfte er zur Tür, um sie abzusperren.
Alle im Verlag wussten, dass er sich nur mit regelmäßigen Übungen beweglich halten konnte, aber er wollte nicht, dass ihm irgendjemand dabei zusah. Es reichte, wenn er sich im Geiste selbst dabei zusah und Mitleid empfand mit einem frühzeitig den Altersschwächen anheim gefallenen Kleinverleger. Den körperlichen Teil seiner Person wäre er am liebsten losgeworden. Selbst das ausgefeilteste Gymnastikkonzept konnte seine Krankheit nicht heilen, so viel war gewiss. Wenn es ihm gegönnt wäre, ansonsten organisch gesund zu bleiben, würde er im Rollstuhl und letztlich im Rollbett enden. Und so war er mit seinen Gedanken oft in der Zukunft und fragte sich, ob er wohl erkennen werde, wann es an der Zeit wäre, Schluss zu machen, oder ob er sich selbst etwas vorgaukeln werde und am Ende gar andere bitten müsste, ihn zu erlösen. Das stellte er sich als den schlimmsten Zustand des Lebens vor, sterben zu wollen, aber nicht sterben zu können. Zum Weiterleben gleichsam verurteilt zu sein.
Während eines Kuraufenthalts in Jáchymov, der gerade erst zwei Wochen zurücklag, war er gezwungen gewesen, sich tagaus, tagein mit dem Verlauf seiner Krankheit zu beschäftigen. Bei der Heimfahrt stellte sich heraus, dass bestimmte Bewegungen, die er eigentlich schon aufgegeben hatte, wie der Blick durch die Heckscheibe beim Rückwärtsfahren, nun wieder möglich waren. Die Physiotherapeutin hatte ihm versichert, dass es bei seiner Krankheit, mit der sie täglich zu tun habe, keine klaren Prognosen gebe. Das machte ihm neuen Mut. Vielleicht könnte er durch Übungen die Krankheit so im Zaum halten, dass es ihm bis ins hohe Alter möglich wäre, sich von seinem Schreibtischstuhl zu erheben. Denn das war ihm immer als das albtraumhafte Ende seines Verlegerdaseins erschienen. Er würde die Nummer 300 wählen, Birgit würde fragen, wie lange willst du ungestört sein, und er würde antworten müssen, bitte hilf mir, ich kann nicht mehr aufstehen.
Er wusste, was ihm alles drohte, wenn er auf die Übungen verzichten würde. In einem fortgeschrittenen Stadium würde man die gänzlich versteifte Wirbelsäule, die einschlägige Literatur sprach von einer Bambuswirbelsäule, in einer aufwendigen Operation brechen und mit Metallplatten in einer aufrechteren Stellung neu verschrauben müssen. Eine Prozedur, die selten ohne größere Komplikationen abläuft, weil die Wirbel in diesem Krankheitsstadium durch Osteoporose schon so angegriffen sind, dass sie oft nicht einmal den Belastungen beim Umbetten oder Aufsetzen gewachsen sind. Rückenmarkschäden und Lähmungen sind die Folge. Anstatt sich in die Knechtschaft seiner Krankheit zu begeben und sich von immer neuen Einschränkungen langsam zermürben zu lassen, wollte er sich lieber als der Feldwebel des eigenen Körpers aufspielen und immer dann, wenn die Krankengymnastik anstand, darauf achten, dass der Patient den trotz aller Tabletten meist schmerzhaften Übungen auch gewissenhaft nachkam. Er war der Herr seines Körpers, und ihm war klar, dass seine Tage als Herr davon abhingen, dass der Knecht spurte. Seit seinem Kuraufenthalt in Jáchymov war ihm jedoch, als sollte der Knecht nicht nur spuren, sondern selbst vom Leben noch etwas haben.
Im vergangenen Herbst, als wieder einmal die Dosis der schmerzstillenden Medikamente erhöht werden musste, hatte ihm Dr. Wachsmann, sein Hausarzt, der über die Jahre zu seinem Freund geworden war, geraten, eine Radonkur zu versuchen. Als mögliche Kurorte hatte er Bad Gastein, Bad Kreuznach, Bad Schlema und St. Joachimsthal genannt. In Bad Gastein war Anselm Findeisen schon einmal gewesen, wobei ihm die Spaziergänge, zu denen der Ort mit dem Wasserfall in der Mitte geradezu einlud, wegen der großen Höhenunterschiede als besonders mühselig in Erinnerung geblieben waren. Es kam ihm vor, als hätte er seine Gasteiner Freizeit vor allem in seinem bevorzugten Transportmittel, im Parkhauslift, verbracht. Über Bad Kreuznach wusste der Hausarzt zu berichten, dass es ein netter Ort sei, in dem Karl Marx seine Jenny von Westphalen geheiratet habe. Ein altes Radon-Sole-Bad von eher milder Intensität, sagte er und entkorkte dabei eine Flasche DAC. Du solltest etwas Stärkeres probieren.
Meinst du ein Schnäpschen? Man spricht übrigens schon im Wartezimmer über deine Vorlieben.
Ach ja? Was sagt man denn?
Anselm Findeisen, der gewöhnlich am Freitagnachmittag als letzter Patient bestellt war, hatte an diesem Tag länger warten müssen. Schon im Vorzimmer, wo die Sprechstundenhilfe seine Versicherungskarte registrierte, fiel ihm auf, dass die Patienten nicht wie sonst schweigend im Wartezimmer saßen, in Zeitschriften blätterten oder auf die gepolsterte Tür starrten, sondern sich unterhielten, wenngleich mit gedämpfter Stimme, sodass er nicht hören konnte, worüber sie sprachen. Als er eintrat, wurde das Gespräch kurz unterbrochen. Dann nahm eine Frau aus der Klagbaumgasse, von der er sogar wusste, in welchem Haus sie wohnte, ohne je mit ihr gesprochen zu haben, den Faden wieder auf. Und nun war auch klar, warum sie so leise sprachen.
Wenn er wirklich ein Alkoholiker wäre, sagte sie, müsste er doch auch tagsüber trinken, und das würde man riechen. Wenn er aber nur am Abend trinkt, hätte er nicht so ein rotes, aufgedunsenes Gesicht gekriegt. Der muss etwas anderes haben, was meinen Sie?
Die Frau wandte sich an Anselm Findeisen, vielleicht wusste sie, dass er mit Dr. Wachsmann vertrauter war als die anderen Patienten. Es war natürlich völlig ausgeschlossen, der Tratschtante aus der Klagbaumgasse zu erzählen, dass Dr. Wachsmann seit Jahren tagsüber Tabletten schluckte und am Abend ein paar Flaschen leerte. Hingegen fühlte er sich verpflichtet, Dr. Wachsmann zu erzählen, worüber seine Patienten sprachen.
Der Arzt tat zunächst so, als würde er gar nicht zuhören. Er nahm zwei langstielige Gläser aus dem Wandschrank, hielt sie kurz gegen das Licht und schenkte Weißwein ein. Die Sprechstundenhilfe hatte er heimgeschickt und die Ordination abgesperrt, wie immer, wenn er mit Anselm Findeisen bei einer Flasche die Arbeitswoche ausklingen ließ. Sie stießen an. Auf eine schmerzfreie Zukunft, sagte Anselm Findeisen.
Die kann ich dir nicht garantieren, antwortete der Doktor, aber schauen wir, was sich machen lässt.
Und du wirst mir am Ende den Cocktail geben, der mich angenehm hinüberträumen lässt?
Was redest du immer vom Sterben, vielleicht hast du noch die schönsten Jahre vor dir.
Leeres Gerede, sagte Anselm Findeisen. Am Ende stellt sich heraus, dass die schönsten Jahre diejenigen waren, in denen man geträumt hat, man hätte sie noch vor sich.
Dann träum wenigstens von Cocktails, die dir das Leben erleichtern, nicht das Sterben. Das hier ist so einer. Prost. Sie stießen erneut an.
Mein Großvater, sagte Dr. Wachsmann, war Pfeifenraucher. Er hat bis ins hohe Alter seine Porzellanpfeife gepafft. Und weißt du, was auf dem Pfeifenkopf stand? Wir leben so dahin/ nd nehmen nicht in Acht,/dass jeder Augenblick/das Leben kürzer macht. So geht das. Wie bei den drei Zigeunern von Lenau. Dreifach haben sie mir gezeigt – der Doktor schloss die Augen und dachte kurz nach, bevor er weiterrezitierte –, wenn das Leben uns nachtet,/wie man's verraucht, verschläft, vergeigt/und es dreimal verachtet.
Er nahm einen Schluck, drehte mit Daumen und Zeigefinger am Stiel des Weinglases und beobachtete dabei die Flüssigkeit. Schau, wie ruhig der Wein bleibt, während es draußen rundgeht, sagte er und stellte das Glas auf dem Schreibtisch ab. Nun ist es also so weit, fuhr er fort, man redet über mich. Er rückte das Weinglas ein Stück von der Computertastatur weg, dann blickte er Anselm Findeisen an und sagte: Weißt was? Lass sie reden. Zurück zu deinem Problem. Im Prinzip wäre Bad Schlema im Erzgebirge zu empfehlen. Allerdings haben sich dort deine speziellen Freunde derart gierig ins Uranerz hineingegraben, dass sich die Talsohle bis zu acht Metern abgesenkt hat. Die alten Radonquellen sind versiegt und man hat letztlich den gesamten Ortskern abtragen müssen. Nach der Wende wurden aber neue Quellen erschlossen und man hat auch ein neues Kurhaus …
Verschone mich mit der russischen Atomindustrie, fiel ihm Anselm Findeisen ins Wort. Ehemaliges Wismut-Gelände kann mir gestohlen bleiben. Ich habe den Roman Rummelplatz von Werner Bräunig gelesen.
Verstehe, sagte der Hausarzt. Dann versuchen wir es mit der tschechischen Seite des Erzgebirges, mit Jáchymov, dem ehemaligen k.u.k. Kurort St. Joachimsthal. Marie Curie, sagt dir der Name was? Sie hat zusammen mit ihrem Mann das Radium entdeckt. In der Pechblende aus St. Joachimsthal. Allerdings hat es später auch dort Uranbergbau gegeben und du musst dich darauf gefasst machen, dass der Ort nach der Stilllegung der Minen, sagen wir, etwas heruntergekommen ist. Wenn du willst, melde ich dich im Radium-Palace an, einem Nobelhotel aus der Zeit der Monarchie, an dem sich seit hundert Jahren nicht viel verändert hat.
Das ist alles, fragte Anselm Findeisen.
Alles, was ich weiß, prost.
Sie stießen erneut an.
Ich muss mich hinlegen, sagte Anselm Findeisen. Sein Freund zog die Ordinationsliege herbei, stellte sie etwas tiefer und half ihm beim Aufstehen. Häng dich an mich, sagte er, ich zieh dich hoch. Ich verpass dir auch gleich die Injektion. Sie wird dich bis morgen Vormittag schmerzfrei halten.
Anselm Findeisen ließ sich mühsam auf die Ordinationsliege zurücksinken, wobei er bei jeder Bewegung die Zähne zusammenbiss.
Lass dir Zeit, sagte Dr. Wachsmann, du weißt am besten, was geht und was nicht.
Scheiße, Scheiße, Scheiße, stöhnte Anselm Findeisen. Als er sich endlich ganz ausgestreckt hatte, injizierte ihm sein Freund ein Antirheumatikum in das Kreuzbein-Darmbeingelenk und stellte ein neues Rezept aus. Probier es mit zwei Tabletten am Tag, sagte er. Wenn es nicht reicht, dann drei. Nicht Auto fahren. Jedenfalls nicht in der ersten Woche. Da wird dir nämlich schwindlig sein. Nach fünf, sechs Tagen solltest du dich daran gewöhnt haben.
Anselm Findeisen nickte. Er begann sich zu entspannen.
Wie ist es in Jáchymov, fragte er.
Wie in jedem Kurort. Eine resolute Krankenschwester wird dir sagen, was du zu tun hast, Wannenbäder, Massagen, Inhalationen, du musst natürlich pünktlich zum Essen erscheinen und wenn du endlich einmal Zeit für dich hättest, musst du die schreckliche Musik der Tanzkapelle ertragen und den alten Damen Komplimente machen. Aber einen Versuch ist es wert. Ich werde mir inzwischen einen Geigerzähler anschaffen, um zu sehen, ob ich dich danach überhaupt noch in die Ordination hereinlassen darf. Prost.
Und was ist mit dir, fragte Anselm Findeisen. Ich meine, du kannst doch nicht einfach so weitermachen. Dein Gesicht ist nicht nur aufgedunsen wie eine Schweinsblase, es beginnt mittlerweile auch blau anzulaufen.
Das musst gerade du mir sagen, entgegnete der Doktor. Ein Schöngeist, der nichts Besseres im Sinn hat, als möglichst elegant seiner Körperruine zu entkommen, beginnt bei anderen kosmetische Details zu benörgeln. Wir werden ja sehen, welche Batterie ihren Testhasen weiter in die Wüste hineinschickt, deine oder meine.
Anselm Findeisen begann, sein Becken vorsichtig zu bewegen, um herauszufinden, ob die Injektion schon wirkte. Dann setzte er sich auf und nahm einen Schluck. Er sagte: Bevor ich dort ein paar Wochen verzweifelt herumhänge und mich mit deutschen Pensionisten über Krankheiten und Altersgebrechen unterhalte, möchte ich mir dieses Jáchymov einmal anschauen.
Dieses Gespräch mit dem Arzt hatte im letzten Herbst stattgefunden. Es war ein folgenreiches Gespräch gewesen. Er hatte die Tänzerin kennen gelernt, für den Verlag ein neues Buchprojekt an Land gezogen und zu seinem Körper ein entkrampfteres Verhältnis gefunden. Ausgestreckt auf der Gymnastikmatte konnte er die Hügellandschaft auf der Unterseite der mittleren Schreibtischlade sehen. Das waren die Kaugummis, die er in besseren Zeiten dort hingeklebt hatte, wenn Besuch gekommen war. Um die Gäste nicht mit seinem Raucheratem zu belästigen, hatte er im Büro nach jeder Zigarette Kaugummi gekaut. Er drehte sich auf die linke Seite, streckte den rechten Arm über den Kopf, legte den linken Arm auf die Rippen und begann tief zu atmen. Das Bild neben der Eingangstür zeigte ihn als siebzehnjährigen Fallschirmspringer bei der Landung. Der junge Mann, der bei nationalen Wettkämpfen Medaillen gewonnen hatte, schaute nun herab auf das Wrack, zu dem er geworden war. Einmal war Anselm Findeisen drauf und dran gewesen, das Bild, das ihn in grauer Uniform kurz vor dem Aufsetzen zeigte, abzuhängen, weil es nicht nur ihm selbst, sondern auch den Mitarbeitern seinen körperlichen Verfall überdeutlich vor Augen führte. Aber als er es in Händen hielt, empfand er dann doch auch wieder eine Art Stolz darüber, dass er sich der Härte der Ausbildung unterzogen hatte und es mit Wagemut, Training und, wie ihm inzwischen auch klar geworden war, einem guten Stück geteilter Weltanschauung bis zum Gruppenführer gebracht hatte. Ursprünglich war er der Gesellschaft für Sport und Technik beigetreten, um günstig und ohne Wartezeiten den Führerschein zu bekommen, sowohl für Motorrad als auch für Pkw und Lkw, aber dann begann er sich für eine Aktivität zu interessieren, für deren Ausübung es sonst keine Möglichkeit gegeben hätte, für das Fallschirmspringen. Innerhalb kürzester Zeit war er diesem Sport verfallen. Wenn sein Körper noch mitmachen würde, er hätte bis heute Lust, aus einem Flugzeug zu springen und mit zweihundert Stundenkilometern auf die Erde zuzurasen, bis zu dem Punkt, an dem es Zeit war, den Aufziehgriff zu betätigen.
Er war mit den alten Rundkappenfallschirmen gesprungen, die eigentlich für das Militär konzipiert worden waren. Und wäre alles nach Plan gelaufen, hätte seine Karriere nicht in den Westen, sondern in die mit vielen Auszeichnungen geehrte Leistungssportgruppe der Fallschirmjäger der nationalen Volksarmee geführt. Als er mit diesem Sport angefangen hatte, waren die Fallschirme noch über die automatischen Aufziehleinen, die am Flugzeug befestigt waren, geöffnet worden. Den Reservefallschirm hatten die Springer damals noch am Bauch montiert. Aber dann bekam die Gesellschaft für Sport und Technik die neuen Fallschirme geliefert, mit einem Aufziehgriff in Brusthöhe und mit Längsschlitzen im Schirm, die ihn über zwei Leinen steuerbar machten. Man konnte auf ein Landungsziel zufliegen, zuerst im freien Fall mit Hilfe der vier Notflügel, die dem Menschen von Natur aus gewachsen sind, dann, nach der Öffnung des Schirms, mit Hilfe der Steuerleinen. Von da an wurde Fallschirmspringen zum Wettkampfsport. Anselm Findeisen war in seinem Zug einer der besten Zielspringer. Am Schluss war er Leiter einer Viererformationstruppe und Kader im Programm der vormilitärischen Ausbildung für Fallschirmjäger der NVA. Immer noch hatte er es in sich, dieses wunderbare Gefühl des Segelns in der Luft, während sein Körper in Wirklichkeit auf der Matte lag und Übungen machte, die aus der Sicht eines Sportlers jenseits jeder ernst zu nehmenden Körperbetätigung lagen.
Sie sollen Ihren Kerper nicht trainieren bis Sie stehnen, hatte die Physiotherapeutin in Jáchymov gemeint, Sie sollen heren, was Kerper sagt. Wollte er sich daran halten, musste er von vorne beginnen, weil er in den letzten Jahren vor allem bestrebt gewesen war, sich Körpergefühle abzugewöhnen und seinem Bewegungsapparat die nötigen Trainingseinheiten gleichsam mechanisch zuzuführen. Was sagt Kerper? Wenn er Übungen machte, sagte sein Körper vor allem, lass mich in Ruh! Und wenn er in Ruhe war, sagte er vor allem, ich brauche Bewegung, sonst halte ich es nicht aus.
Bei seinem ersten Besuch in Jáchymov, es war noch nicht die Kur, es war eine Art Sondierungsfahrt, hatte er eine Tänzerin kennen gelernt, deren Geschichte ihn seither nicht mehr losließ. Sie müssen das aufschreiben, hatte er zu ihr gesagt, Sie müssen mir versprechen, dass Sie das aufschreiben. Er hatte sie dann alle paar Wochen angerufen und auch hin und wieder getroffen, um zu fragen, wie weit das Manuskript sei. Er hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass es dieses Manuskript je geben würde. Er hatte bisher nicht den kleinsten Teil davon gesehen. An diesem Morgen war es plötzlich in der Post gewesen.
Mein Vater, so schrieb sie, hat mich nie auf einer Bühne gesehen. Als ich anfing zu tanzen, lag er schon danieder. Zur Mittagspause im Konservatorium, es waren eineinhalb Stunden, lief ich nach Hause, um ihm behilflich zu sein, er konnte ja selbst nichts mehr machen, oder ich streichelte nur die Hand. Wenn ich am Abend heimkam, ging ich als Erstes zu ihm ins Zimmer. Ich zeigte ihm, was wir übten. Er drehte den Kopf herüber und lächelte. Ich ging zu ihm ans Bett, in meinem Tanzdress. Ich hatte mir das Tutu und die Spitzenschuhe am Konservatorium in der Garderobe ausgezogen, um sie daheim im Vorzimmer wieder anzuziehen. In dieser Aufmachung erschien ich bei meinem Vater, am Bett eines Todkranken. Ich zeigte ihm eine Pirouette und den Entrechat quatre, der mir damals noch nicht ganz gelingen wollte. Ich drehte mich langsam im Kreis, mit Trippelschritten. Er hat den Kopf bewegt und mit den Augen applaudiert. Die Hand konnte er nicht mehr bewegen. Aber er hat seine Lider so gehoben und gesenkt, dass ich deutlich gespürt habe, wie er mir applaudiert und wie er mich umarmt.
In den Gedichten und Geschichten, die ich nach seinem Tod schrieb, gab es Umwege, aber am Ende kam er immer vor. In den Geschichten und auch in meinen Träumen. Alles, was ich schrieb, führte letztlich zu meinem Vater. Manche Geschichten wurden fünf, sechs, sieben Heftseiten lang. Es war wie ein Rausch. Nie hörte ich zu schreiben auf, bevor die Geschichte nicht bei meinem Vater angelangt war. Erst dann wurde ich müde und hatte das Gefühl, jetzt sollte ich Schluss machen und schlafen gehen.
Und es konnte geschehen, dass ich mich am nächsten Tag in derselben Steppe wiederfand, aber die alten Männer mit Bärten, die meinem Vater alle Ehre zugesprochen hatten, waren verschwunden. Als wären sie von der Brücke gesprungen. Ich blicke in die Tiefe, doch da unten sind nur Steine, Sandhaufen und Disteln. Haben die Männer nicht gesagt, in seinen Kindern soll er das Glück finden? Das ist ein Auftrag an mich. Ich bin seine Tochter, ich muss ihm das Glück bringen. Ich blicke mich um. Am Ende der Brücke steht immer noch der Fahrer des Geländewagens. Er hält meinen Koffer in der Hand und winkt mir zu. Er ruft etwas, was ich nicht verstehen kann. Ich gehe zu ihm und sage: Jáchymov! Vergiss die Farm, wir fahren jetzt nach Jáchymov!
Der Fahrer schaut eine Weile nachdenklich drein, ich wiederhole Jáchymov, da nickt er, als hätte er endlich verstanden. Er wirft meinen Koffer hinten ins Auto, wir steigen ein und er fährt los. Aber er fährt weiter den ausgetrockneten Fluss entlang und der Sonne entgegen. Ich sage: Das ist die falsche Richtung. Du musst umdrehen. Doch das kümmert ihn nicht, er braust weiter der Sonne entgegen. Ich klopfe ihm auf die Schulter, ich lege die Hand auf seinen Arm und schreie ihm ins Ohr: Anhalten! Er fährt einfach weiter. Was ich auch rufe und so sehr ich an ihm herumreiße, er beachtet mich nicht. Ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen, als mit aller Kraft in seinen Arm zu beißen. Da bleibt er endlich stehen und betrachtet die Bisswunde. Sie beginnt zu bluten. Ich halte eine Hand darunter und fange die Blutstropfen auf. Eine Weile ist er wie gelähmt, dann springt er aus dem Wagen und läuft fort. Ich steige auch aus und sehe ihm nach, wie er hinter den stacheligen Gewächsen verschwindet. Neben dem Auto liegt ein Stein. Ich zeichne mit dem Blut, das sich in meinem Handteller gesammelt hat, einen Pfeil auf diesen Stein.
Nach einer Weile kommt der Fahrer zurück. Er trägt einen Verband aus Baumrinden um den Arm. Als er den Pfeil sieht, nickt er, als würde er nun erst verstehen, was ich von ihm wollte. Er wendet den Wagen und fährt entlang des Grabens zurück, die Sonne im Rücken. Ich sinke in den demolierten Autositz, aus dem Spiralfedern herausschauen, und warte darauf, dass die Brücke kommt. Mir ist, als müsste sie längst da sein, doch sie ist nicht zu sehen. Da ist immer nur der leere Graben mit Steinen, Sandhaufen und Oasen aus niedrigen grünen Gewächsen. Das Suchen macht mich müde und ich schlafe ein. Im Traum sehe ich meinen Vater, wie er unter Tag mit bloßen Händen einen Stein trägt, so groß, dass er damit nicht vorankommt. Breitbeinig steht er da, schwankt und schiebt auf dem glitschigen Felsenboden einen Fuß nach vorne, kann kaum das Gleichgewicht halten und zieht den anderen Fuß nach. So schleppt er sich Schritt für Schritt voran, bis er einknickt und hinfällt. Er bleibt auf dem Felsen liegen und lässt den Kopf in eine Pfütze sinken. Von den Felswänden tropft Wasser auf seinen Körper.
Ich wache auf, es ist dunkel um mich. Immer noch sitze ich im Auto. Die Fahrt ist ruhiger geworden. Ich schaue aus dem Fenster, aber es ist nichts zu sehen, das Auto hat keine Scheinwerfer. Mir ist schleierhaft, woran der Fahrer sich orientiert, vielleicht an den Sternen.
So werden wir nie nach Jáchymov kommen, sage ich. Da erst bemerke ich, dass wir fliegen. Dieses Auto ist ein Flugzeug.
Ich schaue mir den Chauffeur genauer an. Ein kleiner Mann, der still vor sich hinlächelt. Er trägt, wie mir jetzt erst auffällt, eine Uniform. Aber es ist keine Pilotenuniform.
Wer bist du, frage ich.
Zitek, antwortet er. Siehe da, er kann reden.
Zitek, der Hexenmeister?
Der bin ich, antwortet er.
Und was machen wir jetzt?
Wir fliegen nach Prag, von dort fahren wir nach Jáchymov, um deinen Vater aus dem Stollen zu holen.
Ich werde meinen Vater treffen?
Du wirst ihn sehen, mit meinen Augen. Aber er wird dich nicht sehen und du darfst ihn nicht ansprechen. Du darfst überhaupt niemanden ansprechen, du bist so gut wie nicht vorhanden.
Wir landen nicht in Praha-Ruzyně, sondern in Praha-Letňany, einem kleinen Sportflughafen, der von der Jugendorganisation Svazarm betrieben wird. Die Männer des Bodenpersonals torkeln aus einem flachen Bau hervor, sie winken uns fröhlich mit Wodkaflaschen zu. Als sie Ziteks Uniform sehen, salutieren sie.
Ehre der Arbeit, sagt Zitek. Die Betrunkenen antworten im Chor, Ehre der Arbeit.
Sagt eurem Kommandeur, Genosse Zitek ist eingetroffen, der Oberinspektor der Brigaden der sozialistischen Arbeit. Ich brauche sofort eine Limousine mit Chauffeur für eine Inspektion in Jáchymov.
Die Männer salutieren erneut und laufen zurück in die Flughafenbaracke. Ich sehe ihnen nach, aber ich sehe ihnen mit Ziteks Augen nach. Sein Gesicht ist für mich verschwunden. Ich sehe seinen linken Arm, als Zitek auf die Uhr blickt. Dann sehe ich seinen linken Fuß, wie er ihn anhebt und auf den Querbalken eines Geländers stellt, um den Schnürsenkel neu zu binden. Ich sehe den anderen Fuß, dann seine Hände, sie fahren unter das Blickfeld, dann sehe ich sie seinen Körper heraufkommen, bis nur noch die Handrücken sichtbar sind. Die Finger scheinen auf der Höhe des Halses etwas zu ordnen, die Krawatte oder den Uniformkragen. Ich schaue den Bau entlang mit seinen beleuchteten Fenstern, darüber ein Transparent, das Wort für Wort in den Blick kommt: Willkommen im Lager des Friedens und des Sozialismus. Dann ist ein Motor zu hören, der Blick geht zurück zum anderen Ende des Baus, wo eine Tatra-Limousine um die Ecke fährt und auf uns zukommt. Der Chauffeur ist zuerst durch die Windschutzscheibe zu sehen, dann durch das Seitenfenster. Er springt aus dem Auto, salutiert, läuft auf uns zu und öffnet die Beifahrertür. Als Zitek einsteigt, steige ich in gewisser Weise mit ein, ohne dass für mich eigens die Tür geöffnet werden muss. Zitek deutet auf den herausgezogenen vollen Aschenbecher unter der Konsole. Der Chauffeur zieht ihn heraus und entleert ihn mit einem Schwung aus dem Fenster.
Wir fahren durch die Nacht, vor uns die von Scheinwerfern ausgeleuchtete Straße. Der Fahrer raucht eine Zigarette nach der anderen. Als wir in die Berge kommen, bricht die Morgendämmerung an. Die Uhr auf Ziteks Hand zeigt halb sechs. Auf einer Bergstraße kommen uns mehrere Gruppen entgegen. Sie gehen in Fünferreihen, gut zwanzig hintereinander, sie tragen alle dieselbe Kleidung und Schiffchen auf dem Kopf. Ihre Körper sind so eng beisammen, als wären sie aneinander geklebt. Sie können nur im Gleichschritt gehen.
Halt, höre ich Zitek sagen. Der Wagen bleibt am Straßenrand stehen. Die erste Gruppe von Häftlingen geht an uns vorbei. Ich sehe, dass sie mit einem Stahlseil zusammengebunden sind. Ein Uniformierter mit Gewehr begleitet sie. Das Fenster wird hinabgekurbelt. Die Häftlinge drehen ihre Köpfe zu uns herüber. Ich fange einen Blick auf, einen durchdringenden Blick. Vater, rufe ich, hier bin ich. Er schaut mich an und schüttelt langsam den Kopf. In diesem Augenblick wird mir bewusst, ich hätte ihn nicht ansprechen dürfen. Ich sitze an meinem kleinen Schreibtisch in der Klimentská, meine Mutter schläft schon, für heute habe ich meinen Vater verloren.
Ich hatte eine rauschhafte Verbindung mit meinem Vater, und ich war stolz darauf. Manchmal war es, als würde ich direkt zu ihm sprechen. Länger als ein Jahr ging das so. Es gab auch Tage, an denen ich keinen Text schrieb, weil es einfach nicht möglich war. Den ganzen Tag war irgendein Programm und ich war am Abend zu erschöpft, um noch einmal das Licht anzumachen, das Kleid hinter den Türschlitz zu legen, damit von meinem Zimmer kein Schein nach außen drang, mich an den Schreibtisch zu setzen und dann womöglich meinen Vater damit zu enttäuschen, dass ich keine zwei Seiten mehr durchhalte. Am nächsten Tag habe ich mich dann dafür entschuldigt. Ich habe einen Brief an ihn verfasst. Du darfst nicht denken, dass ich dir untreu geworden bin, habe ich geschrieben. Ich kann doch gar nicht leben ohne dich. Immer werde ich dir treu bleiben, so wie auch Erika dir treu war, während du im Gefängnis warst. Wenn es anders wäre, würde ich es dir sagen. Du weißt, ich sag dir alles. Mit wem hätte sie dich auch betrügen sollen? Einen so schönen Mann wie dich hätte sie nirgendwo gefunden.
Du meinst wegen Erikas Vater, wegen des Herzspezialisten? Der hat gewiss seine eigene Art gehabt, die Frauen am Herzen zu heilen. Erikas Mutter war bald geschieden und ihr Vater ist in die Schweiz zurückgegangen, von der Herzklinik in Prag in eine Herzklinik am Genfer See. Ich konnte mir kein eigenes Bild von ihm machen, ich habe ihn nie kennen gelernt. Wenn es Erika einmal erlaubt wurde, ihn zu besuchen, dann ohne Kinder. Wir mussten in Prag bleiben, wir waren das Faustpfand des Staates, damit Erika wieder zurückkommt. Als du im Gefängnis warst, hat sie uns immer Lieder vorgesungen. Oft war es eine Arie aus der Oper Rusálka von Dvořák. Sie kann so wunderschön singen …
Solche Briefe schrieb ich. Ich erzählte meinem Vater nicht nur, was gerade los war, was ich dachte und für ihn fühlte, sondern auch Sachen, die er wusste oder gar selbst erlebt hatte. Ich bildete mir nicht ein, dass er mich beobachten könnte, im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, wir sind für immer getrennt. Jedenfalls so lange ich lebe. Für mich war er ins Dunkel verschwunden. Und meine Briefe sollten ihm dieses Dunkel erhellen, ihm Nachricht geben von der anderen Welt, die für ihn verloren war. Ich ging davon aus, dass jemand, der nicht mehr auf dieser Welt lebt, auch kein Erinnerungsvermögen mehr haben kann. Das Erinnern gehört zu uns lebenden Menschen. Das, was wir mit Erinnerung meinen, gibt es nur hier auf dieser Welt. Ich brauche nur eins auf den Kopf zu kriegen und meine Erinnerung ist weg. Wie viel mehr, wenn ich sterbe und der Körper sich auflöst. Meinem Vater ist Erinnerung nicht mehr zugänglich, davon war ich überzeugt. Und deshalb wollte ich ihm ein Bild von der Welt, in der er gelebt, und den Menschen, die er zurückgelassen hat, nachliefern.