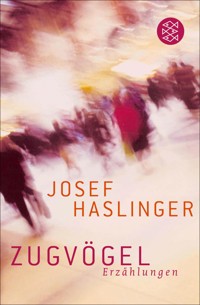9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die Gäste des Wiener Opernballs werden zum Ziel eines Terroranschlags. Ein Fernsehjournalist, der die Live-Übertragung aus den Ballsälen koordinieren soll, beobachtet das Verbrechen auf den Monitoren. Sein eigener Sohn ist unter den Opfern. Die Kameras laufen weiter und senden weltweit auf zahllose Bildschirme das Sterben von Tausenden. Der TV-Journalist versucht, von Trauer um seinen Sohn getrieben, die Hintergründe des Anschlags zu klären. Sie sind verworren, von Schlamperei und Zufällen geprägt. Mindestens so verworren wie das Weltbild jener kleinen Gruppe, die das Morden vorbereitete. Josef Haslingers spannender Medienroman und Politthriller entwirft das Panorama einer vom Terrorismus bedrohten Wohlstandsgesellschaft. Er zeigt die grotesken politischen Widersprüche auf zwischen Liberalität und Bedürfnis nach Sicherheit; den kaum kontrollierbaren Einfluß des Fernsehens auf Alltagsleben und Regierungsentscheidungen sowie das fatale Zusammenwirken von wiederaufflammendem Nationalismus, Fremdenfurcht und politisch motivierter Gewalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Ähnliche
Josef Haslinger
Opernball
Roman
Fischer e-books
Reso Dorf bleibt ein »Bauernführer«
Bei der Vereidigung von Revierleitern greift der Wiener Polizeipräsident erneut zu offenen Worten
Polizeipräsident Reso Dorf, mittlerweile für seine entschlossene und volkstümliche Sprache wohlbekannt, begann seine Rede anläßlich der Angelobung von neuen Revierleitern auf dem Wiener Heldenplatz zunächst mit nachdenklichen Tönen.
»War es nicht auch eine Prüfung«, fragte er im Hinblick auf die Opernballkatastrophe, »die härteste Prüfung, die unser Land in Friedenszeiten heimgesucht hat?«
Doch gleich darauf fand er entschlossenere Worte. »Warum«, so wetterte er zu den angetretenen Kommandanten, »haben wir nicht rechtzeitig die Zügel in die Hand genommen? Diesem Gesindel die Stirn geboten? Mit eisernen Schlägen vernietet, was noch nicht hoffnungslos zerrissen war? Warum haben wir nicht aufgeräumt? Entrümpelt? Das Unkraut ausgerissen, solange es noch klein war?«
Ein Recht ohne Macht, so erklärte Reso Dorf den strammstehenden »Bauernburschen«, sei zum Untergang verurteilt und stürze den ganzen Staat in den Abgrund.
Bei seiner Antrittsrede im März hatte sich Reso Dorf als »Bauernführer« bezeichnet. Ein Polizist, so hatte er damals gemeint, müsse mißtrauisch sein wie ein Bauer.
Seine Rede vor den frisch ernannten Kommandanten wurde von Satz zu Satz bilderreicher.
Wörtlich führte er aus: »Wir haben diese Sonderlinge unterschätzt, wir haben diese Aufsässigen für lächerliche Subjekte gehalten, haben zugelassen, daß sie alles besudelten, heruntermachten, entehrten und hemmungslos schändeten.
›Es sind doch nur Schwächlinge‹, haben wir gesagt. ›Die sind ein Furz, den wir, wenn er uns zu sehr stinkt, einfach durch das Fenster entlassen.‹ Und wir haben darüber gelacht. Zweifellos werden sich einige von Ihnen an solche Sprüche erinnern: ›Die haben wir im Griff.‹ ›Die spritzen wir, wenn sie übermütig werden, von der Straße.‹ ›Die treiben wir über die Donau.‹
Bis uns plötzlich das Lachen verging, als sich herausstellte, daß in diesem Dschungel von Halbaffen, Ratten und Schmeißfliegen die gefährlichsten Täter herangereift waren, die unser Land bislang gesehen. Auf einmal war es zu spät, und wir knickten ein wie morsches Gerümpel.
Während der Bogen des Zumutbaren täglich aufs neue überspannt wurde, empfingen wir Menschenrechtsdelegationen und führten ihnen unsere Gefängnisse vor.
›Liberalität, Toleranz‹, hieß es, ›Freiheit der Meinungsäußerung, Demonstrationsrecht.‹ Aber das hat, verdammt noch mal, alles doch irgendwo seine Grenze.
Wenn ein Hund sein Wasser abschlägt, dünn und stinkend … Ich werde hin und wieder wegen meiner Ausdrucksweise kritisiert. Aber feine Worte sind hier ganz und gar fehl am Platz.«
Sagte es und ließ am Schluß seiner Rede an Deutlichkeit nichts vermissen:
»Wenn ein Hund sein Wasser abschlägt, ist nach kurzer Zeit alles vorbei. Eine kleine Menge unangenehm riechender Flüssigkeit, die am Wegrand versickert.
Doch bei diesen Bestien war es anders. Wir haben ihnen die Wegränder überlassen und nicht darauf geachtet, daß hier kein Einhalt ist, daß die Gülle immer weiterrinnt, daß sich überall Drecklachen bilden, im Winter von milchig brüchigem Eis bedeckt, mit gelben Schlieren darin, daß bereits das ganze Land von Jaucherinnsalen überzogen ist und daß die Kloake unaufhörlich ansteigt, den fruchtbaren Boden versumpft und alles in einen dumpf vor sich hin faulenden Zustand versetzt, bis sich ein Urinteich bildet, ein Jauchesee, ein Güllemeer, durchzogen von Fäulnis, Tod und Verwesung, worin sich Gestalten entwickeln, die tausend Jahre im Licht der Sonne nicht mehr gesehen wurden. Da hätte es doch nur eines geben müssen – aber das haben wir versäumt.«
An der Vereidigungszeremonie nahm auch der Bundespräsident teil. Nach der Feier, auf die Rede von Reso Dorf angesprochen, antwortete er: »Ich würde es anders ausdrücken, aber im Prinzip hat der Herr Polizeipräsident natürlich recht.« (APA/J. H.)
Der Kameramann
Fred ist tot. Die Franzosen haben ihn nicht beschützt. Als die Menschen vernichtet wurden wie Insekten, schaute ganz Europa im Fernsehen zu. Fred war unter den Toten. »Gott ist allmächtig«, hatte ich als Kind gehört. Ich stellte mir einen riesigen Daumen vor, der vom Himmel herabkommt und mich wie eine Ameise zerdrückt. Wenn etwas gefährlich oder ungewiß war, hatte Fred gesagt: »Die Franzosen werden mich beschützen.«
Ich saß damals im Regieraum des großen Sendewagens. Vor mir eine Wand von Bildschirmen. Auf Sendung war gerade die an der Bühnendecke angebrachte Kamera. Plötzlich ging ein merkwürdiges Zittern und Rütteln durch die Reihen der Tanzenden. Die Musik wurde kakophonisch, die Instrumente verstummten innerhalb von Sekunden. Ich schaltete auf die Großaufnahme einer Logenkamera und überflog die Monitore. Die Bilder glichen einander. Menschen schwanken, stolpern, taumeln, erbrechen. Reißen sich noch einmal hoch, können das Gleichgewicht nicht halten. Stoßen ein letztes Krächzen aus. Fallen hin wie Mehlsäcke. Einige schreien kurz, andere länger. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Sie sehen, sie spüren, daß sie ermordet werden. Sie wissen nicht, von wem, sie wissen nicht, warum. Sie können nicht entkommen.
Als es geschah, fand ich Fred nicht auf den Bildschirmen. Er war der einzige Gedanke, an den ich mich erinnere. Die Aufzeichnung bewies mir jedoch, daß ich routinemäßig noch ein paar andere Kamerapositionen abgerufen hatte, bevor mir die Hände versagten. Millionen von Menschen aus ganz Europa schauten den Besuchern des Wiener Opernballs beim Sterben zu.
Fred wurde erst mein Sohn, als er siebzehn Jahre alt und heroinsüchtig war. Damals begann ich, um ihn zu kämpfen. Er gewann sein Leben zurück. Er wollte es festhalten. Er war sich selbst keine Gefahr mehr. Er hatte Tritt gefaßt. Und dann wurde er ermordet. Wir alle sahen zu und konnten nichts tun.
Um mich herum ein paar Techniker. Einer von ihnen war geistesgegenwärtig genug, mein Regiepult zu übernehmen. Die bemannten Kameras lieferten bald nur noch Standbilder, auf denen nacheinander die Bewegungen erstarrten. Stumme Aufnahmen von glitzernden, hohen Räumen, übersät mit Toten. Fotos von Menschen in Ballkleidern, die bunt durcheinander im Erbrochenen liegen, umrankt von Tausenden rosa Nelken. Die drei automatischen Kameras fingen wieder zu schwenken an. Vergeblich suchten sie nach Anzeichen von Leben. Neben mir sprach einer französisch. Ich schwankte hinaus in den Lärm. Ich dachte, ich müsse Fred retten. Draußen herrschte Chaos. Ich drängte mich durch die Menge, bis ich in die Nähe des Operneingangs kam. Da sah ich, daß es nichts gab, was ich für Fred noch hätte tun können. Als ich in den Sendewagen zurückkam, erfuhr ich, daß Michel Reboisson, der Chef von ETV, nach mir verlangt hatte.
ETV blieb europaweit auf Sendung. Eine unerträgliche Stille. Nur zwei Kameras waren ausgefallen. Die anderen lieferten weiter ihr jeweiliges Standbild. Sie wurden in langsamer Folge auf Sendung geschaltet. Jemand schrie ins Telefon: »Musik, wir brauchen Musik!«
Wir hatten keine geeignete Aufnahme im Sendewagen. Nach einer Weile wurde vom Studio aus, wo es in dieser Nacht nur einen technischen Notdienst gab, das Violinkonzert von Johannes Brahms eingespielt. Der Streit darüber, ob dies die richtige Musik sei, dauerte bis gegen Ende des zweiten Satzes. Dann wurde das Violinkonzert unterbrochen. Es gab Durchsagen der Polizei und der Feuerwehr. Währenddessen wurde Mozarts Requiem gefunden. Wir blieben auf Sendung. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis die Kameras auf den mit Leichen verstopften Korridoren der Wiener Staatsoper wieder Leben einfingen – Männer mit signalroten Schutzanzügen und Gasmasken.
Ich sah den Massenmord auf zwanzig Bildschirmen gleichzeitig. Mein einziger Gedanke: Fred ist nicht dabei. Ich finde ihn nicht. Er hat eine neue Kassette geholt. Er ist auf die Toilette gegangen. Er hat Kamera fünf seinem Assistenten überlassen, ist rauchen gegangen. Fred ist starker Raucher. Er ist nicht im Saal. Und doch sehe ich, wie er den Mund aufreißt, wie er auf die am Boden liegende Frau fällt. Ich sehe seinen leblosen Körper, das Erbrochene, das aus seinem Mund auf das weiße Abendkleid herabrinnt. Ich sehe, wie es seinen Kopf mit einem Ruck nach hinten reißt, wie er über die Balkonbrüstung stürzt. Ich sehe, wie sein Gesicht in einem Teller aufschlägt. Ich sehe, wie sich sein Körper zusammenkrampft. Ich sehe, wie er auf der Feststiege zertrampelt wird. Ich kann Fred nicht finden.
Nur noch drei Kameras werden bewegt. Kamera fünf zoomt. Das muß sein Assistent sein. Fred hat die Situation erkannt und ist fortgelaufen. Fred ist nicht mehr in der Oper. Die Franzosen haben ihn beschützt. Er wurde draußen auf der Ringstraße gebraucht. Er kennt sich bei Hebekränen gut aus. Kamera fünf bewegt sich nicht mehr. Sie zeigt eine Loge mit Toten. Fred, wo bist du? Die letzte Kamera stellt die Bewegung ein. Nur noch starre Bilder von starren Körpern. Die amplifier der Saalmikrophone zeigen kaum noch Ausschläge. Fred liegt irgendwo unter den Leichenbergen.
Einen Monat lang bin ich ihm nachgestorben, einen Monat lang habe ich ihm beim Sterben zugesehen. Ich habe im Bandmaterial die letzten Sekunden seines Lebens gefunden. Einen Monat lang habe ich sie in allen Einzelheiten studiert, wieder und wieder. Wenn die Tränen ausblieben, hielt ich das für ein Versagen, für einen Verrat. Ich hörte Eric Claptons Tears in Heaven, ich hörte Gustav Mahlers Kindertotenlieder. Dann konnte ich wieder weinen.
Der kleine Bub in London. Wie er mit der Schultasche vor unserem neuen Haus in der Talbot Road auf den Eingangsstufen saß. Stundenlang. Um zwei Uhr hätte ich zu Hause sein sollen, aber ich kam erst nach fünf. Ich hatte ihn vergessen.
»Einmal die Woche«, schrie mich Heather in der Nacht an. »Nur einmal die Woche. Und das vergißt du?«
Fred saß da in seinem gelben Regenmantel. Er sah mich an, als würde er mich nicht kennen. Er verweigerte mir die Hand. Die Nachbarn links von uns waren nicht zu Hause gewesen, die anderen kannten uns noch nicht. Ich entschuldigte mich hunderttausendmal bei ihm. Er wollte mir nicht ins Haus folgen. Als wäre ich nicht wirklich hier. Ich öffnete die Tür, er blieb auf den Stufen sitzen. Ich trug ihn hinein und setzte ihn auf ein Sofa. Er blieb den ganzen Abend lang ein stummes Kind. Als ich ihn später auszog und zu Bett brachte, sagte ich, er solle sich etwas wünschen. Alles hätte er haben können. Er sah mich an und begann zu weinen. Ich streichelte ihn, bis er einschlief. Als wir Jahre später, nach seiner Heroinsucht, zusammenfanden, sagte er zu mir, er sei damals überzeugt gewesen, seine Eltern nie mehr zu sehen.
Als Kind hatte er Heather und mich oft streiten gehört. Es ging vor allem um ihn. Fred war kein Wunschkind. Heather hatte sich geweigert, abzutreiben. Als das Kind da war, kamen wir mit ihm nicht zu Rande. Erst recht nicht, als Heather wieder zu arbeiten begann. Sie war beim Hörfunk der BBC, Kulturredaktion. Ich arbeitete in der Dokumentationsabteilung des Fernsehens. Unsere ständigen Zankereien seien eine Folge der zu kleinen Wohnung, redete ich mir ein. So konnte ich endlich in jene Gegend ziehen, in der ich meine Studentenjahre verbummelt hatte. Wir verschuldeten uns maßlos, als wir das Haus in der Talbot Road, einer Seitenstraße der Portobello Road, kauften. Nun mußten wir uns erst recht auf unsere Karrieren konzentrieren und hatten für Fred noch weniger Zeit. Damals war ich im Innendienst und hatte einigermaßen geregelte Arbeitszeiten. Heather verbrachte vormittags oder nachmittags ein paar Stunden im Studio, am Abend hetzte sie von einer Veranstaltung zur anderen. Trotzdem war sie es, die Fred versorgte. Ich hatte mich am Abend um das Kind zu kümmern. Meist engagierte ich eine Studentin. Nur an diesem einen Nachmittag die Woche, wenn Heather Redaktionskonferenz hatte, war ich wirklich für Fred da. Wir fuhren in den Zoo. Wir verbrachten Stunden in der Spielzeugabteilung von Harrods. Wir fuhren zum Hunderennen ins Walthamstow Stadium. Fred liebte Hunderennen. Mehr als Pferderennen. Mehr als Fußball oder Rugby. Und eines Tages vergaß ich ihn einfach. Ich saß im Studio und schnitt irgendeine Dokumentation. Um halb fünf fragte mich eine Kollegin verwundert: »Du bist da? Ist Fred bei Freunden?«
Als Heather in der Nacht heimkam, gutgelaunt und ein wenig beschwipst, erzählte ich ihr, was geschehen war. Sie tobte. Hätte ich nicht das Haus verlassen, sie hätte die gesamte Einrichtung zerschlagen.
Nach Freds Ermordung saß ich einen Monat lang im Studio und tat nichts anderes, als mir die letzten Sekunden seines Lebens anzusehen. Ich sollte das Material zu einer Dokumentation von 115 Minuten zusammenschneiden. Aber ich war unfähig dazu. Ich suchte nach Fred, und ich fand ihn. Die letzte noch bewegte Kamera brachte ihn kurz ins Bild. Der sie bediente, war offensichtlich zusammengebrochen. Die Kamera führte den Vertikalschwenk selbsttätig weiter bis zur Deckenbeleuchtung. Zuerst die Leichenberge im Parkett, dann ein Ruck und der Schwenk nach oben. Er streift die Kaiserloge, danach das rechte Fenster des Inspizientenraums und die unmittelbar angrenzende Loge, in der Kamera fünf stand. Normalerweise ist diese Loge nicht begehbar, weil sie vollgestopft ist mit allen Scheinwerfern, die in den Beleuchtungsluken keinen Platz mehr fanden. In der Nacht vor dem Opernball waren die Scheinwerfer abmontiert worden. Fred war froh gewesen über seine Kameraposition, weil er in der Beleuchtungsloge von Ballgästen unbehelligt blieb, auch weil die Kaiserloge, der Treffpunkt der politischen Prominenz, direkt darunter lag und somit für Kamera fünf nicht erfaßbar war.
Er hat nicht einmal versucht zu entkommen. Unmittelbar neben ihm war die Tür zum Inspizientenraum. Er hat sie nicht geöffnet. Von dort aus hätte er über einen Gang zur sogenannten Personaltreppe gelangen können. Alle, die über die Personaltreppe flüchteten, haben überlebt. Die Personaltreppe wurde nicht belüftet. Fred blieb bei seiner Kamera. Er filmte bis zum Schluß.
Einen Monat lang sah ich mir den letzten Schwenk seines Kollegen immer wieder an. In Standbild und Zeitlupe. Der Blick führt nach oben zur rechten Seite der Kaiserloge, wo eine Hand mit weißem Manschettenhemd und hinaufgerutschtem Frackärmel über die Brüstung ragt, geht weiter, die beigegoldenen Samttapeten entlang zu einem Kranz von rosa Nelkenbouquets, bis das Fenster des Inspizientenraums sichtbar wird und die Brüstung der Beleuchtungsloge. Da ist plötzlich Fred zu sehen. Er geht einen Schritt zur Seite, krümmt sich nach vorn, öffnet den Mund, als müsse er erbrechen. Mit der rechten Hand hält er noch den Steuerarm der Kamera fest. Er richtet sich auf, läßt den Steuerarm los, streckt beide Hände von sich, wankt. Er reißt die Augen weit auf. Dann ist sein Kopf aus dem Bild. Der Schwenk geht weiter hinauf zu den Menschenknäueln auf der Galerie, in denen noch Arme, Köpfe und Beine zucken, zur Decke, und bleibt stehen, als der Kristalluster am Bildrand erscheint. Um Null Uhr 58:57 Sekunden kommt aus einem Mikrophon, das direkt vor Kamera fünf angebracht war, Freds Todesschrei. Auf Kamera fünf wird kurz zuvor noch gezoomt. Bei Null Uhr 58:49 Sekunden hört die Kamerabewegung auf. Man sieht in Großaufnahme eine gegenüberliegende Loge, in der eine tote Frau mit rotem Abendkleid sitzt. Ihr Körper ist seitlich an die Logenbrüstung gestützt, ihr Kopf hängt nach hinten über die Stuhllehne. Ihre Augen sind weit offen.
Einen Monat lang sah ich nur solche Bilder. Am Abend saß ich daheim und trank.
»Would you hold my hand«, flehte ich und weinte Rotz und Wasser dabei. Fred würde mir im Himmel die Hand verweigern. Er hatte allen Grund dazu.
Einmal machten wir eine Küstenrundfahrt in Brighton. Fred saß auf meinem Schoß. Er war noch keine zwei Jahre alt. Die Küste interessierte ihn nicht. Er blickte nur zum Meer. Dann stand er auf, stellte sich auf meine Oberschenkel und schaute ins Kielwasser hinab. Ich hielt ihn ganz fest an den Beinen. Das Wellenspiel faszinierte ihn. Er streckte seinen Kopf über die Reling hinaus. Heather hatte Angst, er könnte hinunterfallen.
»Ich halte ihn doch«, sagte ich. Sie konnte nicht zusehen. Sie verlangte, daß ich Fred sofort niedersetze.
»Aber ich halte ihn doch fest. Was soll passieren. Ich halte ihn doch.«
Wir zankten uns, während Fred ins Wasser schaute. Nach einer Weile setzte ich ihn zurück auf meinen Schoß. Er hatte rote Augen. Über seine Wangen liefen Tränen.
Solche Erinnerungen überschwemmten meinen Kopf, während ich trank und mir mit der flachen Hand die Stirn rieb. Ich stellte mir vor, wie das Kielwasser Freds kleinen Körper in die Tiefe hinabzog, wie er immer tiefer sank mit ausgebreiteten Armen, in eine Welt, in der er nicht überleben, der er aber auch nicht entrinnen konnte. Und ich hatte es nicht einmal bemerkt.
Nach der Scheidung lebte ich im Hotel. Fred war bei Heather im Haus geblieben. Ich war mittlerweile Kriegsberichterstatter der BBC und seit Monaten ohnedies kaum noch daheim gewesen. Dann kam eine Zeit, in der die Kriege nicht richtig reifen wollten. Konfliktherde gab es zur Genüge, aber es schien, als hätten die Militärs ihre Kraft verloren. Brutale Diktaturen, die eben noch Kritiker bespitzelten und ins Arbeitslager steckten, ließen sich nun mehr oder weniger widerstandslos stürzen. Ein paar Interviews mit Oppositionellen, ein paar Bilder von Großdemonstrationen – und ich konnte wieder zurückfliegen. Ich hing in meinem Hotel im Stadtteil Bayswater herum, auf dem Bildschirm Tag und Nacht der Teletext der BBC mit den neuesten Weltnachrichten. Ich wartete auf einen richtigen Einsatz. Alle paar Tage riefen meine Eltern an und erzählten mir, daß daheim, im Stadtteil Hampstead, noch immer mein Zimmer für mich bereitstehe. Ich könne auch gerne ein zweites dazu haben. Ein Leben im Hotel, das sei doch kein Leben. Man brauche etwas Festes, sonst werde man verrückt. Meine Eltern sprachen deutsch mit mir. Die Mutter mit ihrem tschechischen, der Vater mit seinem wienerischen Akzent.
»Ich brauche nichts Festes«, antwortete ich. »Alles Feste ist für mich bisher ein Horror gewesen. Gescheitert bin ich immer nur am Festen.« Sie gaben nicht auf. Ich sagte ihnen nicht, daß ich längst nach einer geeigneten Wohnung Ausschau hielt. Sie sollte nicht zu nahe an Hampstead liegen. Ich fand schließlich ein kleines Haus in Kensington. Es lag in einem schmalen, verwinkelten Seitengäßchen hinter der High Street. Die Straße war ruhig. Hätte ein Auto dort geparkt, hätte kein zweites vorbeifahren können. Das Häuschen hatte Wohnzimmer und Küche im Erdgeschoß, darüber zwei Schlafzimmer. Für mich reichte es. Mein Büro schlug ich im Wohnzimmer auf, das zweite Schlafzimmer war für Fred gedacht, oder als Gästezimmer. Fred hat das Haus nie betreten. An der Mauer neben der Eingangstür fand ich einmal eine Kreidezeichnung vor. Ein Gebirge, darüber die Sonne. Ich ließ die Zeichnung an der Mauer, bis der Regen sie abwusch. Vermutlich war sie von Fred. Ich wollte es glauben. Ich zahlte Alimente, ich zahlte immer noch für das Haus in der Talbot Road, aber ich hatte zu Heather und Fred keinen Kontakt. Bis Heather mich eines Tages anrief.
»Ich will dir nur mitteilen, daß dein Sohn die High-School längst abgebrochen hat und heroinsüchtig ist.«
Ich wollte Fred treffen. Aber Heather wußte nicht, wo er sich herumtrieb. Sie sagte: »Gelegentlich kommt er vorbei, um mich auszurauben.«
Später erzählte sie mir, daß er sich, soweit sie herausfinden konnte, oft in der Walworth Road aufhalte. Ich fuhr mehrmals mit der Bakerloo Line zur Endstation Elephant & Castle. Nirgends sieht London so trostlos amerikanisch aus wie in Walworth. Ich lief die Walworth Road auf und ab, durchstreifte die Seitenstraßen, ging in die Pubs der East Street und in alle Fast Food Restaurants. Jeden Junkie, den ich traf, fragte ich nach Fred. Vergeblich. Einer saß zusammengesunken auf einer Parkbank. Er hatte ein grünes Spinnennetz ins Gesicht tätowiert. Er gab mir keine Antwort. Ich packte ihn an den Schultern und schüttelte ihn. Er sah mich nur mit müden, glasigen Augen an. Aber ich hatte den Eindruck, er verstand, was ich sagte, er kannte Fred. Eine Antwort war aus ihm nicht herauszubringen. Meine Suche blieb erfolglos.
Ich rief Heather an. Sie nannte mir einen Termin, an dem Fred kommen werde. Zumindest habe er es versprochen. Sobald ich einträfe, werde sie fortgehen.
In der Nacht vor diesem Treffen wachte ich jede Stunde auf. Ich war mir sicher, ich würde versagen. Ich wollte Fred Hilfe anbieten. Er sollte sich jederzeit an mich wenden können, auch wenn ihn vorläufig nur mein Geld interessierte. Ich würde es ihm geben. In Tagesrationen, damit ich mit ihm in Kontakt bliebe. Aber was sollte ich tun, wenn er mich zurückwies, mit mir gar nichts zu tun haben wollte? Ich überlegte mir, wie ich ihn an mich binden könnte, und kam auf keinen grünen Zweig. Um halb sieben Uhr in der Früh gab ich es auf, noch Schlaf zu finden. Ich ging ins Wohnzimmer hinab. Auf dem Bildschirm gab es nur mehr ein Thema: Der Golfkrieg war ausgebrochen. Drei Stunden später saß ich im Flugzeug nach Saudi-Arabien.
Oft denk ich, er ist nur ausgegangen und wird wieder nach Hause gelangen. Als er tot war, wollte ich ihn keinen Augenblick mehr allein lassen, als könnte ich noch irgend etwas gutmachen. Er stand hinter mir. Ich spürte, wie er mich anblickte. Er hatte in Wien eine Wohnung im selben Haus wie ich. Ich hörte ihn die Wohnungstür aufsperren. Ich hörte, wie er in der Nacht mit Freunden heimkam. Ich lief hinaus ins Stiegenhaus, schlich leise die Treppen hinab, ganz langsam, bis das Ganglicht ausging. In der Dunkelheit stand ich vor seiner Wohnungstür und horchte. Ich sperrte auf, ich legte mich in sein Bett. Ich roch Fred an seinem Bettzeug. Ich stellte mir vor, wie er den Tod vor sich hatte und trotzdem bei der Kamera blieb. Er hat die Chance gehabt, zu entkommen. Die Menschen in den Logen und Galerien weiter oben starben ein wenig später als die im Parkett. Sie bewegten sich noch, da war unten schon alles still. Wenn er gleich geflüchtet wäre, er hätte es als einziger Kameramann geschafft.
Er sieht auf dem kleinen Monitor, daß die Menschen im Parkett zusammenbrechen. Er spürt den Bittermandelgeruch. Jetzt müßte er in den Inspizientenraum laufen. Aber er tut es nicht. Seine Augen beginnen zu brennen. Die Gedärme drängen herauf. Mit einem Mal ist er sicher, daß auch er gleich sterben wird. Aber anstatt zu flüchten, beginnt er zu zoomen. Die Gegenstände verschwimmen, bewegen sich wie Wellen von ihm weg. Es reckt ihn. Er tritt einen Schritt zur Seite, um zu kotzen, hält aber die Hand noch am Zoom-Knopf. Es krümmt ihn zusammen. Er läßt die Kamera los, sucht vor sich Halt. Er stürzt, stürzt, unendlich tief, tausende Meter, kann nicht mehr atmen, kann sich nicht mehr bewegen. Es gibt keinen Boden. Wie ein Glockenspiel hört er aus der Ferne die Todesschreie der anderen. In seinem Inneren hat sich ein Feuer entzündet. Es breitet sich mit rasender Geschwindigkeit im ganzen Körper aus. Bis ein glühender Ball aus seinem Inneren fährt und im fernen Nebel verschwindet.
Er ist mir nur vorausgegangen und wird nicht wieder nach Haus verlangen. In der kurzen Zeit zwischen Golfkrieg und Jugoslawienkrieg gelang es mir, Fred nach Jahren das erste Mal zu sehen. Er kam nicht zu mir, sondern ich mußte mich auf sein Terrain begeben. Als Treffpunkt nannte er mir am Telefon die Village Brasserie an der Ecke Stockwell Road/Brixton Road. Ich war noch nie in dieser Gegend gewesen. Ich wußte nur, daß vor allem Schwarze dort wohnen, auch Asiaten. Als ich im Lokal eintraf, war ich angenehm überrascht. Es war fast leer und wirkte, ganz gegen meine Erwartungen, nicht verkommen. Runde, schwarze Tische, Aluminiumstühle, etwas zu laute Musik. Fred war noch nicht da. Ich bestellte einen Cappuccino. In der Ecke lief ein Fernsehapparat ohne Ton. An der Wand hingen zwei Reproduktionen von Joan Miró. Vor den tief hinabreichenden Fenstern gingen schwarze Frauen und Kinder vorbei, gelegentlich Männer. Junge Burschen schlängelten sich mit Fahrrädern zwischen den Passanten durch. Dann kam Fred. Ich erkannte ihn kaum. Um den Kopf hatte er ein Palästinensertuch gewickelt. Seine Füße waren schmutzig. Sie steckten in abgetragenen Sandalen. Er setzte sich mir gegenüber und grinste mich an.
»Was trinkst Du?« fragte ich ihn.
»Worthington Bitter.«
Ich bestellte auch einen für mich. Seine Hände waren ungewaschen, die Nagelenden mit Dreck verstopft. Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand waren vom Rauchen gelb und bräunlich gefärbt. Er nahm Tabak aus der Hosentasche und drehte sich eine Zigarette. Ich sah, daß seine Hände zitterten. Die Zigarette gelang nicht. Er ließ sie fallen und probierte es erneut. Auch die zweite Zigarette gelang nicht. Der Tabak landete auf dem Tisch, das Papier war eingerissen. Ich bot ihm eine Zigarette an. Er nahm die Schachtel zur Hand und verwies auf den darauf abgedruckten Barcode.
»Das kann angefunkt werden. Sie können Dich überallhin verfolgen.«
»Wer?«
»Die Nazis.«
»Woher weißt Du das?«
»Ich liege mit ihnen im Clinch. Würden mir die Franzosen nicht helfen, die Nazis hätten mich längst erwischt.«
Er erzählte mir, daß die französische Botschaft schützend ihre Hand über ihn halte. Neulich habe er François Mitterrand in einer öffentlichen Toilette getroffen. Der Präsident habe ihm beim Pinkeln versichert, daß ihm nichts geschehen werde. Ich hörte ihm zu und nickte. Von seiner Zigarette fiel die Asche herab. Er rauchte gierig. Das Bier trank er nur langsam. Er schaute immer wieder ins Glas hinein, hielt es gegen das Licht. Er sagte: »Die verwenden vergiftetes Wasser. Man kriegt jetzt überall vergiftetes Wasser.«
Er fragte mich, ob in meinen Wasserhähnen Filter eingebaut seien. Er trinke nur noch gefiltertes Wasser. Dann erzählte er mir von einem neuen water purifier. Er kenne den Mann, der ihn erfunden habe.
Plötzlich stand er auf und ging weg. Ich dachte, jetzt läuft er mir davon. Er ging zu einem Tisch neben der Theke und setzte sich wieder.
»Dort sind zu viele Strahlen«, sagte er. Ich kam mit den Gläsern und den Zigaretten nach.
Ich fragte ihn, wo er wohne. Er gab mir keine Antwort. Statt dessen grinste er mich wieder an. Er sagte: »Wo ich wohne, habe ich die Fenster vernagelt. Mir können die Nazis nichts anhaben.«
Ich wußte nicht, was ich darauf antworten sollte. Er sagte, auch die Franzosen hätten ihm geraten, nicht hinter Fenstern zu sitzen.
Ich fragte ihn, ob die Strahlen nicht auch Holz durchdrängen. Er ging nicht darauf ein, sondern erzählte mir, er habe jetzt viermal Madame Bovary gelesen. Dann fragte er mich unvermittelt, ob ich Stan Parker sei.
»Stan Parker?«
»Kennst Du nicht The Tree of Man von Patrick White?«
»Doch, ich habe es einmal gelesen. Aber das ist lange her. Der Mann, der am Schluß stirbt, heißt der Stan Parker?«
Fred versuchte wieder eine Zigarette zu drehen. Ich gab ihm meine Schachtel und sagte: »Behalte sie.«
Er nahm sie nicht. Auf seiner Tabaktasche war kein Barcode.
»Wovon lebst Du?« fragte ich ihn.
Er grinste. Seine rötlichen Augenbrauen waren unter dem Palästinensertuch gerade noch zu sehen.
»Du bist nicht Stan Parker«, sagte er.
»Brauchst Du Geld?« fragte ich ihn.
»Ich werde water purifier verkaufen.«
»Du hast also Geld.«
»Borge mir hundert Pfund. Bis morgen, okay?«
Ich gab ihm hundert Pfund. Dann hatte er es plötzlich eilig.
»Wir treffen uns hier morgen um dieselbe Zeit«, sagte ich.
Er ließ das Bier stehen und ging fort. Ich sah ihm durch das Fenster nach. Er ging die Brixton Road Richtung U-Bahn, bog aber dann nach links in die Electric Avenue ab. Nach einer Weile folgte ich ihm nach, konnte ihn aber nicht mehr finden. Vor dem Bogen einer Eisenbahnbrücke saß der Junkie mit dem grünen Spinnennetz im Gesicht.
Fred ist tot. Er hatte einen roten Vollbart. So wie ich, als ich jung war. Bei Innenaufnahmen lief er zwischendurch hinaus, um zu rauchen. Nur an diesem einen Abend in der Wiener Staatsoper nicht. Ich hatte es ihm nicht erlaubt.
»Ich muß Deine Kamera jederzeit zuschalten können«, hatte ich gesagt. »Sie hat den besten Blick auf das Orchester.«
Der Ingenieur
Erstes Band
»Jede Kultur hat das Recht auf ungestörte Entwicklung, jede Kultur hat das Recht auf Reinheit.«
Das, so hat uns der Geringste erzählt, sei ihm schlagartig klargeworden, als er nach Wien kam und gezwungen war, den mühsamen Aufstieg seines Vaters zu wiederholen. Sein Vater, ein Häuslerbub aus dem Waldviertel, war mit dreizehn Jahren vor der Wahl gestanden, entweder lebenslang in Knechtschaft zu leben oder, gestützt auf nichts als den eigenen Willen, alles zu riskieren. Er entschied sich für letzteres, schnürte sein Ränzlein und lief aus der Heimat.
»Wenn ich«, sagte der Geringste, »fünfzig Jahre später gezwungen war, dasselbe zu tun, dann ist das doch der schlagende Beweis, daß wir nicht vorangekommen sind, daß der ganze Weltkrieg umsonst war. Mit siebzehn Jahren stand ich vor derselben bitteren Entscheidung wie mein Vater mit dreizehn. Wollte ich weiterkommen, mußte ich alles hinter mir lassen.«
Es gibt eine Reinheit der eigenen Seele, »eine Charakterstimme«, wie der Geringste das nannte, die mehr wiegt als jede Erfahrung. Alle hatten seinem Vater abgeraten, fortzugehen, ja sie wollten ihn sogar daran hindern. Den Knechten schien es gar nicht zu gefallen, daß einer der Ihren diesem Los entkommen wollte. Ihr mieses Leben war das einzige, was sie sich noch vorstellen konnten. Es scheint viel Trost in der Gewißheit zu liegen, daß das Unglück des eigenen Lebens im Unglück künftiger Generationen sich fortsetzt.
»Das gewöhnliche Leben«, so hat uns der Geringste von Anfang an gesagt, »ist schicksalsergeben. Orientiert Euch nicht an den Perspektiven des gewöhnlichen Lebens. Es ist ausgelaugt und hat nichts mehr anzubieten. Es bezieht seine Höhen und Tiefen aus dem Fernsehapparat. Das gewöhnliche Leben scheut davor zurück, sein Schicksal herauszufordern, weil es Angst hat vor einem ehrlichen Blick auf das eigene Unglück.«
Der Geringste, wiewohl er uns jede Bemerkung, die ihn über andere gestellt hätte, strikt verbat, war kein Gewöhnlicher. Gerade weil wir das nicht sagen durften, war es um so augenscheinlicher. Er war anwesend wie niemand sonst. Man spürte ihn, wenn er eintrat, auch wenn man nicht hinsah. Wenn er zu reden anfing, verstummten alle. Niemand hat ihn zum Führer gemacht. Er war es einfach. Auf ihn haben alle gehört. Oft brauchte er nicht einmal etwas zu sagen. Man hat ihm in die Augen gesehen und verstanden, was er meinte. Alles teilte sich aus seinen Augen mit. Diese Sprache war mindestens so wichtig wie seine Worte. Vielleicht war es das völlige Übereinstimmen dieser beiden Sprachen, das ihn so einmalig machte. Er war ganz er selbst. Nein, er war wir. Nie hatte ich das Gefühl, daß er für sich selbst etwas wollte. Er war die Bewegung. Er verkörperte sie voll und ganz. Wir fanden uns in ihm. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können. Ihm entging nichts. Er war sozusagen immer bei uns, in uns. Wenn er zu mir hersah, war es, als habe er meine Hintergedanken durchschaut. Ein kurzer Blick, und ich begann mich zu schämen. Dabei war sein Auge ganz ruhig. Es war das Drumherum. Das Zusammenspiel von Augenbrauen, Wimpern, Lidern und vielerlei Muskeln und Fältchen teilte alles viel schneller und direkter mit, als es Worte je vermocht hätten. Blitzartig zog sich da etwas zusammen – und jeder wußte, was es bedeutete. Seine Augen ermahnten und straften. Ein kurzer Blick, und die Ordnung war wiederhergestellt. Meistens reichte das. Nur bei Feilböck reichte es später nicht mehr. Aber Feilböck war von Anfang an unser schwarzes Schaf.
Der Blick des Geringsten konnte auch ermutigen. Er besagte: »Was immer auch kommen mag, ich bin bei Dir. Auf mich kannst Du zählen bis ans Ende der Tage.«
Gerade war man noch verzweifelt gewesen, hatte Scherereien mit der Polizei, mit Kollegen oder mit Passanten gehabt. Dann kam man in das Blickfeld des Geringsten, und alle diese persönlichen Wehwehchen und Kränkungen waren plötzlich lächerlich, gemessen an der gemeinsamen Aufgabe, die uns zusammenhielt.
Als ich nach seiner Wiederkehr sein Vertrauen gewann, erzählte er mir von seiner Herkunft und Jugend. Das war meist zu später Nachtstunde in einer kleinen Wohnung in der Wohllebengasse. Er schenkte mir ein Glas Whisky ein, strich durch sein langes Haar und redete von früher. Er schrieb an einem Buch über sein Leben und seine Ideen. Kleine Ausschnitte las er mir vor. Das Manuskript muß es noch irgendwo geben. Sein Vater war ihm wichtig. Er erzählte mir dessen ganzes Leben, aber er mochte ihn nicht. Über seine Mutter habe ich nicht viel erfahren. Nur wenn er ihren Tod erwähnte, merkte ich, daß sie ihm alles war. Ich stellte ihm kaum Fragen, ich hörte zu. Wenn man ihn fragte, gab er oft keine Antwort. Jedenfalls keine hörbare. Das war von Anfang an so. Aber er stellte die Fragen selbst. Und wenn ich die Antwort nicht wußte, gab er sie mir.
Sein Vater hatte nach langem Herumirren schließlich Arbeit als Lehrling in einer Werkstätte der österreichischen Post gefunden. Er reparierte Postautobusse und wurde von den anderen geohrfeigt. Nach einigen Jahren legte er die Gesellenprüfung ab. Nun werde alles anders, dachte er. Hatte er nicht erreicht, was er wollte? Er war in der Stadt und in einer sicheren Stellung untergekommen. Dennoch war ihm, als sei er ein Stück Dreck geblieben. Über ihm gab es eine unüberschaubare Hierarchie, die Kette hatte unendlich viele Glieder und Instanzen bis hinauf zum Generaldirektor. Unter ihm waren nur die verachteten Lehrbuben, die er nun so malträtieren durfte, wie er malträtiert worden war. Und das sollte es gewesen sein? Er wollte etwas Höheres werden und schrieb sich in einer Abendschule ein. Während seine Kollegen in Gasthäuser und Kinos gingen, saß er über seinen Büchern. In ungewöhnlich kurzer Zeit, in drei Jahren, erlangte er die Hochschulreife. Er wäre gerne das geworden, was ich bin, Ingenieur. Doch es gab keine Möglichkeiten, nach einem harten Arbeitstag sein Studium zu absolvieren. Es sah ganz so aus, als würde er knapp vor dem Ziel scheitern.
»Und warum«, fragte mich der Geringste, »hat er es doch geschafft?« Ich zuckte mit den Achseln.
»Es war der Krieg«, sagte er. »Der Krieg hat vielen Hoffnungslosen eine Chance gegeben, so auch meinem Vater.«
Im damaligen Generalgouvernement, in der Nähe von Lublin, gab es eine Werkstätte der Deutschen Wehrmacht. Dorthin wurde der Vater des Geringsten eingezogen. Seine Untergebenen waren vor allem Polen, die in ihrer eigenen Heimat Fremdarbeiter genannt wurden. Er erwarb sich besondere Verdienste bei der Aufdeckung von Sabotageakten. Keine angefeilte Bremsleitung, kein durchlöcherter Simmerring, keine eingesägte Kurbelwelle blieb ihm verborgen. Reihenweise stellte er die Saboteure. Über jede neue Methode eines Anschlags auf Einrichtungen der Deutschen Wehrmacht verfaßte er genaue Beschreibungen mit Anleitungen, wie man sie am besten abwehren könne. Obwohl er die Berichte auf dem Dienstweg weiterzureichen hatte, versah er sie mit der Adresse: An den Herrn Generalgouverneur Hans Frank in der Königsburg zu Krakau. Er hatte von den rauschenden Festen gehört, die der Generalgouverneur in Krakau feierte, während in der Werkstätte von Lublin die wichtigsten Materialien ausgingen.
»Davon redete er immer wieder«, sagte der Geringste. Er schüttelte den Kopf, und über seinem Mund war der Anflug eines spöttischen Lächelns. Es kam ganz selten vor, daß der Geringste lächelte. Darum erinnere ich mich so genau. Er lächelte über seinen Vater und sagte: »Das war seine Heldentat. Immer wieder hat er davon erzählt. Ich konnte es nicht mehr hören. Er hat einen Brief mit einer sonderbaren Adresse versehen. Darin steckte der ganze Mut seines Lebens. Und wahrscheinlich hat es nicht einmal jemand bemerkt.«
1944 wurde der Vater des Geringsten zum Leiter der Zentralwerkstätte Ost ernannt. Bevor die Rote Armee Lublin erreichte, verminte er das gesamte Werkstättengelände und jagte es in die Luft.
Nach dem Krieg war der Vater des Geringsten einer der meistgefragten Männer. Es gab praktisch keinen Posten im Bereich der Metallindustrie, der ihm nicht angeboten wurde. Die Sozialistische Partei wollte ihm den Wiederaufbau der Hermann-Göring-Werke – damals war man sich noch nicht einig, wie sie nun heißen sollten – anvertrauen, die Volkspartei wollte ihn zum Direktor der Steyr-Werke machen. Im Gespräch war auch noch die Leitung des Wiederaufbaus der Flugmotorenwerke oder der Österreichischen Bundesbahnen. Aber nichts interessierte ihn so sehr wie eine Stellung bei seiner alten Firma, der Post.
»Ohne den Krieg«, sagte der Geringste, »hätte er es vielleicht zum Meister in der Werkstätte gebracht. Nun zog er als Verwaltungsdirektor aller Postwerkstätten in die Generaldirektion ein. Bis er eine der Sekretärinnen, mit denen er Verhältnisse hatte, zur Frau nahm, vergingen noch einige Jahre.«
Vom Bauernknecht zum höheren Verwaltungsbeamten, dieser Weg des Vaters stand in der Erinnerung des Geringsten mit roter Kreide auf der Wand des Hauses in Litzlberg am Attersee geschrieben, in das die Familie nach der Pensionierung des Vaters übersiedelte. Die letzten zehn Arbeitsjahre hatte er sein ganzes Geld in dieses Haus gesteckt. Jedes Wochenende fuhr er nach Litzlberg. Wenn er am Sonntagabend zurückkam, jammerte er, daß die Handwerker im neuen Haus nicht gearbeitet, sondern offenbar wieder nur eine Woche Urlaub gemacht hätten. Seine bittere Jugend ließ ihm ganz natürlich das später Erreichte um so größer erscheinen, als dieses doch nur ausschließliches Ergebnis seines eisernen Fleißes und eigener Tatkraft war. Es war der Stolz des Selbstgewordenen, der ihn bewog, auch seinen Sohn in die gleiche, wenn möglich natürlich höhere Lebensstellung bringen zu wollen.
Als der Vater seine Pension am Attersee antrat, kam der Geringste ins Stiftsgymnasium von Kremsmünster. Er hatte kaum Zeit gehabt, sich in Kremsmünster einzuleben, da machte sich sein Vater schon Gedanken darüber, welches Studium er seinem Sohn acht Jahre später finanzieren werde.
»Du wirst einmal Jus studieren, das öffnet Dir das gesamte Feld der Verwaltung bis hinauf in die Politik.« So redete er mit seinem Sohn. Alle bedeutenden Positionen in der Umgebung des Vaters waren mit Juristen besetzt gewesen. Der Geringste jedoch wollte Priester werden, dann Missionar, schließlich Prälat. Der Abt des Stiftes Kremsmünster wurde sein großes Vorbild.
Schon in der Unterstufe, im Alter von dreizehn Jahren, geschah es zum ersten Mal, daß der Abt den Geringsten in die Prälatur einlud, ihm Zigaretten und Wein anbot und ihm von Judas Ischariot erzählte, dem Verräter Jesu.
Nach seiner Wiederkehr wollten wir wissen, wer in Amerika seine Lehrer gewesen waren. Er antwortete: »Der Abt von Kremsmünster und niemand anderer hat mir die Augen geöffnet. Bei ihm hat mein Denken Feuer gefangen. Was ich in Amerika dazugelernt habe, lag alles schon in mir. Es war nichts als ein Schüren der Glut aus Kremsmünster.«
Der Abt von Kremsmünster hat so großen Eindruck auf den Geringsten gemacht, daß er begann, ihn zu verehren und ihm nachzueifern. Er konnte sich damals kein wünschenswerteres Lebensziel vorstellen, als selbst einmal Abt in einer Prälatur zu sein. Allerdings, so sagte er zu mir, sei er sich der Tragweite der Gedanken des Abtes keineswegs bewußt gewesen. Er habe diese Gedanken bei seiner späteren Abwendung von der Kirche sogar gänzlich aus dem Auge verloren. Er habe gemeint, allem Theologischen endgültig den Rücken kehren zu müssen, und sei erst später, in Amerika, dahintergekommen, daß seine Abwendung vom Theologischen nichts anderes war als die konsequente Anwendung der Gedanken des Abtes von Kremsmünster. Nach seiner Wiederkehr, als ich ihn fast jede Nacht besuchte, sagte er einmal: »Weißt Du, was die Essenz der Lehren des Abtes von Kremsmünster war? Daß die Zukunft nur über den Verrat zu erlangen ist.«
Das hat mir zu denken gegeben. Wahrscheinlich würde ich ohne diesen Rat heute nicht auf Mallorca sitzen, sondern wäre auf der Totenliste. Ja, wie Ihr Sohn. Nein, verdammt noch mal. Auch der Geringste ist tot. Ich dachte, Sie wollen alles wissen. Ich war es nicht. Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich: Es war überhaupt niemand von uns. Wollen Sie abbrechen, oder können wir fortfahren?
Der Abt von Kremsmünster hatte sich bei den Einladungen des Geringsten zu Zigaretten und Wein in die Prälatur, die mit den Jahren immer häufiger wurden, als Verehrer von Judas Ischariot zu erkennen gegeben. Judas sei der wahre Held des Christentums. Er habe sich geopfert, um das Erlösungswerk zu ermöglichen, da Jesus schwach geworden sei und, anstatt sich freiwillig zu stellen, verzweifelt zu beten angefangen habe. Danach sei Judas nichts anderes übriggeblieben, als Selbstmord zu begehen. Für die Anhänger von Jesus sei er zum Verräter geworden, zum Hassenswertesten, was denkbar ist. Niemand werde so gehaßt wie ein Verräter, weil niemand die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Weg so sehr in Frage stelle, weil niemand einem die eigene Unfähigkeit und den eigenen Irrweg so drastisch vor Augen führe. In Wirklichkeit habe Judas, so sei der Abt von Kremsmünster im Privatgespräch nicht müde geworden zu betonen, das Erlösungswerk gerettet. Er habe, unter Preisgabe seiner Zukunft, sich selbst zum Werkzeug der Heilsgeschichte gemacht. Die kleine Christenschar mit ihren revolutionären Ideen wäre verschwunden wie Hunderttausende andere Sekten der Weltgeschichte, hätte Judas nicht den Anstoß dafür gegeben, daß die Bekenner nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Blut getauft wurden. Große Ideen verlangen ihren Blutzoll, sonst gehen sie unter.
»Wer die Idee des Pazifismus durchsetzen will«, hat der Geringste gesagt, »muß letztlich Atombomben werfen.« Das waren dann nicht mehr die Gedanken des Abtes von Kremsmünster, das war sicher schon ihre Fortsetzung im Kopf des Geringsten. Er hat natürlich gewußt, daß für mich, wie auch für die anderen, seine Gedanken ein Evangelium waren, eine Offenbarung. Aber nur mir war es gegönnt zu erfahren, wie diese Gedanken entstanden sind. Ich empfinde das heute noch als eine Auszeichnung und werde mich ihrer würdig erweisen.
Darum erzähle ich Ihnen das alles. Verstehen Sie, der Geringste war nicht einfach irgendein Terrorist, der den Opernball vergasen wollte, weil es ihm gerade Spaß machte oder weil er ein paar Leute haßte, die sich dort vergnügten. Es ging um etwas ganz anderes. Um Ihnen das begreiflich zu machen, muß ich ausholen. Kremsmünster ist für die Entwicklung des Geringsten nicht hoch genug einzuschätzen. Wer seine Schulzeit hindurch den Geruch eines tausendzweihundert Jahre alten Klosters einatmet und im zwanzigsten Jahrhundert jeden Morgen Gesänge aus dem zehnten Jahrhundert anstimmt, entwickelt, ob er sich dessen bewußt ist oder nicht, eine tiefe Ehrfurcht gegenüber großen, über alle geschichtlichen Rückschläge erhabenen Ideen. Was immer in unserem Lande geschehen sein mag, welche Herrscherhäuser und Regierungsformen im Laufe von tausend Jahren einander abgewechselt haben, welche Volksaufstände auch verloren, Armeen besiegt, Dörfer ausgelöscht, Städte bombardiert, Landstriche besetzt und in andere Sprachen umbenannt wurden, Kremsmünster blieb davon unberührt. Kremsmünster war immer schon da, Kremsmünster blieb Kremsmünster. Dort sammelten sich im neunten Jahrhundert die Mönche mehrmals am Tag zum lateinischen Chorgebet, genau so, wie sie es in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts taten, als der Geringste dort Oberministrant war und in privaten Gesprächen von seinem Religionslehrer, dem Abt des Klosters, ins Vertrauen gezogen wurde. Von Kremsmünster aus auf die Geschichte Österreichs zu blicken war wie das Gnadenrecht einer Perspektive sub specie aeternitatis. Dem Geringsten war es gewährt, und er hat es später verstanden, diesen unschätzbaren Vorteil für sein Denken zu nutzen und an uns weiterzugeben.
»Richtige Ideen«, so hat uns der Geringste gelehrt, »können weder von der Presse noch vom Fernsehen, auch nicht von der wöchentlichen Meinungsumfrage umgestoßen werden. Sie sind wie eine brennende Lunte. Was eben noch ein hilflos dem Wind ausgeliefertes Flämmchen mit einem Rauchfähnlein war, kann im nächsten Augenblick den Weltenbrand entfachen.«
In der zwölfhundert Jahre alten Beständigkeit von Kremsmünster mag der Geringste schon in früher Jugend eine Vorbereitung für eine seiner späteren Hauptideen erfahren haben, für das heilige Anspruchsrecht der eigenen Kultur. Was in den Bibliotheken überdauert, hängt nicht von Papierqualität ab, sondern darüber wird draußen mit Feuer und Schwert entschieden. Nur über den Scheiterhaufen verbrannter Hexen und geköpfter Häretiker konnte die Mönchskultur ihre Reinheit bewahren.
Während sein Vater schon in Fachzeitschriften und durch Gespräche mit ehemaligen Kollegen die beste juristische Fakultät ausfindig zu machen suchte, wandelte sich in der Abgeschiedenheit des Klosterlebens die Berufsvorstellung des Geringsten. An den kirchlichen Ideen konnte er kein Genügen mehr finden, das Korsett der Alltagsordnung, die Wiederholung des immer Gleichen, ohne Aussicht, es jemals abschütteln zu können, erschien ihm von Tag zu Tag enger, und es wurde ihm bewußt, daß auch ein Abt mit diesem Korsett zu leben hatte, selbst wenn er heimlich Judas Ischariot verehrt. Das ewig Gleiche nährt den Traum vom Verrat, aber der Geringste war nicht von jener schwachen Natur, die sich mit Träumen begnügt, anstatt ihr Leben zu ändern. Der Geringste wollte ganz für und in seinen Ideen leben – und so reifte in ihm der Wunsch, Schriftsteller zu werden. Mit seinem Vater war darüber nicht zu reden.
»Dichter?« fragte der, »Hungerkünstler? Nein, nicht solange ich lebe.«
So, wie sein Vater sich einst gegen die guten Ratschläge der Knechte gewehrt hatte, so wollte auch der Geringste sich gegen die Pläne seines Vaters zur Wehr setzen. Der eigenen Zukunft wurde er von Tag zu Tag gewisser, und ihr begann er alles andere unterzuordnen. Bald stellten sich die ersten Schwierigkeiten in der Schule ein. Alles, was ihm vorgesetzt wurde, befragte er danach, ob er es später als Schriftsteller brauchen könne. Wenn es ihm bedeutungslos erschien, verweigerte er es. Seine Zeugnisse wurden zu einer bunten Ansammlung guter und schlechter Noten. Mehrere sehr gut und gut standen neben vielen genügend und auch einigen nicht genügend. Der Vater ermahnte ihn immer nachdrücklicher zu mehr Anstrengung. Doch er strengte sich ja an, bloß konnte er im Büffeln von allem und jedem, nur um es wieder zu vergessen, nicht den Sinn einer zwölfjährigen Ausbildung sehen. Die Revolutionierung des Schulsystems hat er später für eine der vordringlichsten Aufgaben gehalten.
»Das Ziel des Unterrichts«, sagte er, »darf nie und nimmer im Auswendiglernen und Herunterhaspeln von Einzeldaten liegen. Es kommt nicht darauf an«, erklärte er uns, »wann diese oder jene Schlacht geschlagen, ein Feldherr geboren wurde oder gar ein (meistens sehr unbedeutender) Monarch die Krone seiner Ahnen auf das Haupt gesetzt erhielt. Nein, wahrhaftiger Gott, darauf kommt es wenig an.«
Aber worauf kam es an? Der Geringste erkannte früh, daß die Welt im tausendzweihundertjährigen Kloster mit der Welt draußen nicht mehr übereinstimmte. Hier badete man täglich in der Reinheit der eigenen Lehre und tat so, als wären die nächsten tausend Jahre spielend zu bewältigen, aber draußen war ein ganzer Kontinent dem Untergang geweiht. Im Osten und Süden fraß das fremde Völkergift am europäischen Kulturkörper, und selbst die alte Kulturmetropole Wien wurde, wie allen Berichten zu entnehmen war, für die angestammte Bevölkerung mehr und mehr zur fremden Stadt.
Der Geringste hatte keine Gelegenheit mehr, seinem Vater die wirklichen Motive für seine Verweigerung darzulegen. Denn während sein Widerwillen gegen das Klosterinternat und gegen das Stiftsgymnasium immer offensichtlicher wurde, ohne daß er mit sich selbst über die Gründe seines Aufbäumens schon ins klare gekommen wäre, starb sein Vater an einem Schlaganfall. Der unerwartete Tod schien die Entwicklung des Geringsten zu bremsen. Sein Drang, von den vorgegebenen Bahnen abzuschweifen, ließ nach, so als gelte es ein Vermächtnis des Vaters zu erfüllen.
Der Abt von Kremsmünster nahm den Geringsten nun besonders unter seine Fittiche. Jeden Sonntag nach der Vesper läutete der Geringste an der Prälatur. Die Tür wurde elektrisch geöffnet, in vier aufeinander folgenden, durch hohe Flügeltüren verbundenen Barockzimmern gingen, wenn der Geringste sie durchschritt, nacheinander die Lichter an. In der Prälatur stand neben dem Schreibtisch des Abtes ein kleines, würfelförmiges Bücherregal, das sich um die Mittelachse drehen ließ. Auf diesem Regal standen ein Aschenbecher und zwei Weingläser. Es gab zwar auch eine kleine Sitzgruppe im Zimmer, aber der Geringste benutzte sie nie. Immer saß er dem Abt gegenüber auf einem Sessel neben dem drehbaren Bücherregal, rauchte Zigaretten, trank Prälatenwein und sah den gestikulierenden Händen des Abtes zu.
Genau so ein kleines, drehbares Bücherregal stand in der Wohllebengasse neben dem Sofa. Darinnen lag auch sein halbfertiges Buchmanuskript. Der Geringste stellte meinen Whisky auf das Regal, setzte sich gegenüber und spielte den Abt von Kremsmünster.
»Radikales Christentum«, sagte er und fuchtelte mit der Hand in der Luft, »scheut nicht den Tod. Es führt in den Tod. Aber radikales Christentum ist nicht eines, das sich Hals über Kopf ins Abenteuer stürzt. Es denkt nach, was es will, und es überlegt genau, wie es seine Ziele am besten erreichen kann. Den Tod nicht scheuen heißt nicht, das Leben aus Jux verschleudern.« Das letzte Wort zog er in die Länge und vollführte dabei eine ausholende und nach hinten wegwerfende Handbewegung. Ich habe den damaligen Abt von Kremsmünster – vielleicht gibt es mittlerweile einen neuen – nie gesehen, nicht einmal auf einem Foto. Aber ich konnte ihn mir gut vorstellen.
Der Abt von Kremsmünster hat den Geringsten überzeugt, daß es sinnvoll sei, das Gymnasium abzuschließen. Ohne lange nachzudenken, konnte er jene Lehrer nennen, die der Geringste haßte. Er erzählte Geschichten, in denen sie wie hilfsbedürftige Kreaturen dastanden, denen man, anstatt sie zu bekämpfen, zuallererst zu einer freien Persönlichkeit verhelfen müsse.
»Gerade unsichere Menschen«, hat der Abt zum Geringsten damals gesagt, »die hilflos in der Welt stehen und nicht wissen, was sie anfangen sollen, drängt es in den Lehrerberuf. Wenn einer in betrunkenem Zustand anfängt, Balladen aufzusagen, dann wird er voraussichtlich Lehrer werden. Die Ordnungen und Werte der Schule sind für ihn der einzige Bezugsrahmen geblieben. Bei einem Maturatreffen«, so erinnerte sich der Geringste in der Wohllebengasse an die Worte des Abts, »habe ich mir die Burschen in die Prälatur eingeladen. Es endete damit, daß sie stundenlang Gedichte, vor allem Balladen und Parodien auf Balladen aufsagten. Dabei war das noch ein guter Jahrgang, mit mehreren Hochschulprofessoren darunter. Männer mit Vollbärten beginnen plötzlich zu kichern wie dreizehnjährige Mädchen. Bis zum Schluß habe ich mir das angesehen und gedacht: Mein Gott, was haben wir da gezüchtet. Nein, die Lehrer darfst Du nicht allzu ernst nehmen. Du mußt sie einfach benutzen, um weiterzukommen, aber es lohnt nicht, sich mit ihnen anzulegen. Du würdest dabei auf der Strecke bleiben.«
Zum Abschied, so erzählte mir der Geringste, habe ihn der Abt immer lange umarmt und dann ganz plötzlich weggestoßen. Er habe ihn an sich gedrückt und geschnauft. Aber plötzlich ein Stoß – und die Vertrauensseligkeit war vorbei. Der Abt war wieder der Abt und der Geringste ein ganz normaler Zögling, der Vorgesetzten respektvoll zu begegnen hatte.
Als der Geringste aus Amerika zurückkam und, um nicht ausfindig gemacht zu werden, alle paar Wochen das Quartier wechselte, gab es nur einen einzigen Einrichtungsgegenstand, den er von Wohnung zu Wohnung mitnahm, das kleine drehbare Bücherregal. Ich habe es erst in der Wohllebengasse, einem seiner letzten Quartiere, kennengelernt. Feilböck hatte uns früher schon davon erzählt. Offenbar hat er den Geringsten auch in anderen Quartieren besuchen dürfen. In der Wohllebengasse zog er manchmal Bücher aus dem Regal, um sie mir zu schenken oder nur zur Lektüre zu empfehlen. Manchmal zog er das Manuskript heraus und las ein oder zwei Abschnitte vor. Immer nur kurze Absätze, als würde der Fortgang der Arbeit Schaden leiden, wenn er zuviel davon verriet.
»Alles, was wirklich wichtig ist«, sagte er, »hat Platz in diesem Bücherregal. Den Rest kann man wegwerfen.«
Das achte Jahr war der Geringste schon in Kremsmünster, da wurde er vom Abt an der Eingangstür zur Prälatur abgeholt. Es gab keine Zigaretten, und es gab keinen Wein. Der Abt sagte: »Du mußt nach Wels fahren ins Krankenhaus, zu Deiner Mutter.«
Die Art, wie er den Geringsten zu sich zog und seinen Hinterkopf streichelte, ließ keinen Zweifel an der hoffnungslosen Lage, in der sich seine Mutter befinden mußte. Sie lag mehrere Tage im Koma, dann wurden die Geräte abgeschaltet. Sie war mit dem Auto von der schmalen, unübersichtlichen Zufahrt zu ihrem Haus in Litzlberg am Attersee auf die Hauptstraße hinausgefahren und von einem Lastzug erfaßt worden. Die Mutter wurde im Auto zerquetscht. Auch wenn sie den Unfall überlebt hätte, hätte sie keine Chance gehabt, das Bett je wieder zu verlassen. Sie war noch keine vierzig Jahre alt.
Eine Woche nach dem Begräbnis stand der Geringste in der Prälatur von Kremsmünster, um sich von seinem Lehrer zu verabschieden. Der Abt konnte ihn keinen Tag länger halten. In seinem Manuskript beschrieb er das etwa so: »Meinen Vater habe ich verehrt, die Mutter jedoch geliebt Einen Koffer mit Kleidern und Wäsche in den Händen, mit einem unerschütterlichen Willen im Herzen, fuhr ich nach Wien. Was dem Vater fünfzig Jahre vorher gelungen, hoffte auch ich dem Schicksal abzujagen; auch ich wollte etwas werden, allerdings – Schriftsteller und auf keinen Fall Beamter.«
Das Manuskript müßte es irgendwo geben. Er hat es sicher nicht in der Wohllebengasse zurückgelassen. Vielleicht ist es von der Polizei beschlagnahmt worden, weil am Schluß alles überraschend kam.
Als der Geringste nach Wien fuhr, war er ein Nichts. Er hatte keine abgeschlossene Ausbildung. Eine Waisenrente sicherte ihm das Überleben. Zwar gab es eine Erbschaft zu erwarten – es war vor allem das Haus am Attersee, in das der Vater all sein Erspartes hineingesteckt hatte –, aber der Geringste hatte darauf keinen Zugriff. Er war siebzehn Jahre alt, also noch nicht volljährig.
Er suchte in Wien eine Wohnung, und er suchte Arbeit. Beides war nicht zu finden. Es herrschten katastrophale Zustände. Wurde eine Wohnung zu erschwinglichen Preisen vermietet, mußte man bei Vertragsabschluß unterderhand zweihundert- bis dreihunderttausend Schillinge als Ablöse zahlen. Konnte man sich, so wie der Geringste, keine Ablöse leisten, blieben zwei andere Möglichkeiten. Die eine schied aus. Ablösefreie Wohnungen waren zwar gewöhnlich in gutem Zustand, die Monatsmiete wäre aber höher gewesen als die Waisenrente. Blieb nur noch der illegale Wohnungsmarkt.
Fünf Nächte lang wanderte er durch Wien und traf dabei auf die unterschiedlichsten Gruppen von Obdachlosen. Alle stanken sie nach Alkohol, selbst diejenigen, die sich Heroin spritzten. In der fünften Nacht schlief er übermüdet auf einer Bank im Stadtpark ein. Als er aufwachte, war seine Reisetasche verschwunden. Er wusch sich im Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz und fragte den ganzen Tag lang jeden, den er traf, ob er ein Quartier für ihn wisse. Eine Ausländerin gab ihm schließlich eine Adresse.
Dieses Haus am Lerchenfeldergürtel, in dem der Geringste fast zwei Jahre lang wohnte und in dem er die Bewegung der Volkstreuen gründete, wurde von uns in der Nacht, nachdem er ausgezogen war, abgefackelt. Was ein Fehler war, nicht nur weil die Polizei sehr schnell unsere Spur aufnahm. Persönliche Rache zu nehmen, erkannten wir später, ist das Niedrigste, was es gibt. Rache für andere zu nehmen, sein Leben für die europäische Kultur einzusetzen und nicht für den eigenen Vorteil, darauf gründet die Zukunft des christlichen Abendlands. Und darauf beruhte, nach der Wiederkehr des Geringsten, die Größe der neuen Bewegung der Entschlossenen.
Ob Sie daran glauben oder nicht, ist mir scheißegal. Noch einmal: Ich war es nicht. Wir waren es nicht. Wir hätten es sein können, aber wir waren es nicht. Wir waren doch keine Selbstmörder. Es war immer nur von Kohlenmonoxid die Rede. Warum sind Sie so vorlaut? Haben Sie irgendwo eine Waffe versteckt? Nein? Wenn ich Sie jetzt über den Haufen schieße, was dann? Kein Mensch würde Sie finden hier draußen. Also. Ich halte mich an unseren Deal, und Sie halten die Klappe.
Der Geringste wohnte am Lerchenfelder Gürtel für zweieinhalbtausend Schilling Monatsmiete in einem Kellerabteil. In den anderen Abteilen wohnten zwei Serben, ein Bosnier, eine Familie aus Somalia, eine rumänische Familie, eine Angolesin, zwei Ägypter und ein Araber unbekannter Herkunft. Sie alle teilten sich eine Toilette, ein Geschirrspülbecken und eine Dusche. Zwei Abteile, nämlich das des Bosniers und das des Arabers, waren fensterlos, die anderen hatten, an der dem Eingang gegenüberliegenden Seite, ein doppeltes Oberlicht, das mit einem Mechanismus aus Eisenstangen zu öffnen und zu schließen war. Die schmalen Fenster der Kellerabteile auf der einen Seite saßen direkt auf dem Trottoir des Lerchenfelder Gürtels, bei den Abteilen auf der anderen Seite gingen die Fenster auf den Hof des fünfstöckigen Gebäudes. Man wußte nicht, welche Seite besser war. Auf der Hofseite war es ruhig, aber zwei mächtige Kastanienbäume hielten alles Licht ab, so daß es den ganzen Tag stockdunkel blieb und man jedes Gefühl für Tag und Nacht verlor. Auf der anderen Seite war es zwar heller, dafür donnerten direkt vor dem Fenster die Lastautos vorbei. Aber nicht einmal in den Abteilen auf der Straßenseite wurde es so hell, daß man ohne künstliche Beleuchtung hätte lesen können.
Lesen war damals die Hauptbeschäftigung des Geringsten. Er beobachtete die Welt und machte sich lesend einen Reim darauf. Sein damaliges Wiener Martyrium schuf die Grundlage unserer Bewegung, den Granit unseres Handelns. Er hat am eigenen Blut erfahren, welche Gefahr uns droht; in ihm ist in leidvoller Erfahrung der Entschluß herangereift, nicht länger zuzusehen, wie alles vor die Hunde geht. Als ich das erste Mal diesen schimmeligen, muffelnden Keller sah und all das Elend, den Jammer, den Unrat und die Verkommenheit, von der die anderen immer wieder berichtet hatten, konnte ich der Hauptsorge des Geringsten nur zustimmen: »Die gedankenlose weiße Kultur. Sie ist verloren, wenn einst aus diesen Elendshöhlen der Strom aufständischer Sklaven über sie hereinbricht und Genugtuung fordert.«
Finden Sie sein Manuskript. Dann werden Sie endlich begreifen, daß Ihr Sohn nicht der Mittelpunkt der Welt ist.
Fritz Amon, Revierinspektor
Erstes Band
Am Vormittag, es muß so gegen elf gewesen sein, kamen uns die drei Fernsehleute das erste Mal in die Quere. Wir hatten uns gerade mit Leberkässemmeln versorgt, was im Dienst nicht so gern gesehen wird, jedenfalls nicht auf offener Straße. Um den Überwachungskameras auszuweichen, fuhren wir nicht, wie sonst üblich, vor der Oper mit der Rolltreppe in die Passage hinab, sondern gingen durch die Operngasse zu einem weniger frequentierten Abgang am Rande des Karlsplatzes.
Der kleine Umweg brachte uns ins Fernsehen. An der Ecke beim Café Museum halfen wir einer Frau, den Kinderwagen in die Passage hinunterzutragen. Rollstühle und Kinderwagen müssen in Wien vor allem getragen werden. Seit dem letzten Innenminister, oder war es der vorletzte, die treten ja alle bald zurück, sind wir angehalten, bei Rollstühlen und Kinderwagen zuzupacken. Mein Kollege und ich hatten uns gerade geeinigt, wer vorne geht, da kamen aus dem Café Museum diese drei Herren heraus und machten sich gleich an ihren Umhängetaschen zu schaffen. Es war ein Kamerateam des Satellitensenders European Television, ETV. Wir schenkten ihnen zunächst keine Beachtung, schnappten den Kinderwagen und marschierten, jeder eine Semmel im Mund, der Kollege vorne, ich hinten, los. Dabei fiel mir der Leberkäse aus der Semmel und in den Kinderwagen hinein. Die Kameraleute hatten nichts Besseres zu tun, als uns zu filmen, was wir aber erst bemerkten, als wir den Wagen unten abstellten. Mein Kollege machte ihnen eine Szene. Er stand einen Dienstgrad höher als ich und kennt sich in den presserechtlichen und urheberrechtlichen Dingen besser aus. Ich wiederum bin im Strafrecht unschlagbar. So ergänzten wir uns ganz gut.
»Der Film ist beschlagnahmt«, sagte er. »Wenn Sie uns filmen wollen, müssen Sie vorher bei der Pressestelle der Bundespolizeidirektion ein Ansuchen stellen.«
Derjenige, der die wenigsten Taschen zu tragen hatte, tat ganz überrascht. »Oh, entschuldigen Sie. Ich wußte nicht, daß Ihnen das nicht recht ist. Wir wollten nur die Hilfsbereitschaft der Wiener Polizei dokumentieren. Das ist für heute abend, für den Vorspann zur Direktübertragung des Opernballs.«
Der Kameramann sagte: »Wir machen Euch berühmt. In ganz Europa wird man sehen, was bürgernahe Polizisten sind.«
Wir einigten uns schließlich darauf, die Szene noch einmal zu drehen. Die Leberkässemmeln nunmehr in den linken Seitentaschen der Uniform – die rechten Seitentaschen sind ja unten offen, um zur Pistole durchgreifen zu können –, trugen wir den Kinderwagen hinauf und noch einmal hinunter. Am Schluß, das hatten wir so vereinbart, schüttelte die Mutter jedem von uns die Hand, und mein Kollege sagte: »Gern geschehen, Gnädigste!«
Und was haben sie gezeigt?
Als ich am nächsten Nachmittag, nach 35 Stunden Dauerdienst mit tränenden Augen, völlig erschöpft vom Verladen der Toten, die Uniform vollgesogen mit Leichengeruch, endlich nach Hause kam, wich meine Frau entsetzt zurück. Sie brachte keinen Ton heraus.
»Durst«, sagte ich und ließ mich auf den Küchenstuhl fallen. »Durst. Ich kann nicht mehr stehen.«
Sie brachte mir ein Bier, setzte sich mir gegenüber und sah mich lange an. Im Radio weinte der Landwirtschaftsminister. Er mußte jetzt die Regierungsgeschäfte übernehmen. »Das schlimmste Verbrechen der Geschichte«, sagte er und begann wieder zu heulen. Meine Frau war noch immer sprachlos. Dann ergriff sie meine Hand und sagte: »Dir ist der Leberkäs aus dem Mund gefallen.« Das hat mir den Rest gegeben.
Die Fernsehfritzen haben uns reingelegt. Andere haben mir das bestätigt. Selber habe ich es leider nicht überprüfen können. Zwar hatte ich meine Frau am Abend, als klar wurde, daß ich während des Opernballs nicht nach Hause konnte, angerufen und sie gebeten, die Übertragung aufzuzeichnen. Aber sie hat natürlich wieder ein falsches Programm aufgenommen. Sie bildet sich immer ein, der Videorecorder nimmt das Programm auf, das sie sich gerade im Fernsehen ansieht. Wie oft habe ich ihr das schon erklärt. Einmal habe ich sie mit der Fernbedienung so lange programmieren lassen, bis ich sicher war, jetzt weiß sie es. Aber das nächste Mal hatte ich statt der Straßen von San Francisco die Kür der Damen auf dem Band. Und diesmal statt Opernball das Phantom der Oper, noch dazu ohne Anfang.
Da lachen Sie, aber das war so. Während ETV den Opernball übertrug, zeigte der öffentliche Rundfunk Das Phantom der Oper.