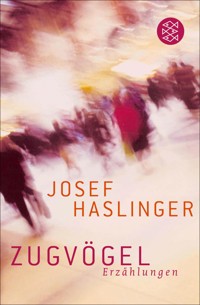9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Rupert Kramer, genannt Ratz, ist der Sohn eines österreichischen Ministers. Er ist 35 Jahre alt und das, was man einen Versager nennt. Nächtelang sitzt Ratz vor dem Computer, um ein abstruses Vatervernichtungsspiel zu entwickeln. Er hasst seinen korrupten sozialdemokratischen Vater, der seine Familie wegen einer jungen Frau verlassen hat. Im November 1999 erhält Ratz einen geheimnisvollen Anruf von Mimi, seiner Jugendliebe. Ratz fliegt nach New York, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Bald ist klar: Er soll helfen, das Versteck von Mimis Großonkel auszubauen, einem alten Nazi, der an der Hinrichtung litauischer Juden beteiligt war. Seit 32 Jahren verbirgt er sich im Keller eines Hauses auf Long Island. Dort kommt es zu einer unheimlichen Begegnung mit dem verwahrlosten Mann. Anschaulich und fesselnd erzählt Josef Haslinger vom Schicksal dreier Familien: einer jüdischen Familie, die bei den Massakern der Nazis in Litauen vernichtet wird, der Familie der Täter, die sich nach Amerika retten kann und dort einen grotesken Zusammenhalt bewahrt, sowie von Ratz´ eigener, sozialdemokratischer Familie, die sich im Wien der neunziger Jahre erbärmlich auflöst. Bestechend genau beleuchtet Haslinger die Verwerfungen des vergangenen Jahrhunderts und macht eindringlich spürbar, dass man der Geschichte nicht entkommen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
Ähnliche
Josef Haslinger
Das Vaterspiel
Roman
Roman
Fischer e-books
Für Edith
Mit Ausnahme von Waldemar Bastos, Ralph Bendix, John Cale, Bill Clinton, Leonard Cohen, Heinz Conrads, Anton Diabelli, Bob Dylan, Elkhanan Elkes, Falco, Karl Farkas, Hertha Firnberg, Clark Gable, Geier Sturzflug, Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Gottschalk, Wehrmachtsfotograf Gunsilius, Lauryn Hill, Adolf Hitler, Janet Jackson, SS-Standartenführer Karl Jäger, Jay-Z, Elton John, SS-Hauptsturmführer Jordan, John F. Kennedy, Heinz Kolisch, Wolfgang Kos, Tone Loc, Rosa Luxemburg, Madredeus, Bob Marley, Marcello Mastroianni, Karl May, Issey Miyake, Wjatscheslaw Michailowitsch Molotow, Nana Mouskouri, Georges Moustaki, Paul Newman, Olivia Newton-John, The Notorious B. I. G., Lee Harvey Oswald, Opus, Publius Ovidius Naso, Pablo Picasso, Pink Floyd, Bill Ramsey, Lou Reed, R. E. M., Ivo Robić, Alfred Rockenschaub, Teresa Salgueiro, Friedrich Schiller, Oswald Spengler, Bruce Springsteen, Philippe Starck, Michael Staudacher, Alfred Treiber, Tom Waits, Ernst Waldbrunn, Kurt Waldheim, Rüdiger Wischenbart, der Worried Men Skiffle Group, Peter Yarrow, Neil Young und Klara Zetkin sind alle Personen dieses Romans frei erfunden.
Teil 1Die rote Brut
Ich war zu schnell unterwegs, das wusste ich. Die Dunkelheit ringsum. Der dichte Schneefall. Die Straße war nicht geräumt. Zu dieser frühen Stunde war noch kein Mensch außer Haus. Es gab keinen Unterschied zwischen Asphalt, Wiese und Acker. In der Windschutzscheibe lief ein Bildschirmschoner, Starfield Simulation, mit zweihundert Sternen, der Höchstanzahl, die man einstellen konnte. Sie rasten aus dem Dunkel des Alls auf mich zu. Ich musste genau schauen, um noch anderes wahrzunehmen, zum Beispiel die Stangen, die für den Schneepflug aufgestellt worden waren. Sie trugen Rückstrahler, rote auf der rechten, weiße auf der linken Straßenseite. Das sind keine Flugobjekte, sagte ich mir. Ich brauchte etwas Bodennahes. Und so stellte ich mir vor, die weißen Lichter wären entgegenkommende Panzer mit kampfbereiten Geschützen, die, einer nach dem anderen, plötzlich aus der Dunkelheit auftauchten, um alles zu durchsieben, was ihnen in die Quere kam. Manchmal blitzte im Scheinwerferlicht etwas auf, die Ecke eines Gefahrenzeichens, der noch nicht vom Schnee verklebte Rest eines Wegweisers, die windpolierte Wölbung einer Leitplanke. Die vielen Kurven machten es schwer, das Auto in der Straßenmitte zu halten. Die Panzer hatten gute Chancen, mich zu kriegen. Ich hätte langsamer fahren sollen, aber ich tat es nicht. Ich hatte einen Auftrag, und ich wollte ihm gewachsen sein.
Über Jahre war meine Haupttätigkeit für die anderen nicht sichtbar gewesen. Ich will mich ja nicht in dein Leben einmischen, hatte mein Vater ein ums andere Mal gesagt und sich dabei in mein Leben eingemischt. Er warf mir vor, ich würde den ganzen Tag nur mit dem Computer spielen. Er hatte nicht ganz Unrecht. Es gab tatsächlich kaum ein Computerspiel, das ich nicht kannte. Ich beobachtete die grafischen Effekte. Wenn sie mir gefielen, versuchte ich die Files zu knacken und ihr digitales Innenleben bloßzulegen. Das war nicht leicht, denn sie suchten ihre Eingeweide genauso zu schützen, wie Lebewesen es tun. Zur Entspannung schlachtete ich meinen Vater.
Drei Millionen, oder ich bring dich um, sagte ich.
Schau, sagte mein Vater. Wenn er unangenehm wurde, sagte er immer: Schau. Er hatte auch zu meiner Mutter dauernd Schau gesagt in der Zeit, als er nur noch unangenehm war. Schau, sagte er, ich habe dir das schon oft erklärt. Ich würde dir nichts Gutes tun damit.
Schade, antwortete ich, kann man nichts machen. Und dann rammte ich ihm das Messer in den Bauch. Er bekam große Augen.
Weißt du, sagte ich, ich würde dir nichts Gutes tun, wenn ich dich länger am Leben ließe. Korrupte Schweine wie du müssen früher oder später geschlachtet werden.
Für meinen Vater hatte ich mir schon Hunderte Todesarten ausgedacht. Die mit dem Messer war eine vergleichsweise harmlose, ein beruhigender Gedanke zwischendurch. Ein schnelles Gegenübertreten von Mann zu Mann. In zwanzig Minuten wäre das Blut auf dem Boden geronnen. Natürlich würde ich Handschuhe tragen. Aber ich würde sie nicht im Garten wegwerfen, sondern in meinem eisernen Öfchen verbrennen. Mit der zufriedenen Miene eines Mannes, der getan hat, was getan werden musste.
So waren die Jahre dahingegangen. Aber dann hatte Mimi angerufen und ich war losgefahren. Zwar hatte ich um ein paar Stunden Bedenkzeit gebeten. Aber es gab nichts zu bedenken. Es sollte nur nicht so aussehen, als hätte ich sonst nichts zu tun. Ich ging ein paar Mal im Kreis, dann rief ich zurück. Viel zu schnell. Mir fehlte jede Reserve.
Zum Glück bin ich jetzt selbstständig, sagte ich. Da kann ich es mir einteilen. Bloß die Katze. Irgendwo muss ich die Katze unterbringen.
Lenin lebt noch?
Nein, Lenin ist tot. Sein Nachfolger heißt Alexandr, benannt nach dem Bruder von Lenin.
Lenin hatte einen Bruder?
Alexandr wurde hingerichtet, als Lenin siebzehn war.
Wusste ich gar nicht.
Dieser knappe Satz, dann schwieg sie. Vielleicht dachte sie über Lenin und seinen Bruder nach. Vielleicht versuchte sie sich vorzustellen, was man als Siebzehnjähriger empfinden muss, wenn die Machthaber deinen Bruder hinrichten. Das teure Ferngespräch war plötzlich zu einem Fernschweigen geworden.
Meine Mutter könnte ich fragen, sagte ich, damit etwas weiterging.
Das ist gut. Frag deine Mutter.
Dann schwieg sie wieder. War sie unsicher geworden, ob sie sich an den Richtigen wandte? Wir hatten einander eine Ewigkeit nicht gesehen.
Wie viel Geld werde ich brauchen?
Gar keines.
Ich frage nur, weil bei uns gleich die Banken zusperren. Du weißt ja, wie das hier ist. In der Früh, wenn die Leute zur Arbeit fahren, sind die Banken geschlossen. Wenn sie von der Arbeit heimkommen, sind sie auch geschlossen. Ernsthaft arbeitende Menschen stellen sich unter einem Bankangestellten einen Automaten vor, weil sie einem menschlichen Exemplar noch nie begegnet sind.
Das ist hier nicht viel anders, antwortete sie. Nach einer kurzen Pause sagte sie: Das Geld lass meine Sorge sein. Du brauchst nichts mitzubringen. Ein paar Klamotten, sonst nichts.
Das war gut. Denn ich hätte meinen Vater sicher nicht noch einmal um Geld gebeten. Weg von hier. Das traf sich gut. Nichts wie weg von hier.
In die Einreiseformulare, sagte Mimi, musst du eintragen, wo du wohnen wirst. Lass mich aus dem Spiel. Gib irgendein Hotel an.
Welches?
Nicht das Chelsea-Hotel. Alle, die kein Hotel wissen, geben das Chelsea-Hotel an, das erregt Verdacht.
Genau so war es mir fünf Jahre zuvor ergangen. Ich hatte nicht einmal die Adresse des Chelsea-Hotels gewusst und war dann vier Stunden am Flughafen festgehalten worden. Davon sagte ich nichts. Ich wollte Mimi nicht als erstes Lebenszeichen nach langen Jahren meine Niederlagen auf die Nase binden.
Kannst du mir ein Hotel sagen, das geeignet ist?
Hast du eine E-Mail-Adresse?
Rwie Rupert, dann Kramer, aber ohne Punkt dazwischen, dann der Klammeraffe, dann Vienna, Punkt, at.
Moment. Wieso Rupert, du heißt doch Helmut.
Schreib ja nicht Helmut. Das kriegt sonst mein Vater.
Ich verstehe, sagte sie. Dann schwieg sie wieder. Hatte sie doch Zweifel?
Wie geht es dir?, fragte ich. Aber anstatt darauf zu antworten, sagte sie: Ich kann dir doch vertrauen?
Du kannst mir vertrauen.
Ich hatte die Frau seit vierzehn Jahren nicht gesehen, nur hin und wieder ihre Stimme im Radio gehört. Und dann sagte ich einfach zu ihr: Du kannst mir vertrauen. Immerhin brachte mich das auf den Gedanken, endlich nachzufragen, worum es eigentlich geht.
Du hast doch damals bei uns ausgemalt, sagte sie.
In der Wohnung von Brigitte? Das ist lange her.
Ja, das ist lange her. Kannst du auch Mauern aufstellen?
Mauern aufstellen?
Ich meine, Räume unterteilen, eine Wärmedämmung anbringen, gegen Schall isolieren und solche Sachen.
Ich stellte mir eine Wohnung in einem roten Backsteinhaus vor, mit Feuerleitern vor den Fenstern.
Bei euch in New York?
In einem Haus auf Long Island.
Ah. Ist das ein Holzhaus?
Ja.
Dann kann ich es. Ich habe es nie gemacht, aber ich denke, dass ich es kann.
Gut. Dann komm so schnell wie möglich hierher.
Was heißt so schnell wie möglich?
Morgen.
Morgen?
Ja, geht es morgen schon?
Sie war im Internet die Flüge durchgegangen. Sie wusste, dass die Direktflüge von Wien nach New York für die nächsten elf Tage ausgebucht waren. Sie wusste, dass innerhalb der nächsten Woche auch von München kein New York-Flug zu bekommen war. Und sie wusste ebenso, dass es am nächsten Tag noch Plätze von Frankfurt aus gab, in einer Maschine der Pakistan Airlines. Für diesen Flug hatte sie sogar schon einen Platz reserviert. Sie nannte die Buchungsnummer. Das Ticket liege in Frankfurt am Schalter der Pakistan Airlines bereit. Es gebe nur ein Problem. Die Flüge von Wien nach Frankfurt seien leider auch alle ausgebucht. Ich müsse mit dem Zug nach Frankfurt fahren.
Zehn Minuten später blinkte das Briefsymbol am unteren Rand meines Bildschirms. Das kurze Schreiben enthielt die Adresse des Paramount-Hotels in der 46. Straße. Ein kleiner Absatz war noch angehängt:
Mein Verhalten muss dir merkwürdig vorkommen. Aber ich kann dir das nicht in Kürze erklären. Du wirst nichts tun müssen, was du nicht tun willst. Herzlichst Mimi. Und lösch das File bitte.
Dann ging ich wieder im Kreis. Gerade hatte ich noch gedacht, ich sollte Mimi behilflich sein beim Aufstellen einer Mauer, beim Abteilen eines Zimmers, beim Isolieren gegen Schall und ähnlichen Dingen. Und nun der Satz: Du wirst nichts tun müssen, was du nicht tun willst. Was erwartete sie von mir, von dem sie annahm, dass ich es möglicherweise nicht tun wollte? Wozu die Heimlichkeiten? Wer darf nicht wissen, dass sie ein Zimmer abteilt?
Vielleicht, so überlegte ich, hat Mimi mit dem Hausbesitzer schon derart viele unangenehme Gerichtstermine hinter sich gebracht, dass sie ihm nun sogar zutraute, er würde Computer im anderen Kontinent beschlagnahmen lassen, nur um beweisen zu können, dass der Maurer der Geheimhaltung halber aus Europa bestellt worden war.
Vertrauen in mich bedeutete auch, die Gründe für meine Reise vor meiner Mutter geheim zu halten. Ich wollte meine Mutter nicht belügen. Sie war in ihrem Leben genug belogen worden. Meine Mutter zu belügen hätte bedeutet, mich mit meinem Vater, diesem unnötigen Restexemplar von einem Menschen, auf eine Stufe zu stellen. Ich musste meine Mutter über den Zweck der Reise im Unklaren lassen. Was nicht so schwer sein konnte, da mir dieser Zweck selbst nicht ganz klar war.
Im Kreis zu gehen war sinnlos. Ich setzte mich an den Computer und schlachtete zur Beruhigung meinen Vater. Ich zog ihm den Hals in die Länge, schnürte ihm die Taille ab, kickte ihm den Schädel vom Rumpf. Das ging alles viel zu schnell. Ich brauchte etwas Ausführlicheres. Im Wohnzimmer hatte mein Vater eine gut zwei Meter hohe Skulptur stehen. Es war eine überdimensionale Ausführung der Zitruspresse von Philippe Starck. Ich setzte meinen Vater darauf und presste ihn genüsslich aus. Das Gemisch seiner Säfte fing ich auf und verteilte es in die verschiedenen Einweck- und Gewürzgläser im Küchenregal, die ich sorgsam mit Hausherrentrunk beschriftete. Den übrig gebliebenen Hautlappen meines Vaters putzte ich mit einem Scheuermittel. Dann fettete ich ihn mit seiner teuren Hautcreme, die ihm den Verfall verschleiern sollte, von oben bis unten ein und besprühte ihn mit Herrenparfum. Ich frisierte ihm die Haare und legte ihn vor das widerliche französische Bett mit integrierter Hi-Fi-Anlage, das er seit kurzem mit seiner Schnepfe teilte. Da lag er nun als Bettvorleger mit hochstehendem Kopf, wie die Trophäe einer Großwildjagd. Ich schrieb Freundschaft Genosse unter das Bild und betrachtete in Ruhe mein Werk. Dann klickte ich zurück zum Mail-Programm.
Ich markierte die Adresse und druckte sie aus. Ich löschte das File und löschte es dann noch einmal im Ordner der gelöschten Files. Alexaridr streifte zwischen meinen Beinen herum und schmiegte sein grau-weiß gesprenkeltes Fell an meine Füße. Er wollte Abschied nehmen. Vielleicht wollte er auch nur darum bitten, ihm den Transportkorb zu ersparen. Er wusste immer im Voraus, wann ich verreiste. Vielleicht verstand er meine Telefongespräche. Oder ich ging jedes Mal, bevor ich ihn abschob, im Kreis. So genau wollte ich es gar nicht wissen.
Als ich am nächsten Morgen das Haus meiner Mutter verließ, war alles verschneit. Irgendwo unten im Dorf fuhr eine Schneeschaufel über den Asphalt. Ihr blechernes Kratzen war der einzige Laut, der zu hören war. Der Schneefall war so dicht, dass ich nicht einmal den angrenzenden Friedhof sehen konnte. Um diese Jahreszeit, es war der Tag nach Allerseelen, brannten gewöhnlich alle Grablichter. Sie waren in schmiedeeiserne Laternen eingeschlossen, der Schnee konnte sie nicht ausgedrückt haben. Am Abend war da noch ein Lichtermeer gewesen. Aber jetzt war nicht ein einziges Kerzlein zu sehen. Es war nicht kalt, knapp unter null. An den Tagen davor war es kälter gewesen. Mein Auto war eine abgeflachte weiße Halbkugel. Hätte ich mich nicht erinnert, aus welcher Richtung kommend ich es abgestellt hatte, ich hätte nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Mit einem Handbesen machte ich mich an die Arbeit. Um mir nicht selbst die Ausfahrt zu blockieren, versuchte ich, den Schnee in weitem Bogen vom Dach zu schleudern. Aber ich musste meinen Eifer zügeln, der Kopf schmerzte. Windböen drückten mir die Augen zu. Die Flocken blieben an den Wimpern hängen und ließen mich blinzeln. Als ich schließlich auch die Heckscheibe gereinigt hatte, war die Windschutzscheibe schon wieder undurchsichtig geworden.
In der Nacht hatte ich zu viel Wein getrunken. Das war nicht schlimm. Aber ich hatte den Fehler begangen, den ich in letzter Zeit häufig beging, wenn ich zu viel Wein trank. Ich hatte zum Abschluss noch ein paar Schnäpse nachgespült. Wenn ich am nächsten Tag ausschlafen konnte, spielte das keine Rolle. Diesmal musste ich dafür büßen. Ich warf den Besen vor die Haustür. Er blieb mit den Borsten nach oben liegen. In ein paar Minuten würde er unsichtbar sein. Der dichte Schneefall gefiel mir. Ich startete den Wagen und stellte den Drehknopf des Heizungsgebläses auf das Symbol für die Windschutzscheibe. Dann ging ich noch einmal ins Haus zurück und nahm zwei Aspirin. Bevor ich losfuhr, warf ich einen Blick auf das Schlafzimmerfenster meiner Mutter. Die Vorhänge waren nicht zugezogen, das Licht brannte, aber von meiner Mutter war nichts zu sehen. Wahrscheinlich schlief sie noch. Ich überlegte, ob ich zurückgehen und das Licht ausknipsen sollte. Aber da hatte ich schon den zweiten Gang eingelegt und bewegte den Wagen mit schleifender Kupplung durch den tiefen Schnee, hinüber zum Weg, der am Friedhof vorbei zur Straße hinunterführt. Anfangs fuhr ich vorsichtig. Dann wurde mir bewusst, wie spät ich dran war, und ich drückte aufs Gas. Ich hatte keine Scheu vor der unberührten Landschaft, ich kannte mich aus. Mir war klar, jetzt kommt eine Rechtskurve, jetzt ein Ort, gleich wird es bergauf gehen, dann ein Wald. Doch mit einem Mal verlor ich den Überblick. Ich konnte das wenige, das ich sah, keinem Bild mehr zuordnen. Ob ich bergauf oder bergab fuhr, merkte ich nur noch am Geräusch des Motors. Ein Baum, ein Wald, eine scharfe Linkskurve. Dann Straßenlichter und Hausmauern, ein Ort. Aber welcher? Mir war kein Ortsschild aufgefallen und ich sah auch keines, als die Lampen wieder verschwunden waren. Als wäre ich in eine unbekannte Gegend geraten. Finnland, dachte ich. Ich bin durch ein Loch gerutscht und im finnischen Winter angekommen. Ich wartete auf finnisch beschriebene Straßenschilder. Huoltoasema. Ich hatte einmal im Fernsehen gesehen, wie ein verdutzter Literaturkritiker in ein finnisches Kulissendorf entführt wurde. Er starrte auf ein Schild mit der Aufschrift Huoltoasema. Der Tankwart konnte keine Auskunft geben, er sprach nur finnisch.
Okay, sagte ich, ihr könnt das Licht wieder andrehen, die Schneekanonen abschalten und die Kulissen wegräumen. Ihr habt es geschafft.
Es hörte mir offensichtlich niemand zu.
Abräumen, schrie ich. Eins zu null für euch. Ihr habt es geschafft.
Es nützte nichts. Der Schneefall war nun so dicht, dass die Straßenränder nicht mehr als Lichterfolge von Rückstrahlern erkennbar waren. Ich hatte Mühe, von einer Begrenzungsstange zur nächsten zu sehen. Und da verlor ich plötzlich das Bild der Straße. Sie war kein Band mehr, das sich irgendwohin schlängelte. Ich sah eine weiße Fläche, von den Autoscheinwerfern aus tiefer Dunkelheit herausgeschnitten, und ich sah ein paar Lichtpunkte inmitten von dichtem Flockengesirr. Diese weißen Lichter, sagte ich mir, müssen links von mir sein, es sind die kleinen Kampfpanzer, die mir entgegenkommen, und diese roten Lichter müssen immer rechts sein, es sind Rücklichter einer freundlichen Panzerkolonne, die ich überhole. Da ist der nächste weiße und da der nächste rote Strahl. So tastete ich mich voran. Als ich das Fernlicht einschaltete, war es, als wäre ich in die Bildstörung eines Fernsehapparats geraten, in einen gegenstandslosen, flirrenden Raum. Ich schaltete wieder auf das Abblendlicht zurück und suchte meine Orientierungspunkte. Hier ein rotes Licht, dort ein weißes. Ein freundlicher Panzer und ein feindlicher.
Karlstift stand auf einem Wegweiser. Fast wäre ich daran vorbeigefahren. Ich riss den Wagen im letzten Augenblick nach links hinüber. Für eine Weile war ich hellwach. Der unbekannte finnische Ort, so überlegte ich, muss Langschlag gewesen sein. Da erst merkte ich, dass sich das Geräusch geändert hatte. Auch die Fahrbahn war nun wieder deutlich zu erkennen. Sie wurde auf der rechten Seite von einer Schneewechte begrenzt und auf der linken von einer gut zehn Zentimeter hohen Stufe. Je schneller ich fahre, dachte ich, desto mehr bin ich gezwungen, mich zu konzentrieren. Ich hörte das Klicken von Rollsplitt auf dem Boden der Karosserie. Die Panzerkolonne war abgerissen. Aber es ging wieder voran.
Das Prasseln der Steinchen gegen den Autoboden, diese alte, vertraute Wintermusik von den Fahrten mit meinen Eltern nach Scheibbs. Dort gab es Glühwein und Weihnachtsgebäck. Lilienporzellan.
Deck doch heute das Lilienporzellan, sagte meine Großmutter, als meine Mutter ins Speisezimmer ging, Das waren abgeschnittene Kegel mit Dreieckshenkeln. Es gab sie in verschiedenen Pastellfarben. Ich bekam immer die hellblaue Tasse, die meiner Schwester war rosa. Aber sie enthielt keinen Glühwein, nur Kindertee. Innen waren die Tassen weiß. Vergeblich suchte ich die Lilien.
Du musst sie umdrehen.
Ich drehte sie um.
Nein, schau dir an, was du angerichtet hast.
Mein Vater war längst nach Wien zurückgefahren, meine Mutter erzählte von der Schule, und der Großvater sagte Erziehung. Lilienporzellan und Erziehung, das waren zwei Scheibbser Weihnachtswörter.
Du musst durchgreifen, die tanzen dir sonst auf dem Kopf herum.
Ich saß daneben und stellte mir die Schüler meiner Mutter vor, kleine, freche Läuse, die ihr auf dem Kopf herumtanzen.
Wie Meteoriten rasten die Schneeflocken auf das Auto zu, oder wie kleine Zerstörer. Die Panzer hatten fliegen gelernt. Das All hatte es darauf angelegt, ein einsam durch die Nacht schwebendes Raumschiff zu durchsieben, es mit Abertausenden von Flugobjekten zu bombardieren. Die fetten, weißen Geschosse stießen in dichten Formationen herab und nahmen Kurs auf mein Cockpit. Im letzten Moment, knapp vor dem Aufschlag, drehten sie ab. Einige reagierten zu langsam. Sie zerplatzten auf dem Glasschild. Der Aufräumdienst drückte den wässerigen Überrest an den unteren Scheibenrand.
Plötzlich gab es Licht im Weltall. Zuerst war es nur ein leichter gelblicher Schein, wie das Flackern eines entfernten Sterns. Doch dieser Funke wurde schnell größer. Was gerade noch ein kleiner Punkt war, wuchs im nächsten Augenblick zur Ausleuchtung des gesamten Horizonts. So als hätte jemand in der kosmischen Tiefe einen Dimmer auf Hell gestellt. Hinter dem Geflirr der hereinstürzenden Flugobjekte begann der Himmel zu blinken. War es das Mutterschiff der kleinen Zerstörer? Es war groß, sehr groß. Und es kam in Windeseile näher. Es strahlte ein flackerndes, orangefarbenes Licht aus. Als Erstes war ein umgedrehter Kegel zu sehen, wie eine große Tasse Lilienporzellan oder eine Raketendüse. Aus der nach unten ragenden Spitze sprühten Funken heraus.
In diesem Moment, als die Größe des Objekts, mit dem ich gleich kollidieren würde, absehbar war, erinnerte ich mich daran, dass ich im Auto saß. Ich war schlagartig bei Sinnen. Jetzt nur nicht auf die Bremse treten, dachte ich. Aber mein Wagen war zu schnell. Er würde auffahren. Also doch auf die Bremse. Vorsichtig. Nicht zu viel Druck. Ein Ziehen nach rechts. Nachgeben. Antippen, nur leicht antippen. Und noch einmal. Immer noch zu schnell. In den dritten Gang runterschalten und die Kupplung sanft einschleifen lassen. Ganz sanft. Ich spürte meinen Herzschlag.
Wahrscheinlich hätte man diesen Moment für eine Autowerbung verwenden können. Alle reden vom Vorderradantrieb. Lass sie reden. Ich weiß den Vorteil der alten Hinterradtechnik zu schätzen: Man kann bei glatter Fahrbahn die Motorbremse verwenden. Ich war einem Auffahrunfall knapp entkommen. Und das Raumfahrzeug war ein Räumfahrzeug. Ich versuchte laut zu lachen. Irgendwie musste ich mich beruhigen. Mein Brustkorb hüpfte im Rhythmus des Herzschlags.
Natürlich hätten sie mich nach dem Casting abgelehnt. Darüber machte ich mir keine Illusionen. Rote Augen, ein ausgefranster, roter Vollbart, schütteres Kopfhaar, ganz oben auf der Birne, dort, wo der Putz sein sollte, eine kreisrunde, mit natürlichen Ressourcen nicht mehr kaschierbare Glatze. Kinder, Kinder, hätte der Produktionschef spätestens bei der Vorführung der Clips gerufen. Wir wollen ein Auto verkaufen und keine Ratte. Das nächste Take, bitte.
Ich wusste, wie ich von der Seite aussah. Oft genug hatte ich einen Handspiegel genommen und mich damit neben den Badezimmerspiegel gestellt. Meine spitze Oberlippe kann ich mit der Unterlippe nicht einfangen. Das sagt alles. Keiner, der mit der Unterlippe über die Oberlippe leckt, entgeht mir. Ich habe einen Blick dafür. Von der Seite gesehen wirkt meine Oberlippe wie die Verlängerung der Nase. Sie steht ab. Bildet ein Vordach, um die Nasentropfen vom Körper fern zu halten. Ich schaute in den Spiegel, betrachtete mein eigenes Profil und sagte: Du hast einen Rattenschädel. Du kannst es nicht leugnen. Du bist eine verdammte Ratte.
Dort, wo ich zur Mittelschule ging, sagte man Ratz zur Ratte. Und so hieß ich dann auch. Nicht mehr Helmut oder Heli, sondern: der Ratz. Ich habe denjenigen, der mich als Erster Ratz nannte, durch den Klassenraum verfolgt und habe ihm, da ich ihn nicht erwischte, das Geodreieck nachgeworfen. Das Geodreieck war zerbrochen, aber der Ratz blieb mir. Von dem Tag, an dem das Geodreieck durch die Klasse flog, bis zu dem Schikurs, an dem ich nur noch Ratz genannt wurde, war nicht einmal ein Monat vergangen. Der Zusammenhang von Name und Erscheinung war zu augenfällig. Hätte man die Wirtsleute in Saalbach oder Zauchensee bei der Ankunft des Autobusses mit den Schikursteilnehmern gefragt, wer von uns der Ratz sei, sie hätten ohne zu zögern auf mich gezeigt. Der Name blieb haften wie ein Brandzeichen. Er war mir von Anfang an ins Gesicht geschrieben. Es brauchte nur jemand zu kommen, der ihn lesen konnte.
Als Student dachte ich, ein Vollbart würde mir helfen. Ein mit Barthaaren nach vorne gerundetes Kinn würde zur Oberlippe einen Gegenpol bilden, würde ihr gleichsam die Spitze brechen. Aber der Bart wurde nur eine halbe Sache. Rotblonde Typen wie ich taugen nicht dafür. Ich hatte schon die zwanzig überschritten, bis ich endlich mein erstes Brusthaar entdeckte. Ich musste nachhelfen. Am Beginn des Studiums massierte ich Klettenwurzenöl in mein Kinn, in den folgenden Semestern waren es von meiner Mutter angesetzte Brennnesseltinkturen. Später verwendete ich Priorin, gegen das Ende meines langen Studierversuches zu kam ein neues Mittel auf den Markt, Regaine. Ich massierte es mir täglich zweimal ins Kinn, mit dem Erfolg, dass Lucia, meine Nichte, kaum konnte sie sprechen, mir rundweg ins Gesicht sagte: Du siehst aus wie ein Ratz mit Geißbart.
Auf der Rückseite des Räumfahrzeugs, dem ich folgte, war ein eiserner Trichter montiert, aus dem, von zwei grellen Rotationslampen beflackert, eine Drehscheibe Splitt herausschleuderte. Bei meinem Bremsmanöver war ich so nahe an das Fahrzeug herangekommen, dass die Steinchen auf die Kühlerhaube sprangen. Ich musste mich zurückfallen lassen. Am Straßenrand leuchteten die Bäume orange auf, von vorne war zu hören, wie der Schneepflug über den Asphalt schrammte. Es fiel mir schwer, Abstand zu halten. Immer wieder kam ich so nahe, dass das Auto von Steinchen getroffen wurde.
Der Schneepflug hinterließ eine deutliche Stufe, nicht direkt an der Straßenmitte, sondern ein wenig auf die linke Seite versetzt. Es war, als wäre die andere Fahrbahn nicht nur schmäler, sondern auch noch eine unüberwindbare Ebene höher gelegen. Sie lud nicht gerade zu einem Überholmanöver ein. Hinzu kam der dichte Schneefall. Es wäre richtig gewesen, Abstand zu halten und auf bessere Bedingungen zu warten.
Bei diesem Tempo war es aussichtslos, um zwei Uhr in Frankfurt zu sein. Ich würde das Flugzeug versäumen. Am besten wäre es, langsam nach Wien zurückzufahren, Mimi anzurufen und ihr alles zu erklären. Aber das wollte ich nicht. Mimi hatte mich von allen ihren Freunden und Bekannten ausgewählt. Sie vertraute mir, und sie hatte den Flug bezahlt. Und ich antworte damit, dass ich das Flugzeug versäume?
Mimi hier, hatte sie am Telefon gesagt. Und dann war eine Pause gewesen. Ich hatte ihre Stimme sofort erkannt, sie war oft im Radio zu hören. Die Worte Mimi hier klangen, als würde sie einen Korrespondentenbericht beginnen. Ihre klare, sonore Stimme nahm allem, was sie sagte, den Zweifel. Wenn sie über eine Broadway-Produktion berichtete, dann klang das nicht wie ihre Meinung, sondern dann wollte man das so nehmen, wie sie es sagte. Gäbe es da noch einen Zweifel, so besagte ihr entschiedener Tonfall, dann würde ich gar nicht darüber berichten. Mimi kannte die Kraft ihrer Stimme und sie nutzte sie. Kein Ich bin der Meinung oder Ich sehe das so flossen in ihre Kommentare. Jeder Satz war ein unbezweifelbares Das ist so. Mimi Madonick, New York. Mit diesen Worten schloss sie ihre Berichte, und die Theaterdirektoren setzten sich ins Flugzeug. Eine Saison später war das Stück in Wien.
Sie sagte Mimi hier und wartete darauf, wie ich reagierte. Vielleicht war sie ja auch unsicher, ob wirklich ich am Telefon war und nicht etwa mein Vater oder sonst jemand mit demselben Namen, der im Wiener Telefonbuch gleich ein paar Seiten füllt. Ich war zu überrascht, um etwas zu sagen.
Erinnerst du dich an mich?
Klar erinnere ich mich an dich. Deine Stimme klingt wie im Radio.
Ich habe mir deine Nummer von der Auskunft geben lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das jetzt erklären soll.
Versuche es.
Kannst du schweigen? Ich meine, obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben.
Natürlich kann ich schweigen, sagte ich. Aber im nächsten Moment dachte ich, das war vielleicht zu voreilig. Deshalb fügte ich hinzu: Es hängt schon auch davon ab, worüber.
Weißt du, fuhr sie fort, ich rufe dich an, weil ich Vertrauen zu dir habe. Das muss jetzt alles ganz komisch für dich klingen. Ich habe überlegt, an wen ich mich wenden könnte, und da bin ich auf dich gekommen.
Als der Anruf kam, war es mitten am Nachmittag. Danach ging ich im Kreis. Das ist meine Chance, dachte ich. In New York werde ich meine Videoanimationen verkaufen. New York wird mich reich und berühmt machen. Ich werde Mimi beim Haus helfen, und sie wird mir bei der Vermarktung meiner Erfindung helfen. Und dabei werden wir uns wieder nahe kommen. Mein lieber Ratz, du alter Masturbator, was du da gerade am Telefon gehört hast, war keine Radiostimme und keine alte Freundin aus Studienzeiten, es war nichts Geringeres als deine eigene Zukunft.
Am liebsten hätte Mimi gehabt, dass überhaupt niemand erfährt, dass ich nach New York fahre. Aber das ging natürlich nicht. Und so fragte sie mich, ob ich nicht in irgendeiner Weise selbst etwas in New York zu tun haben könnte. Und das war nun ein goldenes Tablett, auf das ich mit sparsamen Worten meine Erfindung legte.
Bring alles mit, was du hast, sagte sie. Wir werden sehen, was wir machen können.
Es sind drei Disketten, mehr nicht.
Gut, dann bring die drei Disketten mit. Und am besten gleich noch ein paar Kopien davon.
Zwei Kopien hatte ich noch, der Vorrat an leeren Disketten reichte noch für neun weitere Kopien. Als ich zu kopieren begann und die Etiketten beschriftete, war ich in euphorischer Stimmung. Ich hatte Mimi nicht gesagt, dass ich schon einmal in New York gewesen war, um meine Videoanimationen zu verkaufen, allerdings ohne Erfolg. Damals war mein Produkt noch nicht ausgereift. Und vielleicht war auch ich es noch nicht. Jedenfalls war ich die Sache falsch angegangen. Ich hatte keine Ahnung von den Verkaufspraktiken in der Softwarebranche. Mimi wird wissen, wie man es richtig macht. Ich werde meinen Vater nicht abstechen, dachte ich, ich werde ihm systematisch das Leben vermiesen, bis er von selbst geht. Das Einzige, was mir Sorgen machte, war, dass mich die Amerikaner für hoffnungslos veraltet halten könnten, weil ich mit Disketten komme anstatt mit einer CD-ROM. Mein Alter hatte sich geweigert, einen CD-ROM-Brenner zu bezahlen.
Drei Disketten waren fehlerhaft. Billiger Ramsch. Ich versuchte sie mit meinem Scan-Disk-Programm zu reparieren, aber es ging nicht.
Dir werde ich es zeigen, sagte ich und warf die Disketten in den Müll. Als Erstes werde ich mir ein neues Auto kaufen. Das musste sein. Einen Lincoln. Keinen Mercedes. Wäre zwar gut, geht aber nicht. Kommt mit einem fetten Mercedes daher. Was ich früher selber gesagt hatte, musste ich jetzt nicht unbedingt von anderen hören. Nein, einen Lincoln. Genauso teuer, genauso gut, aber keiner sagt: Kommt mit einem fetten Lincoln daher. Zuerst das Auto. Und dann, möglichst noch am selben Tag und möglichst im Auto geschrieben und, wenn es sich machen lässt, vom Auto aus in den Postkasten geworfen, ein Briefchen an den Vater:
Lieber Genosse Vater. Du kannst dir dein Geld in die Haare schmieren. Freundschaft!
Dein Sohn Rupert.
PS: Solltest du einmal in finanzieller Verlegenheit sein, weil es deine Schnepfe gar zu bunt treibt, wende dich vertrauensvoll an mich. Ich habe dir noch viel heimzuzahlen.
Ein Lincoln würde diesem Briefchen das nötige Gewicht verleihen. Ein schöner Neubeginn unserer Beziehung. Ein paar Zeilen, abgefasst in der einzigen Sprache, die mein Vater verstand. Und der Weg zu diesem Briefchen war der Flug nach New York. Aber dann war die Mail gekommen: Du wirst nichts tun müssen, was du nicht tun willst. Ich konnte und wollte nicht mehr zurück. Ich hatte zugesagt zu kommen und davon sollte mich nicht einmal dieser unendlich langsame Schneepflug vor mir abhalten.
Vielleicht hatte Mimi einfach die Arbeit gemeint. Sie wollte sagen, dass ich mich zu keiner Arbeit bei ihr verpflichtet fühlen müsse, dass ich jederzeit, wenn es mir auf die Nerven gehen sollte, wieder zurückfliegen könne. Mimi, so überlegte ich mir, hat sich auf Long Island ein Haus gekauft und sich dabei finanziell übernommen. Jetzt fehlt ihr das Geld, um das abgewohnte Haus zu sanieren. Sie muss die Arbeiten selber durchführen, ihre derzeitigen Freunde sind dafür offenbar ungeeignet. Irgendwelche amerikanischen Großstadtintellektuellen. Und da hat sie sich daran erinnert, dass ich in ihrer Wohngemeinschaft einmal ausgemalt und ein Elektrokabel verlegt habe, und so ist sie auf mich gekommen. So weit schien mir alles plausibel. Bis auf die Geheimniskrämerei. Die Geschichte mit dem ominösen Hausbesitzer, der von dieser Zwischenwand partout nichts erfahren dürfe, wollte mir, als ich hinter diesem grell blinkenden Schneepflug nachzuckelte und Steinchen auf die Motorhaube bekam, nicht mehr recht einleuchten. Aber es gab ja immer noch die Erfindung und meinen schlachtreifen Vater.
Ich war dem Scharren und Donnern des Schneeräumfahrzeugs gut zehn Minuten lang gefolgt. Als ich mir vornahm, nun nicht mehr länger zuzuwarten, sondern zu überholen, tat ich dies mit der Gewissheit, einen Fehler zu begehen. Ich zog den Wagen nach links hinüber und drückte aufs Gaspedal. Das Heck scherte aus. Ich nahm das Gas sofort weg und musste mehrmals gegenlenken, um das Auto wieder in den Griff zu bekommen. Es schlingerte von einer Seite zur anderen. Durch die Kälte der letzten Tage war der Boden unter dem Schnee offenbar gefroren. Bei jedem stärkeren Druck auf das Gaspedal drehten die Hinterräder durch. Ich war gegenüber dem Schneepflug etwas zurückgefallen und fuhr wieder nahe an ihn heran. Zwischendurch gab ich Vollgas, nur um zu sehen, wie der Tourenzähler auf über viertausend hinaufschnellte, ohne dass der Wagen eine spürbare Beschleunigung erfuhr. So kam ich nicht weiter. Langsam führte ich die linken Räder an die Schneekante heran. Sie glitten ab. Als ich mehr Druck machte, scherte wieder das Heck aus. Die Schneedecke war fester, als ich erwartet hatte. Wollte ich mich wirklich darauf einlassen, den Schneepflug zu überholen, musste ich anders vorgehen.
Ich schaltete in den vierten Gang und nahm dadurch dem Motor die Kraft. Der Tourenzähler fiel auf unter tausend. Ich war nun langsamer als das Räumfahrzeug. Um auf die andere Fahrbahn zu wechseln, bewegte ich mich zuerst von ihr weg. Ich fuhr an den rechten Straßenrand heran, ganz nahe an die vom Schneepflug frisch aufgehäuften und mit Splitt durchsetzten Schneewände, von denen Brocken herabrollten. Dann zog ich den Wagen vorsichtig nach links und fuhr in einem steileren Winkel als zuvor auf die andere Fahrbahn hinüber. Die Schneekante versetzte den Rädern einen leichten Schlag. Ich nahm noch mehr Gas weg und kam dabei in eine stabile Lage. Der Motor lief untertourig, sein Meißeln war deutlich zu hören. Doch er war stark genug, um wieder in Fahrt zu kommen. Das Räumfahrzeug war nur noch ein flimmerndes Orange hinter den Schneeflocken. Die Räder griffen, und langsam kam ich auf der Überholspur wieder an das Räumfahrzeug heran. Steinchen prasselten gegen die rechte Seite der Karosserie, als sich der Wagen neben die Doppelreifen des Lastfahrzeugs schob. Die Schneeketten rasselten im Rhythmus der Drehungen. Es war ein herzloses Geräusch, als wäre das Räumfahrzeug ferngesteuert. Vorne schrammte, von hellen Scheinwerfern beleuchtet, die Pflugschaufel. Wolken von Schneestaub stiegen auf und verloren sich inmitten der nach wie vor dicht fallenden Flocken. Das Dröhnen und Poltern wurde lauter, je näher ich an die Pflugschaufel herankam. Mir war, als würde ich darunter sogar Funken wegfliegen sehen. Als ich auf der Höhe der Fahrerkabine war, beugte ich mich nach vorne und warf einen seitlichen Blick hinauf zum Chauffeur des Schneepflugs. Sein Gesicht war nicht zu erkennen, aber seine Hand. Sie fuhr ein paar Mal hin und her, als wollte sie die Bewegung eines Scheibenwischers nachahmen. Du bist ein Verrückter, schien sie zu sagen. Dir ist nicht zu helfen.
Ich fuhr an der Pflugschaufel vorbei. Das Auto war nun aus dem unteren Drehzahlbereich heraus, es zog deutlich an. Bloß nicht zu stark draufdrücken. Den Wagen unmittelbar vor dem Schneepflug quer zu stellen, könnte böse ausgehen. Die Straße war noch gut ausgeleuchtet, aber da vorne wartete eine Wand von dichtem, undurchdringlichem Schneefall. Sie war nachgiebig, sie verschob sich, aber sie rückte dennoch unaufhaltsam näher, je weiter ich mich vom Räumfahrzeug entfernte. Als ich das Auto in einem leichten Bogen auf die rechte Fahrbahn zurückzog, schaltete das Räumfahrzeug dreimal hintereinander das Fernlicht ein. Leck mich, Kollege, sagte ich.
Jetzt galt es, dem Schneepflug zu entkommen. Ihn zuerst zu überholen, um dann genauso schnell zu fahren oder ihn gar bei der Räumarbeit zu behindern, das wäre ein jämmerlicher Auftritt. Ich drückte weiter auf das Gaspedal. Das orange Flackern der Waldbäume erlosch. Im Rückspiegel verlor sich das Lichterwerk des Räumfahrzeugs. Dessen Fahrer, so schwor ich mir, sollte mich kein zweites Mal zu Gesicht bekommen. Es war wieder dunkel ringsum, und ich fuhr wieder zu schnell. Kein Wetter sollte mich von meinem Flug abhalten.
Der Schneepflug war das einzige Fahrzeug gewesen, das ich bis dahin getroffen hatte. Es war gut eine halbe Stunde vergangen, seit ich vom Haus meiner Mutter losgefahren war.
Ich wäre mit dem Zug gefahren, hätte meine Mutter nicht am Telefon behauptet, ich würde sie nur noch als Tierheim verwenden. Ich hatte sie gebeten, Alexandr abzuholen. Es war schon später Nachmittag, sie schluckte am Telefon, und ich hatte Angst, sie würde gleich losheulen. Nichts hasse ich mehr, als wenn Menschen am Telefon heulen. Ich fühlte mich ihr ausgeliefert, war unfähig zu reagieren. Mir fehlte die Sprache. Ich versuchte mir vorzustellen, was ich sagen würde, wenn ich ihr gegenüberstünde, sie sehen und berühren könnte, aber es fiel mir einfach nichts ein. Ich horchte in den Telefonhörer und dachte mir, als wäre das eine wirksame Beschwörungsformel: Fang jetzt bitte, bitte bloß nicht zu weinen an!
Aber meine Mutter schluckte und gluckste weiter, gleich würde sie losheulen, und so sagte ich zu ihr: Ich lege jetzt auf. In zwei Stunden bin ich bei dir.
Dann steckte ich Alexandr in den Tragekorb, schnappte den Plastiksack mit Katzenfutter, den Aktenkoffer mit meinen Disketten, dem Telefon und meinen Papieren, die schnell mit ein paar Klamotten gefüllte Reisetasche und fuhr los. Meine Mutter sitzt bei der Weinflasche und heult. Mit diesem Bild war ich zwei Stunden lang durch einen schönen Herbstabend unterwegs. Als ich in der hereinbrechenden Dunkelheit bei ihrem Haus in Kirchbach ankam, stellte meine Mutter gerade einen Papiersack mit zusammengerechtem Herbstlaub neben die Mülltonne und lachte.
Was machst du in Amerika?, fragte sie.
Ich werde dort reich und berühmt, antwortete ich.
Protokoll I
(Ludwigsburg, 15.1.1959)
Ich heiße Jonas Shtrom und bin amerikanischer Staatsbürger. Um hier, vor der »Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen«, meine Aussage zu machen, bin ich eigens aus Chicago angereist. Es geht um Verdachtsmomente, die von der hiesigen Staatsanwaltschaft leichter geprüft werden können als von jedem amerikanischen Gericht.
Ich wurde am 23. Februar 1925 in Klaipeda, Litauen, geboren. Von der deutschsprachigen Mehrheit wurde die Stadt Memel genannt. Sie ist zwei Jahre vor meiner Geburt von Litauen besetzt worden. Ich bin also gebürtiger Litauer und habe bis zum Alter von fünfzehn Jahren auch einen litauischen Pass besessen. Meine Großeltern väterlicherseits lebten bei uns im Haus. Sie sprachen jiddisch und russisch. Die Großeltern mütterlicherseits lebten in Riga. Ich sah sie nur selten. Mein Vater war Rechtsanwalt. Er sprach mit mir deutsch. Später auch litauisch. Meine Mutter war Gesangslehrerin und leitete einen Chor, der im Schützenhaus von Memel Konzerte gab. Wir beachteten zwar die wichtigsten jüdischen Feiertage, aber mehr der Großeltern wegen. An die Regeln hielten wir uns nicht. Lediglich Channuka war ein großes Familienfest, zu dem auch die Großeltern aus Riga anreisten.
Die meisten meiner Klassenkameraden wussten am Anfang wahrscheinlich gar nicht, dass ich Jude war. Jonas ist in Litauen auch unter Nichtjuden ein geläufiger Name. Ich besuchte das deutsche Gymnasium. Das geschah auf Wunsch meiner Eltern. Meine Großeltern hätten mich gerne in der jüdischen Schule gesehen. Aber mein Vater hatte viele deutsche Klienten und wollte ein Zeichen setzen. Ich war bei weitem nicht der einzige Jude in der deutschen Schule.
Drei Klassen über mir war ein Schüler namens Algis. Er war der Sohn des litauischen Regionalpolitikers Munkaitis. Ich weiß, dass er eine ältere Schwester hatte. Sie hatte das Mädchen-Lyzeum besucht und dort von meiner Mutter Gesangsunterricht erhalten, aber ich habe sie nie kennen gelernt. Ich bin nicht einmal sicher, ob Algis mich kannte. Wir spielten zwar miteinander Fußball, aber die Jüngeren kennen in der Schule doch eher die Älteren als umgekehrt. Und er war der Politikersohn. Schon deshalb kannten ihn alle. Wegen der Politik seines Vaters wurde er manchmal gehänselt. Es gab viele Schüler, auch Lehrer, die darauf warteten, dass die Deutschen kämen und das Memelland zurückholten. Algis wollte seine Mitschüler überzeugen, dass es auch für die Deutschen von Vorteil wäre, wenn das Memelland litauisch bliebe. Ich verstand damals nicht viel von der Sache, aber ich wusste, dass Litauen für uns Juden besser war als Deutschland. Und so habe ich Algis, wenn ich in der Pause bei solchen Gesprächen zuhörte, immer ein wenig bewundert. Wenn er ging, bewegten sich seine Schultern im Rhythmus der Schritte weit nach links und rechts. Ich dachte mir damals, so gehen richtige Männer, und habe diesen Gang heimlich nachgemacht. Es gab deutsche Schüler, die sich für etwas Besonderes hielten und nicht mit uns Juden sprachen. Algis war da anders. Er war froh, wenn ihn die älteren jüdischen Schüler in seinen Ansichten unterstützten. Im neuen Schuljahr, es muss 1937 gewesen sein, war Algis nicht mehr in unserer Schule. Es wurde gesagt, er habe in das neue litauische Vytautas-Gymnasium gewechselt. Von da an sah ich Algis mehrere Jahre nicht und kann auch nicht angeben, was er in der Zwischenzeit gemacht hat.
Aus den Wahlen von 1938 gingen im Memelland die Nationalsozialisten als Sieger hervor. In unserer Schule wurde die Hitlerjugend gegründet. Nach den Weihnachtsferien wurden die Lehrer, wenn sie die Klasse betraten, mit »Heil Hitler« gegrüßt. Wir Juden standen mit den anderen auf, mussten aber schweigen. Die privaten Kontakte mit deutschen Schülern waren nun so gut wie zu Ende. Es wurde ihnen untersagt, sich mit uns abzugeben. Im März 1939 musste das Memelland, nach einem Ultimatum von Hitler, wieder an Deutschland abgetreten werden.
Schon vor dem Ultimatum übersiedelten wir nach Kowno, auch Kaunas genannt, die damalige Hauptstadt von Litauen. Ich nahm diese Übersiedlung nicht als Flucht wahr. Wir waren nicht unmittelbar bedroht. In der Schule waren wir jüdischen Schüler zwar isoliert gewesen, aber nicht benachteiligt. Die deutschen Schüler fuhren zu ihren Treffen und Zeltlagern, wir zu unseren. Mein Vater hatte durch seine vielfältigen Kontakte größeren Einblick in das, was sich zusammenbraute. Er hatte die Übersiedlung sorgfältig vorbereitet und eine Wohnung angezahlt. Einige Klienten meines Vaters, vor allem natürlich Juden, waren ebenfalls nach Kowno gezogen. Und so konnte er, nach anfänglichen Problemen, seiner Arbeit wieder nachgehen. Meine Mutter gab Gesangsunterricht in einem jüdischen Kulturverein. Ich ging nun zur Jüdisch-Litauischen Schule.
Innerhalb kürzester Zeit füllte sich die Stadt mit Flüchtlingen, darunter Bekannte aus dem Memelland, die häufig bei uns wohnten, bis sie eine neue Bleibe fanden. Dann kamen österreichische Juden, hierauf polnische. Meine Eltern arbeiteten in einem Hilfskomitee. Meine Mutter organisierte Musikabende, deren Erlös den Flüchtlingen zugute kam. Wir haben gewusst, dass es den Juden unter den Deutschen nicht gut ging. Vor allem die polnischen Juden erzählten schlimme Geschichten. Aber ich muss gestehen, dass mich das alles nicht sonderlich berührte. Wir hatten ja vorgesorgt, wir waren rechtzeitig fortgegangen. Ich hatte damals ein ganz anderes Problem. Mir gehörte ein großes, eigenes Zimmer, aber ich konnte es kaum bewohnen, weil wir immer Flüchtlinge zu Gast hatten. Die Fenster gingen auf eine Nebenstraße hinaus. Wenn sie am Abend geöffnet waren, konnte ich die Musik aus einem benachbarten Tanzcafé hören. »Rosamunde« war damals ein beliebter Schlager. Aber nun standen vier Betten in meinem Zimmer, und ich musste auf einer schmalen Couch im Musikzimmer meiner Mutter schlafen. In der Früh wurde mein Bettzeug weggeräumt, weil Musikstudenten zum Gesangsunterricht kamen. Hin und wieder musste ich sogar im Zimmer meiner Großeltern übernachten, weil auch im Musikzimmer jemand untergebracht war. Ich war vierzehn, fünfzehn Jahre alt und wartete auf den Tag, bis die Flüchtlingsströme endlich aufhörten.
Es gab ein reges gesellschaftliches Leben in Kowno. Meine Eltern gingen in die Oper, ich ging lieber ins Kino. Für »Dick und Doof«-Filme hätte ich mein gesamtes Taschengeld ausgeben können. Später waren es andere Filme und Schauspieler, die mich begeisterten, Marlene Dietrich zum Beispiel. »Der blaue Engel« war damals wahrscheinlich schon zehn Jahre alt, aber er lief immer noch. Ich ging zu meinem Freund Hermann lernen, und er ging zu mir lernen. In Wirklichkeit saßen wir beide in der Nachmittagsvorstellung des Kinos. Es gab viele Vereine, Tanzveranstaltungen, Cafés und, wenn ich mich recht erinnere, vier jüdische Zeitungen.
Am 15. Juni 1940 marschierte die Rote Armee ein. Ich hatte am Vortag einen neuen amerikanischen Film gesehen, »Vom Winde verweht«, und war mit meinen Gedanken noch im amerikanischen Bürgerkrieg. Aber es kam nicht ganz unerwartet. Wir waren auf die Ankunft der Russen vorbereitet. Es war mehr ein sanfter Einmarsch. Mit Clark Gable im Kopf lief ich auf die Straße hinaus und winkte den Soldaten der Roten Armee zu. Sie hatten die alte Hauptstadt Vilnius zurückerobert, die ja nach dem Ersten Weltkrieg von den Polen besetzt worden war. Die Sowjetsoldaten fuhren schrottreife Panzer aus der Vorkriegszeit. Wir Jungen machten darüber Witze. Wir nannten sie die »Fünfzigerpanzer«. Einen Mann brauche man zum Lenken und neunundvierzig zum Schieben. Später habe ich erfahren, dass es auch Widerstand gab, aber in Kowno habe ich nichts davon gesehen.
Meine Eltern waren froh, dass die Russen kamen. »Sie werden uns vor den Deutschen schützen«, sagten sie. Es schien so, dass der Hitler-Stalin-Pakt Europa endgültig zwischen Russen und Deutschen aufgeteilt hatte. Wir hatten Glück gehabt, wir waren auf der für Juden sicheren Seite gelandet. Und anfangs war es auch so. Lediglich die polnischen Flüchtlinge mokierten sich. Sie sagten: »Jetzt habt ihr endlich euer Wilna zurück, aber dafür ist Litauen russisch geworden.«
Mein Vater befasste sich in den ersten Monaten dieses so genannten »Russenjahres« vor allem mit Eigentumsfragen. Wohlhabende Bürger hatten ihren Besitz verloren, andere bei der Umstellung von Litas auf Rubel ihre Ersparnisse eingebüßt. Manche in unserer Schule traten der Komsomol, der kommunistischen Jugendliga, bei, andere hatten heimliche Sympathien für die LAF, die Litauische Aktivisten Front, die im Untergrund gegen die sowjetische Besatzungsmacht operierte. Ich hatte mit beiden nichts zu tun. Aber einmal fiel mir ein Flugblatt der LAF in die Hände. Aller Wahrscheinlichkeit nach war dies im März 1941, eventuell auch Anfang April, jedenfalls Monate vor dem Einmarsch der Deutschen. Es lag auf der Toilette in unserer Schule. Darauf stand: »Nicht ein einziger Jude soll glauben, dass er im neuen Litauen auch nur die minimalsten Rechte oder Lebensmöglichkeiten haben wird. Unser Ziel ist es, die Juden gemeinsam mit den roten Russen zu vertreiben.« Ich faltete das Flugblatt ganz klein zusammen und steckte es in meine Hosentasche. Daheim zeigte ich es meinem Vater. Während er es las, warf er mir zwischendurch beunruhigte Blicke zu. Dann legte er es in eine Mappe auf seinem Schreibtisch. Er sagte: »Das hat nichts zu bedeuten. Die Burschen haben keine Chance.«
Von da an sah ich die LAF mit anderen Augen. Auch meine Freunde kannten das Flugblatt. Es war offenbar in großer Anzahl in den Schulen verstreut worden.
Auf unsere jüdischen Vereine wurde von den Behörden zwar deutlicher Druck ausgeübt, aber die meisten bestanden weiter. Da keine neuen Flüchtlingsströme kamen, schien sich für uns die Lage eher zu beruhigen. Die großen Deportationen nach Sibirien begannen erst gegen Ende des Russenjahrs. Da wurden dann auch einige Synagogen, jüdische Gemeindehäuser und Klubs geschlossen. Es gab Listen von unerwünschten Personen. Vor allem litauische Nationalisten, Regierungsbeamte, Zionisten und wohlhabende jüdische Bürger waren plötzlich gefährdet. Man nannte sie »Volksfeinde« und »konterrevolutionäre Elemente«. Sie wandten sich in ihrer Not natürlich an meinen Vater. Er war ja Rechtsanwalt und sprach gut russisch. Bei seinen Bittgängen zu den sowjetischen Behörden hatte er auch den einen oder anderen Erfolg. Aber viel konnte er nicht ausrichten. Wer auf den Deportationslisten stand, saß in der Falle. Es gab keinen Fluchtweg mehr. Vor den ausländischen Konsulaten standen lange Menschenschlangen. Aber selbst wenn jemand mit Geld und Einfluss ein Visum ergatterte, nützte es nicht viel. Ohne die Zustimmung der sowjetischen Behörden gab es kein Entkommen.
Und dann kam der Morgen des 22. Juni 1941. Ich erinnere mich noch, dass ich bester Laune schlafen gegangen war, weil ich seit einigen Tagen wieder mein eigenes Zimmer hatte. Doch dann wurde ich von Detonationen geweckt. Ich hatte keine Ahnung, was das sein könnte. Die Sirenen heulten. Als ich ins Wohnzimmer ging, war auch von der Straße her großer Lärm zu hören. Meine Mutter kam mir entgegen und sagte: »Die Deutschen kommen.«
In der Ecke lief unser Rundfunkempfänger. Radio Moskau meldete das Bombardement von Kowno, Riga und Šiauliai. Molotow hielt eine wütende Rede. Mein Vater saß bei Tisch, ganz bleich im Gesicht. Er brachte keinen Bissen hinunter. Mit starrem Blick schaute er mich an, sagte aber nichts. Mein Großvater war noch am gefasstesten. Er bat mich, das Radio auszuschalten. Dann legte er meinem Vater die Hand auf die Schulter und sagte auf Jiddisch: »Es iz nit der ershter mol. Mir veln geyn vayter.«
Gemeinsam traten wir auf den Balkon hinaus. Unsere Wohnung lag in der Laisvésallee, der Hauptstraße der Stadt. Soweit wir die Straße nach beiden Richtungen überblicken konnten, war sie vollkommen verstopft. Russische Militärfahrzeuge, Motorräder, Pferdewagen, Handkarren, Menschen, die sich mit Bündeln auf dem Rücken, mit Koffern und Fahrrädern durchzudrängen versuchten, Soldaten, die rücksichtslos alle zur Seite stießen, um sich Platz zu verschaffen. Von der anderen Seite des Nemunas-Flusses, in gar nicht so weiter Ferne, vernahmen wir das Heulen deutscher Stukas, Detonationen und die Salven der Flugabwehrkanonen.
»Das muss am Flughafen von Aleksotas sein«, sagte mein Vater. »Wenn sie nur die Stadt verschonen.«
Ich blickte auf das Menschengewimmel, das Geschiebe, Gedränge, Schreien und Hupen. Mir war es unverständlich, warum wir plötzlich unsere schöne Wohnung aufgeben sollten. Ich habe sehr gern in Kowno gelebt. Ich war zu der Zeit das erste Mal richtig verliebt. Mit Lea war ich heimlich im Kino gewesen und hatte ihre Hände gesucht und dann die ganze Vorführung hindurch gestreichelt. Gegen Ende des Films hatte ich ihr ins Ohr geflüstert, dass ich sie heiraten werde. Meine Mutter gab Lea Klavierunterricht, aber sie ahnte nicht, dass ich mich danach heimlich mit ihr traf. Die Vorstellung, dass ich mich jetzt mit einem Bündel in der Hand da unten in dieses wilde Durcheinander einreihen sollte, war mir ganz und gar zuwider.
Meine Mutter sagte: »Ich gehe zum Bahnhof. Zunächst einmal fahren wir zu meinen Eltern nach Riga, dann werden wir weitersehen.«
Das schien ein vernünftiger Vorschlag zu sein. Wir gingen in das Wohnzimmer zurück und schlossen die Balkontür. Mein Vater suchte im Radio den Sender BBC, meine Mutter verließ die Wohnung. Unter normalen Verhältnissen wäre man von uns aus in zwanzig Minuten am Bahnhof gewesen, aber meine Mutter kam erst nach dreieinhalb Stunden zurück. Sie sagte: »Ich bin nicht einmal in den Bahnhof hineingekommen. Es ist völlig aussichtslos. Neben dem Bahnhof brennt ein Haus. Das Militär hat alle Züge beschlagnahmt.«
Mein Vater verbrachte den restlichen Tag damit, ein Fuhrwerk aufzutreiben. Er kannte viele Unternehmer und Direktoren von Firmen. Aber die waren entweder selber auf der Flucht oder die Fahrzeuge waren ihnen von flüchtenden Russen entwendet worden. Auch am Nachmittag schlugen Bomben ein, diesmal waren die Ziele näher als am Morgen. Meine Mutter ging noch einmal zum Bahnhof. Er war mittlerweile in Flammen aufgegangen. Draußen auf den Gleisanlagen standen noch Waggons. Sie waren voll gestopft mit Russen, aber sie hatten keine Lokomotive.
Auch am nächsten Morgen schlugen in der Stadt Bomben ein. Sie waren gegen abziehende russische Konvois gerichtet, zerstörten aber auch Häuser. Meinem Vater gelang es, ein kleines Lastauto zu organisieren. Es sollte uns und die Familie Mendelson, die in derselben Straße wohnte, nach Panevéžys bringen. Von dort wollten wir uns irgendwie nach Riga durchschlagen. Ich half unserem Dienstmädchen, meiner Mutter und meinen Großeltern, unser Hab und Gut zu verpacken. Aus der Ferne hörte man Flugzeuge, Gewehrfeuer und immer wieder auch Bombenexplosionen. Aber das Kriegsgeschehen schien sich nun aus der Stadt hinaus nach Norden zu verlagern. Wir hatten die Fenster verdunkelt. Immer wieder schaute ich zwischen den Vorhängen hindurch. Die Straße war nun fast leer. Eine gespenstische Ruhe nach all dem Durcheinander am Tag davor. Schließlich wagte ich es, auf den Balkon hinauszugehen. Da sah ich die ersten deutschen Soldaten. Sie trugen graue Uniformen und Helme und fuhren auf Motorrädern vorbei. Schnell trat ich in die Wohnung zurück. Am nächsten Tag warteten wir in aller Frühe auf das Auto, aber vergeblich. Gegen Mittag kam der Fahrer zu Fuß und erklärte uns, dass es kein Benzin mehr gäbe. Unser Telefon funktionierte noch. Mein Vater bemühte sich redlich, aber auch ihm gelang es nicht, irgendwo Benzin aufzutreiben. Und so gingen der Herr Mendelson, mein Vater und ich am Nachmittag in die Dörfer hinaus, um bei Bauern ein Fuhrwerk zu organisieren. Mein Vater wollte mich nicht mitnehmen, aber ich bestand darauf. Im Gegensatz zu meinem Vater sprach ich ein akzentfreies Litauisch, und so sah er schließlich ein, dass ich von Nutzen sein könnte.
Aber wohin sollten wir uns wenden? Die Straße nach Jonava, die Hauptflüchtlingsstraße nach Norden, kam nicht in Frage, weil von dort immer noch Flugzeuglärm, Bomben und Schüsse zu hören waren. Herr Mendelson, der ein Lebensmittelgeschäft besaß, kannte einen Bauern in der Nähe von Garliava. Dieser hatte ihm über Jahre hinweg mit einem Pferdewagen Äpfel und Gemüse zugeliefert. Garliava lag jedoch in südlicher Richtung, von wo auch der deutsche Vormarsch zu erwarten war. Obendrein mussten wir am Flughafen vorbei, von dem wir nicht wussten, unter wessen Kontrolle er sich befand. Wir machten uns auf den Weg. An einer Ecke stand ein Junge, nicht älter als zwölf Jahre, und verkaufte die Zeitung »I Laisve«, was so viel heißt wie »Der Freiheit entgegen«. Herr Mendelson wollte eine Zeitung erstehen, doch der Junge verweigerte sie. Er drückte den Packen an sich und sagte: »Nicht für Juden.«
Herr Mendelson war darüber aufgebracht und wollte ihm die Zeitung entreißen. Da trat der Junge zur Seite und schrie: »Nicht für Juden, habe ich gesagt!«
Herr Mendelson war ein korpulenter Herr mit Glatze. Ich konnte sehen, wie sein ganzer Kopf rot anlief. Um kein weiteres Aufsehen zu erregen, setzten wir unseren Weg in einer Nebenstraße fort. Als wir den Nemunas-Fluss überquert hatten, bogen wir nach links in eine kleine Straße ein, um vom Flughafen wegzukommen. Am Stadtrand gingen wir dann auf einem Feldweg weiter. Herr Mendelson schimpfte immer noch über den Zeitungsjungen. Er sagte, das nächste Mal werde er ihm eine Ohrfeige geben. Vereinzelt kamen uns Flüchtlinge entgegen, die mit voll bepackten Fuhrwerken und Leiterwagen unterwegs waren. Sie suchten Zuflucht in der Stadt.
»Dreht um«, sagte einer. »In den Dörfern sind Banden unterwegs, die Juden erschießen und plündern.«
Wir gingen weiter. Da hörten wir Gewehrfeuer in unmittelbarer Nähe. Es waren fünf oder sechs Schüsse schnell hintereinander und dann noch ein paar vereinzelte. Vor uns lag ein Feld, in dem halbhoch grünes Korn stand. Dahinter waren Büsche und Bäume. Von dort waren die Schüsse gekommen. Nach einer Weile sahen wir eine Gruppe von acht Männern mit geschulterten Gewehren aus den Büschen hervorkommen und auf unseren Weg zugehen. Es waren Zivilisten. Wir bückten uns und liefen hintereinander in das Kornfeld hinein. Dort legten wir uns auf den Boden und krochen in verschiedene Richtungen. Die Männer gingen am Weg vorbei. Sie waren bester Laune. Offenbar waren sie betrunken. Sie sprachen litauisch. Mir schlug das Herz so laut, dass ich kaum verstehen konnte, was sie sagten. Ich hörte aber, dass einer grölte: »Jetzt wird aufgeräumt.« Andere wiederholten: »Ja, jetzt wird aufgeräumt.«
Zum Glück bemerkten sie unsere Spur nicht. Nach einer Weile krochen wir auf allen vieren weiter, in die Richtung, aus der die Gruppe gekommen war. Es gab dort einen kleinen Weiher. Ringsherum standen Büsche und Bäume. Ich erreichte sie als Erster. Ein schmaler Weg führte in das Gebüsch. Vor mir lag ein buntes Durcheinander von Kleidern und Schuhen. Die Sachen waren auf dem Weg verstreut, hingen aber auch an den Zweigen.
»Was war hier los?«, fragte mein Vater. Er kam hinter mir.
»Ich weiß nicht«, antwortete ich. In diesem Moment sah ich es. Der Weiher war rechter Hand rot und bräunlich eingefärbt. Auf dem Wasser schwammen Haare und es schauten Arme und Beine heraus. Ich konnte im ersten Moment gar nicht verstehen, was ich sah. Nach und nach begriff ich es. Ich begann zu zittern. Tränen liefen mir übers Gesicht. Mein Vater drückte mich an sich. Herr Mendelson war nachgekommen. Wir gingen am Ufer entlang zu der Stelle hinüber. Der Weiher war seicht, und die nackten Leichen lagen nur halb im Wasser. Der Kopf eines Kindes war zerfetzt. Daneben schwamm eine graue Masse. Es waren die Leichen von sieben Personen. Alle erschossen. Zwei alte Menschen, zwei jüngere und drei Kinder, das kleinste wahrscheinlich noch keine zwei Jahre alt. Am Ufer klebten Blut und Gehirnmasse.
Wir gingen an die gegenüberliegende Seite des Weihers und versteckten uns zwischen den Büschen. Immer wieder musste ich zurückschauen zu den Leichen. Die Vorstellung, dass auch uns das bevorsteht, ließ mich fast wahnsinnig werden.
Bei Einbruch der Dunkelheit gingen wir weiter. Das Haus des Bauern, den Herr Mendelson kannte, lag am anderen Ende eines Dorfes. Wir gingen in weitem Bogen um die Ortschaft herum und näherten uns dem Hof. Neben der Eingangstür waren zwei beleuchtete Fenster zu sehen. Als wir näher kamen, schlug ein Hund an. Er bellte und jaulte und wollte sich nicht mehr beruhigen. Bis der Bauer aus dem Fenster schaute. Er trug einen dicken Schnauzbart. Da er nichts sah, öffnete er das Fenster. Das war der Moment, als Herr Mendelson auf ihn zuging.
»Petras«, sagte er, »ich bin es, der Chaim Mendelson aus Kaunas.«
»Verschwinde!«, sagte Petras. »Ich kann mich mit Juden nicht mehr einlassen. Das ist viel zu gefährlich.«
Dann rief er dem Hund zu, er solle schweigen. Als er sich wieder Herrn Mendelson zuwandte, erblickte er meinen Vater und mich. Wir waren näher gekommen.
»Nein!«, rief er aus. »Da sind ja noch andere. Ihr müsst sofort verschwinden. Ich kann nichts für euch tun.«
Herr Mendelson hielt ihm ein Bündel Geldscheine unter die Nase. Mein Vater zog ebenfalls ein Bündel Geldscheine aus dem Rock.
»Wir brauchen ein Fuhrwerk, nichts als ein Fuhrwerk«, sagte Herr Mendelson. »Sie können alles dafür haben.«
Hinter dem Bauern erschien eine blonde Frau mit hochgeknoteten Haaren. Sie bekreuzigte sich, als sie uns sah. »Oh Gott«, rief sie, »was sind das für Zeiten.«
»Ein Fuhrwerk«, wiederholte Herr Mendelson, »nur ein Fuhrwerk. Bitte.«
Petras sah seine Frau an, die sich noch einmal bekreuzigte. Dann sperrte er uns die Tür auf. Die Bäuerin war vielleicht vierzig Jahre alt, ihr Mann etwas älter. Er zog sofort die Vorhänge zu. Wir setzten uns an den Tisch. Die Bäuerin fragte, ob wir Hunger hätten. Mein Vater und ich hatten seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Sie brachte eine Kanne Milch und Brot.
Herr Mendelson erklärte dem Bauern, dass wir für zwei Familien ein Fuhrwerk bräuchten, um in den Norden zu kommen.
»Das ist unmöglich«, sagte Petras. »Die fangen euch schon vor dem nächsten Dorf ab.«
Wir wussten, dass er Recht hatte. Aber wir saßen nun in seiner Stube, und das hieß, dass er doch irgendwie bereit war, uns gegen gute Bezahlung zu helfen.
Mein Vater erzählte von den Erschossenen im Weiher. Petras sagte, das könnte die Familie Grünblat aus dem Dorf sein. Die sei heute abgeholt worden. Er sagte »abgeholt«. Die Bäuerin bekreuzigte sich wieder. »Was sind das für Zeiten«, schluchzte sie. Dann erklärte sie uns, dass Herr und Frau Grünblat die Dorfschule geleitet hätten. Der alte Grünblat sei einmal ihr Lehrer gewesen.
Vielleicht war es diese Hinrichtung, die Petras bewog, sich nun doch unser anzunehmen. Er sagte: »Mit Übersiedlungsgut auf dem Wagen kommt ihr nicht weit. Um überhaupt noch von hier wegzukommen, müsst ihr euch als Bauern verkleiden und alles Gepäck zurücklassen.«
Ich hatte ihn im Verdacht, dass er sich unsere Sachen aneignen wollte. Aber mein Vater und Herr Mendelson gingen sofort auf den Vorschlag ein. Sie legten die Rubelscheine auf den Tisch, und die Bäuerin begann alte Kleidung zu suchen. Sie kam mit einem Packen zurück, aber es stellte sich heraus, dass es nicht ausreichte. Die Mendelsons hatten zwei Kinder. Der Sohn Isi war jünger, die Tochter Fanny älter als ich. Wir waren insgesamt neun Personen. Die Bäuerin begann zu überlegen, ob sie nicht von Kazys ein paar Sachen dazugeben könnte. Kazys, so stellte sich heraus, war der Sohn des Bauern. Unmöglich, sagte Petras. Kazys gibt sicher nichts für Juden her.
Ich sah nun meine Stunde gekommen. Wenn ich diesem Kazys gegenübertrete, dachte ich, und er merkt, dass ich nicht mit jiddischem, polnischem oder russischem Akzent, sondern einfach litauisch spreche, wird er sich vielleicht erweichen lassen. Vorlaut sagte ich: »Ich könnte ja einmal mit ihm reden.«
Der Bauer antwortete: »Ich habe ihn schon zwei Tage nicht gesehen. Er treibt sich mit seiner Gruppe herum.«
Keiner von uns hat nachgefragt, was diese Gruppe macht. Es war vollkommen klar, wer sich in diesen Tagen herumtrieb. Petras hatte schließlich die goldene Idee. Er sagte: Wenn ihr alle eure Sachen auszieht und hier lasst, auch die Schuhe, wird Kazys damit einverstanden sein.
Unsere Hosen und Röcke waren durch das Kriechen auf dem Boden von oben bis unten verdreckt, aber sie konnten für einen einfachen Bauernjungen schon einen gewissen Wert darstellen, vor allem unsere Schuhe. Und so zogen wir uns bis auf die Unterhosen aus und kleideten uns mit alter Bauerntracht ein. Statt meiner maßgefertigten Lederschuhe trug ich nun Holzpantoffeln. Die Bäuerin schnürte die restlichen Sachen zu zwei Bündeln zusammen und dann wurden wir hinauskomplimentiert. Petras sagte, er werde im Morgengrauen losfahren. Wir sollten auf keinen Fall Koffer mitnehmen, sondern höchstens Körbe oder ein paar kleine Bündel. Schweigend gingen wir durch die sternklare Nacht zurück. In der Ferne brannten Häuser, wir hörten Schüsse, aber wir hörten auch betrunkene Männer die litauische Nationalhymne singen. Immer wieder blieben wir stehen und horchten. Wenn eine dieser ausgelassenen Gruppen des Weges kam, versteckten wir uns und warteten, bis sie weit genug fort war. Meine Mutter und meine Großeltern hatten schon ängstlich auf uns gewartet. Mein Vater sah sich im Wohnzimmer um, wo all die verpackten Kisten und transportbereiten Möbel standen. Er sagte: »Alles bleibt hier. Wir nehmen nur ein paar haltbare Lebensmittel mit.«
Meine Mutter begann in das Innere ihres Bauernkittels Schmucksachen einzunähen. Ich ging zu Bett. Vor meinen Augen waren die nackten Leichen aus dem Weiher, die Einschusslöcher, die zerfetzten Schädel. Aber die Erschöpfung erstickte die Bilder und ich schlief bald ein.