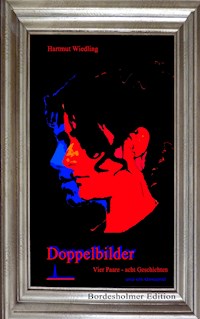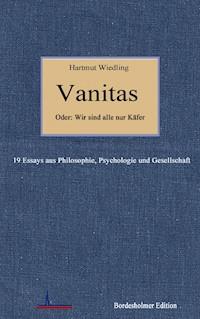Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei junge Unternehmensberater Daniel, Joseph und Magda entwickeln in absurder Übertreibung gesellschaftlicher Abartigkeiten die absonderlichsten wirtschaftlichen, ethischen und kulturellen Ideen zur Neuordnung einer in Schwierigkeiten geratenden europäischen Gesellschaft. Zu ihrer Überraschung werden ihre Ideen von ihrem Arbeitgeber aufgegriffen und es gelingt, eine neue Staatsform in der virtuellen Welt „Second Life“ zu simulieren. Dadurch erlangen ihre politischen Ideen so ungeahnte Zustimmung und Popularität, dass sich eine neue Staats- und Gesellschaftsform in Europa ausbreitet. Der Roman verfolgt das Leben der drei Protagonisten, die Liebesbeziehung zwischen der progressiven Magda und dem konservativen Joseph im Schatten des großen Machers Daniel und erzählt die Schicksale der Protagonisten, die sich schließlich der neuen, von ihnen geschaffenen Gesellschaftsordnung auch selbst hilflos unterworfen sehen. Nach einer schweren beruflichen und menschlichen Katastrophe droht dem bis dahin erfolgreichen, jetzt aber zunehmend resignierten Joseph vorzeitig ein Leben im Altersreservat, der staatlichen Einrichtung für gesellschaftlich als nutzlos angesehene Bürger. Die junge Asiatin Sou Zie, seine ehemalige Studentin, ermöglicht dem lebensmüden Joseph eine verlockende Rückkehr ins Berufsleben. Joseph ist dankbar und glücklich, doch er zögert und sucht sich seinen eigenen Weg aus dem unerträglichen Reservat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bordesholmer Edition
Bd. 16
3. Auflage 2016
Unveränderter Nachdruck
Zu diesem Buch:
„Wie kommst du zu so kranken Eingebungen?“
„Ich stelle mir Sonderschüler vor. Genauer, solche, die dem Unterricht der Sonderschule nicht folgen können und sich ihren eigenen Reim auf die Dinge machen. Und dann lausche ich in sie hinein, wie sie die Welt sehen, in ihrer kindlichen Einfalt.“
„Und was soll der Unsinn?“
„Unsinn? Du musst nur bereit sein, den Ideen zu folgen, und unversehens verwandeln sie sich in weise Gedanken.“
Zum Autor:
Hartmut Wiedling, geb. 1940, Professor für quantitative Betriebswirtschaftslehre an der FH Kiel, trat 2003 vorzeitig in den Ruhestand, um sich der Schriftstellerei zu widmen.
„Klosterbrut“ war sein erster veröffentlichter Roman.
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Teil II
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Teil III
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
I.
1.
Alles hatte ganz harmlos angefangen.
Mit einem guten Universitätsabschluss in der Tasche wollten sie die Welt erobern, Joseph, Magda, Daniel und wie sie alle hießen, die munter ins Blaue hinein studiert hatten, was ihnen Freude machte, weiter nicht gedacht hatten, nicht hatten denken wollen.
Und sie hatten Glück gehabt. Hatten etwas gefunden, wovon sie leben konnten, waren erfolgreich.
Unter dem großen Dach der Unternehmensberatung GAMMA bot sich ihnen ein verlockendes Sprungbrett in die weite vielfältige Wirtschaftswelt. Zunächst unverbindlich im Status von Trainees, doch mit Aussicht auf freie Mitarbeiterschaft, auf räumlich und inhaltlich unbegrenzte Entfaltungsmöglichkeit.
Jeder arbeitete an einem anderen Standort des Unternehmens, ohne von den anderen zu wissen.
Am Anfang waren sie nur mitgelaufen. Hatten Hilfs- und Zubringerdienste erledigt und über jede Beratung, die sie verfolgen durften, Abschlussberichte geschrieben. Nun aber hatte man sie offenbar für ein besonderes Vorhaben ausgewählt.
Einen ganzen Monat lang wurden sie von allen anderen Arbeiten freigestellt, um sich auf eine Klausurtagung in einem Kloster in Südfrankreich mit dem nichtssagenden Thema: „Neue Strategien der Personalführung“ vorzubereiten. Es gab kein Tagungsprogramm, keine Referentenliste, keine Teilnehmerliste. In der 16. Kalenderwoche sollte es losgehen. Mehr wurde nicht mitgeteilt. Alle Rückfragen blieben ergebnislos. Man wollte sie offenbar nicht informieren. Die zugewiesenen persönlichen Betriebstutoren - erfahrene langjährige Berater in hohen und höchsten Positionen - wechselten sofort das Thema, wenn sie um Informationen über die bevorstehende Tagung in Aix-en-Provence gebeten wurden. Allen war es so ergangen.
2.
Bei der Ankunft im Kloster fand jeder an der Rezeption eine mit seinem Namen versehene Informationsmappe vor. Abgesehen von Zeitpunkt und Raum des ersten Treffens enthielt sie jedoch lediglich einen Plan der Klosteranlage und seines Parks sowie landeskundliche Informationen über die nahe Stadt, deren Museen, Theaterveranstaltungen und Ausflugsmöglichkeiten.
Beim abendlichen Souper sahen sich alle zum ersten Mal. Sie trafen sich in einem spärlich beleuchteten mittelalterlichen Kellergewölbe des Klosters mit einer aus einem alten Mauerstück gearbeiteten Bar, davor einer hohen altertümlichen Sitzbank aus massivem dunklen Holz und, den Rest des kleinen Raumes füllend, vier modernen Stehtischen. Gegenüber führten drei offene, aus großen Steinquadern gefügte Rundbögen in einen weiteren Raum, der jedoch von der Bar her nur schwer einzusehen war.
Joseph, der als erster – und eigentlich etwas zu früh - eingetroffen war, trat an einen der Bögen und überblickte jetzt das andere, sehr viel größere Kellergelass, dessen Tonnengewölbe ebenfalls rundum auf alten steinernen Bögen ruhte - vielleicht eine Krypta aus frühen Klosterzeiten. Beleuchtet war der Raum von Fackellampen an den Mauerteilen zwischen den Säulen, die die Bögen stützten. An den Seiten, in von den Wandbögen gebildeten Nischen beinahe verborgen, waren kleinere, mit alten Tellern, Bestecken und Gläsern gedeckte Tischchen mit je zwei Stühlen zu erkennen. In der Mitte stand ein für zwölf Personen festlich gedeckter schwerer Eichentisch mit dazu passendem altem klösterlichem Gestühl. Das Ende auch dieses Raumes bildeten wiederum weite große Mauerbögen, die aber durch Flügeltüren verschlossen und, abgesehen von dem mittleren, etwas breiteren, von Kommoden und Anrichttischchen verstellt waren, auf denen Blumen, Obstschalen, Gläser und Behälter für Getränke in symmetrischer Anordnung aufgebaut waren.
Sanfte gregorianische Chormusik füllte die Leere der Räume und gab ihnen eine feierliche aber gastfreundliche Atmosphäre.
„Guten Abend, ja, schauen Sie sich nur um, ich hoffe, es wird Ihnen gefallen“, begrüßte ihn die angenehme Stimme eines großen, hageren, schwarz gekleideten Herrn, den Joseph zunächst im Halbdunkel nicht bemerkt hatte. Nun aber trat er hinter der Bar hervor, kam auf Joseph zu, und für eine kurze Zeit gelangte er in den Schein eines Deckenstrahlers, der eine Steinfigur unter einem der Mauerbögen beleuchtete, und ließ in seinem südländischen, braun gebrannten Gesicht unter kräftigen dunklen Augenbrauen für einen kurzen Augenblick überraschend helle blaue Augen aufleuchten, bevor die Dunkelheit des Raumes ihnen wieder die Farbe nahm.
„Guten Abend Herr Dr. Winter“, begrüßte er, auf ihn zutretend, Joseph noch einmal offiziell und schaute ihn mit wissendem Lächeln, aber unaufdringlich freundlicher Unverbindlichkeit an.
„Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise.“
In diesem Augenblick traten weitere Gäste ein und zogen die Aufmerksamkeit auf sich, so dass es Joseph erspart blieb, ein Gespräch mit dem ihm fremden Herrn anzuknüpfen, von dem er nicht wusste, ob er klösterliches Personal – was er wegen der Kleidung zunächst angenommen hatte – ob er Tagungsleiter oder vielleicht ein ihm bislang unbekannter Manager seines Unternehmens war.
Nach und nach erschienen auch die anderen Teilnehmer, alle wohl zwischen fünfundzwanzig und höchstens fünfunddreißig Jahren. Wie von unsichtbarer Regie geleitet, blieb jeder zunächst unschlüssig am Eingang stehen, die Augen an die Dunkelheit des Kellerraumes gewöhnend, überrascht vom einladenden klösterlichen Ambiente.
Der freundliche Herr im schwarzen Anzug begrüßte sie und stellte ihnen seine inzwischen mit einem Tablett voller Getränke eingetretenen Assistentin vor, eine zierliche junge Frau mit dunklem Teint, vielleicht nordafrikanischer Herkunft.
Sie nahmen jeder einen der von der hübschen Südländerin liebenswürdig angebotenen Aperitifs und sie wurden an die Stehtische geführt, wo der eigentümliche Empfangschef die Neuankömmlinge den bereits Erschienenen, jeden mit Namen und Titel, in einer so selbstverständlichen Weise bekannt machte, wie wenn er sie alle seit langem persönlich kennte.
Es waren am Ende sechs Frauen und sechs Männer, die die Stehtische umstanden, von ihrer Anreise und ersten Eindrücken im Kloster erzählten und untereinander ihre Visitenkarten austauschten. Alle hatten die gleichen Karten mit dem Logo der Unternehmensberatung GAMMA - Global Association for Marketing & Management Aids - und der gleichen Berufsbezeichnung „Trainee“, unterschiedlich lediglich in den Angaben der Namen und der akademischen Abschlüsse.
Zur allgemeinen Verwunderung vertraten die Teilnehmer die verschiedensten akademischen Fachrichtungen: Dr. rer. nat., Dr. jur., Dipl. Math, Dipl. Psych., Dr. med., Dr. Ing, Dr. rer. pol., D. theol. sowie je ein Magister der Kunstgeschichte und der Philosophie. Keiner von ihnen war Wirtschaftswissenschaftler. Der einzige Dr. rer. pol. war Soziologe.
3.
Irgendetwas an der Art ihrer Bewegung hatte seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen noch ehe sie in sein eigentliches Blickfeld trat, eine junge Frau, unklösterlich gut gelaunt, an der Seite eines großen, schlanken, Tagungsteilnehmers mit langen ein wenig unfrisiert wirkenden dunkelbraunen Haaren.
Jungmanager und solche, die bemüht waren, als solche angesehen zu werden, zeigten sich zu der Zeit - ungeachtet der im damaligen Deutschland unrühmlichen politischen Rolle von Skinheads - vorzugsweise kahlköpfig, zumindest aber mit kurzem Haarschnitt. Doch trotz seines eher an die 68er Jahre erinnernden Outfits wirkte der Neuankömmling herausfordernd fortschrittlich, gleichzeitig aber sicher und natürlich und vor allem ohne jegliche künstliche VIP-Aura.
Er und seine Begleiterin schienen – wie auch Joseph - ein wenig älter zu sein als die meisten übrigen, wirklich noch ganz unerfahren wirkenden Gäste.
Der Empfangschef stellte sie als Magda Gustavson, ihn als Dr. Daniel Broth vor. Ihre Visitenkarten wiesen ihn als Soziologen, sie als Psychologin aus.
Die beiden gingen – nicht ohne eine aufmerksame Freundlichkeit seitens Broths an die Adresse der hübschen Mademoiselle – in lebhafter Unterhaltung auf eines der Stehtischchen zu.
Joseph wollte sich gerade zu ihnen gesellen, da richtete sich Dr. Broth brüsk an ihn:
„Bevor Sie hier bei uns einen Platz bekommen, beantworten Sie doch bitte eine Frage zu der bedeutsamen Problematik, die uns beschäftigt.“ Er machte eine kleine Pause, um seine Worte auf den Eindringling wirken zu lassen, dann fuhr er fort:
„Also. Sie gehen durch eine hübsche Gartenlandschaft, oder, genauer, Sie durchqueren den blühenden Rosengarten einer barocken Parkanlage. Der schnellste Weg, um Ihr Ziel zu erreichen, wäre ein hässlicher illegitimer Trampelpfad, eine verbotene Abkürzung quer über den Rasen. Der von der Stadtgärtnerei angelegte und liebevoll gepflegte offizielle Weg dagegen würde in einem weiten Bogen, also auf einem großen Umweg dorthin führen. Was tun Sie?“
Während er sprach, schaute er belustigt auf den neben ihm klein und brav wirkenden Joseph herab. Doch der, scheinbar unbeeindruckt von den taxierenden Blicken der beiden, erwiderte ohne Zögern, gerade so, als stelle man ihm jeden Tag diese Frage
„Ich verhalte mich so, wie ich es in öffentlichen Anlagen zu tun pflege, wenn ich heimlich einen städtischen Baum für ein dringendes Bedürfnis missbrauchen möchte: Ich schaue mich unauffällig um, ob ich gesehen werden kann, prüfe, ob der Rasen nicht so feucht ist, dass ich meine Schuhe beschmutzen oder gar nasse Füße bekommen könnte, ob auch keine Kinder in der Nähe sind, denen ich Vorbild sein sollte, horche noch einmal in mich hinein, ob ich im Falle der Fälle auch wirklich bereit wäre,…“
„Schon gut. Wir sollten Du sagen“, unterbrach ihn Dr. Broth, und nach einem winzigen Zögern fügte er, ihn anschauend, aber dennoch mehr für die Ohren der jungen Frau an seiner Seite bestimmt, belustigt hinzu „Natürlich nur, wenn es keiner hört - falls Sie darauf bestehen.“
„Also ich bin die Magda“, brach die freundliche Psychologin neben ihm die neuerliche Stichelei ab und ersparte es Joseph, darauf einzugehen.
„Der Nachname interessiert nicht“, fügte sie hinzu. „Er ist ohnehin nur kurzzeitig ausgeliehen“, wobei sie die letzten Worte in einem belustigten, ein wenig gekünstelten leisen Lachen ausklingen ließ, bevor sie, die Ironie ihres Vorredners aufgreifend, ergänzte „aber für den Notfall: Gustavson, geborene Semper.“
„An dem verheißungsvollen Mädchennamen könnte ich eher Gefallen finden“, scherzte Joseph.
Doch aus Furcht, mit seiner durchschaubaren Anzüglichkeit zu weit gegangen zu sein, gab er einem plötzlichen Einfall nach und beeilte sich, klarzustellen:
„Ich liebe Dresden und vor allem seine Oper“, und bevor sie reagieren konnte, kam er zurück auf den Eignungstest.
„Und ihr? Wie haltet ihr es mit der verbotenen Abkürzung? Ich könnte mir vorstellen und wünschte es mir fast, dass Magda ihre Entscheidung davon abhängig machen würde, ob sie im Grün der verbotenen Wiese oder zwischen den Rosen des gärtnergepflegten Parkweges ein hübscheres Bild abgibt.“
Die Bemerkung kam gut an. Daniel nickte beifällig, und schaute auf Magda. Die Angesprochene, für eine Sekunde unentschieden, ob sie sich als Frau geschmeichelt oder als Psychologin unter Wert verkauft fühlen und entsprechend reagieren sollte, antwortete nach einer kurzen Bedenkpause, die sie mit spöttischem Lachen überbrückte, das sie, ihr Selbstbewusstsein sogleich wiederfindend, in ein scherzhaft zustimmendes Kichern übergehen ließ:
„Na ja, ein wenig ist es schon so. Marktpsychologie.“ - Erneut unterbrach ihr belustigtes Lachen ihre Antwort - „Aber ich glaube, ich würde wohl nicht lange darüber nachdenken und den Weg gehen, der mir gerade besser passt. Wenn ich eilig bin, riskiere ich mein Schuhwerk und nehme den Trampelpfad. Aber wenn ich Zeit habe, gar in besonderem Outfit unterwegs bin, ergehe ich mich in der schönen Allee der Gartenanlage und genieße die neugierig taxierenden Blicke müßiger Spaziergänger. Hommage an mein ästhetisches Bedürfnis.“
„Und den verräterischen Duft von Narzissen!“, kommentierte Daniel.
„Nun tu doch nicht so, als könntest gerade du auch nur an einem einzigen Spiegel vorbeigehen, ohne deinem Ebenbild einen Blick zu schenken!“ „Stimmt. Allerdings sucht meine Eitelkeit ihre Spiegel vorzugsweise in der Gesellschaft. Doch um unsere eigentliche Frage zu beantworten: Grundsätzlich beuge ich mich nicht administrativen bürgerlichen Bevormundungen. Ich lasse mir von denen doch nicht meinen Weg verbieten. Schon daher bevorzuge ich Trampelpfade, sogar wenn es Umwege sind. Meinem gesellschaftlichen Ego zuliebe“, und schmunzelnd fügte er hinzu: „Oder ganz einfach, weil eine hübsche Frau ihn vor mir eingeschlagen hat.“
„Du verhunzt mir das schöne Bild!“, protestierte Joseph. „Ein langes rotes Sommerkleid hatte sie an und schritt mutterseelenallein anmutig über die einsame Waldwiese. Tandaradei. - Und nun trampelt da plötzlich so ein Unhold hinterher!“
„… und schneidet dir den Weg ab, während du noch überlegst, ob du die Abkürzung riskieren sollst!“
„Aber er könnte ihr die kleine blütenweiße Handtasche rauben, und so haste ich in Panik hinterher.“
„… und musst enttäuscht feststellen, dass die beiden sich freundschaftlich begrüßen und als Paar weitergehen.“
„Ja, ja. Zum Standesamt. Das würde dir so passen!“
„Damit bin ich durch. Gott sei Dank!“
„Schon wieder Trampelpfade?“
An dieser Stelle wurde ihr Gespräch unterbrochen. Der freundliche blauäugige Empfangschef kam auf sie zu, um die Drei auch offiziell einander vorzustellen.
„Darf ich die junge Dame mit Herrn Dr. Winter bekannt machen? Herr Dr. Winter ist Mathematiker in Hamburg. Ich nehme an, Herr Dr. Broth, Doktor der Soziologe“, dabei neigte er sich ihrer Begleitung in einer angedeuteten Verbeugung zu - hat sich Ihnen schon selbst vorgestellt. Sie kamen ja gemeinsam.“ Und, an Dr. Winter gewandt, „Ich habe das Vergnügen, Sie mit Frau Gustavson bekannt zu machen. Frau Gustavson ist Psychologin an der Universität Frankfurt.“
Gleich darauf ließ er sie wieder allein, um weitere neu Eintretende zu begrüßen und den übrigen vorzustellen.
„Meine Damen und Herren“, ergriff er das Wort, als sich der Raum um die Stehtische gefüllt hatte und kein weiterer Gast mehr erwartet wurde, „einmal abgesehen von Küchenpersonal, Rezeption und Zimmerdienst sind während der nächsten Tage Mlle. Dufour“ - dabei nickte er seiner jungen Kollegin freundlich zu - „und ich – mein Name ist Eugène Rother - für Ihr Wohlergehen in unserem schönen Hause verantwortlich.
Sie werden unsere einzigen Gäste sein. So ist es mit dem Auftraggeber abgesprochen. Das ganze Kloster, einschließlich der Wellness-, Fernseh-, Musik- und Leseräume, sowie vor allem auch der großen und durchaus nicht nur antiken Bibliothek, wird ausschließlich Ihnen zur Verfügung stehen. Frühstück und Mittagessen sind für Sie im früheren Refektorium vorgesehen. Das Abendessen wird hier in den geräumigen Katakomben serviert. Zu Fahrten in die Stadt oder Zielen der nahen Umgebung steht Ihnen unser Kloster-Shuttle zur Verfügung. - Wann immer Sie Fragen oder besondere Wünsche haben, scheuen Sie sich bitte nicht, sie uns zu sagen. Wir werden unser Bestes tun, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.“ Und mit einer Handbewegung zu dem hinter den offenen Torbögen eingedeckten großen Eichentisch fuhr er fort:
„Aber nun nehmen Sie erst einmal Platz. Das Essen könnte jetzt serviert werden, wenn es Ihnen recht ist.“
Durch Tischkarten war eine eigenartige Sitzordnung festgelegt. Die sechs Plätze an der einen Seite des Tisches waren für die Damen und die ihnen gegenüber für die Herren vorgesehen. Die Kopfseiten des Tisches blieben frei. Eine besondere Anordnung der Gäste nach ihrer fachlichen Herkunft war nicht zu erkennen. In Anbetracht der Breite des Tisches war so zwischen den Herren und den gegenüber sitzenden jungen Frauen zwar Blickkontakt, ein Gespräch dagegen kaum möglich.
Die Drei wurden daher, kaum dass sie erste Bekanntschaft geschlossen hatten, auch schon wieder getrennt. Immerhin waren sie sich, bevor sie an ihre Plätze gingen, noch schnell einig geworden, dass man anschließend an das Essen unbedingt noch etwas gemeinsam unternehmen müsse.
Während die Vorspeise serviert wurde, richtete der wie ein Kellner gekleidete Herr erneut das Wort an die kleine Gesellschaft:
„Die heutige Tischordnung ist bewusst ungewöhnlich gewählt, so dass es ihnen nicht schwer fallen wird, sie in Zukunft nach Ihrem Belieben zu ändern. Der Veranstalter schlägt vor, dass Sie während der Zeit Ihres Aufenthalts bei uns zu jeder Mahlzeit eine andere Platzordnung einnehmen. Aber darauf wird unser Haus dann keinen Einfluss mehr nehmen.“
Nach dem gemeinsamen Souper wurde die Gesellschaft eine Treppe hinauf und anschließend durch den romanischen Kreuzgang, vorbei am Zugang zur Klosterkapelle, in das hohe Gewölbe der Eingangshalle geleitet, wo man sich – je nach Verlangen - bei Kaffee, Cognac oder Liqueur in Grüppchen zusammenfand, und sich bemühte, die noch immer etwas steife Atmosphäre durch heitere Konversation zu überwinden.
Als der Anstandspflicht gruppendynamischer Geselligkeit Genüge getan war, löste sich Magda von der Gruppe, ging durch die geöffnete Terrassentür hinaus in die südlich warme Abendluft, schlenderte über den Kiesweg auf das Dunkel des von einer Mauer umgebenen Parks zu und wartete dort - eingedenk ihrer Verabredung – auf Daniel und Joseph, die ihr bereits folgten.
Ein Taxi – im Shuttle wären sie nicht unter sich geblieben - brachte sie ins Zentrum von Aix. Sie bummelten durch die breite nächtliche Platanenallee, tauchten ein in die warme südländische Heiterkeit, ließen sich von den Wellen vorbeiziehender französischer Sprachfetzen umspülen. Und wenn sie aus dem munteren Stimmengewirr ab und zu ein „Merci“, „toujours“, „bien sur“ oder „à demain“ heraushörten, war es für sie wie ein erstes herzliches Willkommen.
„Freunde, tretet zuweilen in den Atem, der euch nicht meint. Lasst ihn an euren Wangen sich teilen. Hinter euch zittert er – wieder vereint“, rezitierte Daniel leise aber theatralisch wie ein Schauspieler
„Ist das etwa von dir?“, fragte Magda nach einer Weile, als der Nachhall von Daniels Stimme längst wieder in der Flut der umgebenden abendlichen Redseligkeit versunken war.
„Leider nur ein einziges Wort. Alles andere bedauerlicherweise nicht. Ist vielleicht auch besser so. Aber trotzdem schade.“
Als bei einem der vielen Straßenrestaurants unter den Alleebäumen einer der kleinen Tische frei wurde, setzten sie sich und genossen es, wenngleich auch nur als Gäste, teilzuhaben an der wohltuend beschaulichen Lebensart. Die beiden Männer bestellten einen Côtes du Rhône, Magda einen kühlen, prickelnden Gaillac Blanc.
Das bis dahin so lebhafte Gespräch brach ab, als sie Platz genommen hatten. Vielleicht waren sie nur erschöpft von der Reise und froh, sitzen zu können, die angenehme Umgebung in sich aufzunehmen und geruhsam ein wenig zu entspannen, vielleicht fiel auch einfach niemandem etwas ein, worüber er reden wollte, jedenfalls entstand eine Pause. In das Schweigen hinein, das ihr bedenklich lange zu dauern schien, platzte Magda mit ihrer Frage „Wie kommt ihr eigentlich hierher? Als heimliche Aufpasser? So ganz normale Trainees wie die anderen seid ihr doch beide nicht. Bei mir ist das was anderes. Ich habe erst spät studiert und bin eigentlich sogar noch halb dabei. Aber ihr?“ „Wolltest du uns in einen Stuhlkreis setzen?“, spottete Daniel.
„Zur Gesprächstherapie bin ich natürlich auch nicht hier“, meinte Joseph, zu Daniel gerichtet, stimmte ihr dann aber bei: „Ein wenig mehr als nur eure akademischen Titel wüsste ich allerdings auch gern von euch.“
Sie schaffte es. Das Gespräch kam wieder in Gang. Zunächst im Stil einer Geschäftsordnungsdebatte: Man stritt über die Methode. Ob man eher durch direktes Fragen einen Menschen kennenlernen könne oder indirekt durch die Art, wie er sich in ein Gespräch einbrachte. Aber dann folgte man doch Magdas Anregung, und jeder gab ein wenig von sich und seinem Werdegang preis.
Es zeigte sich, dass sie alle drei schon eine gewisse Vergangenheit hatten, sich aber im Umbruch fühlten. Sie fühlten sich, gerade über dreißig, noch zu jung, zu unfertig, zu sehr voller Tatendrang, um sich endgültig festzulegen, um es schon dabei zu belassen, waren voller Ideen und wollten ihn noch nicht grau werden lassen, den Alltag. Wären dazu nicht in der Lage gewesen, mussten erst noch ausprobieren, was die Welt ihnen sonst noch bieten konnte. Privat und erst recht beruflich.
Als das Restaurant sich allmählich leerte, hatte die Nacht nichts von ihrer einladenden lauen Wärme verloren, und sie zogen weiter durch die nächtlichen Straßen, und wenn sie an ein Lokal kamen, in dem noch Gäste waren, gingen sie durch die offene Tür hinein und tranken auch noch ein Glas am Tresen.
Weit nach Mitternacht, als es bereits drohte ungemütlich hell zu werden, landeten sie schließlich nach ungezählten anderen Stationen in einem Nachtclub beim Gastspiel einer Pariser Transvestitenshow, die sie aber vorzeitig verließen.
„Ob Lesben Transen mögen?“, fragte Magda beim Hinausgehen und fügte lachend hinzu. „Immerhin haben sie ja mehr zu bieten als ihr gewöhnlichen Männer.“
„Gewöhnlich nennt sie uns“, wehrte sich Joseph, „Hast du das gehört? Behaart und ohne Busen, das findet sie also gewöhnlich.“
„Vielleicht ist es nicht das allein“, gab Daniel zu bedenken, „Und außerdem, woher willst du eigentlich wissen, dass ich behaart bin?“
„Sollen wir mal nachsehen?“ kam es lachend von Magda.
„Von mir aus gern“ ging Daniel spontan darauf ein und machte Anstalten, sein Hemd aufzuknöpfen, „aber dann wollen wir auch nachsehen!“
„Das könnte euch so passen. - Männer!“
„Wer hat denn angefangen?“
„Das Kaninchen hat angefangen!“ kam es zurück.
Auf der Suche nach einem Taxi entwickelten sich makabre Nachtunterhaltungen. Geschickt parierten die Beiden Magdas Feministinnenthesen, die die ihnen hinwarf, als wollte sie Enten mit vergifteten Ködern füttern, und spielten sie ihr – scheinbar charmant, scheinbar aggressiv, scheinbar ernsthaft interessiert, verpackt in mehr oder weniger geistreiche Ausschmückungen - zurück.
Im Gegensatz zu Daniel, mit seiner Verachtung für die Primitivität der seiner Meinung nach unsozialen und noch dazu unfähigen kapitalistischen Gesellschaft, fand Joseph – seiner konservativen Erziehung in einer heilen Lehrerfamilie entsprechend – mehr besänftigende, verbindende, auf harmonischen Ausgleich bedachte Worte, die ihm zwar bisweilen den Spott der beiden anderen einbrachten, die er aber so geschickt und entwaffnend zu verteidigen wusste, dass sie gezwungen waren, ihn wegen der verblüffenden Logik seiner bisweilen abenteuerlichen Argumentationen trotz mangelnder Progressivität doch mehr und mehr ernst zu nehmen. Dies desto mehr, als bei Josephs Bemerkungen nie recht erkennbar war, ob es sich nicht vielleicht lediglich um formallogische Gebilde seiner spielerischen Phantasie handelte.
Das eigentlich Begeisternde an ihrem ersten gemeinsamen Abend aber war für Daniel und Joseph – und wohl nicht nur für sie - ihre temperamentvolle sprachgewandte weibliche Begleitung. Daniels lockere Sprüche gefielen ihr und verleiteten sie zu immer gewagteren frivolen Scheinbekenntnissen. Genüsslich entblößte sie vor seinen Therapeutenaugen eine unwiderstehlich laszive verführerische Seele, wohl wissend, dass er sich am verlockenden Intimschmuck ihrer psychischen Nacktheit berauschen würde, auch und gerade da er natürlich durchschaute und sich geschmeichelt fühlte, dass sie ein eigens für ihn entworfenes Trugbild ihrer Fantasie vor ihm entschleierte. Längst war sie sein Lustobjekt, das er im Handstreich nehmen würde.
Für Joseph dagegen wurde sie Gegenstand der Bewunderung und Verehrung. Freilich keine Madonna. Die freizügigen Reden und die unverblümte Sprache ließen einen Heiligenschein nicht zu. Ihre anstößigen Äußerungen irritierten ihn. Er empfand sie als peinliche Nabelschau, suchte aber die Ursache bei Daniels aggressiver Gesprächsführung, und gab ihm die alleinige Schuld für alle ihre Entgleisungen.
Seine klösterlichen Nachtgedanken reduzierten die aufregende Erinnerung an Magda auf ihre verführerische Art, sich zu bewegen und ihr bleiches Gesicht mit dem wunderschönen großen Mund und nicht minder schönen großen blauen Augen und ihren langen, braunen, lockeren Haaren die sich, ihren Kopfbewegungen folgend, in ständig sich wandelnder weicher Verzierung immer neu um ihr Gesicht legten.
Als dann aber die Träume in der dunklen Zelle die Herrschaft über seinen Schlaf gewannen, begnügten sie sich freilich nicht mit derlei kindlichen wenngleich verlockenden Details, und gaukelten dem braven Joseph vor, es wäre die eigene Mönchspritsche und nicht die seines neuen Freundes, die in jener ersten Klosternacht unberührt blieb.
4.
Am Morgen fanden sie beim Frühstück ihren Arbeitsauftrag vor:
Tagungsprogramm: Es gibt kein Programm.
Sie werden völlig frei eine Woche zusammen mit elf weiteren jungen Hochschulabsolventen aus ganz verschiedenen akademischen Disziplinen leben. Was Sie tun, hängt allein von Ihnen ab. Kein Personalchef wird je erfahren, ob und wie Sie diese Tage genutzt haben.
Auf Referenten und jegliche Form von Organisation wurde verzichtet. Zeiteinteilung und Arbeitsorganisation sind Ihnen überlassen. Gönnen Sie sich Muße, machen Sie Ausflüge, gehen Sie in Museen. Lassen sie sich von Ihrer Umgebung inspirieren.
Vergessen Sie für diese Tage alles, was Sie auf der Universität an Fachwissen gelernt haben. Nehmen Sie Urlaub von unseren erstarrten Denksystemen. Lassen Sie Gedanken und Fantasien freien Lauf. Erträumen Sie eine neue utopische Welt.
Lassen Sie sich von abenteuerlichen Ideen verführen, geben Sie sich ihnen hin und verfolgen Sie sie. Behindern Sie Ihre schöpferische Kraft nicht durch kleinliche Bedenken der praktischen Durchführbarkeit.
Was auch immer Ihnen einfällt, halten Sie es fest. Schreiben Sie es auf – nur für sich - spontan und unreflektiert. Oder diskutieren Sie darüber mit Ihren Kollegen. Führen Sie Nonsensgespräche!
Genießen Sie für eine Woche unbegrenzte Narrenfreiheit!
Und am Ende - sind wir gespannt auf Ihre Ergebnisse – falls Sie sie uns zu lesen geben.
Das „Tagungsprogramm“ rief Erstaunen und Heiterkeit hervor. Neben Erleichterung und Freude bei den einen, Verwirrung, Unsicherheit und Ängste bei anderen.
Karrierebewusste, die gewohnt waren, altbekannte und bewährte Theorien behutsam aufzupolieren, um damit zu glänzen, hatten den Boden unter den Füßen verloren, und sie fielen hilflos ins Nichts. Oder sie begriffen nicht und verschwanden wie gewohnt in der Bibliothek, glaubten an die göttliche Inspiration im gewohnten Tempel, um erlesenen Gedanken anschließend ein kleines kritisches, niemanden verletzendes Novum anzufügen: Zaunkönige, die sich in den Brustfedern der Adler verkrochen, sich mangels eigener Kraft in fremde Höhen tragen zu lassen, um dann zu versuchen, mit ein paar kleinen Flügelschlägen und lächerlich aufgeregtem Gezeter den Königen der Lüfte den Rang streitig zu machen.
Die meisten aber empfanden die vorgegebene Methodik zwar ungewöhnlich, aber immerhin spannend und bewegten sich zwischen „Augen zu und durch“ und „Mal sehen, was dabei herauskommt“.
Für Daniel, beflügelt durch die gewährte Freiheit, motiviert durch das Vorschussvertrauen und ohne den geringsten Zweifel, es ausfüllen zu können, war es wie das Zeichen, auf das er nur gewartet hatte, um loszulegen. Endlich einmal.
Auch Magda fühlte sich erlöst. Sie hatte gefürchtet, in diesen Tagen, unentrinnbar eingesperrt in Klostermauern, zusammen mit einer Herde von Mitgefangenen ein durch die Unternehmensleitung vorgegebenes festes wissenschaftliches Programm abarbeiten zu müssen.
Joseph jedoch, gleichermaßen motiviert und verunsichert, brauchte, wie so oft in neuen Situationen, erst einmal Zeit. Nicht zur Überwindung der Angst vor dem Sprung ins kalte Wasser – er war nicht feige. Es war die Aufregung des Drachenfliegers vor dem ersten Start. Euphorie und Blockade im Widerstreit, Tatendrang und Lähmung zugleich. Nachdenklich stand er in der Rezeption und las alles noch einmal, Wort für Wort.
„Du kommst mit uns!“, weckte Daniel ihn auf, nahm Joseph am Arm und zog ihn mit zum Ausgang, wo Magda sie erwartete. - Der Flug in die Zukunft hatte begonnen.
Die kurzfristig von einigen anberaumte Vollversammlung interessierte sie nicht. Magda wollte in die Stadt, Joseph ins Museum, Daniel ans Meer. Nur nicht hierbleiben und zulassen, wie die Chance vertan wurde. Man einigte sich auf das Bistro vom Vorabend.
Währenddessen beschloss die so dezimierte Vollversammlung, zunächst einmal alle ihnen bekannten Lehrmeinungen zum Thema Unternehmensstrategie stichwortartig zusammenzustellen um anschließend die Liste im klostereigenen Rechnersystem allen verfügbar zu machen. Dies sollte aber – neben einer Einstimmung in die Thematik – lediglich zur Erstellung eines Negativkataloges von Ansätzen dienen, die nicht weiter verfolgt werden durften. Als Sicherung gegen Rückfälle in altbekannte ausgefahrene Geleise der bestehenden Gesellschaft.
„Das hört sich doch ganz gut an“, meinte Joseph, als sie davon erfuhren. „Perfekt. Bürokratie der Entbürokratisierung“, war Daniels Kommentar, und er fügte hinzu: „Vor der Vernichtung der Akten sind von jeder Seite sorgfältige Kopien anzufertigen“.
„Unter Umgehung der Reifung vorzeitig gealtert“, spottete Magda.
Die Drei grenzten sich aus. Gern ließ man sie ziehen. Ein Verdienst von Daniel. Mit Geschick und Vergnügen hatte er sich schnell unbeliebt gemacht, indem er seit dem ersten gemeinsamen Abendessen immer wieder und unbelehrbar bei jeder Gelegenheit propagierte, globale Stabilisierung erfordere den Nord-Süd-Konflikt, um – wie früher im Kalten Krieg des Ost-West-Konflikts - ein neues globales Gleichgewicht der Kräfte zu schaffen. Und als er noch draufsattelte, dass diesmal Jerusalem als „Frontstadt“ die Rolle des geteilten Berlin von damals zu übernehmen habe und genüsslich hinzufügte: „Es ist ja alles längst vorbereitet. Die Mauer ist doch schon da!“, war man erleichtert, als er sich – und in seinem Gefolge Magda und Joseph – von der übrigen Gruppenarbeit zurückzog.
Joseph versuchte noch einzulenken. Er wird aber von Daniel und Magda überstimmt. Immerhin setzt er durch, dass sie pro forma täglich irgendetwas ins Netz stellen.
Im Schatten der Platanen von Aix, in den Bistros der Museen, am Hafen von Marseille, unter Olivenbäumen und am Strand wetteifern sie in verrückten Ideen. Gaga. Einige stellen sie ins Netz. Von den allerbesten allerdings können sie sich nicht trennen. Zu schade dafür. Heimlich schreiben sie sie dennoch auf. Daniel ist der Erfindungsreichste und überschüttet die anderen mit seinen Parolen:
„Abschaffung von Bildung. Bücherverbrennung.“
Oder
„Käufliches Wahlrecht.“
Und dazwischen platte Stammtischthesen:
„Alte sollten eingeschläfert werden. Spätestens mit 70. Abschlachtprämien, wenn es früher vollzogen wird. Keine medizinische Behandlung mehr für Ruheständler. Weg mit dem gesellschaftlichen Wasserkopf!“
Magda und Joseph lachen.
„Wie kommst du zu so kranken Eingebungen?“
„Ich stelle mir Sonderschüler vor. Genauer, solche, die dem Unterricht der Sonderschule nicht folgen können und sich ihren eigenen Reim auf die Dinge machen. Und dann lausche ich in sie hinein, wie sie die Welt sehen, in ihrer kindlichen Einfalt.“
„Und was soll der Unsinn?“
„Unsinn? Du musst nur bereit sein, den Ideen zu folgen, und unversehens verwandeln sie sich in weise Gedanken.“
„Na dann verfolge mal das käufliche Wahlrecht bis hin zu einem weisen Gedanken!“
„Ganz einfach. Wer Geld opfert und in Politik investiert, übernimmt Verantwortung. Endlich wieder.“
„Und die Armen haben nichts zu sagen. Sehr praktisch“, und wie so oft unterstreicht sie mit einem gekünstelten Kichern vorsichtshalber die Ironie ihrer Bemerkung.
„Haben sie erstens sowieso nicht und sollen sie außerdem auch gar nicht erst bekommen.“
„Nicht ganz neu“, stellt Joseph fest. „Verantwortung erfordert Besitz.“
„Bismarck?“
„Nein. Klassenwahlrecht vom alten Kaiser Wilhelm.“
„So beschränkt ist unsere Phantasie.“
„Weiter“, beharrt Daniel. „Nimm die Alten. Deren Leben ist vorbei. Ernsthaft, die gehören eingeschläfert. Wäre menschlich und gesellschaftlich das Beste. Wir sind jetzt dran. Müssen schnell machen, bevor diese unbelehrbaren Versager den Rest der Welt verprasst haben.“ „Vielleicht gehen sie ja freiwillig, wenn man ihnen einen sanften Tod anbietet.“
„Und als Anreiz eine Ablebensprämie für die Erben“, spinnen Magda und Joseph den Gedanken weiter.
„Noch mal zum Wahlrecht“, kommt Daniel, auf das erste Thema zurück. „Nimm die ganzen Spendenaffären. Dann doch lieber gesetzlich zulässiger Stimmenkauf statt politischer Korruption.“
„Jedem“, vervollständigt er seine Theorie, „der politisches Verantwortungsgefühl besitzt, sollte die Möglichkeit gegeben werden, dieses durch finanzielle Opfer in die Tat umsetzen. Ganz offiziell. Ohne Heimlichkeit. Für alle überprüfbar. Im Internet. Eine saubere Sache. Ich schlage vor, 1000€ je Stimme.“
“Und die Arbeitslosen? Woher sollen die 1000€ nehmen?“
„Brauchen sie ja nicht. Die verkaufen ihre Stimme und verdienen gutes Geld damit.“
-
„Und du? Wie erfindest du neue Ideen?“, wendet Magda sich an Joseph. „Ich stelle mir eine politische Wahlveranstaltung vor und erfinde Strategien, die zu 0% Stimmen führen.“
„Gibt’s nicht.“
„Weiß ich. Immer irgendwo militante Minderheiten. Na sagen wir, Vorschläge, die den größtmöglichen Protest provozieren.“
„Zum Beispiel?“
„Erbschaftsteuer 100%. Arbeitsverbot für Frauen. Aufzeichnung aller Gespräche, Telefonate und E-Mails von Politikern und Führungskräften der Wirtschaft. Psychopharmaka statt medizinischer Betreuung. Abschaffung des Geldes.“
„Wozu das alles?“
„Zur Sanierung der Staatsfinanzen, Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Korruption und sogar als Lösungsansatz für Gesundheitsreform und Korruptionsbekämpfung. - Und du?“, fragt er Magda im Gegenzug.
„Ich stelle mir vor, womit ich konservativen Moralaposteln am brutalsten ihre doppelte Moral verderben könnte.“
„Und? Schon Ideen?“
„Legalisierung der Trampelpfade.“
„Das heißt?“
„Anpassung der offiziellen Ethik an das praktizierte Leben. Zulassen, was sowieso alle tun.“
„Und praktisch?“
„Haben wir doch zum Teil längst. Beispiel Sexualleben. Seit grundsätzlich alles erlaubt ist, kennt das Gesetz keinen Ehebruch und die Gesellschaft keine Treue-Pharisäer mehr. Ist doch toll!“
„Und keine Sexualethik.“
„Sexualität ist körperlich. Körper kennen keine Moral.“
„Moral soll es überhaupt nicht mehr geben?“
„Ethik, Moral. Wovon sprichst du eigentlich? Nimm den Sport. Doping überall. Im Fußball Regelwidrigkeiten und vorsätzliche Körperverletzung als Erfolgsrezepte. Geübt, trainiert, geduldet und, wenn geschickt und erfolgreich, sogar bejubelt. Dann doch lieber gleich alles erlauben! Steuerhinterziehung genauso. Ein Trottel wer sein Gourmetmenu im Fünfmützenrestaurant nicht als Werbungskosten deklariert und Handwerksbetriebe beauftragt statt Schwarzarbeiter. Mein Nachbar bezeichnet es als „Gebot der Freundschaft“, dass ich seine zerbrochene Fensterscheibe meiner Haftpflichtversicherung melde. So als ob mein Sohn sie auf dem Gewissen hätte. Und er war empört, als ich mich weigerte. Und so weiter und so weiter. Von dem, was wir Moral nennen, hat sich die Gesellschaft doch heimlich längst verabschiedet. Höchste Zeit für eine zeitgemäße, für unser heutiges Lebensgefühl neu geschriebene Ethik.“
„Faustrecht meinst du.“
„Natürlich nicht. Kein Chaos. Rechtsprechung muss sein. Ich dachte: Alles erlauben, was keinen gesellschaftlichen Schaden anrichtet.“
„Auch Mord und Totschlag?“
„Das Strafmaß richtet sich nach dem wirtschaftlichen Schaden für die Gesellschaft, und solange keine Arbeitskraft vernichtet wird…“
“Handle so, dass dein Handeln als allgemeine ökonomische Richtschnur dienen könnte“, kommentiert Joseph grinsend, kommt mir doch irgendwie bekannt vor.“
„Abgestandener Kant-Marx-Verschnitt“, brummelt Daniel.
„Wirklichen Unsinn gibt es ja vielleicht überhaupt nicht“, meditiert Magda zu ihrer Verteidigung. Vernunft ist immer und überall.“
-
„Wie beim Roulette“, fällt Joseph dabei ein und er kann nicht widerstehen, es loszuwerden, auch wenn es nicht ganz hierher passt. „Statistisch gesehen ist es fast genauso schwer, Geld systematisch zu verspielen wie es durch Gewinne zu mehren: Chancen 37:36 gegenüber 36:37.“
„Versteh ich nicht“, bekennt Daniel.
„Macht nichts. Würdest es ja doch nicht glauben.“
„Arschloch!“
-
Ideen, geboren aus aufgestautem geistigem Mutwillen werden aufgeblasen und als Versuchsballons gestartet. Später wird daran weitergearbeitet. Gemeinsam während der Siesta unter hohen Pinien oder einsam in der Stille der Klosterzelle. Gegen Abend zu Dritt beim Aperitif werden Neubearbeitungen vorgestellt, kritisiert, in Frage gestellt. Manches wird verworfen, anderes gemeinsam weiterentwickelt, Formulierungen erprobt, später in der Nacht beim Wein zu abenteuerlichen Systemen ausgesponnen und schließlich ins Netz gestellt.
Ihr Beispiel macht Schule. Die Vollversammlungen werden aufgegeben. Lockere improvisierte Meetings entstehen. Die exotische Vielfalt der vertretenen Fakultäten und die Suche nach innovativen, nie da gewesenen Ideen gebiert unter dem Druck zur Originalität die skurrilsten Vorschläge. Die Diskussionen in den „blue hours“ entarten zu parodistischen Galavorstellungen elitärer akademischer Verrücktheiten. Doch unter dem Eindruck einer wenngleich zunächst nur gespielten Seriosität weicht die anfänglich bis zur Albernheit ausufernde Heiterkeit einer Form heiliger Frivolität. Aus ungezügelter pubertärer Freude an mutwilligen Kakophonien erwächst der strenge Ernst systematischer Zwölftönigkeit.
5.
Joseph sog die freie Luft der neuen Märchenwelten ein und überließ sich für Stunden der schönen Illusion, endlich angekommen zu sein, wohin er und sie alle immer schon, ohne es zu wissen, hingestrebt hatten.
Dann wieder verscheuchte der trockene Mathematikergeist in ihm die berauschenden Botschaften der schönen neuen Welt, zerriss die absonderlichen Hirngespinste, und er zog sich zurück. – Schuldbewusst, denn er wollte kein Spaßverderber sein. – Ängstlich, denn er fühlte sich seinen Freunden unterlegen. – Traurig, da er sie beneidete. – Zufrieden, da er wieder zu sich selbst zurückfand.
Es war nicht seine Welt, in der sie lebten. Aber er spielte mit, so gut er konnte, behauptete sich erstaunlich gut und vergaß für glückliche Augenblicke, dass es nicht sein Leben war, bis unvermittelt die euphorischen Nebel der Begeisterung sich wieder teilten und die klare Sicht auf die Realität freigaben. Nicht, dass er sich dann absonderte oder schweigsam wurde. Im Gegenteil. Er überspielte es so gut er konnte, brachte seine Freunde mit bitteren formalistischen Scherzchen zum Lachen und produzierte ein Sperrfeuer geistreicher linguistischer Spielereien, hinter deren absurder Inhaltslosigkeit er sich versteckte.
Natürlich durchschauten sie das Spiel. Daniel ließ ihn. Er schätzte Joseph. So wie er war. Anders Magda. Ihre Zuneigung zeigte sich darin, dass sie sich immer wieder bemühte, wenigstens zeitweise den schützenden Wall zu durchbrechen, mit dem er sich umgab. Und bisweilen gelang es ihr.
Nicht morgens. Da ließ sie ihn in Ruhe. Aber mittags, wenn die südliche Sonne hoch stand, sie gemeinsam Kühlung im Meer gesucht hatten und sie zu dritt im Schatten einer Pinie lagerten, war auch Joseph zugänglicher. Und als Daniel schweigsam neben ihnen lag, setzte sie sich zu ihm, schaute ihn liebevoll an und beklagte, dass er sich so verschließe, dass man überhaupt nicht an ihn herankomme. Ob es ihm denn nicht gefiele bei ihnen, ob er sich unwohl fühle. Nicht dass sie sich beklagen wolle, jeder habe ja schließlich seinen eigenen Lebensstil und ein Recht darauf, so zu sein, wie er ist, aber sie würde gern mehr von ihm wissen, ihn besser verstehen können. Ob er nicht einmal etwas von sich selbst erzählen wolle.
Joseph schrak zurück bei dem Gedanken, von sich zu reden. Er wusste, dass er verschlossen und abweisend wirkte, kannte sein Defizit, seine Schüchternheit, die ihm von anderen oft als Arroganz ausgelegt wurde. Dass er nun auch von diesen beiden, immerhin einem Soziologen und einer Psychologin so missverstanden wurde, ärgerte ihn. Er wollte ihnen ja entgegenkommen, hatte nichts zu verbergen, wollte sich öffnen. Aber wie? Wollte auf ihre Bitte eingehen und von sich erzählen. Aber was? Womit beginnen?
Nach Magdas Worten entstand eine Pause. Sie legte sich zurück in den Sand, und betrachtete ihn. Er folgte ihrem Beispiel, legte sich neben sie und sah sie an. Er überlegte. Es fiel ihm schwer, etwas zu finden, was in die Leichtigkeit ihrer neuen Welt passen könnte und gleichzeitig doch etwas von ihm selbst preisgab. Scherzhaft ausweichende Oberflächlichkeit würde alles verderben. Vielleicht endgültig. Noch einmal würde sie ihn nicht so liebevoll um mehr Nähe bitten. Er suchte nach etwas, das zeigte, dass er sich eigentlich nicht vor ihnen verstecken wollte, auch wenn er es fortgesetzt tat. Etwas das deutlich machte, dass er zu ihnen gehören wollte, Vertrauen zu ihnen hatte und bereit war, ihnen etwas preiszugeben, das er nicht jedem offenbaren würde.
Magda beobachtete ihn. Sie ließ ihm Zeit. Daniel hinter ihr lag auf dem Rücken und schaute nach oben, als wollte er die Pinienzapfen an den Zweigen zählen.
Nach einigem Nachdenken entschied er sich. Er erzählte ihnen, dass seine Mutter ihn nach der Geburt nicht hatte säugen können und gestand ihnen, dass er bis heute in die junge Frau verliebt sei, die ihm an ihrer Stelle die Brust gab, um ihn und ihr eigenes Neugeborenes zugleich an ihrem köstlichen Überfluss teilhaben zu lassen. Wirkliche Erinnerung hatte er nicht an seine frühe Wohltäterin, dafür aber die immer wiederkehrende träumerische Vorstellung von seiner engelgleichen Amme und ersten Geliebten, mit der sich alle späteren Frauen hatten messen müssen. Er versuchte, sie zu beschreiben. Und während er darüber sprach, wurde ihm bewusst, dass beim Erzählen dieses Bild des ersten weiblichen Wesens in seinem Leben mehr und mehr die Züge von Magda annahm, die neben ihm lag und ihn anschaute, und er musste sich beherrschen, Gesicht, Gestalt und gar den Busen dieser ihn säugenden Frau nicht so genau zu beschreiben, dass man durchschaute, was gerade in ihm geschah.
Es kam gut an. Magda bedankte sich ganz leise, berührte dabei kurz seine Hand, und kaum merklich schüttelte sie ihren Kopf.
Joseph fühlte, auch bei ihr hatte er nun bestanden - wie seinerzeit bei Daniel.
Am Abend, wie gewöhnlich unter den Platanen in Aix beim Côtes du Rhône, war er besonders froh gestimmt. Am liebsten hätte er jetzt noch mehr Absonderliches von seinem Leben preisgegeben, aber hinter ihm lag ein so behüteter, bürgerlicher Lebenslauf, dass er fürchtete, seine kleinen Abenteuer seien zu langweilig, um sie zu erzählen. Daher verfiel er ins Gegenteil. Berichtete, dass sein Vater bestimmt hatte, dass er an derselben Universität studieren musste, an der seine ältere Schwester war, damit diese ein wenig auf ihn aufpassen könne und dass die Eltern einmal sogar bereits besorgt die Polizei angerufen hatten, als er – bereits stolzer junger Diplommathematiker – bei einem Besuchsaufenthalt zu Hause mit Studienfreunden ausgegangen und um zwei Uhr in der Nacht noch nicht heimgekommen war.
In seiner Bescheidenheit übertrieb er: Alles in seinem Leben sei wohlbehütet vorgezeichnet gewesen. Keine eigene Leistung.
Und ein wenig hatte er auch recht. Als Sohn einer intakten Lehrerfamilie reichten Geld und Begabung – beides nicht im Überfluss, aber doch hinlänglich – für Gymnasium und Studium. Auf Wunsch des Vaters absolvierte er sogar ein Referendariat. Keine Leistung bis dahin, betonte er, vorgezeichnetes Mittelmaß. Erst als Assessor begann es ihm vor der eintönigen Zukunft ‚Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Oberrat’ zu grausen, und er brach aus der muffigen Spießigkeit aus. Spät genug.
Das alles erzählte er, und am Ende fühlte er sich befreit. Es hatte ihn aufgeregt. Aber er bereute es nicht.
Später, in der Stille seiner Zelle, ordnete er die grellen Geschehnisse und Diskussionen des hellen Tages. Am Ende fanden seine Gedanken zurück zu einer Lieblingsidee, die ihn seit Tagen beschäftigte. Einmal schon hatte er sie seinen Freunden angedeutet. Aber sie war in ihren Scherzen ungehört untergegangen. Und da ihm sein Ansatz weder witzig, noch allzu absurd zu sein schien, hatte er - ängstlich, sie damit zu langweilen – gezögert, noch einmal davon anzufangen.
Jetzt traute er sich noch einmal damit hervor. Morgens früh, gleich als erstes Thema nach dem Frühstück, als alle noch wortkarg waren und sie, träge von der langen Nacht, schweigend auf den alten Steinbänken vor dem Kloster saßen und sich das Wetter noch nicht endgültig entschlossen zu haben schien, ob es, wie in den letzten Tagen, vielleicht doch der Sonne wieder den Vorzug vor den feuchtwarmen, nebligen Wolken des Morgens geben solle.
„Ich weiß, meine Vorschläge sind nicht so revolutionär wie eure“, begann er zögernd, kam dann aber unvermittelt und ohne jegliche Vorbereitung gleich zum Kern seines Anliegens, indem er seine erstaunten Zuhörer in lauter und bestimmter Stimme mit einem viel zu komplizierten Satz überrannte.
„Was würdet ihr davon halten, alle Löhne nach dem Wert zu bemessen, den die zu erwartende Restlebensarbeitskraft der betreffenden Person für die Gesellschaft hat und so Entlohnung zur gesellschaftlichen Belohnung zu machen?“
Ungläubiges Erstaunen trat ihm aus den verschlafenen Gesichtern seiner Freunde entgegen, die ihn ansahen, als sei die Stimme eines überdrehten Predigers auf sie niedergegangen, sie aus ihrer wohlverdienten Morgenstarre zu reißen.
„Mein Gott. So etwas als erstes am frühen Morgen! - Klingt nach 68er Ideologie. - Falls das wirklich ernst gemeint war, musst du es mir erst noch einmal wiederholen.“
Da er sich den Satz lange vorher wörtlich zurechtgelegt hatte, kam er Magdas Bitte sofort nach und wiederholte:
„Was würdet ihr davon halten, alle Löhne nach dem Wert zu bemessen, den die zu erwartende Restlebensarbeitskraft der betreffenden Person für die Gesellschaft hat und so Entlohnung zur gesellschaftlichen Belohnung machen?“
„Ach so: Geld kriegt, wer Gutes tut. Und folglich: Gut ist, wer Geld hat. Genial!“
Dann meldete sich Daniel zu Wort.
„Da bastelt nun seit Ewigkeiten ein Heer von Moralphilosophen und Psychologen erfolglos an einer neuen Ethik ohne Gott. Vielleicht hast du sie ja nun so ganz nebenbei in Form eines neuen Entlohnungssystem gefunden.“
Er hatte in einem Tonfall gesprochen, als wollte er sagen „Da hat doch unser blindes Huhn wahrhaftig auch mal ein Korn gefunden!“, aber er wirkte nachdenklich, als er fortfuhr:
„De facto haben wir den Zustand schon fast. In Amerika wurden mir Personen mit Worten vorgestellt wie ‚This is Mr. Peter Brown; Peter is a Two-Millions-Dollar-Man’. Gerade so, als handele es sich um einen bewundernswerten Charakterzug.“
„Na ja, eine verdienstvolle Persönlichkeit war es dann ja in jedem Fall“, schlussfolgerte Joseph in seiner Freude an Wortspielen und gab noch eine seiner überflüssigen Interpretationen dazu:
„Verdienst ist Verdienst. Wer unterscheidet da schon zwischen männlich und sächlich?“
„Mich vergisst er wieder“, bemängelte Magda scherzhaft, „aber Joseph hat recht. Eine schöne Vision: Jeder verdient, was er verdient. Kapitalismusethik. Reich ist, wer gut ist. Gut ist, wer reich ist. Könnte fast von Calvin stammen: Gott ist mit den Reichen.“
„… und mit den stärkeren Bataillonen“, lästerte Joseph.
„Das sowieso“, stimmte ihm Magda zu. „Ist letztlich ja auch dasselbe.“ „Siege werden stets mit Gott errungen“, sagte Daniel in einem Ton, dass die anderen kurz überlegten, ob er am Ende gar gläubig sein könnte, zumal er eine kleine Pause einlegte, und erst seine Worte wirken ließ, bevor er ihre Bedeutung geradezu ins Gegenteil verkehrte: „Logisch, einen Allmächtigen kann man nicht besiegen. Es sei denn, der hat keine Lust, sich dauernd um alles zu kümmern. Hätte ich auch nicht.“
„Deshalb soll man ihn ja auch durch Gebete an seine Aufgaben erinnern“, spottete Magda weiter.
„Nur Pech, wenn er seine Hausaufgaben schon längst im Voraus erledigt hat.“ Gab Daniel zu bedenken.
„Du meinst, er hat schon alles festgelegt und schaut nur noch zu?“ überlegt Magda, „Das muss aber ganz schön langweilig sein. Wie wenn man seine elektrische Eisenbahn fertig aufgebaut und programmiert hat und sie dann stur ihre Kreise herumfahren lässt und nur eingreift, wenn sie droht zu entgleisen, weil irgendwo eine Weiche falsch…“
„Fehlanzeige. Gott irrt sich nicht!“, fällt ihr Daniel ins Wort.
„Ist ja wahr. Wenn sogar der Papst schon unfehlbar ist, dann Gott ja wohl erst recht“, stimmte sie lachend zu.