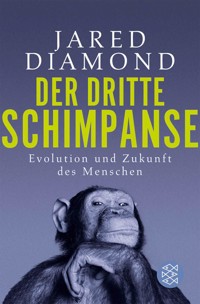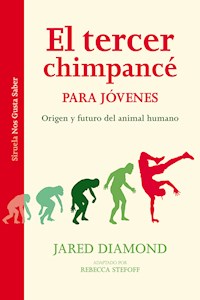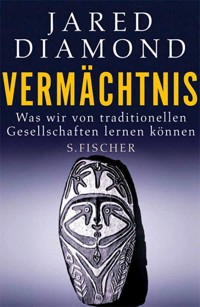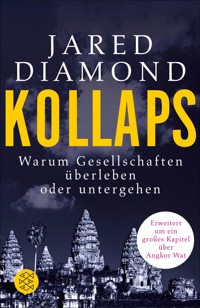
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Weltbestseller als erweiterte Neuausgabe! Die überwucherten Tempelruinen von Angkor Wat, die zerfallenden Pyramiden der Maya in Yucatan und die rätselhaften Moai-Statuen der Osterinsel – sie alle sind stille Zeugen von einstmals blühenden Kulturen, die irgendwann verschwanden. Doch was waren die Ursachen dafür? Jared Diamond zeichnet in seiner erweiterten, faszinierenden wie hochaktuellen Studie die Muster nach, die dem Untergang von Gesellschaften (oder ihrem Überleben) zugrunde liegen, und zeigt, was wir für unsere Zukunft daraus lernen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1209
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jared Diamond
Kollaps
Warum Gesellschaften überleben oder untergehen
Über dieses Buch
Der Weltbestseller als erweiterte Neuausgabe!
Die überwucherten Tempelruinen von Angkor Wat, die zerfallenden Pyramiden der Maya in Yucatan und die rätselhaften Moai–Statuen der Osterinsel – sie alle sind stille Zeugen von einstmals blühenden Kulturen, die irgendwann verschwanden. Doch was waren die Ursachen dafür? Jared Diamond zeichnet in seiner erweiterten, faszinierenden wie hochaktuellen Studie die Muster nach, die dem Untergang von Gesellschaften (oder ihrem Überleben) zugrunde liegen, und zeigt, was wir für unsere Zukunft daraus lernen können.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jared Diamond, 1937 in Boston geboren, ist Professor für Physiologie an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Sein Hauptforschungsgebiet ist die Evolutionsbiologie. In den letzten 25 Jahren hat er rund ein Dutzend Expeditionen in entlegene Gebiete von Neuguinea geleitet. Für seine Arbeit auf den Gebieten der Anthropologie und Genetik ist er mehrfach ausgezeichnet worden, u.a. mit dem Pulitzer-Preis. Nach ›Der dritte Schimpanse. Evolution und Zukunft des Menschen‹ und ›Arm und Reich‹ hat er zuletzt bei S. Fischer den Bestseller ›Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen‹ veröffentlicht.
Impressum
Erweiterte Neuausgabe
Erschienen bei FISCHER E –Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel: ›Collapse. How Societies Choose to Fail or Suceed‹ im Verlag Viking Penguin Group, New York
© 2005 Jared Diamond
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2005
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Stuart Westmorland/Corbis
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403400-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog Eine Geschichte von zwei Bauernhöfen
Teil Eins Montana heute
Kapitel 1 Unter dem großen Himmel von Montana
Teil Zwei Gesellschaften früherer Zeiten
Kapitel 2 Schatten über der Osterinsel
Kapitel 3 Die letzten lebenden Menschen: Pitcairn und Henderson
Kapitel 4 Altvordere: Die Anasazi und ihre Nachbarn
Kapitel 5 Zusammenbrüche bei den Maya
Kapitel 6 Die Wikinger: Präludium und Fugen
Kapitel 7 Die Blütezeit von Normannisch-Grönland
Kapitel 8 Das Ende von Normannisch-Grönland
Kapitel 9 Auf entgegengesetzten Wegen zum Erfolg
Teil Drei Gesellschaften von heute
Kapitel 10 Malthus in Afrika: Der Völkermord von Ruanda
Kapitel 11 Eine Insel, zwei Völker, zwei Historien: Die Dominikanische Republik und Haiti
Kapitel 12 China: Der torkelnde Riese
Kapitel 13 »Abbau« in Australien
Teil Vier Praktische Lehren
Kapitel 14 Warum treffen manche Gesellschaften katastrophale Entscheidungen?
Kapitel 15 Großkonzerne und Umwelt: Unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Folgen
Kapitel 16 Die Welt als Polder: Was bedeutet das alles für uns?
Nachtrag Angkors Aufstieg und Fall
Danksagung
Weiterführende Literatur
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6–8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Tafelteil
Bildnachweis
Für
Jack und Ann Hirschy,
Jill Hirschy Eliel und John Eliel,
Joyce Hirschy McDowell,
Dick (1929–2003) und Margy Hirschy,
und alle Menschen unter dem Himmel Montanas.
Ein Mann berichtete aus mythischem Land:
Zwei Riesenbeine, rumpflos, steingehauen
Stehn in der Wüste. Nahebei im Sand
Zertrümmert, halbversunken, liegt mit rauen
Lippen voll Hohn ein Antlitz machtgewöhnt,
Voll Leidenschaften, die bestehn; es sagt:
Der Bildner, der es prägte, wusste dies,
Wess Herz und Hand sie speiste und verhöhnt.
Und auf dem Sockel eingemeißelt lies:
»Ich bin Ozymandias, Herr der Herrn.
Schaut, was ich schuf, ihr Mächtigen, und verzagt!«
Nichts bleibt. Um den Verfall her riesengroß
Des mächtigen Steinwracks öd und grenzenlos
Dehnt sich die leere Wüste nah und fern.
Percy Bysshe Shelley (1817)
Teil EinsMontana heute
Kapitel 1Unter dem großen Himmel von Montana
Die Geschichte von Stan Falkow • Montana und ich • Warum zum Anfang ausgerechnet Montana? • Die Wirtschaftsgeschichte von Montana • Bergbau • Forstwirtschaft • Boden • Wasser • Einheimische und eingeschleppte Arten • Verschiedene Visionen • Einstellungen gegenüber Vorschriften • Die Geschichte von Rick Laible • Die Geschichte von Chip Pigman • Die Geschichte von Tim Huls • Die Geschichte von John Cook • Montana, eine Welt im Kleinformat
Mein Freund Stan Falkow ist 70 Jahre alt und Professor für Mikrobiologie an der Stanford University nicht weit von San Francisco. Als ich ihn fragte, warum er sich im Bitterroot Valley in Montana ein Ferienhaus gekauft hätte, erzählte er mir, wieso diese Entscheidung zu seiner gesamten Lebensgeschichte passte: