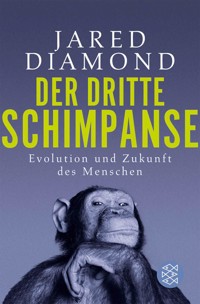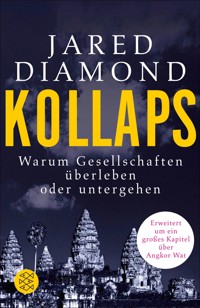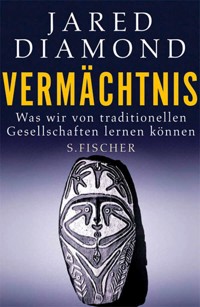12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach den Bestsellern »Arm und Reich« und »Kollaps« zeigt der Pulitzer-Preisträger Jared Diamond in seinem neuen und bisher persönlichsten Buch, wie Nationen mit den gegenwärtigen Krisen – Klimawandel, soziale Ungleichheit, gesellschaftliche Polarisierung – erfolgreich umgehen können. Sie müssen Krisen bewältigen wie Menschen persönliche Schicklsalsschläge! Anhand der deutschen Nachkriegsgeschichte, Chiles Umgang mit der Diktatur Pinochets, Japans erzwungener ökonomischer Öffnung 1853 und weiterer historischer Beispiele zeichnet Diamond die Muster nach, wie sich Staaten von tiefgreifenden Erschütterungen erholen. Dabei wird deutlich: Bei der Bewältigung von Krisen sind ähnliche Faktoren entscheidend wie beim Umgang mit individuellen Traumatisierungen: sich eingestehen, dass man in einer Krise steckt; eine ehrliche Bestandsanalyse betreiben, statt sich als Opfer zu stilisieren; die Probleme eingrenzen; Hilfe annehmen und bereit sein, aus Krisen anderer zu lernen. Letztlich gilt es, sich zu verändern, ohne alles infrage zu stellen. Ein Buch zur rechten Zeit, das erklärt, wie Nationen an Krisen wachsen und Hoffnung für die Zukunft macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jared Diamond
Krise
Wie Nationen sich erneuern können
Über dieses Buch
Staaten müssen Krisen bewältigen wie Menschen persönliche Schicksalsschläge! Der Bestsellerautor und Pulitzer-Preisträger Jared Diamond zeigt in seinem neuen Buch, wie Nationen mit den gegenwärtigen Krisen erfolgreich umgehen können. Anhand der deutschen Nachkriegsgeschichte und weiterer historischer Beispiele zeichnet Diamond die Muster nach, wie sich Staaten von tiefgreifenden Erschütterungen erfolgreich erholen. Dabei wird deutlich: Bei der Bewältigung von Krisen sind ähnliche Faktoren entscheidend wie beim Umgang mit individuellen Traumatisierungen. Es gilt, sich zu verändern, ohne alles infrage zu stellen. Ein Buch zur rechten Zeit, das erklärt, wie Nationen an Krisen wachsen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jared Diamond, 1937 in Boston geboren, ist Pulitzer-Preisträger und Autor des Bestsellers »Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen«. Er ist Professor für Geographie an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Sein Hauptforschungsgebiet ist die Evolutionsbiologie. Für seine Arbeit auf dem Feld der Anthropologie und Genetik ist Jared Diamond vielfach ausgezeichnet worden. Nach »Der dritte Schimpanse«, »Arm und Reich«, hat er zuletzt in den S. Fischer Verlagen »Vermächtnis« veröffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Upheaval. Turning Points for Nations in Crisis« im Verlag Little, Brown and Company, New York
© 2019 by Jared Diamond
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS Visuelle Kommunikation
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400669-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog Eine Brandkatastrophe und ihre Folgen
Teil I Individuen
Kapitel 1 Persönliche Krisen
Teil II Nationen: Krisen der Vergangenheit
Kapitel 2 Finnland und der Krieg mit der Sowjetunion
Kapitel 3 Die Ursprünge des modernen Japan
Kapitel 4 Ein Chile für alle Chilenen
Kapitel 5 Indonesien: der Aufstieg eines neuen Staates
Kapitel 6 Der Wiederaufbau Deutschlands
Kapitel 7 Australien: Wer sind wir?
Teil III Nationen und die Welt: Krisen heute
Kapitel 8 Wie geht es in Japan weiter?
Kapitel 9 Wie geht es mit den Vereinigten Staaten weiter? Die Stärken und ein großes Problem
Kapitel 10 Wie geht es mit den Vereinigten Staaten weiter? Drei »andere« Probleme
Kapitel 11 Wie geht es weiter mit der Welt?
Epilog Lehren, Fragen, Ausblick
Dank
Bildteil
Bildnachweis
Weiterführende Literatur
Kapitel 1: Persönliche Krisen
Kapitel 2: Finnlands Krieg mit der Sowjetunion
Kapitel 3: Die Ursprünge des modernen Japan
Kapitel 4: Ein Chile für alle Chilenen
Kapitel 5: Indonesien: der Aufstieg eines neuen Staates
Kapitel 6: Der Wiederaufbau Deutschlands
Kapitel 7: Australien: Wer sind wir?
Kapitel 8: Wie geht es in Japan weiter?
Kapitel 9 und 10: Wie geht es mit den Vereinigten Staaten weiter?
Kapitel 11: Wie geht es weiter mit der Welt?
Epilog: Lehren, Fragen und Ausblick
Register
Ich widme dieses Buch
dem Andenken meiner Eltern Louis und Flora Diamond und der Zukunft meiner Frau Marie Cohen und
meiner Söhne Max und Joshua Diamond
PrologEine Brandkatastrophe und ihre Folgen
Zwei Geschichten ■ Was ist eine Krise? ■ Persönliche und staatliche Krisen ■ Was dieses Buch will und was nicht ■ Der Aufbau dieses Buches
Fast jeder von uns erlebt im Laufe seines Lebens persönliche Umbrüche oder Krisen, die wir durch die Veränderung unseres eigenen Verhaltens meistern oder nicht. In ähnlicher Weise erleben auch Staaten nationale Krisen, die durch Veränderungen auf nationaler Ebene erfolgreich bewältigt werden oder nicht. Zum Thema »Bewältigung persönlicher Krisen« ist reichlich Forschungs- und anekdotisches Material vorhanden, erarbeitet und zusammengetragen von Therapeuten. Könnten ihre Erkenntnisse uns dabei helfen, die Bewältigung von Staatskrisen zu verstehen?
Lassen Sie mich anhand von zwei Geschichten, die ich selbst erlebt habe, beispielhaft zeigen, was ich mit persönlichen und nationalen Krisen meine. Man sagt, die ersten datierbaren sicheren Erinnerungen eines Kindes würden im Alter von etwa vier Jahren angelegt, wobei sich Kinder jedoch auch an einzelne frühere Ereignisse erinnern könnten. Diese allgemeine Aussage trifft auf mich zu, denn das früheste Ereignis, das ich zeitlich festmachen kann, ist der Brand im Bostoner Cocoanut Grove, der kurz nach meinem fünften Geburtstag stattfand. Obwohl ich (glücklicherweise) nicht vor Ort war, habe ich es durch die schrecklichen Berichte meines Vaters, der Arzt war, sozusagen aus zweiter Hand erlebt.
Das Feuer brach am 28. November 1942 in einem überfüllten Bostoner Nachtclub namens Cocoanut Grove (so die Schreibung, die der Besitzer gewählt hatte) aus und breitete sich rasch aus, aber der einzige Ausgang war in kürzester Zeit blockiert. Insgesamt kamen 492 Menschen zu Tode, Hunderte wurden verletzt, sie erstickten, wurden niedergetrampelt, erlitten Rauchvergiftungen oder Verbrennungen (Tafel 0.1). Ärzte und Krankenhäuser waren überfordert – nicht nur mit den direkten Feueropfern, den Verletzten und den Sterbenden, sondern auch mit den indirekten, den psychischen Opfern des Feuers: Angehörige, die daran verzweifelten, dass ihre Ehemänner, ihre Ehefrauen, ihre Kinder oder Geschwister auf so schreckliche Art ums Leben gekommen waren, aber auch Überlebende, die traumatisiert waren von Schuldgefühlen, weil sie überlebt hatten, während Hunderte anderer Gäste zu Tode gekommen waren. Bis 22.15 Uhr war ihr Leben in Ordnung gewesen, man feierte Thanksgiving, ein Footballmatch und die Soldaten auf Heimaturlaub. Um 23.00 Uhr waren die meisten Todesopfer bereits gestorben, und ihre Angehörigen und die Überlebenden stürzten in eine Krise. Ihre gesamte Lebensplanung war über den Haufen geworfen. Sie schämten sich, dass sie lebten, während jemand, den sie geliebt hatten, sterben musste. Die Angehörigen hatten jemanden verloren, der für ihre Identität von zentraler Bedeutung war. Nicht nur für die Überlebenden des Feuers, auch für die Bostoner, die weit weg vom Feuer wohnten (so wie ich als Fünfjähriger) erschütterte die Katastrophe den Glauben an eine gerechte Welt. Die so Gestraften waren keine unartigen Jungs oder üble Verbrecher gewesen: Es waren ganz normale Leute, die ohne eigene Schuld umgekommen waren.
Einige der Überlebenden und der Angehörigen blieben für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Manche begingen Selbstmord. Doch bei den meisten setzte nach mehreren Wochen tiefsten Schmerzes, in denen sie nicht in der Lage waren, ihren Verlust anzunehmen, ein langsamer Prozess ein, in dessen Verlauf sie trauern, ihre Stärken wiederfinden, ihr Leben neu aufbauen und entdecken konnten, dass ihre Welt nicht komplett zerstört war. Viele, die ihren Ehepartner verloren hatten, heirateten wieder. Doch selbst in den besten Fällen wiesen sie Jahrzehnte später eine zusammengesetzte, eine »Mosaik«-Identität auf, bestehend aus der, die nach der Brandkatastrophe entstanden war, und der, die sie davor besessen hatten. Wir werden die Mosaik-Metapher in diesem Buch noch öfter auf Individuen und Staaten anwenden, in denen verschiedene Elemente unharmonisch koexistieren.
Der Brand im Cocoanut Grove stellt ein extremes Beispiel für eine persönliche Krise dar. Aber es ist nur in dem Sinn extrem, weil das Unglück eine große Zahl von Opfern auf einmal traf – die Opferzahl war sogar so groß, dass der Brand zudem eine Krise heraufbeschwor, die neue Herangehensweisen in der Psychotherapie erforderte, wie wir in Kapitel 1 sehen werden. Viele von uns erleben solche individuellen Tragödien aus erster Hand im eigenen Leben oder aus zweiter Hand durch das, was ein Verwandter oder ein Freund erlebt. Und doch sind solche Tragödien, die nur einem einzigen Opfer widerfahren, für dieses Opfer und seinen Freundeskreis ebenso schmerzlich, wie es der Brand im Cocoanut Grove für die Freundeskreise der 429 Opfer war.
Hier nun, zum Vergleich, ein Beispiel für eine nationale Krise. Während der späten 1950er und der frühen 1960er Jahre lebte ich in Großbritannien, das zu dieser Zeit eine schleichende Staatskrise durchlief, obwohl weder meine britischen Freunde noch ich das damals richtig wahrhaben wollten. Großbritannien war seinerzeit führend in der Wissenschaft, mit einer reichen kulturellen Geschichte gesegnet, stolz und einzigartig britisch und sonnte sich noch im Gedenken an die weltgrößte Flotte, den weltgrößten Wohlstand und das flächenmäßig größte Imperium der Weltgeschichte. Nur blutete Großbritannien in den 50ern wirtschaftlich leider aus, es verlor sein Empire und seine Macht, war sich uneins, welche Rolle es in Europa spielen wollte, und hatte mit alten Klassenunterschieden und neuen Einwandererwellen zu kämpfen. Zwischen 1956 und 1961 spitzten sich die Dinge zu, als Großbritannien seine verbliebenen Schlachtschiffe verschrottete, seine ersten Rassenunruhen erlebte, seine afrikanischen Kolonien nach und nach in die Unabhängigkeit entlassen und außerdem zusehen musste, wie die Suezkrise schmählich offenbarte, dass es die Fähigkeit verloren hatte, unabhängig als Weltmacht zu agieren. Meine britischen Freunde bemühten sich, all diese Geschehnisse zu verstehen und sie mir, ihrem amerikanischen Gast, zu erklären. Diese Tiefschläge verstärkten die Diskussionen über die Identität und die Rolle Großbritanniens zwischen der Bevölkerung und den Politikern.
Heute, sechzig Jahre später, ist Großbritannien ein Mosaik aus seinem neuen und seinem alten Selbst. Es hat das Empire abgeschüttelt und sich zu einer multiethnischen Gesellschaft entwickelt, es ist ein Wohlfahrtsstaat geworden und betreibt staatliche Schulen von hoher Qualität, um die Klassenunterschiede zu verringern. Seine beherrschende Rolle als See- und als Handelsmacht hat Großbritannien nicht wiedererlangt, und mit seiner Rolle in Europa hadert es noch immer (Stichwort »Brexit«). Aber Großbritannien gehört noch immer zu den sechs reichsten Nationen der Welt, es hat immer noch eine parlamentarische Demokratie mit einer Königin als Galionsfigur, es ist immer noch führend in Wissenschaft und Technik, und es hat immer noch sein Pfund Sterling als Währung und nicht den Euro.
Diese beiden Geschichten illustrieren, worum es in diesem Buch geht. Krisen und der Druck zur Veränderung betreffen Individuen und Gruppen auf allen Ebenen, von der Einzelperson über Teams und Wirtschaftszweige bis hin zu Staaten und der Welt als Ganzem. Krisen können durch Druck von außen ausgelöst werden, etwa wenn ein Mensch seinen Partner verliert, sei es durch Trennung oder durch Tod, oder wenn eine Nation von einer anderen angegriffen wird. Alternativ können Krisen auch durch inneren Druck ausgelöst werden, etwa wenn ein Mensch erkrankt oder eine Nation von Unruhen erschüttert wird. Der erfolgreiche Umgang mit innerem oder äußerem Druck erfordert selektive Veränderungen. Das gilt für Staaten wie Individuen gleichermaßen.
Das Schlüsselwort heißt »selektiv«. Es ist weder möglich noch erstrebenswert, dass sich Individuen oder Nationen völlig verändern und alles aufgeben, was mit ihrer früheren Identität zu tun hat. Die Herausforderung für Individuen oder Staaten in der Krise ist herauszufinden, welche Teile der jeweiligen Identität gut funktionieren und beibehalten werden können und welche nicht mehr ordentlich funktionieren und deshalb verändert werden sollten. Individuen und Nationen, die unter Druck stehen, müssen eine ehrliche Bestandsaufnahme ihrer Fähigkeiten und Werte vornehmen. Sie müssen entscheiden, was bei ihnen funktioniert, was vielleicht sogar unter den neuen Bedingungen angemessen ist und daher beibehalten werden kann. Umgekehrt brauchen sie den Mut zu erkennen, was sich ändern muss, um mit der neuen Situation umzugehen. Dafür ist es erforderlich, dass Individuen oder Staaten neue Lösungen finden, die mit ihren Fähigkeiten und dem Rest ihres (Staats-)Wesens vereinbar sind. Gleichzeitig müssen sie eine Haltelinie einziehen und die Elemente benennen, die für ihre Identität so wichtig sind, dass sie sie auf keinen Fall ändern wollen.
Das waren einige der Paralleln, die man mit Blick auf Krisen zwischen Individuen und Staaten ziehen kann. Es gibt allerdings auch unübersehbare Unterschiede, die man berücksichtigen muss.
Wie definieren wir »Krise«? Ein naheliegender Ausgangspunkt ist die Herleitung des Wortes aus dem griechischen Substantiv »krisis« und dem Verb »krino«, die verschiedene, aber miteinander zusammenhängende Bedeutungen haben: »trennen«, »entscheiden«, »einen Unterschied machen« und »Wendepunkt«. Das heißt, man kann sich die Krise als eine Art Stunde der Wahrheit vorstellen: Ein Wendepunkt, an dem sich die Bedingungen vor und nach diesem »Moment« »viel mehr« voneinander unterscheiden als vor und nach den »meisten« anderen Momenten. Ich setze die Wörter »Moment«, »viel mehr« und »meisten« in Anführungszeichen, weil es ein praktisches Problem darstellt festzulegen, wie kurz der Moment, wie groß die Unterschiede der geänderten Bedingungen und wie viel seltener als die meisten anderen Momente ein Wendepunkt sein sollte, um ihn als »Krise« bezeichnen zu können und nicht als irgendein kleines, aber auffälliges Ereignis oder eine ganz normale, allmählich eintretende Veränderung.
Der Wendepunkt stellt eine Herausforderung dar. Es entsteht der Druck, neue Methoden zur Lösung des Problems zu finden, wenn sich frühere Methoden als ungeeignet für diese Herausforderung erwiesen haben. Wenn es einer Person oder einer Nation gelingt, bessere Methoden zur Lösung des Problems zu finden, dann sagen wir, die Krise wurde erfolgreich gemeistert. In Kapitel 1 werden wir sehen, dass der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg beim Lösen eines Problems nicht immer ganz klar ist – vielleicht ist es nur ein Teilerfolg, oder der Erfolg hält nicht an, und das Problem kehrt zurück. (Denken Sie nur an das Vereinigte Königreich, das seine Rolle in der Welt »klärte«, indem es 1973 der Europäischen Union beitrat, und 2017 dafür stimmte, die Europäische Union wieder zu verlassen.)
Beschäftigen wir uns jetzt mit dem praktischen Problem: Wie kurz, wie groß und wie selten muss ein Wendepunkt sein, damit er die Bezeichnung »Krise« verdient? Wie oft im Leben eines Individuums oder in tausend Jahren regionaler Geschichte kann man das Etikett »Krise« sinnvollerweise anwenden? Auf diese Fragen gibt es unterschiedliche Antworten, Antworten, die für unterschiedliche Zwecke taugen.
Eine extreme Antwort beschränkt das Wort »Krise« auf sehr seltene und dramatische Umbrüche in sehr großen Zeitabständen: zum Beispiel einige wenige Male während der Lebenszeit eines Individuums und alle paar hundert Jahre bei einem Staat. Ein Fachmann für römische Geschichte könnte das Wort »Krise« beispielsweise auf gerade einmal drei Ereignisse anwenden, die nach der Gründung der römischen Republik (um 509 v. Chr.) stattfanden: die ersten beiden Punischen Kriege (264–241 und 218–201 v. Chr.), das Ersetzen der republikanischen Regierungsform durch das Kaisertum (um 23 v. Chr.) und der Einfall der Barbaren, der zum Untergang des Weströmischen Reiches führte (um 476 n. Chr.). Natürlich wäre das, was sich sonst noch zwischen 509 v. Chr. und 476 n. Chr. in der römischen Geschichte zugetragen hat, für diesen Historiker nicht trivial; aber er würde nur die drei genannten außergewöhnlichen Ereignisse als »Krisen« bezeichnen.
Das umgekehrte Extrem finden wir in einer Veröffentlichung meines UCLA-Kollegen David Rigby und seiner Koautoren Pierre-Alexandre Balland und Ron Boschma, in der sie eine ausgezeichnete Studie über »technologische Krisen« in amerikanischen Städten vorstellen. Krisen definierten sie für ihren Zweck als Zeiträume, in denen die Patentanmeldungen kontinuierlich zurückgingen, wobei das Wort »kontinuierlich« mathematisch definiert war. Mit diesen Definitionen als Grundlage stellten sie fest, dass sich eine amerikanische Stadt im Schnitt etwa alle zwölf Jahre in einer technologischen Krise befindet und dass diese Krise durchschnittlich vier Jahre anhält. Diese Definition war aufschlussreich für das Verständnis einer Frage von hohem praktischen Interesse: Was versetzt andere amerikanische Städte in die Lage, technologische Krisen dieser Art zu vermeiden? Unser Beispielhistoriker würde all die Ereignisse, die David und seine Kollegen untersucht haben, als belanglose Bagatellen abtun, während David und seine Kollegen dagegenhalten würden, dass der Historiker bis auf die drei Großereignisse alles unter den Tisch fallen lässt, was sich in 985 Jahren römischer Geschichte zugetragen hat.
Ich bin der Auffassung, dass man »Krise« unterschiedlich definieren kann, nach Unterschieden in der Häufigkeit, in der Dauer oder in der Auswirkung. Sowohl das Studium seltener großer Krisen als auch das häufiger kleiner Krisen kann sinnvoll sein. In diesem Buch betrachte ich Zeiträume von ein paar Jahrzehnten bis zu einem Jahrhundert. Alle Länder, über die ich sprechen werde, haben während meiner eigenen Lebenszeit eine – wie ich meine – »größere Krise« durchlaufen. Niemand bestreitet, dass alle außerdem häufiger kleinere Wendepunkte erlebt haben.
Bei individuellen und bei staatlichen Krisen schauen wir oft auf einen einzigen, entscheidenden Moment: zum Beispiel der Tag, an dem eine Frau ihrem Mann erklärt, dass sie die Scheidung eingereicht hat, oder ein Datum wie der 11. September 1973 (im Fall der chilenischen Geschichte), als das chilenische Militär die demokratisch gewählte Regierung stürzte und der Präsident Selbstmord beging. Manche Krisen treten allerdings auch ohne Vorwarnung aus heiterem Himmel ein, wie etwa der Tsunami, der am 26. Dezember 2006 vor Sumatra entstand und dem in kürzester Zeit 200000 Menschen zum Opfer fielen, oder der Tod meines Cousins, der in der Blüte seines Lebens starb, als sein Auto auf einem Bahnübergang von einem Zug zermalmt wurde, und der eine Frau und vier Kinder hinterließ. Doch die meisten individuellen und staatlichen Krisen sind die Gipfelpunkte einer längeren Entwicklung, die sich über Jahre hingezogen hat: beispielsweise die Eheprobleme des Paares, das sich nun scheiden lässt, oder die politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Chile. Die »Krise« ist der Moment, in dem jemand den Druck, der sich über lange Zeit aufgebaut hat, plötzlich als solchen erkennt oder plötzlich darauf reagiert. Dass diese Beschreibung zutrifft, bestätigte Australiens Premierminister Gough Whitlam nachdrücklich: Wie wir in Kapitel 7 sehen werden, stampfte er im Dezember 1972 innerhalb von 19 Tagen ein umfangreiches Reformprogramm aus dem Boden, spielte es aber als »Anerkenntnis dessen, was bereits geschehen ist« herunter.
Nationen sind keine Individuen im Großformat: Sie unterscheiden sich ganz offensichtlich in vielem von Individuen. Warum ist es nichtsdestoweniger erhellend, nationale Krisen durch die Brille individueller Krisen zu betrachten? Welche Vorteile bringt diese Herangehensweise?
Ein Vorteil, der mir oft begegnet, wenn ich mit Freunden und Studenten über Staatskrisen diskutiere, ist der, dass persönliche Krisen für Nichthistoriker leichter zu verstehen sind, auch weil die meisten so etwas selbst schon einmal erlebt haben. Die Perspektive der individuellen Krise erleichtert es daher dem normalen Leser, den Vergleich zu einer nationalen Krise herzustellen und deren Komplexität zu durchschauen.
Ein anderer Vorteil ist, dass wir durch die Erforschung individueller Krisen inzwischen ein Dutzend Faktoren kennen, die uns erklären, weshalb Krisen unterschiedlich ausgehen. Diese Faktoren stellen einen guten Ausgangspunkt dar, um eine entsprechende Liste von solchen Faktoren zu erarbeiten, die uns hilft zu verstehen, weshalb nationale Krisen unterschiedlich enden. Wie wir sehen werden, lassen sich manche Faktoren eins zu eins von der individuellen auf die staatliche Krise übertragen. Zum Beispiel erhalten Menschen in einer Krisensituation oft Hilfe von Freunden, und genauso können Staaten in einer Krisensituation Hilfe von verbündeten Nationen anfordern. Menschen in einer Krisensituation orientieren sich bei der Lösung des Problems unter Umständen daran, wie andere mit einer ähnlichen Krise umgegangen sind; auch Staaten in der Krise können Lösungen, die andere Nationen mit ähnlichen Problemen bereits entwickelt haben, aufgreifen und für sich adaptieren. Bereits früher überstandene Krisen können sowohl Individuen als auch Staaten das Selbstvertrauen geben, die aktuelle Krise zu meistern.
So weit die augenfälligen Parallelen. Wir werden aber auch sehen, dass einige Faktoren, die uns etwas über den Ausgang persönlicher Krisen verraten, wenngleich sie sich nicht direkt auf staatliche Krisen übertragen lassen, trotzdem als nützliche Metaphern dienen und Faktoren ins Gespräch bringen können, die für staatliche Krisen relevant sind. Beispielsweise hat es sich für die Therapie als hilfreich erwiesen, eine persönliche Eigenschaft zu definieren, die als »Ich-Stärke« bezeichnet wird. Staaten haben keine Ich-Stärke in diesem psychologischen Sinne, doch man könnte ein vergleichbares, ähnlich wichtiges Konzept für Staaten vorschlagen, die »nationale Identität«. Im persönlichen Bereich werden Lösungsmöglichkeiten für Krisensituationen oft durch praktische Dinge, wie das Problem der Kinderbetreuung oder berufliche Anforderungen, eingeschränkt. So etwas gibt es auf staatlicher Ebene natürlich nicht. Aber wie wir noch sehen werden, können auch Staaten, wenn auch aus anderen Gründen, wie geopolitischen Zwängen oder den Staatsfinanzen, in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt sein.
Der Vergleich mit persönlichen Krisen hebt auch die Merkmale deutlicher hervor, die nationale Krisen aufweisen können und für die es keine Entsprechungen bei individuellen Krisen gibt. Zu diesen Merkmalen gehört, dass Staaten Herrscher oder Regierungschefs haben, Individuen dagegen nicht. Damit stellt sich bei staatlichen, nicht jedoch bei persönlichen Krisen regelmäßig die Frage nach der Rolle der Führungspersönlichkeit. Unter Historikern wurde und wird noch immer darüber gestritten, ob außergewöhnliche Herrscher oder Anführer wirklich den Lauf der Geschichte verändert haben (»Große Männer machen Geschichte«-Theorie) oder ob die Geschichte mit einer x-beliebigen anderen möglichen Führungsfigur nicht ähnlich verlaufen wäre. (Zum Beispiel: Wäre der Zweite Weltkrieg auch dann ausgebrochen, wenn Hitler 1930 bei dem Autounfall, bei dem er schwer verletzt wurde, tatsächlich gestorben wäre?) Staaten haben politische und ökonomische Einrichtungen, Individuen nicht. Zur Lösung nationaler Krisen gehört immer die Interaktion von Gruppen und das Herbeiführen einer Entscheidung innerhalb der Nation; Individuen können ihre Entscheidungen oft alleine treffen. Staatskrisen können entweder durch gewaltsame Revolution (Beispiel Chile 1973) oder durch friedliche Evolution (Beispiel Australien nach dem Zweiten Weltkrieg) beendet werden; ein einzelnes Individuum macht keine gewaltsame Revolution.
Wegen dieser Ähnlichkeiten, Metaphern und Unterschiede bin ich zu der Auffassung gelangt, dass Vergleiche zwischen staatlichen und persönlichen Krisen sinnvoll sind, um meinen Studenten an der UCLA (University of California, Los Angeles) das Verständnis von Staatskrisen zu erleichtern.
Leser und Rezensenten eines Buches merken oft erst während des Lesens, dass das Buch nicht die Themen behandelt oder nicht so an sie herangeht, wie sie es erwartet oder sich gewünscht hatten. Worum geht es in diesem Buch, und wie nähern wir uns diesen Themen? Was habe ich weggelassen?
Dieses Buch untersucht vergleichend, erzählend, forschend Krisen und selektive Veränderungen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten und in sieben modernen Nationen, die ich alle aus persönlicher Anschauung kenne und die ich unter dem Aspekt selektiver Veränderungen in persönlichen Krisen betrachte. Die Länder sind Finnland, Japan, Chile, Indonesien, Deutschland, Australien und die Vereinigten Staaten von Amerika.
Lassen Sie mich erklären, was das im Einzelnen bedeutet.
Die vergleichende Herangehensweise. Dieses Buch widmet sich nicht einer Nation allein. Stattdessen verteilt es seine Aufmerksamkeit auf sieben Nationen, so dass diese miteinander verglichen werden können. Sachbuchautoren müssen sich entscheiden, ob sie einzelne Fallbeispiele vorstellen oder viele Fälle miteinander vergleichen wollen. Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile. Bei einer vorgegebenen Textlänge kann man im Einzelfall sehr viel mehr ins Detail gehen, aber Vergleiche eröffnen Perspektiven und decken Dinge auf, die sich aus einer Einzelfallstudie nicht ergeben hätten.
Historische Vergleiche zwingen dazu, Fragen zu stellen, die sich aus einer Einzelfallstudie wohl kaum ergeben hätten: Warum hat ein bestimmter Ereignistyp in einem Land zum Ergebnis R1 geführt, in einem anderen aber zum ganz anderen Ergebnis R2? Zum Beispiel können Bücher, die die Geschichte des Amerikanischen Bürgerkriegs in einem Band abhandeln, auf sechs Seiten den zweiten Tag der Schlacht bei Gettysburg beschreiben, aber sie können nicht ergründen, warum die Sieger des Amerikanischen Bürgerkriegs, anders als die Sieger des Spanischen oder des Finnischen Bürgerkriegs, das Leben der Unterlegenen verschonten. Autoren von Einzelfallstudien beklagen vergleichende Studien oft als zu stark vereinfachend und oberflächlich, Autoren vergleichender Studien dagegen bemängeln an Einzelfallstudien ebenso oft, dass sie nicht in der Lage seien, weitgefasste Fragen zu beantworten. Diese Auffassung wird oft in folgendem Bonmot zusammengefasst: »Wer nur ein Land untersucht, wird am Ende kein Land verstehen.« Dieses Buch ist vergleichend angelegt, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.
Nachdem die Seiten dieses Buches unter sieben Nationen aufgeteilt sind, achte ich peinlich genau darauf, dass mein Bericht über jede einzelne kurz und prägnant ist. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und mich umwende, sehe ich hinter mir auf dem Boden meines Arbeitszimmers ein Dutzend bis 1,50 Meter hohe Stapel aus Büchern und Artikeln, jeder davon enthält das Material für ein Kapitel. Es war eine geistige Herkulesaufgabe, die 1,50 Meter Material über das Nachkriegsdeutschland auf ein Kapitel mit 11000 Wörtern zu komprimieren. Ich musste so vieles weglassen! Aber die Kürze hat auch ihr Gutes: Sie hilft Lesern, wichtige Themenbereiche zwischen Nachkriegsdeutschland und anderen Nationen zu vergleichen, ohne sich in faszinierenden Details, Ausnahmen, Wenns und Abers zu verlieren oder davon erschlagen zu werden. Leser, die tiefer in die Thematik eindringen wollen, finden am Ende des Buches eine Liste mit Büchern und Artikeln zu Einzelfallstudien.
Die erzählende (narrative) Darstellungsweise: Das ist der traditionelle Stil der Historiker; er geht zurück bis auf die Anfänge der Geschichtsschreibung, die vor mehr als 2400 Jahren von den griechischen Autoren Herodot und Thukydides entwickelt wurde. »Erzählender Stil« heißt, dass die Argumente und Überlegungen in Prosa vorgetragen werden, nicht in Gleichungen, Tabellen, Graphen oder statistischen Signifikanztests, und dass es sich um eine kleine Zahl von untersuchten Fällen handelt. Dieser Stil steht in starkem Kontrast zum machtvollen neuen quantitativen Ansatz in der modernen sozialwissenschaftlichen Forschung, die von Gleichungen, testbaren Hypothesen, Tabellen, Graphen und großen Stichprobengrößen (das heißt vielen untersuchten Fällen), die statistische Signifikanztests erlauben, ausgiebig Gebrauch macht.
Ich habe die Aussagekraft der modernen quantitativen Methoden schätzen gelernt. Und ich habe mich ihrer in einer statistischen Untersuchung zur Entwaldung von 73 polynesischen Inseln bedient,[1] um zu Schlüssen zu kommen, die aus einem erzählenden Bericht über die Entwaldung von ein paar Inseln nie überzeugend hätten abgeleitet werden können. Außerdem war ich Mitherausgeber eines Buches,[2] in dem einige meiner Koautoren quantitative Methoden in genialer Weise anwandten, um Fragen zu beantworten, die schon seit langem ergebnislos von erzählend arbeiteten Historikern diskutiert worden waren. Zum Beispiel ob Napoleons militärische Eroberungen und die davon aufgelösten politischen Brüche für die anschließende wirtschaftliche Entwicklung in Europa gut oder schlecht waren.
Anfangs hatte ich noch gehofft, moderne quantitative Methoden in dieses Buch integrieren zu können. Ich verbrachte Monate damit, das zu versuchen, bis ich schließlich einsah, dass dies eine Aufgabe für ein eigenes, späteres Projekt wäre. Aus diesem Grund musste dieses Buch stattdessen mit Hilfe einer narrativen Untersuchung Hypothesen und Variablen identifizieren, die später in einer quantitativen Studie getestet werden können. Meine Stichprobengröße von gerade einmal sieben Nationen ist zu klein, um statistisch signifikante Schlüsse zu ziehen. Es wird noch viel Arbeit sein, meine narrativen qualitativen Konzepte wie »erfolgreiche Krisenbewältigung« und »ehrliche Selbsteinschätzung« zu »operationalisieren«, das heißt, solche sprachlichen Konzepte in etwas zu übersetzen, das mit Zahlen gemessen werden kann. Aus diesem Grund stellt dieses Buch eine narrative Erforschung dar, die – wie ich hoffe – quantitative Tests anregen wird.
Von den weltweit über 210 Staaten beschäftigt sich dieses Buch lediglich mit sieben, die ich recht gut kenne. Alle sieben habe ich mehrfach besucht. In sechs davon habe ich längere Zeit gelebt, zum Teil schon vor siebzig Jahren, und ich spreche ihre Sprache oder habe sie früher gesprochen. Ich schätze und bewundere alle diese Nationen und freue mich jedes Mal, wenn ich sie wieder besuchen kann. Alle sieben habe ich in den vergangenen zwei Jahren bereist, und von zweien könnte ich mir vorstellen, mich dauerhaft dort niederzulassen. Das heißt, ich kann mit Sympathie und Wissen über sie schreiben, aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen und derjenigen meiner langjährigen Freunde dort. Meine Erfahrungen und die meiner Freunde überspannen eine ausreichend lange Zeit, in der wir Zeugen größerer Veränderungen waren. Japan ist die einzige der sieben Nationen, bei der meine persönlichen Erfahrungen etwas stärker eingeschränkt sind, da ich die Sprache nicht spreche und meine Besuche dort in den vergangenen 21 Jahren auch nur von kurzer Dauer waren. Dafür kann ich auf die lebenslangen Erfahrungen meiner angeheirateten japanischen Verwandten zurückgreifen und auf die meiner japanischen Freunde und Studenten.
Natürlich handelt es sich bei den sieben Nationen, die ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen ausgewählt habe, nicht um eine Zufallsstichprobe aller Staaten der Welt. Fünf davon sind reiche Industrieländer, eine verfügt über bescheidenen Wohlstand und nur eine ist ein armes Entwicklungsland. Es ist kein afrikanisches Land dabei, zwei Länder liegen in Europa, zwei in Asien, und je ein Staat gehört zu Nordamerika, Südamerika oder Australien. Es bleibt anderen Autoren überlassen zu testen, inwieweit sich die Schlussfolgerungen, die ich aus dieser nicht zufälligen Stichprobe ziehe, auch auf andere Nationen anwenden lassen. Ich habe diese Einschränkungen akzeptiert und diese sieben Länder ausgewählt, weil ich es für einen immensen Vorteil halte, nur über Staaten zu sprechen, die ich aufgrund langer und intensiver persönlicher Erfahrungen, Freundschaften und (in sechs Fällen) Vertrautheit mit der Sprache verstehe.
In diesem Buch geht es fast ausschließlich um Staatskrisen neuerer Zeit, solche, die sich während meiner Lebenszeit ereignet haben, so dass ich aus der Perspektive eines Zeitzeugen darüber schreiben kann. Die Ausnahme stellt wieder Japan dar, dem ich zwei Kapitel widme; in einem davon diskutiere ich das heutige Japan, im anderen Veränderungen, die vor meiner Zeit stattfanden, das Japan der Meiji-Ära (1868–1912). Dieses Kapitel habe ich aufgenommen, weil es sich um ein schlagendes Beispiel für bewusst herbeigeführte selektive Veränderungen handelt, weil die Ereignisse noch in der jüngeren Vergangenheit stattfanden und weil die Erinnerung an das Meiji-Japan und dessen Probleme auch im heutigen modernen Japan noch präsent sind.
Natürlich ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Staatskrisen und Veränderungen gekommen, und sie haben ähnliche Fragen aufgeworfen. Über Fragen der Vergangenheit kann ich nicht aus persönlicher Erfahrung berichten, aber zu solchen Krisen liegt umfangreiche Literatur vor. Bekannte Beispiele sind Niedergang und Fall des Weströmischen Reiches im 4. und 5. Jahrhundert, Niedergang und Fall des südafrikanischen Zulustaates im 19. Jahrhundert, die Französische Revolution von 1789 und die nachfolgende Neuorganisation Frankreichs oder Preußens katastrophale Niederlage in der Schlacht von Jena 1806, seine Eroberung durch Napoleon und die anschließenden Reformen im sozialen, wirtschaftlichen und militärischen Bereich. Ein paar Jahre nachdem ich begonnen hatte, an diesem Buch zu schreiben, und mir sogar schon einen Titel dafür überlegt hatte, stellte ich fest, dass es bereits ein anderes Buch gab, dessen Titel (Crisis, Choice, and Change) nahelegte, dass es sich mit ähnlichen Themen beschäftigt, und das schon 1973 bei meinem amerikanischen Verlag (Little, Brown and Company) erschienen war![3] Dieses Buch unterscheidet sich dennoch von meinem, unter anderem weil es einige Fallbeispiele aus der ferneren Vergangenheit enthält, aber auch in einigen grundlegenden Aspekten. (Es war ein Band mit Beiträgen von vielen Autoren und mehreren Herausgebern, die alles in einen Rahmen namens »Systemfunktionalismus« stellten.)
Professionelle Historiker legen bei ihrer Forschungsarbeit großen Wert auf Archivstudien, das heißt, sie analysieren die erhaltenen schriftlichen Originaldokumente. Jedes neue Geschichtsbuch rechtfertigt seine Existenz damit, dass es bislang nicht oder zu wenig genutzte Quellen heranzieht oder Quellen, die andere Historiker bereits verwendet haben, neu interpretiert. Im Gegensatz zu den meisten der zahlreichen Bücher, die ich in der Bibliographie aufführe, beruht mein Buch nicht auf Archivstudien. Stattdessen kommt sein Beitrag durch einen neuartigen Rahmen zustande, der sich aus persönlichen Krisen herleitet, aus einer explizit vergleichenden Herangehensweise und einem Blickwinkel, der auf meinen eigenen Erfahrungen und denen meiner Freunde beruht.
Dies ist kein Zeitschriftenartikel zur aktuellen politischen Lage, der in den Wochen nach seiner Veröffentlichung gelesen wird und dann überholt ist. Vielmehr ist es ein Buch, das auch Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung noch lieferbar sein soll. Ich hebe das eigentlich Selbstverständliche hervor, nur damit Sie sich nicht vielleicht wundern, dass hier nirgendwo von der Politik der derzeitigen US-Regierung die Rede ist, auch nicht von Präsident Trumps Regierungsstil oder von den laufenden Brexit-Verhandlungen in Großbritannien. Alles, was ich heute über diese sich schnell verändernden Themen schriebe, wäre in beschämender Weise überholt, bis das Buch auf dem Markt wäre, und zudem in zehn oder zwanzig Jahren völlig uninteressant. Leser, die sich für Präsident Trump, seine Politik oder den Brexit interessieren, finden mehr als genug Veröffentlichungen zu diesen Themen an anderer Stelle. In den Kapiteln 9 und 10 steht jedoch eine ganze Menge zu Themenfeldern, die die US-amerikanische Politik seit zwanzig Jahren umtreiben, die unter der gegenwärtigen Regierung noch mehr Aufmerksamkeit erfordern und die uns wahrscheinlich auch noch mindestens zehn weitere Jahre beschäftigen werden.
Und hier kommt nun der Fahrplan durch mein Buch. Im ersten Kapitel werde ich über persönliche Krisen sprechen, den Rest des Buches widme ich staatlichen Krisen. Wir alle haben selbst schon Krisen durchlitten oder Krisen im Freundeskreis oder in der Familie miterlebt, von daher wissen wir, wie unterschiedlich solche Krisen enden können. Im besten Fall gelingt es den Betroffenen, neue und bessere Bewältigungsstrategien zu finden, und sie gehen gestärkt aus der Krise hervor. Im traurigsten Fall schaffen sie es nicht, die Krise zu bewältigen, kehren in ihre ausgetretenen Pfade zurück oder suchen sich neue, schlechtere Wege, um damit umzugehen. Manche Menschen in Krisensituationen nehmen sich sogar das Leben. Therapeuten haben zahlreiche Faktoren ausgemacht, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand eine persönliche Krise erfolgreich bewältigt; zwölf dieser Faktoren stelle ich in Kapitel 1 vor. Zu diesen Faktoren suche ich später nach vergleichbaren Faktoren, die den Ausgang von Staatskrisen beeinflussen.
All denen, die jetzt entsetzt aufstöhnen: »Ein Dutzend Faktoren! Wer soll sich das denn merken? Können Sie die nicht noch ein bisschen reduzieren?«, sage ich: Es wäre absurd zu glauben, dass sich die Folgen für das Leben eines Menschen oder die Geschichte einer Nation in sinnvoller Weise auf ein paar wenige Schlagworte reduzieren ließen. Sollten Sie das Pech gehabt haben, an ein Buch geraten zu sein, das Ihnen genau das verspricht, werfen Sie es weg, ohne es zu Ende zu lesen. Und umgekehrt, sollten Sie an ein Buch geraten sein, das alle 76 Faktoren zur Konfliktlösung abhandelt, werfen Sie es ebenfalls weg: Es ist die Aufgabe des Autors, nicht die des Lesers, die ungeheure Komplexität des Lebens auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren und Prioritäten zu erstellen. Meiner Meinung nach sind zwölf Faktoren ein akzeptabler Kompromiss zwischen diesen beiden Extremen: detailreich genug, um ein Gutteil der Wirklichkeit zu erklären, aber nicht so detailliert, wie man vorgehen würde, um eine Inventurliste zu erstellen.
Auf das einleitende Kapitel folgen drei Kapitelpaare, wobei jedes Paar einem anderen Typ von Staatskrise gewidmet ist. Das erste Paar beschäftigt sich mit Krisen in zwei Ländern (Finnland und Japan), die völlig überraschend kamen, als Reaktion auf Schocks, die von anderen Ländern ausgelöst wurden. Beim zweiten Paar (Chile und Indonesien) geht es ebenfalls um Krisen, die unvermittelt ausbrachen, aber aufgrund plötzlicher Ereignisse im Inneren. Mit dem letzten Paar (Deutschland und Australien) beschreibe ich Krisen, die nicht schlagartig ausbrachen, sondern sich allmählich entwickelten, vor allem aufgrund der Belastungen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auftraten.
In Finnland brach die Krise aus, als die Sowjetunion das Land am 30. November 1939 angriff. Während des sogenannten Winterkriegs wurde Finnland buchstäblich von all seinen möglichen Verbündeten im Stich gelassen und erlitt schwere Verluste, dennoch gelang es dem Land, seine Unabhängigkeit gegen die Sowjetunion, das vierzigmal mehr Einwohner hatte als Finnland, zu verteidigen. Zwanzig Jahre später verbrachte ich einen Sommer in Finnland; ich war zu Gast bei Veteranen, Witwen und Waisen des Winterkriegs. Vermächtnis des Krieges war eine auffällige, selektive Veränderung, die Finnland zu einem vorher nicht gekannten »Mosaik«, einer Mischung gegensätzlicher Elemente werden ließ: Eine wohlhabende, kleine, liberale Demokratie, die eine Außenpolitik verfolgte, die alles daransetzte, das Vertrauen der verarmten, reaktionären, riesigen Sowjetdiktatur zu erlangen. Von vielen Nichtfinnen, die die historischen Hintergründe dieser Politik nicht verstanden, wurde sie als beschämend angesehen und als »Finnlandisierung« schlechtgemacht. Einen der intensivsten Augenblicke meines Sommers erlebte ich, als ich gegenüber einem Veteranen des Winterkriegs unwissentlich eine ähnliche Auffassung vertrat und dieser mir höflich erklärte, das sei die bittere Lektion, die die Finnen gelernt hätten, nachdem ihnen von anderen Nationen die Hilfe verweigert worden sei.
Die andere der beiden Krisen, die durch einen von außen herbeigeführten Schock eintraten, traf Japan. Dessen langjährige Abschottungspolitik endete am 8. Juli 1853, als eine Flotte amerikanischer Kriegsschiffe in die Bucht von Tokio einfuhr und einen Handelsvertrag und Rechte für US-Schiffe und -Seeleute verlangte (Kapitel 3). Am Ende stand die völlige Umgestaltung des politischen Systems in Japan, ein bewusst herbeigeführtes Programm weitreichender Veränderungen und ein ebenso bewusstes Programm zur Aufrechterhaltung vieler traditioneller Eigenheiten. Dank dieser Entscheidungen gehört Japan heute zu den reichsten Industrienationen der Welt und hat dennoch seinen eigenständigen Charakter gewahrt. In den Jahrzehnten nach dem Eintreffen der US-Flotte, in der sogenannte Meiji-Ära, durchlief Japan eine große Transformation; an diesem Beispiel lassen sich auf nationaler Ebene viele der Faktoren, die den Ausgang persönlicher Krisen beeinflussen, hervorragend demonstrieren. Die Entscheidungsprozesse und die militärischen Erfolge des Meiji-Japan helfen uns umgekehrt zu verstehen, warum Japan in den 1930er Jahren andere Entscheidungen traf, die zu seiner vernichtenden Niederlage im Zweiten Weltkrieg führten.
In Kapitel 4 geht es um Chile, das erste der beiden Länder, deren Krisen innere Zusammenbrüche waren, die auf den Verlust des politischen Ausgleichs unter ihren Bürgern zurückgingen. Am 11. September 1973, nach Jahren politischen Stillstands, wurde Chiles demokratisch gewählte Regierung unter Präsident Allende vom Militär gestürzt; dessen Anführer, General Pinochet, blieb danach für 17 Jahre an der Macht. Meine chilenischen Freunde hatten weder den Putsch selbst noch die Rekorde für sadistische Folter, die Pinochets Regierung brechen sollte, vorhergesehen, als ich – ein paar Jahre vor dem Umsturz – eine Zeitlang in Chile lebte. Im Gegenteil, sie hatten mir stolz von Chiles langer demokratischer Tradition erzählt, die so anders war als die anderer südamerikanischer Staaten. Auch heute ist Chile wieder ein demokratischer Sonderfall in Südamerika, nach einer selektiven Veränderung, die Teile von Allendes und Teile von Pinochets Modellen in sich vereint. Für amerikanische Freunde, die das Manuskript meines Buches vorab gelesen und mir Rückmeldung gegeben haben, war dieses Kapitel dasjenige, das ihnen am meisten Angst machte: wegen der Geschwindigkeit und der Vollständigkeit, mit der sich eine Demokratie in eine sadistische Diktatur verwandelte.
Das Gegenstück zu Chile ist Indonesien in Kapitel 5. Auch hier führte der Zusammenbruch des politischen Ausgleichs zwischen seinen Bürgern zu einem inneren Zusammenbruch und einem Putschversuch, der am 1. Oktober 1965 stattfand. Der Putsch endete anders als der in Chile: Ein Gegenputsch führte zu einem Massenmord an Anhängern der Partei, die man für den Putschversuch verantwortlich machte. Indonesien ist in fast jeder Hinsicht das Gegenteil der anderen in diesem Buch untersuchten Staaten: Es ist das ärmste, das am wenigsten industrialisierte und das am wenigsten westlich orientierte der sieben von mir ausgewählten Länder, und es hat die jüngste nationale Identität, die sich erst in den vierzig Jahren gefestigt hat, seit denen ich dort arbeite.
Die nächsten beiden Kapitel (6 und 7) beschäftigen sich mit Staatskrisen in Deutschland und Australien, die nicht plötzlich ausbrachen, sondern sich scheinbar über längere Zeit entwickelten. Manche Leser zögern vielleicht, Begriffe wie »Krise« oder »Umbruch« für solche allmählichen Entwicklungen zu verwenden. Doch selbst wenn man einen anderen Begriff dafür verwenden möchte, finde ich es sinnvoll, diese Beispiele im selben Rahmen zu betrachten wie diejenigen, die ich als Beispiele für abruptere Übergänge anführe, da sie dieselben Fragen zu selektiven Veränderungen aufwerfen und dieselben Faktoren aufweisen, die den Ausgang der Krise beeinflussen. Zudem ist die Grenze zwischen einer »plötzlichen Krise« und einer »allmählichen Veränderung« nicht wirklich scharf zu ziehen, sondern etwas willkürlich: Beides geht ineinander über. Selbst in Fällen wie dem tatsächlich harten Übergang beim Putsch in Chile gingen dem Jahrzehnte allmählich anwachsender Spannungen voraus, und es folgten Jahrzehnte allmählicher Veränderungen. Ich beschreibe die Krisen in den Kapiteln 6 und 7 nur als »scheinbar« allmähliche Entwicklungen, weil die Krise von Nachkriegsdeutschland genau genommen mit einer so traumatisierenden Zerstörung begann, wie sie keines der anderen Länder, über die ich in diesem Buch spreche, erfahren hat: Am Tag der Kapitulation, dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945, lag Deutschland in Ruinen. Die Nachkriegskrise in Australien entwickelte sich ebenfalls allmählich, aber auch sie begann mit drei schockierenden militärischen Niederlagen, die innerhalb von drei Monaten eintraten.
Als Beispiel für ein Land, in dem die Krise nicht plötzlich eintrat, werde ich zunächst Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg (Kapitel 6) analysieren. Das Land sah sich gleichzeitig mit dem Erbe der Nazi-Zeit, mit Auseinandersetzungen über die hierarchische Struktur der deutschen Gesellschaft und dem Trauma der politischen Teilung in West- und Ostdeutschland konfrontiert. Zu den charakteristischen Merkmalen der Krisenbewältigung im Nachkriegsdeutschland gehören in meinem Vergleichsrahmen ungemein heftige Konflikte zwischen den Generationen, starke geopolitische Beschränkungen und der Versöhnungsprozess mit den Nationen, die während des Krieges Opfer deutscher Gräueltaten geworden waren.
Das zweite Beispiel für eine nicht plötzlich eintretende Krise ist Australien (Kapitel 7), ein Land, das sich in den 55 Jahren, in denen ich es immer wieder besucht habe, eine neue nationale Identität gegeben hat. Als ich 1964 das erste Mal dort war, kam mir Australien vor wie ein britischer Außenposten im Pazifischen Ozean, es orientierte sich und seine Identität an Großbritannien, und es betrieb eine Politik des »weißen Australien«, das die Immigration von Nichteuropäern beschränkte oder untersagte. Aber Australien geriet in eine Identitätskrise, weil sich diese weiße, britische Identität immer weniger mit seiner geographischen Lage, den außenpolitischen Erfordernissen, der Verteidigungsstrategie, der Wirtschaft und der Zusammensetzung der Bevölkerung vereinbaren ließ. Heute sind Australiens Wirtschaft und Politik auf Asien ausgerichtet, überall auf den Straßen australischer Städte und in den Hörsälen australischer Universitäten sieht man Asiaten, und die australischen Wähler haben ein Referendum, das die Queen of England als Staatsoberhaupt abschaffen wollte, nur mit knapper Mehrheit abgelehnt. Doch wie im Meiji-Japan und in Finnland waren diese Veränderungen nur selektiv: Australien ist immer noch eine parlamentarische Demokratie, die Landessprache ist immer noch Englisch, und der bei weitem überwiegende Teil der Australier ist immer noch britischer Abstammung.
Die Staatskrisen, von denen bis hierher die Rede war, sind allesamt wohlbekannt und bewältigt (oder die Wege zur Bewältigung werden schon lange beschritten), so dass wir ihren jeweiligen Ausgang beurteilen können. In den letzten vier Kapiteln beschreibe ich gegenwärtige und zukünftige Krisen, von denen wir noch nicht wissen, wie sie enden werden. Dieser Teil beginnt mit Japan (Kapitel 8), das schon in Kapitel 3 Thema war. Japan hat heute mit zahlreichen fundamentalen Problemen zu kämpfen, von denen einige größtenteils erkannt sind und vom japanischen Volk und der japanischen Regierung als solche anerkannt werden, während andere nicht erkannt oder von den Japanern sogar weitgehend geleugnet werden. Im Augenblick zeichnet sich für diese Probleme nicht wirklich eine Lösung ab. Japans Zukunft ist absolut offen, sie liegt in den Händen seiner Bevölkerung. Wird die Erinnerung daran, wie das Meiji-Japan seine Krise mutig und erfolgreich überwand, dem modernen Japan den Weg weisen?
Die nächsten beiden Kapitel (Kapitel 9 und 10) beschäftigen sich mit meinem eigenen Land, den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich kann vier wachsende Krisen ausmachen, die das Potential haben, die amerikanische Demokratie und die amerikanische Stärke binnen zehn Jahren auszuhöhlen, so wie es in Chile der Fall war. Diese Erkenntnisse stammen nicht von mir: Alle vier Bereiche werden von vielen Amerikanern offen diskutiert, und fast überall in den USA ist eine Krisenstimmung spürbar. Mir selbst kommt es vor, als bewege sich in keinem der Problemfelder etwas auf eine Lösung zu, sondern als werde es im Gegenteil immer schlimmer. Und doch können sich die USA, wie das Meiji-Japan, auf überwundene Krisen zurückbesinnen, etwa den langen und selbstzerstörerischen Bürgerkrieg und den plötzlichen Eintritt in den Zweiten Weltkrieg nach einer Phase der politischen Isolation. Werden die Erinnerungen an diese Krisen meinem Land helfen, die aktuellen erfolgreich zu überwinden?
Zum Schluss kommt die ganze Welt (Kapitel 11). Man könnte eine lange Liste von Problemen erstellen, der sich die Welt gegenübersieht, aber ich werde mich auf vier konzentrieren, von denen ich glaube, dass sie – wenn sich die bereits zu beobachtenden Trends fortsetzen – innerhalb der nächsten Jahrzehnte die Lebensstandards überall auf der Welt untergraben werden. Anders als Japan und die USA, die beide auf eine lange Geschichte nationaler Identität, Selbstbestimmtheit und Erinnerungen an erfolgreiche kollektive Einsätze zurückblicken, hat die Welt als Ganzes keine solche Geschichte. Wird es der Welt ohne solche inspirierenden Erinnerungen gelingen, ihre Krisen zu bewältigen, jetzt, wo wir zum ersten Mal in der Geschichte mit Problemen konfrontiert werden, die sich unter Umständen fatal global auswirken?
Das Buch endet mit einem Epilog, der die Analyse der sieben Länder und der Welt im Licht unserer zwölf Faktoren betrachtet. Ich frage, ob Staaten Krisen brauchen, um endlich größere Veränderungen anzugehen. Der Schock der Brandkatastrophe im Cocoanut Grove war notwendig, um Kurzzeit-Psychotherapie zu verändern. Sind Staaten in der Lage, ohne einen solchen Schock Veränderungen einzuleiten? Ich werde mir Gedanken zur Frage machen, ob politische Führer die Geschichte wirklich entscheidend beeinflussen können. Ich werde Vorschläge für weitere Untersuchungen machen, und ich werde sagen, was wir, meiner Meinung nach, realistischerweise aus dem Blick in die Geschichte lernen können. Wenn Nationen, oder vielleicht auch nur ihre Führungsfiguren, sich dazu entschlössen, über vergangene Krisen nachzudenken, könnte uns das helfen, aktuelle und zukünftige Krisen zu bewältigen.
Fußnoten
[1]
Barry Rolett und Jared Diamond. Environmental predictors of pre-European deforestation on Pacific islands. Nature 431:443–446 (2004)
[2]
Jared Diamond und James Robinson (Hrsg.). Natural Experiments of History. (Harvard University Press, Cambridge, MA, 2010)
[3]
Gabriel Almond, Scott Flanagan, Robert Mundt (Hrsg.). Crisis, Choice, and Change: Historical Studies of Political Development. (Little, Brown, Boston, 1973)
Teil IIndividuen
■ ■ ■
Kapitel 1Persönliche Krisen
Eine persönliche Krise ■ Verläufe ■ Vom Umgang mit Krisen ■ Faktoren, die den Ausgang beeinflussen ■ Staatliche Krisen
Mit 21 Jahren durchlebte ich die schwerste Krise meines Berufslebens. Ich war in Boston als ältestes Kind von gebildeten Eltern aufgewachsen, mein Vater war Harvard-Professor, meine Mutter Linguistin, Pianistin und Lehrerin, und beide förderten meine Freude am Lernen. Ich besuchte eine großartige höhere Schule (Roxbury Latin School) und ein großartiges College (Harvard College). Ich ging gerne in die Schule, war gut in sämtlichen Kursen, die ich belegte, führte noch am College zwei Forschungsprojekte im Labor durch und publizierte deren Ergebnisse und hatte den besten Abschluss in meiner Klasse. Angeregt vom Beispiel meines Vaters, der Arzt war, und beflügelt von meinen beglückenden und erfolgreichen Erfahrungen mit den Forschungsprojekten am College, beschloss ich in einem Laborfach, der Physiologie, zu promovieren. Für das Promotionsstudium ging ich im September 1958 an die University of Cambridge in England, die zu der Zeit weltweit führend in Physiologie war. Weitere Pluspunkte meines Umzugs nach Cambridge waren die Gelegenheiten, erstmals weit weg von zu Hause zu leben, Europa zu bereisen und Fremdsprachen zu praktizieren, deren sechs ich bis dahin nur aus Büchern gelernt hatte.
Schon bald stellte sich heraus, dass mir das Promotionsstudium in England viel schwerer fiel als die Kurse an meiner Schule und am Harvard College. Der Betreuer meiner Doktorarbeit in Cambridge, mit dem ich Labor und Büro teilte, war ein großartiger Physiologe, er erforschte die Erzeugung von Elektrizität bei elektrischen Aalen. Er gab mir die Aufgabe, die Bewegung elektrisch geladener Teilchen (Natrium- und Kaliumionen) durch die Elektrizität erzeugenden Membranen der Aale zu messen. Das bedeutete, dass ich mir den Versuchsaufbau überlegen und die dafür benötigten Gerätschaften bauen musste. Aber ich war nie geschickt mit den Händen. Mir war es an der Highschool ohne Hilfe nicht einmal gelungen, ein einfaches Radio zusammenzubasteln. Ich hatte nicht den Hauch einer Idee, wie ich eine Messkammer zum Studium von Aalmembranen bauen sollte, erst recht nicht, wie man mit etwas auch nur annähernd so Kompliziertem wie Elektrizität umgeht.
Ich war mit den besten Empfehlungen meines Harvard-Betreuers nach Cambridge gekommen. Unübersehbar für mich und meinen Betreuer in Cambridge stellte es sich aber nun heraus, dass ich eine Enttäuschung für ihn war. Er konnte mich als Mitarbeiter für seine Forschungsarbeit nicht gebrauchen. Deshalb setzte er mich in ein anderes Labor, das ich für mich allein hatte; dort sollte ich mir ein eigenes Forschungsprojekt ausdenken.
In meinem Bemühen, ein Projekt zu finden, das sich besser mit meinem Mangel an technischen Fähigkeiten vereinbaren ließ, verfiel ich schließlich auf die Idee, den Natrium- und Wassertransport in der Gallenblase, einem einfachen sackähnlichen Organ, zu studieren. Die dafür erforderliche Technik war simpel: Man hängt eine mit Flüssigkeit gefüllte Fischgallenblase alle zehn Minuten an eine genaue Waage und wiegt das darin enthaltene Wasser. Das konnte sogar ich! Die Gallenblase selbst ist gar nicht so wichtig, aber sie gehört zu einem Gewebetyp, den man als Epithel bezeichnet, und dazu gehören auch weit wichtigere Organe wie Nieren und Eingeweide. Zu dieser Zeit, 1959, konnte man an allen bekannten Epithelgeweben, die wie die Gallenblase Ionen und Wasser transportieren, eine Spannung messen, die mit dem Transport der geladenen Teilchen zusammenhing. Doch wann immer ich versuchte, eine Spannung an der Gallenblase zu messen, erhielt ich den Wert null. Damals galt das als deutlicher Hinweis, dass ich nicht einmal die simple Technik beherrschte, die man brauchte, um eine Spannung an der Gallenblase zu messen, so denn eine vorhanden war, oder dass ich das Gewebe irgendwie kaputtgekriegt hatte und es deshalb nicht funktionierte. Egal wie, ich hatte mich schon wieder als Versager im Physiologielabor erwiesen.
Meine Demoralisierung setzte sich fort, als ich im Juni 1959 den ersten Kongress der International Biophysical Society in Cambridge besuchte. Hunderte Wissenschaftler aus aller Welt präsentierten ihre Forschungsarbeiten; ich hatte keine Ergebnisse vorzuweisen. Ich fühlte mich gedemütigt. Ich war immer unter den Klassenbesten gewesen, und nun war ich ein Nichts.
In mir keimten grundsätzliche Zweifel auf, ob ich überhaupt eine Forscherkarriere anstreben sollte. Ich las Thoreaus berühmtes Buch Walden wieder und wieder. Es wühlte mich auf, was ich als Botschaft für mich herauslas: Dass das wahre Motiv für Wissenschaftler das Streben nach Anerkennung durch andere Wissenschaftler sei. (Für die meisten Wissenschaftler ist das tatsächlich ein wichtiges Motiv!) Aber Thoreau tat dieses Motiv beredt als inhaltsleeren Vorwand ab. Die Hauptbotschaft in Walden für mich war jedoch: Ich sollte herausfinden, was ich in meinem Leben wirklich erreichen will, und mich nicht von der Eitelkeit der Anerkennung verführen lassen. Thoreau verstärkte meine Zweifel, ob ich meine Forschungsarbeit in Cambridge fortsetzen sollte. Doch ein entscheidender Moment rückte näher: Ende des Sommers würde mein zweites Jahr im Promotionsstudium beginnen, und ich würde mich einschreiben müssen, wenn ich weitermachen wollte.
Ende Juni fuhr ich für einen Monat nach Finnland in den Urlaub, eine tiefgehende, wunderbare Erfahrung, über die ich im nächsten Kapitel sprechen werde. In Finnland erlebte ich zum ersten Mal, wie es ist, eine Sprache – die schöne, schwierige finnische Sprache – nicht allein aus Büchern zu lernen, sondern durch Zuhören und Gespräche mit den Menschen. Ich genoss es. Es war ebenso beglückend und erfolgreich, wie meine physiologische Forschung deprimierend und erfolglos war.
Als der Monat in Finnland zu Ende ging, dachte ich ernsthaft darüber nach, die Karriere in einem naturwissenschaftlichen oder egal welchem akademischen Fach an den Nagel zu hängen. Vielleicht könnte ich stattdessen in die Schweiz gehen, mich dort meiner Liebe zu und meinem Talent für Sprachen hingeben und Simultandolmetscher bei den Vereinten Nationen werden. Damit würde ich allem den Rücken kehren, was ich mir für mein Leben ausgemalt hatte und was mein Vater in beispielhafter Weise verkörperte: ein Forscherleben, kreatives Denken und akademischer Ruhm. Als Dolmetscher würde ich nicht viel Geld verdienen, aber zumindest würde ich etwas tun, von dem ich glaubte, es würde mir Spaß machen und ich wäre gut darin. So dachte ich.
Meine Krise erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt, als ich aus Finnland zurückkehrte und meine Eltern (die ich ein Jahr nicht gesehen hatte) für eine Woche in Paris traf. Ich erzählte ihnen von meinen praktischen und meinen grundsätzlichen Zweifeln an einer Fortsetzung der wissenschaftlichen Karriere und von meinen Überlegungen, Dolmetscher zu werden. Für meine Eltern muss es schrecklich gewesen sein, mich in so großer Verwirrung und tiefer Verzweiflung zu sehen. Gottlob hörten sie mir zu und machten keine Anstalten, mir zu sagen, was ich zu tun hätte.
Die Lösung der Krise kam eines Morgens, als ich mit meinen Eltern auf einer Pariser Parkbank saß und wir zum wiederholten Mal die Frage durchgingen, ob ich die Wissenschaft aufgeben oder weitermachen sollte. Mein Vater machte schließlich einen Vorschlag, behutsam, ohne mich zu drängen. Ja, er sehe ein, dass ich Zweifel hätte bezüglich einer wissenschaftlichen Karriere in der Forschung. Aber es sei doch erst mein erstes Jahr im Promotionsstudium gewesen, und ich hätte nur wenige Monate mit den Versuchen an der Gallenblase verbracht. Sei es nicht eigentlich zu früh, um eine Lebensplanung aufzugeben? Könnte ich nicht nach Cambridge zurückkehren, mir selbst eine weitere Chance geben und einfach noch ein halbes Jahr weiter versuchen, die Probleme mit der Gallenblase zu lösen? Sollte das nicht klappen, könnte ich im Frühjahr 1960 immer noch hinwerfen. Ich müsste jetzt keine wichtige Entscheidung treffen, die sich nicht mehr rückgängig machen ließe.
Der Vorschlag meines Vaters kam mir vor wie der Rettungsring, den man einem Ertrinkenden zuwirft. Ich konnte die große Entscheidung (noch ein halbes Jahr zu versuchen, mit der Gallenblase weiterzukommen) mit gutem Grund aufschieben, und das war nicht unehrenhaft. Die nun getroffene Entscheidung würde mich nicht unwiderruflich zu einer wissenschaftlichen Karriere in der Forschung verdammen. Ich hatte immer noch die Option, in einem halben Jahr den Weg zum Simultandolmetscher einzuschlagen.
Das beruhigte mich. Ich ging nach Cambridge zurück und begann mein zweites Jahr dort. Ich fasste meine Forschungen an der Gallenblase zusammen. Zwei junge Physiologen, denen ich auf ewig dankbar sein werde, halfen mir, die technischen Probleme zu lösen. Vor allem der eine half mir zu erkennen, dass die Methode, mit der ich die Spannung an der Gallenblase messen wollte, vollkommen ungeeignet war; unter den richtigen Bedingungen traten tatsächlich Spannungen an der Gallenblase auf (sogenannte Diffusions- und Strömungspotentiale), die ich messen konnte. An der Gallenblase gab es nur dann keine Spannung, wenn sie Ionen und Wasser transportierte, und zwar aus dem bemerkenswerten Grund (einzigartig für die zu dieser Zeit bekannten Epithelien): Es wurden positiv und negativ geladene Ionen gleichermaßen transportiert; dadurch kam es netto nicht zu einem Transport von Ladung, und es konnte sich keine Transportspannung aufbauen.
Andere Physiologen begannen, sich für meine Gallenblasenergebnisse zu interessieren, und sogar ich war davon angetan. Als ich mit meinen Experimenten Erfolg hatte, schwanden meine großen grundsätzlichen Zweifel bezüglich der Eitelkeit der Anerkennung durch andere Wissenschaftler. Ich blieb vier Jahre in Cambridge, machte meinen Doktor, kehrte in die USA zurück, erhielt gute Jobs an Universitäten, betrieb Forschung und Lehre in Physiologie (zuerst in Harvard, dann an der University of California, Los Angeles) und wurde ein sehr erfolgreicher Physiologe.
Dies war meine erste größere berufliche Krise, eigentlich typisch für persönliche Krisen, und natürlich war es auch nicht meine letzte Lebenskrise. Zwei weitere, aber wesentlich mildere berufliche Krisen hatte ich etwa 1980 und 2000, damals ging es um Veränderungen in der Ausrichtung meiner Forschungsthemen. Und auch schwere persönliche Krisen lagen noch vor mir: meine erste Eheschließung und siebeneinhalb Jahre später die Scheidung. Doch die erste berufliche Krise war in ihren Details einzigartig für mich: Vermutlich hat vor mir noch nie jemand mit sich gerungen, ob er die Gallenblasenforschung aufgeben und eine Ausbildung zum Simultandolmetscher machen soll. Doch wie wir gleich sehen werden, sind die Fragen, die meine Krise von 1959 aufwarf, absolut typisch für persönliche Krisen ganz allgemein.
Wahrscheinlich haben die meisten Leser dieses Buches das innere Chaos, das eine persönliche »Krise« ausmacht, wie ich schon einmal erlebt, oder sie werden es noch erleben. Wenn Sie sich gerade mitten drin befinden, halten Sie nicht inne, um über akademische Fragen zur Definition von »Krise« nachzusinnen, Sie wissen, dass Sie in einer stecken. Später, wenn die Krise vorbei ist und Sie Muße haben, darüber nachzudenken, definieren Sie sie vielleicht rückblickend als eine Situation, in der Sie sich einer wichtigen Herausforderung gegenübersahen, die mit Ihren üblichen Herangehensweisen und Lösungsstrategien offenbar nicht zu meistern war. Sie mussten sich bemühen, neue Wege zu finden. Und ebenso wie ich stellten Sie Ihre Identität, Ihre Werte und Ihre Weltsicht in Frage.
Sicher haben Sie auch gesehen, dass persönliche Krisen unterschiedliche Formen annehmen, aus unterschiedlichen Gründen entstehen und unterschiedlich verlaufen. Manche treten in Form eines einzelnen unerwarteten Schocks auf – wie der plötzliche Tod eines nahestehenden Menschen oder die Kündigung des Jobs ohne Vorwarnung oder ein schwerer Unfall oder eine Naturkatastrophe. Der Verlust führt nicht nur wegen der praktischen Konsequenzen, die sich aus dem Verlust selbst ergeben (zum Beispiel, dass Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann nicht mehr da ist), zu einer Krise, sondern auch wegen des seelischen Schmerzes und wegen des erschütterten Glaubens an eine gerechte Welt. Das war das, was die Verwandten und die Freunde der Opfer des Brandes im Cocoanut Grove erlebten. Andere Krisen haben die Form eines Problems, das allmählich immer größer wird, bis es zum Knall kommt – wie zum Beispiel das Auseinanderleben in einer Ehe, eine schwere chronische Krankheit, die einen selbst oder einen geliebten Menschen betrifft, oder Geldprobleme oder Probleme im Beruf. Wieder andere Krisen sind entwicklungsbedingt, sie treten oft in den Übergangszeiten im Lebenslauf auf, etwa in der Pubertät, in der Lebensmitte, mit der Pensionierung oder im Alter. Bei einer »Midlife-Crisis« haben viele Menschen das Gefühl, ihre besten Jahre seien vorbei, und versuchen krampfhaft, sich neue Ziele für den verbleibenden Rest ihres Lebens zu setzen.
So weit die verschiedenen Formen persönlicher Krisen. Zu ihren häufigsten spezifischen Ursachen gehören Beziehungsprobleme: eine Scheidung, die Zerrüttung einer engen Beziehung oder eine andere tiefe Unzufriedenheit, die Sie oder Ihren Partner, Ihre Partnerin dazu bringt, den Fortbestand der Beziehung in Frage zu stellen. Die Scheidung löst bei Menschen oft Fragen aus wie: Was habe ich falsch gemacht? Warum will er/sie mich verlassen? Warum habe ich die/den Falsche/n geheiratet? Wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Wird es je ein nächstes Mal für mich geben? Wenn ich nicht einmal mit der Person, die mir am nächsten ist und die ich mir erwählt habe, eine erfolgreiche Beziehung führen kann, wozu bin ich dann überhaupt gut?
Abgesehen von Beziehungsproblemen zählen der Tod oder eine schwere Krankheit eines nahestehenden Menschen, eigene gesundheitliche Rückschläge, berufliche oder finanzielle Probleme zu den anderen häufigen Ursachen für persönliche Krisen. Auch die Religion kann bei Krisen eine Rolle spielen: Menschen, die ihr Leben lang geglaubt haben, werden von Zweifeln geplagt, umgekehrt können Nichtgläubige auf einmal einen Zug zur Religion verspüren. Aber eines ist all den unterschiedlichen Krisentypen – unabhängig von ihrer Ursache – gemeinsam: das Gefühl, dass etwas Wichtiges in der Art, wie man das eigene Leben angeht, nicht funktioniert und dass man eine neue Herangehensweise finden muss.
Mein eigenes Interesse an persönlichen Krisen rührt, wie das vieler anderer Menschen, ursprünglich daher, dass ich selbst Krisen durchlebt oder sie im Freundes- und Familienkreis beobachtet habe. In meinem Fall wurden die persönlichen Motive noch verstärkt durch den Beruf meiner Frau Marie, die klinische Psychologin ist. Während unseres ersten Ehejahrs machte Marie eine Ausbildung in einem kommunalen Zentrum für seelische Gesundheit, wo eine Klinik Kurzzeit-Psychotherapie für Menschen in Krisensituationen anbot. Betroffene kamen in die Klinik oder meldeten sich per Telefon, weil sie sich von einer Situation überfordert fühlten, die sie nicht alleine auflösen konnten. Wenn sich die Tür öffnete oder das Telefon am Empfang der Klinik klingelte und der nächste Kunde hereinkam oder zu sprechen begann, wusste der Berater nie vorher, welche Art von Problem diese Person belastete. Doch er wusste, dass sich dieser Klient, wie alle Klienten davor, in einer akuten persönlichen Krise befand, ausgelöst durch die Einsicht, dass seine üblichen Methoden, mit Problemen umzugehen, nicht mehr ausreichten.
Die Erfolge der Beratungen in Gesundheitszentren, die Krisentherapien anbieten, fallen sehr unterschiedlich aus. Im traurigsten Fall begehen manche Klienten Selbstmord oder versuchen es zumindest. Andere finden keine neue, für sie geeignete Problemlösestrategie: Sie kehren in ihre alten Pfade zurück, und manche werden am Ende von Trauer, Wut oder Enttäuschung zerfressen. Im besten Fall jedoch entdeckt der Kunde eine neue, bessere Problemlösestrategie und geht gestärkt aus der Krise. Dieses Ergebnis drückt das chinesische Schriftzeichen aus, das als »Krise« übersetzt wird. Es setzt sich aus zwei Schriftzeichen zusammen, dem Wort »wei«, das »Gefahr« bedeutet, und dem Wort »ji«, das als »Gelegenheit«, »Chance«, »kritischer Punkt« verstanden werden kann. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche drückte einen ähnlichen Gedanken so aus: »Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.« Und von Winston Churchill heißt es zum selben Thema: »Eine gute Krise sollte man niemals ungenutzt vorübergehen lassen.«
Menschen, die anderen in akuten persönlichen Krisen helfen, beobachten häufig, dass sich im Laufe von sechs Wochen etwas verändert. In diesem kurzen Übergangszeitraum stellen wir unsere liebgewordenen Auffassungen in Frage und sind eher bereit, Veränderungen bei uns vorzunehmen, als in der langen Zeit der Stabilität davor. Wir können jetzt nicht mehr länger weiterleben, ohne ein paar Maßnahmen zur Problemlösung zu ergreifen, obwohl wir noch sehr viel länger trauern, leiden, arbeitslos oder wütend sein können. Nach etwa sechs Wochen beginnen wir entweder damit, einen neuen Weg auszuprobieren, um mit der Situation umzugehen, der sich am Ende als erfolgreich herausstellen wird, oder wir beschreiten einen neuen Weg, der nicht geeignet ist, um mit der Situation fertig zu werden, oder wir begehen den Fehler, in unsere alten Verhaltensmuster zurückzufallen, die sich als ungeeignet erwiesen hatten.
Natürlich bedeuten diese Beobachtungen akuter Krisen nicht, dass unser Leben nach einem übermäßig vereinfachten Modell etwa der folgenden Art abläuft: (1) Wenn dich ein Schlag trifft, stelle den Wecker auf sechs Wochen. (2) Erkenne an, dass deine bisherigen