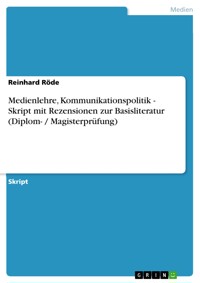29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Skript aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Theorien, Modelle, Begriffe, Note: keine, Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Kommunikationswissenschaften), Veranstaltung: Vorbereitung zur mündlichen Prüfung, Sprache: Deutsch, Abstract: Versuch einer Synthese aus Systemtheorie und Konstruktivismus § Systemtheorie und Konstruktivismus haben gemeinsam, dass sie antirealistisch und beobachterzentriert sind, d.h. jede Weltsicht als Beobachtung begreifen. § Mit den beiden Großtheorien lassen sich die Grundbegriffe der KW neu bestimmen Vergleich Systemtheorie & Konstruktivismus 1) Definitionen: - Konstruktivismus: „Theorie, wie ein Beobachter eine Umwelt konstruiert“; Konstruktion individueller Weltbilder durch Beobachtungsoperationen (=Benennen von Unterscheidungen) - Systemtheorie: Universale Gesellschaftstheorie, die Gesellschaft aus der Selbstbeobachtung von Systemen heraus versteht, die sich selbst über Kommunikation reproduzieren (Autopoeisis) 2) Gemeinsamkeiten: - Thema ist klassisch abendländisch die Dualität zwischen Subjekt und Objekt (Systemtheorie: System und Umwelt -> Systemabhängigkeit der Weltsicht; Konstruktivismus: Beobachter und Welt -> Beobachterabhängigkeit) - Start der Überlegungen ist die Differenz (Unterscheidung), nicht die Identität 3) Unterschiede: - Systemtheorie: Makrotheorie, Individuen spielen keine Rolle, Systeme und Umwelt sind real - Konstruktivismus: Mikrotheorie, Individuum/Beobachter steht im Mittelpunkt, Welt ist nicht real, sondern konstruiert [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2001
Ähnliche
Page 1
Skripte aus dem ThemenbereichKommunikationstheorie
Die Dokumente sind verlinkt. Klicken auf den Titel führt zum jeweiligen Dokument.
Die Skripte sind in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge angeordnet.
Page 2
Der Kern: Versuch einer Synthese aus Systemtheorie und Konstruktivismus
§Systemtheorie und Konstruktivismus haben gemeinsam, dass sie antirealistisch und beobachterzentriert sind, d.h. jede Weltsicht als Beobachtung begreifen.
§Mit den beiden Großtheorien lassen sich die Grundbegriffe der KW neu bestimmen
Vergleich Systemtheorie & Konstruktivismus
1) Definitionen:
2) Gemeinsamkeiten:
3) Unterschiede:
Konstruktivistisch-systemtheoretische Kritik an der KW
§Falsche Ontologisierung (= irriger Glaube, das Wesenhafte z.B. des Journalismus zu erkennen)
§Falsche Normativität (= vorgeben, dass man weiß, wie Kommunikation sein soll)
§Falsche Trivialität (= Vereinfachung in simplen Modellen)
§Falsches Stimulus-Response-Denken
§Falsche Technikgläubigkeit (Beschreibung von Kommunikation über verwandte Technik)
§Falscher Objektivitätsglaube (=Irrtum, z.B. durch Inhaltsanalyse „objektive“ Inhalte der Texte identifizieren zu können)
§Falsche Falsifikationsversuche/Rechthaberei (=wenn Kepplinger Medienwirklichkeit an wirklicher Wirklichkeit misst mit statistischen Daten o.Ä.; „es gibt keinen privilegierten Zugang zur Realität“)
Page 4
Der Kern:
Konstruktivisten wollen die KW neu erfinden, indem sie so tun, als seien Journalisten „Wirklichkeitskonstrukteure“, die sich nur an ihrem eigenen Mediensystem orientieren (Selbstreferenzialität) und verschweigen, wie sie die Realität zusammenkonstruiert haben.
Die Nachricht
Was be deutet „Konstruktion der Wirklichkeit“?
Folgerungen für die empirische Forschung:
„Wirklichkeits-Konstruktion“ beobachten durch:
•Teilnehmender Beobachtung
•Alle quantitativen Daten wie Inhaltsanalyse höchst misstrauisch begutachten, und
nicht Verallgemeinern
•Subjektivität und Emotionalität untersuchen
•Selbstreferenzialität der Medien untersuchen (Medienseiten ...)
•Den Prozess untersuchen, wie eine Information entsteht (Recherche)
Sechs Thesen zur Wirklichkeit der Medien aus konstruktivistischer Sicht
Page 5
Einordnung der Ergebnisse durch Balthas
•Meiner Ansicht nach ist die Debatte zum großen Teil ein verbales Luftgefecht, das die
Medienwissenschaft nicht weiterbringt
•Einzige heuristische Werte: Man kann eventuell die Selektion von Journalisten besser
erklären, wenn man sie a) als aktive Konstrukteure begreift und dann b) untersucht, wie genau solche Konstruktionen aussehen. (Weber sagt zum Beispiel „Der Chefredakteur will es ...“ als Beispiel für „Konstruktionsanweisung“ - Wortschöpfung Balthas)
•Solche „Konstruktionsanweisungen“ gibt es aber in der KW schon lange, zum Beispiel in
der Nachrichtenwert-Forschung oder den Gatekeeper-Studien oder in den Schema -Theorien und und und ...
•Somit ist der Konstruktivismus nichts wirklich neues, und in der radikalen Form von
Weber bringt er der KW nichts, weil er gänzlich verneint, dass sich der Journalismus sehr wohl an einer „Realität“ ausrichtet, und wenn sie eine operative Fiktion sein sollte, dann ist das ganz egal !!!
•„Big Brother“ ist ein Format, zu dem die sechs Thesen allerdings wunderbar passen !!!!
Page 6
§Einfache Reiz-wirkungsmodelle entspringen der Angst vor manipulation und gelten als überholt
§Wirkungsforschung ist seit den 70ern wesentlich weiter gekommen: Vor allem mit rezipientenorientierten Ansätze
§Die Rolle des Zeitfaktors und die Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt finden jetzt Beachtung
Ausgangspunkt: Manipulationsvorwurf
Medienwirkung wird meist als Gefahr dargestellt. Forderung: Medien sollen die Realität und die öffentliche Meinung darstellen. Allerdings werden einzelne Gruppen sich immer unterrepräsentiert fühlen und den Medien Einseitigkeit vorwerfen. Außerdem ist immer die Angst vorhanden, unbemerkt Opfer von Beeinflussung werden zu können.
Information und Meinung ist in Praxis schwer zu trennenàManipulationsvorwurf. Verstärkt durch Theorie der Massengesellschfat (Auflösung von Kleingruppenbindungen, Verfall von Traditionen und Werten): Mensch als Spielball der bösen manipulierenden Medien, der Propaganda und der trivialen Unterhaltung: Vorwurf, Medien fördern Passivität, Konformität, Mittelmäßigkeit.Entwicklung der Wirkungsforschung: Erst: Transfer-Modelle
Ausgehend von Lasswell-Formel (ähnlich auch Maletzke): Suche nachStimulus-Response-Beziehung.Kommunikation wird wie ein physikalischer Prozess verstanden (Übertragung von Information). Grundannahmen über Massenkommunikation:
§asymmetrisch (Einer sendet den Stimulus, ein anderer ist ihm ausgesetzt und reagiert)
§individuell (betrifft primär Einzelne)
§intendiert (zweckgerichtet, auf bestimmte Wirkung angelegt)
§episodisch (Ende und Anfang sind klar definiert)
Entspricht kulturkritischen Ideen, dass die Medien eine Art fremde, dem Menschen aufgesetzte Technik sind. Medien vermitteln Wirklichkeitr aus 2. HandàDiskreditierungder Medienwirkung.
Paradigmenwechsel ab ca. 1970: Aktiver Rezipient:
Nutzen-Ansatz:Medien wirken nur, so weit der Rez. ihnen Wirksamkeit zugesteht. Selektives Verhalten ist Voraussetzung von Wirkung. Der Rezipient ist an Input interessiert ist.àfunktionale Analyse
Page 7
Dynamisch-transaktionaler Ansatz:Optimaler Nutzen für beide Seiten wird ausgehandelt;
Medienangebot und Publikumsnachfrage bedingen sich gegenseitig.Koorientierungsmodell:Bedeutung der interpersonalen Kommunikation; individuelles
Erkennen und Vorstellen ist betont. Wechselseitige Annahmen über einander bedingen das Verhalten. In diesebe Richtung: Noelle-Neumanns SchweigespiraleMakroskopische Perspektive
(Mikroskopisch: (Hovland usw): Indivisuum im Mittelpunkt des Interesses Makroskop.: Beschreibt Wirkung der Medien audf die gesellschaft und v.a. das politische System. Wieder verstärkt im Interesse der Forschung).:
Rolle der Medien für Sozialisation.Vermutung: Soziale Verhaltens- und Orientierungsmuster werden durch Massenkomm. vermittelt.
Konstruktion sozialer Realitätdurch die Medien: Meist einzige Quelle für Information und Unterhaltung. Medienbild der Wirklichkeit ist ein Konstrukt, das zum teil in die Wirklichkeit hinein projiziert wird. Indiz für diese Sicht: Wachsende Zahl von selbstinduzierten und selbstinszenierten Ereignissen in den Medien (Pseudo-Ereignisse)Latente Folgen?Nicht nur die Beeinflussungsabsichten des Kommunikators bestimmen