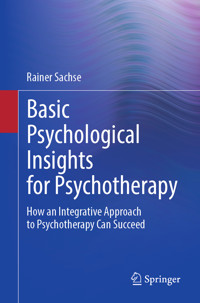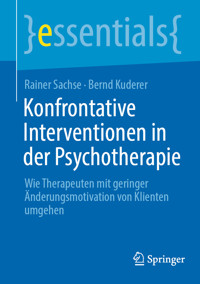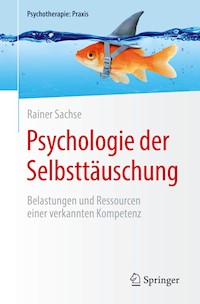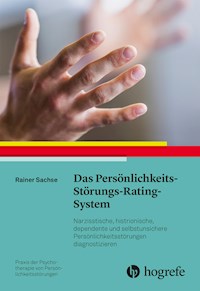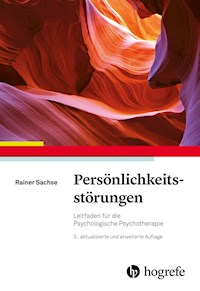19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Praxis der Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen
- Sprache: Deutsch
Die Diagnostik und Therapie von Persönlichkeitsstörungen stellen Therapeuten stets vor besondere Herausforderungen. Liegt darüber hinaus eine Komorbidität mit einer anderen Persönlichkeitsstörung oder einer weiteren psychischen Störung vor, gilt dies umso mehr. Daher werden zu Beginn des Buches die besonderen Probleme bei der Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen dargestellt und Lösungen erörtert. Anschließend wird ausführlich auf das Problem der Komorbiditäten eingegangen: Was Komorbiditäten psychologisch, diagnostisch und therapeutisch bedeuten und wie Therapeuten konstruktiv damit umgehen können. Es werden die speziellen Probleme bei besonders häufig auftretenden Komorbiditäten ausführlich behandelt: Wie Therapeuten schwierige Interaktionen bewältigen können und was sie therapeutisch besonders beachten sollten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Rainer Sachse
Stefanie Kiszkenow-Bäker
Komorbiditäten bei Persönlichkeitsstörungen
Praxis der Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen
Band 11
Komorbiditäten bei Persönlichkeitsstörungen
Prof. Dr. Rainer Sachse, Dipl.-Psych. Stefanie Kiszkenow-Bäker
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Rainer Sachse, Prof. Dr. Philipp Hammelstein, PD Dr. Thomas Langens
Prof. Dr. Rainer Sachse, geb. 1948. 1969–1978 Studium der Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Ab 1980 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum. 1985 Promotion. 1991 Habilitation. Privatdozent an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 1998 außerplanmäßiger Professor. Leiter des Institutes für Psychologische Psychotherapie (IPP), Bochum. Arbeitsschwerpunkte: Persönlichkeitsstörungen, Klärungsorientierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie.
Dipl.-Psych. Stefanie Kiszkenow-Bäker, geb. 1981. 2000-2006 Studium der Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. 2011 Approbation als Psychologische Psychotherapeutin. Dozentin und Supervisorin am Institut für Psychologische Psychotherapie Bochum. Psychotherapeutin in eigener Praxis in Dortmund Arbeitsschwerpunkte: Klärungsorientierte Psychotherapie, Suchttherapie, Persönlichkeitsstörungen, Verhaltenstherapie.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com by Getty Images/Kichigin
Satz: Matthias Lenke, Weimar
Format: EPUB
1. Auflage 2020
© 2020 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2995-3; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2995-4)
ISBN 978-3-8017-2995-0
http://doi.org/10.1026/02995-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
1 Worum es geht
2 Probleme bei der Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen
2.1 Einleitung
2.2 Grundlegende Probleme bei der Anwendung des DSM bzw. Diagnose von Persönlichkeitsstörungen
2.3 Unterschiedliche Aspekte der DSM-Kritik
2.4 Was ist problematisch an einer DSM-Diagnose?
2.4.1 Relative Freiheit von theoretischen Annahmen
2.4.2 Minimale Inferenzen und direkte Beobachtungen
2.4.3 Diagnostik ist eine Frage der Expertise
2.4.4 Kritik an den allgemeinen diagnostischen Kriterien für Persönlichkeitsstörungen
2.4.5 Die Kriterien-Liste von Symptomen
2.4.6 Die Schwellen-Kriterien
2.4.7 Das alternative DSM-5-Modell für Persönlichkeitsstörungen
2.4.8 Das Problem der Komorbidität
2.4.9 Spezielle diagnostische Probleme bei Klienten mit PD
2.4.10 Diagnostische Interviews
2.4.11 Persönlichkeitsstörungs-Fragebögen
2.5 Eine mögliche Lösung: Das Persönlichkeits-Störungs-Rating-System
2.6 Die Stellung von Diagnosen in der Praxis
2.6.1 Einleitung
2.6.2 Merkmale der PD-Störungsdiagnose
2.6.3 Diagnose als Puzzle
3 Das Komorbiditätsproblem
3.1 Was sind und was bewirken Komorbiditäten?
3.2 Der empirische Nachweis von Komorbiditäten
3.3 Komorbiditäten von Persönlichkeitsstörungen untereinander
3.4 Komorbiditäten von Persönlichkeitsstörungen mit Achse-I-Störungen
4 Zur Theorie von Komorbiditäten
4.1 Wechselwirkungen
4.2 Kompatible und konfligierende Komorbiditäten
4.3 Leitstörung und Modi
4.4 Therapeutische Konsequenzen
4.4.1 Erschwerung der Diagnostik
4.4.2 Therapie der Leitstörung
4.4.3 Beachtung des vorherrschenden Modus
4.4.4 Konflikte
5 Komorbiditäten von Persönlichkeitsstörungen mit Achse-I-Störungen
5.1 Einleitung
5.2 Histrionik und Panik: Funktionalität
5.3 Narzissmus und Depression
5.3.1 Depressionen
5.3.2 Persönlichkeitsstörungen: Ein System empfindlicher Balance
5.4 Persönlichkeitsstörungen und Depression
5.4.1 Unter welchen Umständen bedingen Persönlichkeitsstörungen Depressionen?
5.4.2 Manipulative Spielstrukturen: Ein anderer Weg in eine Depression
5.4.3 Psychotherapeutische Konsequenzen dieser Komorbidität
6 Komorbiditäten zwischen Persönlichkeitsstörungen
6.1 Komorbiditäten mit einer narzisstischen Störung
6.1.1 Erfolgreicher Narzissmus mit erfolgreicher Histrionik
6.1.2 Erfolgreicher Narzissmus mit Selbstunsicherheit
6.1.3 Komorbidität zwischen Narzissmus und zwanghafter Persönlichkeitsstörung
6.2 Komorbidität von histrionischer und dependenter Persönlichkeitsstörung
7 Sucht als Komorbidität bei Persönlichkeitsstörungen: Ein sehr spezielles Problem
7.1 Sucht als Störung der Affektregulation
7.2 Was hat das mit Persönlichkeitsstörungen zu tun?
7.3 Konsummotive bei unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen
7.3.1 Narzisstische Persönlichkeitsstörung und Sucht
7.3.2 Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung und Sucht
7.3.3 Histrionische Persönlichkeitsstörung und Sucht
7.3.4 Dependente Persönlichkeitsstörung und Sucht
7.3.5 Distanzstörungen und Sucht: Zwanghafte, passiv-aggressive und paranoide Persönlichkeitsstörung
7.4 Therapeutische Besonderheiten bei der Behandlung einer komorbiden Sucht
Literatur
Endnoten
|7|1 Worum es geht
In diesem Buch wollen wir uns mit zwei Problemen näher befassen, die in der psychotherapeutischen Arbeit mit persönlichkeitsgestörten Klienten immer wieder auftreten: Probleme der Diagnostik und Probleme der Komorbidität.
Probleme der Diagnostik treten vor allem zu Therapiebeginn auf, da Klienten an dieser Stelle typische Interaktionsweisen und Verarbeitungen zeigen, die es einem Therapeuten/Diagnostiker sehr erschweren, eine valide Diagnose zu stellen. Diese Probleme sollen diskutiert werden und es wird insbesondere auf Probleme mit DSM-Diagnosen eingegangen; eine alternative diagnostische Vorgehensweise wird vorgestellt.
Personen mit Persönlichkeitsstörungen (PD) weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit komorbide Störungen auf: „Störungen“ auf Achse I wie Depressionen, Ängste etc. und Komorbiditäten mit anderen Persönlichkeitsstörungen. Die Komorbiditäten erschweren dem Therapeuten sowohl die Diagnostik als auch die Therapie.
Wir wollen hier auf einige besonders häufige bzw. schwierige Komorbiditäten näher eingehen und diskutieren, welche besonderen Probleme sich für Klienten daraus ergeben und wie Therapeuten diese Probleme lösen können.
|8|2 Probleme bei der Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen
Rainer Sachse
2.1 Einleitung
Im Bereich von Psychotherapie geht es zentral um die Frage, welche therapeutischen Interventionen und Strategien ein Therapeut bei einem bestimmten Klienten anwenden soll. Um dies zu entscheiden, muss der Therapeut ein Modell vom Klienten erstellen (Sachse, 2017), ein „Fallkonzept“ entwickeln, also ein Modell darüber, welche Störung(en) der Klient aufweist und wie diese „psychologisch funktionieren“ (Becker & Sachse, 1998; Sachse, 2003, 2006a, 2006b, 2006c, 2013a,b, 2016a,b,c,d,e).
Ein wesentlicher Aspekt eines solchen Klienten-Modells ist die Diagnose: Eine psychologische Hypothese darüber, welche Störung(en) der Klient überhaupt aufweist. Solche Diagnosen sind gerade bei Klienten mit Persönlichkeitsstörungen (PD) besonders wesentlich, da Therapeuten dies schon für eine initiale Gestaltung der therapeutischen Beziehung benötigen.
Es ist deshalb von großer Bedeutung, dass ein Psychotherapeut eine bestimmte Persönlichkeitsstörung valide erfassen kann: Denn die Diagnose ist wesentlich für das weitere therapeutische Vorgehen: Von ihr hängt z. B. ab, welche Art von (komplementärer) Beziehungsgestaltung ein Therapeut einem Klienten gegenüber realisiert, auf welche Art von Tests sich der Therapeut einstellen muss, mit welchen Arten von Interaktionsproblemen er rechnen muss und wie er konstruktiv damit umgehen kann, welche Arten von Schemata er klären muss u. a. (Sachse, 1997a,b,c, 2001a,b, 2002, 2004a,b,c,d, 2006a).
Und: Ein Therapeut sollte eine PD-Diagnose auch möglichst früh im Therapieprozess stellen, denn nur dann weiß er überhaupt, welche Art von komplementärer Beziehungsgestaltung er realisieren sollte; nur dann hat er eine Vorstellung davon, welche „hypersensiblen Schemata“ ein Klient aufweist und an welchen Stellen ein Therapeut damit vorsichtig agieren sollte, um keine interaktionellen Krisen zu provozieren.1
Daher sollte ein Therapeut in der Lage sein, eine solche Diagnose, oder besser gesagt, eine Hypothese über eine solche Diagnose (Sachse, 2017) möglichst schon bis zur fünften Therapiestunde aufzustellen. Tut er dies nicht oder kann er es nicht, wird die Therapie dadurch beeinträchtigt. (Natürlich ist dies nicht für alle Klienten möglich: Bei Klienten mit Distanzstörungen wird dies in der Regel länger dauern; vgl. Sachse & Sachse, 2017.)
|9|Die Diagnose sollte natürlich auch zutreffend sein, denn nur dann „passt“ das therapeutische Handeln auf die spezifische psychische Struktur des Klienten und kann so therapeutisch wirksam werden. Ist die Diagnose unzutreffend, dann wirken die Interventionen im günstigsten Fall gar nicht, im ungünstigen Fall sind sie aber kontraindiziert und verschlechtern die Therapeut-Klient-Beziehung. Daher ist eine valide Diagnostik von PD) von großer Bedeutung.
Bedauerlicherweise ist eine solche Diagnostik jedoch sehr schwierig: Klienten mit PD zeigen spezifische Aspekte von Beziehungsgestaltung, von Schemata, von Images und Appellen etc., die eine valide Diagnostik äußerst stark erschweren, vor allem bei bestimmten diagnostischen Zugängen wie Interviews oder Fragebögen.
Daher kann man Klienten mit Persönlichkeitsstörungen nicht nur im Hinblick auf therapeutische Interventionen nicht genauso behandeln wie Klienten mit Achse-I-Störungen: Man kann dies auch schon auf diagnostischer Ebene nicht tun.
Im Folgenden soll näher auf diese diagnostischen Probleme eingegangen werden. Und es wird diskutiert, warum „klassische“ Diagnose-Systeme wie DSM oder ICD für eine frühe und therapiebezogene Diagnose wenig geeignet sind.
2.2 Grundlegende Probleme bei der Anwendung des DSM bzw. Diagnose von Persönlichkeitsstörungen
Im Folgenden soll auf einige grundlegende Probleme bei der Anwendung des DSM oder der DSM-Kriterien zur Diagnose von Persönlichkeitsstörungen (PD) eingegangen werden. Dabei möchte ich mich auf das DSM konzentrieren; ich gehe jedoch davon aus, dass sehr viele der Kritikpunkte am DSM prinzipiell in gleicher Weise für die Kriterien des ICD gelten (vgl. Dilling et al., 2006; Giere, 1999; Graubner, 2004, 2005). Daher sollen die Kritikpunkte nicht noch einmal anhand der ICD erörtert werden.
Meine Absicht ist auch nicht, eine umfassende Kritik am DSM vorzulegen.2 Vielmehr möchte ich mich auf solche Aspekte des DSM konzentrieren, die sich auf die Diagnose von PD beziehen oder die dafür relevant sind. Außerdem möchte ich einige grundlegende Probleme exemplarisch am Beispiel der narzisstischen PD (NAR) diskutieren, gehe aber davon aus, dass die Kritik sich auf die anderen definierten PD ebenso anwenden lässt.
Ich möchte zusätzlich auf die Frage eingehen, wie geeignet das DSM für eine Diagnostik ist, die die Grundlage für eine Psychotherapie bildet, also die Frage, ob sich aus DSM-PD-Diagnosen irgendwelche Indikationsentscheidungen für eine Psychotherapie ableiten lassen. Dies begründet die Frage, wie relevant das DSM überhaupt im Bereich Psychotherapie ist.
|10|Ich beziehe mich auf das Gesamtwerk des DSM, also auf DSM-I (APA, 1952), DSM-II (APA, 1968), DSM-III (Spitzer et al., 1980), DSM-III-R (Wittchen et al., 1989); DSM-IV (Saß et al., 2001), DSM-IV-TR (Saß et al., 2003) und DSM-5 (Falkai & Wittchen, 2015) sowie auf diagnostische Instrumente, die aus dem DSM (oder ICD) abgeleitet sind.
2.3 Unterschiedliche Aspekte der DSM-Kritik
Diskutiert man die Relevanz und Problematik des DSM für die Diagnose von PD, dann ist es erforderlich, verschiedene Aspekte des DSM zu unterscheiden, jeden Aspekt einzeln zu betrachten und zu kritisieren. (Da diese Aspekte aber relativ eng miteinander verwoben sind, lassen sich dabei Überschneidungen und Redundanzen leider nicht völlig vermeiden.)
Relevante Aspekte des DSM, auf die hier näher eingegangen werden soll, sind die Folgenden.
(1) Theorie-Freiheit
Das DSM hat den Anspruch, möglichst theoriefrei (oder theorie-arm) zu diagnostizieren, damit Praktiker unterschiedlicher Praxisbereiche (Therapie, Forensik, Eignungsdiagnostik) sowie Therapeuten unterschiedlicher Therapie-Richtungen das System sinnvoll anwenden können.
Diskutiert werden sollen hier die Grenzen und Nachteile dieses Vorgehens.
(2) Minimale Schlussfolgerungen
Das DSM hat den Anspruch, die diagnostischen Kriterien so zu formulieren, dass sie auf beobachtbaren Symptomen beruhen und dass diagnostische Schlüsse deshalb auf möglichst wenig Inferenzen beruhen. Damit erhebt das DSM den Anspruch, anders zu sein als andere diagnostische Vorgehensweisen. Diskutiert werden soll, ob ein solches Vorgehen überhaupt prinzipiell möglich und sinnvoll ist.
(3) Allgemeine Kriterien für Persönlichkeitsstörungen
Das DSM definiert allgemeine Kriterien für eine PD. Diese müssen diagnostisch erfüllt sein, damit man dann eine spezifische PD diagnostizieren kann. Diskutiert werden soll, wie sinnvoll die vom DSM definierten Kriterien sind und ob eine solche Vorgehensweise überhaupt sinnvoll ist.
Im DSM-5 (Falkai & Wittchen, 2015) werden z. B als Kriterium A folgende Punkte genannt (S. 885):
Ein überdauerndes Muster von innerem Erleben und Verhalten, das merklich von den Erwartungen der soziokulturellen Umgebung abweicht.
Das Muster manifestiert sich in mindestens zwei der folgenden Bereiche: Kognition, Affektivität, Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen, Impulskontrolle.
|11|Das überdauernde Muster ist unflexibel und tiefgreifend in einem weiten Bereich persönlicher und sozialer Situationen.
(4) Die Symptomlisten
Das DSM definiert jede PD durch eine Liste von Symptomen, von denen eine bestimmte Anzahl erfüllt sein muss, damit man die Diagnose vergeben kann.
Diskutiert werden soll,
inwieweit die angegebenen Symptome (für die jeweilige Störung) sinnvoll/relevant/zentral sind;
inwieweit sie dem aktuellen Forschungsstand entsprechen;
inwieweit sie einem Therapeuten therapeutische Entscheidungen ermöglichen.
(5) Die diagnostischen Kriterien
Das DSM legt Kriterien fest, ab wann man einer Person eine Störungsdiagnose vergeben kann. Diskutiert werden soll,
wie gut diese Kriterien begründet sind;
wie sinnvoll eine dichotome Kategorisierung ist (gestört/nicht gestört).
(6) Alternativ-Modell zur Diagnostik von PD im DSM-5
Das DSM-5 entwickelt ein Alternativ-Modell für die Diagnose von PD. Dieses soll kritisch diskutiert werden.
(7) Das Problem der Komorbidität
Eine wesentliche Frage ist auch, wie das DSM mit dem Problem der Komorbidität umgeht, insbesondere der Komorbidität von Persönlichkeitsstörungen untereinander: Wie wir zeigen werden, ist diese Frage von großer therapeutischer Bedeutung.
(8) Die Relevanz von DSM-Diagnosen für therapeutische Entscheidungen
Im Bereich von Psychotherapie ist eine wesentliche Frage, wie relevant DSM-Diagnosen für die Ableitung therapeutischer Entscheidungen sind. Es soll diskutiert werden, in welchem Ausmaß eine DSM-Diagnose einem Therapeuten therapeutische Entscheidungen ermöglicht.
(9) Ein sehr spezielles Problem: Die Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen
Hier soll darauf eingegangen werden, in welcher Weise Persönlichkeitsstörungen eine Diagnostik derselben erschweren: Denn anders als Klienten mit Ängsten, Depressionen etc. bringen Personen mit PD bestimmte, vor allem interaktionelle Charakteristika mit in den diagnostischen Prozess ein. Und genau diese Charakteristika erschweren in sehr hohem Maße den diagnostischen Prozess.
Diskutiert werden soll, in welchem Ausmaß gerade DSM-Diagnosen von diesen Aspekten betroffen sind.
|12|(10) Diagnostische Interviews
Die diagnostischen Interviews SKID-II (Fydrich et al., 1997) bzw. SCID-5-PD (Beesdo-Baum, Zaudig, Wittchen, 2019) sind Interview-Leitfäden, anhand derer ein Diagnostiker bei einer Person systematisch DSM-Kriterien abfragt. Diskutiert werden soll, welche Bedeutung die diskutierten Aspekte für den Einsatz der Methode haben.
(11) Fragebögen
Viele Fragebögen sind aus DSM- (oder aus ICD-)Kriterien abgeleitet. Diskutiert wird, welche Konsequenzen sich aus den diskutierten Aspekten für den Einsatz solcher Fragebögen ergeben.
2.4 Was ist problematisch an einer DSM-Diagnose?
Ich möchte nun die aufgeführten Kritikpunkte im Einzelnen behandeln.
2.4.1 Relative Freiheit von theoretischen Annahmen
Ein wesentliches Grundprinzip der DSM-Diagnostik besteht darin, die Kriterien, die für die einzelnen Störungen definiert werden, möglichst „theorie-arm“ zu halten: Man will die Kriterien auf beobachtbare Symptome stützen, die ein Diagnostiker mit einem Minimum an Inferenzen erkennen und feststellen kann (Spitzer et al., 1980, S. 7). Spitzer bezeichnen das DSM deshalb auch als „atheoretisch“: Die Kategorien sollen so „deskriptiv“ wie möglich gehalten werden. Sie sollen aus „easily identifiable behavioral signs and symptoms“ bestehen.
Diese Ausrichtung wird dann in allen DSM-Varianten konsequent weiterverfolgt (Saß et al., 2003; Wittchen, 2011; Wittchen & Hoyer, 2011).
Gründe dafür sind vor allem der Versuch, ein allgemein anwendbares Diagnose-System zu schaffen: Es soll von Praktikern aus sehr unterschiedlichen Berufsfeldern genutzt werden können (Therapeuten, Diagnostikern, Forensikern usw.). Und es soll von Therapeuten mit sehr unterschiedlichen therapeutischen Orientierungen benutzt werden können (Spitzer et al., 1980).
Außerdem wollte das DSM die Diagnostik von einer stark psychoanalytischen Orientierung befreien.
Die Grundidee einer „theorienübergreifenden Orientierung von Diagnostik“ ist an sich positiv: Denn in der Tat hat jedes System, auch jedes therapeutische System, eigene Theorien über Störungen, aus denen auch wieder unterschiedliche Vorstellungen über relevante diagnostische Kriterien folgen. Arbeitet ein Praktiker in einem bestimmten theoretischen Kontext, dann sind notwendigerweise die anzuwendenden diagnostischen Kriterien kontextabhängig. Und die Kriterien unterschiedlicher Systeme sind dann oft nicht wirklich kompatibel.
Versucht man also, ein „systemübergreifendes“ Diagnose-Instrument zu schaffen, dann ist eine Vorgehensweise wie die des DSM zwingend. Durch seine systemüber|13|greifende Anwendbarkeit hat das DSM zweifellos große Vorteile. Leider bringt dies aber auch einige Nachteile mit sich, die sich nicht prinzipiell vermeiden lassen.
Dass das DSM „theoriefrei“ sei, wird nirgendwo behauptet: Allerdings muss man annehmen, dass es mehr theoretische Implikationen enthält, als man zunächst vermutet, denn um auch nur Symptome wie „Neid“, „Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen“ oder Ähnliches zu verstehen und Beobachtungen sinnvoll auf solche Konzepte beziehen zu können, braucht man einen Bezugsrahmen. Was man genau unter „Neid“ versteht und wann man ein Bedürfnis hat, das in irgendeiner Weise beachtensbedürftig (= symptomrelevant) ist, hängt von theoretischen Annahmen (den unterschiedlichen „Wissensbasen“) ab und hier werden sich ganz sicher Interpretationen verschiedener Diagnostiker unterscheiden (vgl. schon die Diskussion der „Bedeutungskonstruktion“ bei Hörmann, 1973, 1976, 1981, 1983; Sachse, 2017).
Leider führt aber auch eine relative Theorie-Abstinenz (bei allen Vorteilen) auch zu gravierenden Nachteilen: Denn um zu wissen,
welche Symptome überhaupt warum relevant sind,
welche Symptome zentral und welche peripher sind,
welche Symptome die Grundlage für welche therapeutischen Entscheidungen sind usw.,
braucht man eine der Diagnostik zugrundeliegende (Rahmen-)Theorie: Nur eine theoretische Konzeption kann überhaupt einen solchen Interpretationsrahmen liefern!
Will man mit Diagnostik also irgendetwas mehr tun, als die bloße Feststellung des Vorliegens von Symptomen, dann muss man der Diagnostik ein theoretisches Konzept unterlegen (Caspar, 2008; Caspar & Berger, 2008; Fydrich, 1997; Laireiter, 2001, 2003)!
Tut man dies aber wie im DSM (oder im ICD) nicht, dann beschränkt man damit notwendigerweise die Einsatzmöglichkeiten des Systems. Daher braucht man neben einem „theoriearmen“ immer auch noch ein theoretisch fundiertes Diagnose-System, aus dem man dann Interpretationen, Entscheidungen, Vorgehensweisen etc. ableiten kann!
Das bedeutet auch: Wenn man nicht auf das DSM verzichten will, dann muss man das DSM durch weitere diagnostische Vorgehensweisen ergänzen.
Da es in der Psychiatrie und der Psychologie aber in gar keiner Weise so ist, dass es einheitliche Theorien über psychische Störungen gäbe, sondern die Theorien vielmehr hochgradig heterogen und kontrovers sind, bedeutet ein theoriebasiertes Diagnose-System aufzubauen auch immer, ein für einen bestimmten Ansatz spezifisches System zu entwickeln.