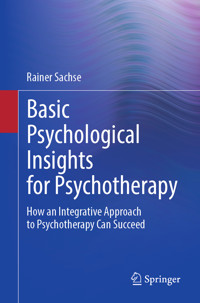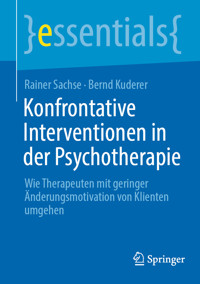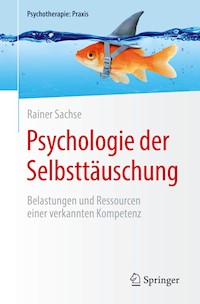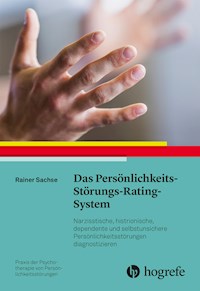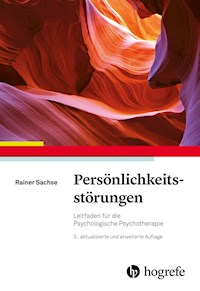
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Fortschritte der Psychotherapie
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist ein praxisorientierter Leitfaden für die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen. Es wird ein psychologisches Modell von Persönlichkeitsstörungen vorgestellt, das "Modell der Doppelten Handlungsregulation", das die charakteristischen interaktionellen Schwierigkeiten und therapeutischen Probleme von Klienten mit diesen Störungen erklärt. Aus diesem Modell werden psychologische Handlungsprinzipien und therapeutische Strategien abgeleitet, mit deren Hilfe Therapeuten die Interaktionsprobleme gut bewältigen und Klienten zu einer effektiven Veränderung führen können. Es werden alle acht "reinen" Persönlichkeitsstörungen ausführlich behandelt: ihre spezifischen Charakteristika, ihre besonderen interaktionellen Eigenheiten und spezifische therapeutische Vorgehensweisen, mit deren Hilfe Therapeuten die Klienten zu einer Veränderung motivieren können und Klienten zu einer Änderung dysfunktionaler Schemata und Verhaltensweisen anleiten können. Besonderer Wert wird auf die Bearbeitung spezifischer Interaktionsprobleme wie Tests, Vermeidungsverhalten und interaktionelle Spiele gelegt, sodass Therapeuten sich gut auf die Klienten einstellen und die spezifischen Schwierigkeiten gut meistern können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Rainer Sachse
Persönlichkeitsstörungen
Leitfaden für die Psychologische Psychotherapie
3., aktualisierte und erweiterte Auflage
Prof. Dr. Rainer Sachse, geb. 1948. 1969–1978 Studium der Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Ab 1980 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum. 1985 Promotion. 1991 Habilitation. Privatdozent an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 1998 außerplanmäßiger Professor. Leiter des Institutes für Psychologische Psychotherapie (IPP), Bochum. Arbeitsschwerpunkte: Persönlichkeitsstörungen, Klärungsorientierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © Fotolia.com / Kushnirov Avraham
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
3., aktualisierte und erweiterte Auflage 2019
© 2004, 2013 und 2019 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2906-9; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2906-0)
ISBN 978-3-8017-2906-6
http://doi.org/10.1026/02906-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
1 Wesentliche Grundkonzepte von Persönlichkeitsstörungen
1.1 Einleitung
1.2 Der Begriff „Persönlichkeitsstörung“
1.3 Stil und Störung
1.4 Das Stellen von Diagnosen
1.5 Ressourcen
1.6 Persönlichkeitsstörungen als Beziehungsstörungen
1.7 Unterschiede zu Achse-I-Klienten
1.8 Expertise der Therapeuten
1.9 Die Relevanz von DSM und ICD
2 Charakteristika von Persönlichkeitsstörungen
2.1 Einleitung
2.2 Ich-Syntonie
2.3 Änderungsmotivation
2.4 Klienten sind stark beziehungsmotiviert
2.5 Interaktionsspiele
2.6 Tests
2.7 Probleme für die Therapeuten
3 Ein allgemeines psychologisches Funktionsmodell für Persönlichkeitsstörungen
3.1 Einleitung
3.2 Das Modell der Doppelten Handlungsregulation
3.2.1 Einleitung
3.2.2 Die Ebene der authentischen Handlungsregulation oder Motivebene
3.2.3 Dysfunktionale Schemata
3.2.4 Die Ebene der intransparenten Handlungen oder Spielebene
3.3 Manipulation und Spiel
3.3.1 Einleitung
3.3.2 Der Begriff der Manipulation
3.3.3 Der Begriff „Spiel“
3.3.4 Manipulative Strategien im Lichte der Impression-Management-Forschung
3.4 Manipulation: Psychologische Begriffbestimmung
3.4.1 Definition von Manipulation
3.4.2 Reziprozität
3.5 Ziele und prinzipielle Vorgehensweisen bei der Manipulation
3.5.1 Ziele der Manipulation
3.5.2 Strategische Ziele
3.5.3 Images und Appelle
3.5.4 Inhaltliche Ziele
3.6 Manipulative Strategien
3.6.1 Komplexe Spielstrukturen
3.6.2 Positive und negative Strategien
3.6.3 Standardspiele
3.7 Eine Konsequenz auf der Motivebene: Andauernde Unzufriedenheit
3.8 Das Verhältnis von authentischem Handeln zum Spielhandeln
3.9 Langfristig negative Konsequenzen
3.10 Das System ist nicht lernfähig
3.11 Tests
4 Diagnostische Charakteristika von Persönlichkeitsstörungen
4.1 Einleitung
4.2 Beziehungsmotive
4.3 Dysfunktionale Schemata
4.4 Kompensatorische Schemata
4.5 Interaktionsspiele
4.6 Allgemeines Modell und spezifische Störungen
5 Therapeutische Strategien für Klienten mit Persönlichkeitsstörungen
5.1 Einleitung
5.2 Klärungsorientierte Psychotherapie
5.3 Klärungsorientierte Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen: Therapiephasen
5.4 Therapeutische Strategien für Phase 1
5.4.1 Modellbildung
5.4.2 Komplementäre Beziehungsgestaltung
5.4.3 Explizierung der Beziehungsmotive
5.4.4 Steuern und Internalisieren
5.4.5 Verstehen und Klären
5.4.6 Bearbeiten von Vermeidung
5.4.7 Bestehen von Tests
5.4.8 Ressourcen-Aktivierung
5.5 Therapeutische Strategien in Phase 2
5.5.1 Entwicklung eines Arbeitsauftrages
5.5.2 Beziehungskonto wieder füllen
5.5.3 Klären
5.5.4 Biographische Arbeit
5.5.5 Umgang mit Vermeidung
5.6 Therapeutische Strategien in Phase 3
5.6.1 Klärung von Schemata
5.6.2 Bearbeitung von Alienation
5.7 Therapeutische Strategien in Phase 4: Bearbeitung von Schemata
5.8 Therapeutische Strategien in Phase 5: Transfer
6 Arten von Persönlichkeitsstörungen
6.1 Einleitung
6.2 „Reine“ und „hybride“ Persönlichkeitsstörungen
6.3 Nähe- und Distanzstörungen
6.4 Unterschiede zwischen Nähe- und Distanz-Störungen
6.4.1 Vertrauen und Beziehungsaufnahme
6.4.2 Affekte und Verarbeitungsprozesse
6.4.3 Therapeutische Konsequenzen
6.4.4 Forschungsstand
6.5 Weitere spezifische Therapieansätze
6.6 Überblick über die Störungen
7 Die narzisstische Persönlichkeitsstörung
7.1 Beschreibung und Typen der Störung
7.1.1 Die bisherige Definition: Erfolgreiche Narzissten
7.1.2 Diagnostik: DSM-Kriterien: Eine Definition erfolgreicher Narzissten
7.1.3 Überblick über empirisch validierte Charakteristika von Narzissmus
7.1.4 Therapeutische Erfahrungen
7.2 Die Definition der Störung „Narzissmus“
7.2.1 Definitionskriterien von Narzissmus
7.2.2 Erfolgreiche Narzissten
7.2.3 Charakteristika gescheiterter Narzissten
7.2.4 Erfolglose Narzissten
7.3 Therapeutische Vorgehensweisen
7.3.1 Einleitung
7.3.2 Allgemeine therapeutische Strategien für „Narzissmus“
7.3.3 Therapeutische Strategien für erfolgreiche Narzissten
7.3.4 Therapeutische Strategien für gescheiterte Narzissten
7.3.5 Therapeutische Strategien für erfolglose Narzissten
8 Die histrionische Persönlichkeitsstörung
8.1 Beschreibung der Störung und Störungstypen
8.1.1 Allgemeine Charakteristika
8.1.2 Empirische Befunde
8.1.3 Prävalenz und Geschlechterunterschiede
8.1.4 Verlauf
8.1.5 Komorbidität
8.2 Beschreibung
8.2.1 Erfolgreiche und erfolglose Histrioniker
8.3 Definition der histrionischen Störung
8.3.1 Zentrale Beziehungsmotive
8.3.2 Dysfunktionale Schemata
8.3.3 Kompensatorische Schemata
8.3.4 Manipulation
8.3.5 Tests
8.3.6 Besonderheiten
8.3.7 Erfolgreiche und erfolglose Histrioniker
8.4 Therapeutische Strategien
8.4.1 Therapeutische Strategien in Phase 1
8.4.2 Therapeutische Strategien in Phase 2
8.5 Therapeutische Strategien in Phase 3
8.5.1 Klärungsprozess
8.5.2 Explizierung durch den Therapeuten
8.5.3 Trojanische Pferde
8.5.4 Biographische Arbeit
8.6 Therapeutische Strategien in Phase 4
8.7 Phase 5: Transfer
8.8 Bearbeitung von Alienation
8.9 Therapeutische Strategien bei erfolglosen Histrionikern
9 Die dependente Persönlichkeitsstörung
9.1 Therapeutische Probleme
9.2 Beschreibung der Störung
9.3 Empirische Befunde
9.4 Relevante Charakteristika
9.5 Definition der dependenten Persönlichkeitsstörung
9.5.1 Beziehungsmotive
9.5.2 Dysfunktionale Schemata
9.5.3 Kompensatorische Schemata
9.5.4 Manipulative Strategien
9.5.5 Tests
9.5.6 Besonderheiten
9.6 Therapeutische Strategien
9.6.1 Therapeutische Strategien in Phase 1
9.6.2 Therapeutische Strategien in Phase 2
9.6.3 Therapeutische Strategien in Phase 3: Klären
9.6.4 Therapeutische Strategien in Phase 4
9.7 Transfer
10 Die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung
10.1 Abgrenzung der selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung von sozialer Phobie
10.2 Beschreibung der Störung
10.3 Charakteristika der selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung
10.4 Definition der Störung
10.4.1 Zentrale Beziehungsmotive
10.4.2 Dysfunktionale Schemata
10.4.3 Kompensatorische Schemata
10.4.4 Spiele und Tests
10.4.5 Besonderheiten
10.5 Therapeutische Strategien
10.5.1 Therapeutische Strategien in Phase 1
10.5.2 Therapeutische Strategien in Phase 2
10.5.3 Therapeutische Strategien in Phase 3
10.5.4 Therapeutische Strategien in Phase 4
10.6 Transfer
11 Die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung
11.1 Beschreibung und Charakteristika der Störung
11.1.1 Beschreibung
11.1.2 Charakteristika: Empirische Ergebnisse
11.1.3 Prävalenz und Komorbidität
11.2 Definition der Störung
11.2.1 Zentrale Beziehungsmotive
11.2.2 Dysfunktionale Schemata
11.2.3 Kompensatorische Schemata
11.2.4 Manipulation
11.2.5 Tests
11.2.6 Besonderheiten
11.3 Therapeutisches Vorgehen
11.3.1 Therapeutische Strategien in Phase 1
11.3.2 Therapeutische Strategien in Phase 2
11.3.3 Therapeutische Strategien in Phase 3: Klären von Schemata
11.3.4 Therapeutische Strategien in Phase 4: Bearbeitung von Schemata
11.3.5 Spezifische Interventionen
11.4 Transfer
12 Die schizoide Persönlichkeitsstörung
12.1 Beschreibung und Charakteristika der Störung
12.1.1 Beschreibung
12.1.2 Prävalenz und Komorbiditäten
12.1.3 Weitere Charakteristika
12.2 Konzepte der KOP
12.2.1 Zentrale Beziehungsmotive
12.2.2 Dysfunktionale Schemata
12.2.3 Kompensatorische Schemata
12.2.4 Manipulation
12.2.5 Tests
12.2.6 Besonderheiten
12.3 Therapeutische Vorgehensweisen
12.3.1 Therapeutische Strategien in Phase 1
12.3.2 Therapeutische Strategien in Phase 2: Umgang mit Spielebene und Tests
12.3.3 Therapeutische Strategien in Phase 3: Klärung der Schemata
12.3.4 Therapeutische Strategien in Phase 4: Bearbeitung der Schemata
12.3.5 Spezifische Interventionen
12.4 Transfer
13 Die zwanghafte Persönlichkeitsstörung
13.1 Beschreibung und Charakteristika der Störung
13.1.1 Beschreibung
13.1.2 Prävalenz und Komorbidität
13.1.3 Biographische Erfahrungen
13.2 Definition der Störung
13.2.1 Zentrale Beziehungsmotive
13.2.2 Dysfunktionale Schemata
13.2.3 Kompensatorische Schemata
13.2.4 Manipulation
13.2.5 Tests
13.2.6 Besonderheiten
13.3 Therapeutische Strategien
13.3.1 Therapeutische Strategien in Phase 1
13.3.2 Therapeutische Strategien in Phase 2
13.3.3 Therapeutische Strategien in Phase 3
13.3.4 Therapeutische Strategien in Phase 4: Bearbeitung von Schemata
13.4 Transfer
14 Die paranoide Persönlichkeitsstörung
14.1 Beschreibung und Charakteristika der Störung
14.1.1 Beschreibung
14.1.2 Prävalenz und Komorbidität
14.2 Definition der Störung
14.2.1 Zentrale Beziehungsmotive
14.2.2 Dysfunktionale Schemata
14.2.3 Kompensatorische Schemata
14.2.4 Manipulation, Images und Appelle
14.2.5 Tests
14.2.6 Besonderheiten
14.2.7 Nähe, Distanz und Bindung
14.2.8 Ich-Syntonie, Perspektive und Vermeidung
14.2.9 Kosten
14.3 Therapeutische Strategien
14.3.1 Therapeutische Strategien in Phase 1
14.3.2 Therapeutische Strategien in Phase 2
14.3.3 Therapeutische Strategien in Phase 3: Klären von Schemata
14.3.4 Therapeutische Strategien in Phase 4: Spezifische Interventionen
14.4 Transfer
Literatur
Endnoten
|1|1 Wesentliche Grundkonzepte von Persönlichkeitsstörungen
1.1 Einleitung
Das Konzept „Persönlichkeitsstörungen“ (es wird hier dafür die Abkürzung „PD“ für „personality disorders“ gewählt) hat eine lange Geschichte, und das hat zur Folge, dass sich sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu entwickelt haben; Vorstellungen, die z. T. weit voneinander abweichen und die kaum noch kompatibel sind* .1
Neuere Entwicklungen des Konzeptes gehen davon aus, dass man Persönlichkeitsstörungen nach zwei Aspekten erfassen sollte: Man sollte konzeptualisieren, was PD im Allgemeinen psychologisch sind, und zweitens genau definieren, was, auf der Grundlage dieses allgemeinen Konzeptes, einzelne PD ausmacht.2 Solche Überlegungen wurden auch im DSM-5 aufgegriffen (APA, 2013).
Das hier vorgestellte Konzept von Persönlichkeitsstörungen verfolgt ein äquivalentes Vorgehen: Es wird ein allgemeines Modell über das „psychologische Funktionieren von Persönlichkeitsstörungen“ vorgestellt und, auf der Grundlage dieses Modells, werden die einzelnen Störungen definiert. Außerdem werden aus dem allgemeinen wie aus den spezifischen Modellen therapeutische Implikationen abgeleitet (vgl. Döring & Sachse, 2008a, 2008b, 2008c, 2017a, 2017b, 2017c).
Die Aufgabe dieses Buches soll jedoch nicht darin bestehen, die Konzeptentwicklungen nachzuzeichnen oder zu diskutieren: Die Aufgabe des Buches soll vielmehr darin bestehen, ein bestimmtes Konzept von Persönlichkeitsstörungen, nämlich das der Klärungsorientierten Psychotherapie (KOP), darzustellen. Zu diesem Zweck werden zunächst grundlegende Vorstellungen des Ansatzes über Persönlichkeitsstörungen deutlich gemacht, um aufzuzeigen, von welchen Vorstellungen hier ausgegangen werden soll.
|2|1.2 Der Begriff „Persönlichkeitsstörung“
Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass es Störungen gibt, die sehr umfassend, sehr tiefgreifend und sehr behandlungsresistent sind, und diese Störungen wurden deshalb als „Störungen der Gesamtpersönlichkeit“ (bzw. des „Charakters“) aufgefasst (vgl. Kernberg, 1978; Kretschmer, 1921; Schneider, 1923).
Nach heutigen psychologischen Analysen muss man immer noch davon ausgehen, dass diese Störungen komplex sind und dass die spezifischen psychologischen Konstellationen der Störungen diese immer noch relativ schwer behandelbar machen (vgl. Millon, 1996, 2011; O’Donohue et al., 2007): Man entfernt sich aber weitgehend von den Auffassungen, die Störungen als „Störungen der Persönlichkeit“ anzusehen. Vielmehr wird deutlich, dass die Merkmale, die eine PD charakterisieren, häufig auch schon in leichteren Ausprägungen vorkommen und dann als weitgehend „normal“ gelten: Und damit erscheinen dann „schwerere“ Ausprägungen nur noch als „Extremisierungen normal-psychologischen Geschehens“ (Fiedler, 2007; Fiedler & Herpertz, 2016) und damit als eine „Variation des Normalen“ und nicht mehr als „pathologisch“.
Damit hat eine weitgehende Tendenz zur „Entpathologisierung“ und „Normalisierung“ von „Persönlichkeitsstörungen“ eingesetzt: Weiterhin ist aber klar, dass die Störungen den Personen große Kosten erzeugen und dass es daher sinnvoll ist, sie therapeutisch zu behandeln; es ist aber auch wichtig, die Betroffenen nicht zu stigmatisieren. Wir (Sachse, Sachse & Fasbender, 2010, 2011; Sachse, Fasbender, Breil & Sachse, 2012) würden, anders als Emmelkamp und Kamphuis (2007), Persönlichkeitsstörungen damit auch nicht als eine „chronic psychiatric disorder [...] characterized by pathological personality traits“ auffassen. Ich halte es für unangemessen, von „pathologischen traits“ zu sprechen, und ich weiß auch nicht, was genau eine „psychiatric disorder“ sein soll: Da Persönlichkeitsstörungen sich gut psychologisch erklären und psychotherapeutisch behandeln lassen, sind sie aus meiner Sicht eine Domäne der Psychologie.
Es ist wesentlich, Persönlichkeitsstörungen als extreme Ausprägungen „normaler“ psychologischer Prozesse aufzufassen, die den betreffenden Personen so hohe Kosten erzeugen, dass eine Psychotherapie sinnvoll ist.
Und damit werden Klienten mit PD hier auch nicht als „infantil“, „unreif“, „pathologisch“, „schwer gestört“ oder als „charakterlich defizitär“ eingestuft oder bezeichnet: Es ist wichtig, von solchen Abwertungen wegzukommen. (Dies ist schon wichtig, um mit den Klienten eine gute therapeutische Beziehung zu gestalten!)
Im Grunde wäre es sinnvoll, auf den Begriff „Persönlichkeitsstörungen“ zu verzichten oder ihn durch den Begriff „Interaktionsstörung“ zu ersetzen. Da der Be|3|griff sich aber weitgehend eingebürgert hat, kann man ihn weiter verwenden, wenn man weiß, was man damit meinen will und was nicht.
1.3 Stil und Störung
Damit in Zusammenhang steht die Auffassung, dass eine psychologisch definierbare Einheit wie z. B. eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ein Kontinuum bildet, das von einem „leichten Stil“ bis zu einer „schweren Störung“ reicht (Kuhl, 2001; Kuhl & Kazén, 1997).
Personen mit einem leichten Stil weisen Charakteristika einer psychologischen Einheit in leichter Ausprägung auf und Personen mit einer schweren Störung weisen diese Charakteristika in einer massiven Ausprägung auf.
Eine wichtige Implikation dieser Sichtweise ist, dass es keine eindeutigen Kriterien dafür gibt, wann aus einem Stil eine Störung wird (deutlich ist, dass auch DSM- oder ICD-Kriterien vollkommen willkürlich und keineswegs empirisch validiert sind!): Im Grunde gibt es keine empirisch validen Kriterien, die angeben könnten, wann genau aus einem Stil eine Störung wird.3
Daher ist es im Psychotherapieprozess sinnvoll, jeweils mit einem Klienten auszuhandeln, ob der Klient seine Störung letztlich für so „störend“ hält, dass er eine Therapie für indiziert erachtet. Auf keinen Fall kann ein Therapeut einem Klienten eine Psychotherapie verweigern, weil er „nicht genügend Kriterien“ erfüllt; eine solche Vorgehensweise ist weder empirisch noch ethisch zu rechtfertigen.
1.4 Das Stellen von Diagnosen
Ein wichtiger Aspekt der „Entpathologisierung“ ist, dass man Diagnosen von PD nicht stellt, um Personen „abzustempeln“: Stellt man „offizielle“ Diagnosen (also solche, die an offizielle Stellen weitergeleitet werden), dann sollte man sich immer darüber im Klaren sein, dass diese durchaus gegen Klienten verwendet werden können und damit sollte man vorsichtig sein. Intern, d. h. in der Supervision, dienen Diagnosen aber ausschließlich dazu zu verstehen, was genau die Störung des Klienten ist, um dann konstruktiv mit dem Klienten umgehen zu können.
Der Sinn von Diagnosen ist ausschließlich, daraus sinnvolle therapeutische Maßnahmen ableiten zu können (Sachse, 2017a).
|4|Daher ist es prinzipiell sinnvoll, dass ein Therapeut
eine Diagnose vergibt,
sich bewusst ist, dass diese immer eine mehr oder weniger gut belegte Hypothese ist, also eine „Arbeitshypothese für die Psychotherapie“,
eine Diagnose möglichst früh im Prozess (und als „erste Hypothese“) erstellt,
eine PD bei einem Klienten nie übersieht.
Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, z. B. von „Narzissmus“ zu sprechen, obwohl der Klient lediglich einen „Stil“ aufweist: Denn es kann auch dann schon hilfreich sein, weil man auf Spiele, Motivationsprobleme etc. vorbereitet ist.
Allgemein ist es sinnvoll, einen Persönlichkeitsstil bzw. eine Störung im Therapieprozess zu berücksichtigen, d. h. also zu diagnostizieren und im therapeutischen Vorgehen zu berücksichtigen, wenn
Aspekte des Stils oder der Störung dem Klienten Kosten bereiten, die er nicht will,
und/oder
Aspekte des Stils oder der Störung in der therapeutischen Interaktion relevant werden, indem sie z. B. zu manipulativem Verhalten führen, das den Interaktionsprozess mit dem Therapeuten signifikant beeinflusst.
In aller Regel sind aber schon leichte Stile relevant, also sollten Therapeuten generell
auf PD achten,
PD schnell erkennen und valide diagnostizieren können,
konstruktiv mit PD umgehen können.
1.5 Ressourcen
In den Konzeptionen von Persönlichkeitsstörungen geht man zunehmend weg von einer alleinigen Konzentration auf Defizite und hin zu einer Konzentration auf Ressourcen. So erkennt man zunehmend, dass PD immer auch bestimmte Ressourcen implizieren: Die Klienten sind aufgrund ihrer Schemata besonders sensibel für bestimmte Informationen, sie können bestimmte Handlungen sehr gut etc. Meist ist das Problem nicht, dass sie keine Ressourcen aufweisen, sondern dass sie ihre Ressourcen nicht konstruktiv einsetzen (können).
Und diese Ressourcen kann man therapeutisch gut einsetzen, wenn es darum geht, Schemata zu verändern, alternative Handlungsmuster zu entwickeln usw.: In den „Lösungsphasen“ der Therapie erweist sich diese Ressourcenorientierung als sehr hilfreich.
|5|Und: Das Fokussieren auf Ressourcen bringt die Konzepte noch weiter weg von Tendenzen zur „Pathologisierung“ und Stigmatisierung.
Die Konzeption hat auch Konsequenzen für die Definition von Therapiezielen: Denn das Ziel „Heilung“ ist gar nicht sinnvoll (abgesehen davon ist es auch nicht realistisch erreichbar): Denn Klienten müssen viele ihrer Aspekte gar nicht aufgeben.
Klienten müssen oft nur lernen, ihre Ressourcen sinnvoller einzusetzen, und lernen, ihre Strukturen konstruktiv zu nutzen und unter ihre eigene Kontrolle zu bekommen.
Auch empirisch ist nicht damit zu rechnen, dass eine Psychotherapie eine Störung „beseitigt“: Sie macht aus einer Störung einen Stil, und das erhöht die Lebensqualität der Klienten schon beträchtlich.
1.6 Persönlichkeitsstörungen als Beziehungsstörungen
Wissenschaftliche Studien machen deutlich, dass ein zentraler Kernbereich von „Persönlichkeitsstörungen“ Probleme auf der Ebene von Beziehungen und Interaktionen sind (vgl. die Forschungsarbeiten bei Sachse, 2004a; Sachse, Sachse & Fasbender, 2010, 2011; Sachse, Fasbender, Breil & Sachse, 2011, 2012). Daher werden in vielen theoretischen Konzepten Persönlichkeitsstörungen zentral als Beziehungs- oder Interaktionsstörungen aufgefasst.4 Diese Auffassung wird auch im Konzept der Klärungsorientierten Psychotherapie (KOP) vertreten. Hier wird angenommen, dass PD zwar psychologisch komplexe Störungen sind, die viele psychologische Funktionsbereiche betreffen, dass jedoch der „zentrale Kern“ von PD eine Beziehungsstörung ist. Aus dieser Annahme kann letztlich auch abgeleitet werden, warum Klienten mit PD im Therapieprozess „schwierige Klienten“ sind: Sie bringen nämlich ihre interaktionellen Probleme in die therapeutische Beziehung mit.
1.7 Unterschiede zu Achse-I-Klienten
Aus den theoretischen Konzeptionen lässt sich auch gut ableiten, warum Klienten mit PD an Therapeuten ganz andere Anforderungen stellen als sogenannte „Achse-I-Klienten“ des DSM-IV (also Klienten, die z. B. Angststörungen aufweisen): Klienten mit PD realisieren von Anfang an andere Arten der Beziehungsgestaltung, reagieren anders auf therapeutische Interventionen und brauchen andere Arten psychotherapeutischer Strategien als Achse-I-Klienten.
|6|Daher sind Klienten, die neben einer Achse-I-Störung noch eine komorbide PD aufweisen, mit Klienten mit einer „reinen“ Achse-I-Störung auch nicht vergleichbar.
Und somit sind auch Therapieergebnisse, die an „reinen“ Achse-I-Klienten gewonnen wurden, nicht auf Klienten mit PD übertragbar (vgl. Gouzoulis-Mayfrank et al., 2008).
1.8 Expertise der Therapeuten
Da Klienten mit PD deutlich höhere Anforderungen an Therapeuten stellen, benötigen Therapeuten für die Behandlung von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen eine deutlich höhere Expertise als für die Behandlung von Achse-I-Klienten.5
Die Therapeuten müssen hier eine hoch flexible Beziehungsgestaltung beherrschen, sie müssen mit sogenannten „Tests“ umgehen können, sie müssen konfrontative Interventionen einsetzen können, mit manipulativem Interaktionsverhalten umgehen können, affektive Schemata bearbeiten können usw. Und vor allem müssen sie in der Lage sein, schnell eine PD zu erkennen und Hypothesen über die Art der Persönlichkeitsstörung zu bilden. Dies setzt die Fähigkeit zu einer schnellen und sicheren Informationsverarbeitung und Modellbildung voraus, erfordert hohes strategisches Wissen, schnelle Handlungsplanung und Interventionsbildung etc. (Sachse, 2006a, 2006b, 2006d, 2009a, 2013b; Sachse, Fasbender & Hammelstein, 2012).
1.9 Die Relevanz von DSM und ICD
Aus meiner Sicht erlauben die bisherigen Diagnose-Systeme DSM-IV (Saß et al., 1996), DSM-5 (Falkai & Wittchen, 2015) und ICD-10 (Dilling et al., 1992) nur eingeschränkt eine Diagnose von Persönlichkeitsstörungen. Allerdings muss man davon ausgehen, dass Klienten mit Persönlichkeitsstörungen Charakteristika aufweisen, die eine Diagnose sehr erschweren, wie z. B.:
hohes Misstrauen,
damit: Tendenz, wenig von sich preiszugeben,
starke Tendenz, Images zu produzieren,
schlechte Repräsentation eigener Problemanteile etc.
Daher können „klassische“ Diagnose-Systeme immer nur „diagnostische Hypothesen“ liefern, insbesondere zu Therapiebeginn (vgl. Sachse, 2006a, 2006d; Sachse & Breil, 2011; Sachse, Sachse & Fasbender, 2011; Sachse, Fasbender, Breil & Sachse, 2012).
|7|Darüber hinaus gibt es noch weitere Probleme mit DSM und ICD:
Der Stand der psychologischen Konzeptentwicklung im Bereich von Persönlichkeitsstörungen wird von DSM und ICD nicht einmal ansatzweise zur Kenntnis genommen.
Die Störungskriterien werden auf wenige reduziert, wobei sehr viele der inzwischen empirisch gesicherten Kriterien unberücksichtigt bleiben (siehe auch die Ausführungen in diesem Buch).
Es werden keine zentralen Kriterien definiert, obwohl empirisch wie theoretisch deutlich ist, dass nicht alle Charakteristika gleich relevant sind.
Wesentliche „Tiefen-Charakteristika“ wie Motive, Schemata etc. werden gar nicht berücksichtigt.
Die Kriterien gehen nicht auf die vorherrschende Position ein, Persönlichkeitsstörungen als Beziehungsstörungen zu konzipieren.
Die Kriterien dafür, ab wann eine Störung eine Störung ist, sind in keiner Weise empirisch validiert und vollkommen willkürlich; aus therapeutischer Sicht sind sie z. T. nicht nachvollziehbar.
Die vom DSM angegebenen „Cluster“ sind unempirisch und fassen Störungen zusammen, die komplett heterogen sind und die weder theoretisch noch therapeutisch sinnvolle Muster bilden.
Das DSM-5 ist in diesen Hinsichten kaum ein Fortschritt; auch Persönlichkeitsstörungen nicht mehr zu definieren, kann sicher nicht als Gewinn betrachtet werden.
Aus meiner Sicht kann ein Therapeut die DSM- und ICD-Kriterien als nützliche Heuristiken verwenden.
Ich bin jedoch der Ansicht, dass es unsere Aufgabe als „Scientific practioneer“ ist, Störungen zu beschreiben, zu analysieren, zu verstehen und aufgrund unseres Verständnisses angemessen zu therapieren. Unsere Aufgabe ist nicht, sie zu normieren, Diskussionen zu erschweren und Entwicklungen zu hemmen. Daher sind aus meiner Sicht DSM und ICD diagnostische Heuristiken.
Als Ergänzung zum DSM können vor allem Ratingsysteme im Therapieprozess eingesetzt werden.6
Die Vorteile dieser Vorgehensweisen bestehen vor allem darin, dass sie auf konkretem Interaktionsverhalten des Klienten basieren, also berücksichtigen, wie der Klient handelt, nicht nur, was er inhaltlich äußert.
Hochgestellte Zahlen verweisen auf weiterführende Literaturangaben in den Endnoten auf Seite 360.
|8|2 Charakteristika von Persönlichkeitsstörungen
2.1 Einleitung
Hier sollen, sozusagen als eine Art „advanced organizer“, wesentliche allgemeine Charakteristika von Persönlichkeitsstörungen zusammengefasst werden, auch in Unterscheidung zu Achse-I-Störungen: Die Frage ist also, was kennzeichnet Klienten mit PD und welche speziellen „Eingangsvoraussetzungen“ bringen die Klienten mit in die Therapie?
2.2 Ich-Syntonie
Auf den Aspekt der „Ich-Syntonie“ (Vaillant & Perry, 1988) hat speziell Fiedler (2007; Fiedler & Herpertz, 2016) aufmerksam gemacht: Eine Störung ist dann „ich-synton“, wenn wesentliche Aspekte der Störung von der betroffenen Person gar nicht als „störend“, als problematisch und damit als „änderungsbedürftig“ wahrgenommen werden; vielmehr werden diese Aspekte von der Person als „zum ich gehörig“, als „Teil der eigenen Identität“ wahrgenommen.
Dagegen ist eine Störung „ich-dyston“, wenn wesentliche Aspekte von der Person als „störend“ erlebt werden: Sie will diese Aspekte nicht und erlebt sie als fremd, als „änderungsbedürftig“.
Anders als Achse-I-Störungen, die meist ich-dyston sind, sind PD in der Regel ich-synton: Wie stark die Ich-Syntonie ist, hängt von der Art der Störung (z. B. ist die selbstunsichere Störung wenig, die zwanghafte PD sehr hoch ich-synton) und von der Stärke der Störung ab.
|9|2.3 Änderungsmotivation
Von der Ich-Syntonie hängt stark das Ausmaß der Änderungsmotivation ab, mit dem Klienten in Therapie kommen: Änderungsmotivation ist die Tendenz, Aspekte der eigenen Person aktiv ändern zu wollen.
Änderungsmotivation impliziert,
dass eine Person erkennt, dass ihr System ihr Kosten erzeugt,
dass diese Kosten relevant sind und sie die Kosten nicht will,
dass eine Veränderung Kosten reduzieren und Ziele erreichbar machen kann,
dass sie die Kosten selbst erzeugt und dass sie die Ziele aktiv verfolgen muss (Sachse, Langens & Sachse, 2012).
Ist eine Störung ich-synton, dann kann eine Person zwar erkennen, dass sie Kosten hat und dass sie die Kosten nicht will, sie erkennt aber nicht, dass sie die Kosten selbst verursacht.
Und damit ist sie „kostenreduktionsmotiviert“, d. h. sie will, dass die Kosten reduziert werden, sie ist aber keineswegs geneigt, selbst etwas dafür zu tun. Oft ist sie sogar „stabilisierungsmotiviert“, d. h. sie will ihr System gerade nicht verändern, sondern „nur“ verhindern, dass es sie etwas kostet.
Dies bedeutet: Die meisten Klienten mit PD sind zu Beginn der Therapie im Hinblick auf Aspekte ihrer PD nicht änderungsmotiviert.
Oder anders gesagt: Bei Klienten mit PD ist Änderungsmotivation keine Ausgangsbedingung für Psychotherapie, sondern Änderungsmotivation muss im Laufe der Therapie geschaffen werden. Und: Es ist eine zentrale Aufgabe der Psychotherapeuten, eine solche Änderungsmotivation zu schaffen (vgl. Sachse, 2009b, 2015b; Sachse & Langens, 2015; Sachse, Langens & Sachse, 2012).
Die Klienten können aber durchaus therapiemotiviert sein: Sie können motiviert sein, ihre Kosten zu reduzieren oder sie vom Therapeuten reduzieren zu lassen. Das Problem ist manchmal, dass Therapeuten diese Motivation tatsächlich für Änderungsmotivation halten, was aber nicht stimmt.
2.4 Klienten sind stark beziehungsmotiviert
Klienten mit PD weisen sehr starke Beziehungsmotive auf und kommen oft in Therapie, um vom Therapeuten diese Motive befriedigt zu bekommen. Aufgrund der starken Beziehungsmotivation und der starken Ich-Syntonie kommen sie oft nicht in Therapie, um therapeutisch zu arbeiten: Daher nehmen sie auch entspre|10|chende Strategien von Therapeuten oft nicht an, was Therapeuten oft als „Sabotage“ erleben (vgl. Sachse, 1997a, 1999a, 1999b, 2006c, 2013b).
Die starke Beziehungsmotivation impliziert, dass Klienten mit PD oft primär in Therapie kommen, um vom Therapeuten bestimmte Arten von Beziehung angeboten zu bekommen, also um sich gewissermaßen eine bestimmte Art von Beziehung „abzuholen“.
Außerdem weisen viele Klienten mit PD ein hohes Ausmaß an Misstrauen allen Interaktionspartnern gegenüber auf: Solange der Therapeut nicht durch eine gute Beziehungsgestaltung Vertrauen aufbaut (oder, wie wir sagen: Beziehungskredit schafft), sind sie nicht zu einer therapeutischen Kooperation bereit.
Klienten können hier dann „Doppelbotschaften“ senden:
„Mir geht es schlecht, ich brauche Hilfe, tun Sie was!“
und
„Ich kann nichts machen, ich kann nicht mitarbeiten, es ist alles zu schwierig!“
Gehen die Therapeuten dann nach der Devise vor, „es muss etwas geschehen“, fahren sie die Therapie „vor die Wand“, weil die Klienten noch überhaupt nicht motiviert sind, sinnvoll therapeutisch mitzuarbeiten.
Aus der extremen Beziehungsmotivation resultiert, dass ein Therapeut als Erstes eine starke komplementäre Beziehungsgestaltung realisieren muss; erst dann, wenn er über ausreichenden „Beziehungskredit“ verfügt, kann er anfangen, gezielte therapeutische Strategien zu realisieren.
2.5 Interaktionsspiele
Personen mit PD realisieren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogenannte „Interaktionsspiele“: d. h. sie verwenden intransparente, manipulative Handlungen in deutlich höherem Ausmaß als Personen ohne PD. Mit solchen manipulativen Handlungen, die man auch als „Interaktionsspiele“ (vgl. Tedeschi et al., 1973, 1985; Tedeschi & Norman, 1985; Tedeschi & Riess, 1981) bezeichnet, bringen sie Interaktionspartner oft in Probleme.
Wichtig ist es zu sehen, dass wir (Sachse, Sachse & Fasbender, 2011) „manipulative Handlungen“ an sich weder für problematisch noch für „ehrenrührig“ halten: Nach der „Impression-Management-Theorie“ (vgl. Mummendey, 1995; Tedeschi et al., 1985) ist „Manipulation“ ein normales Interaktionsverhalten und ein Aspekt sozialer Kompetenz. Das Problem ist nicht die Manipulation an sich, sondern das Ausmaß der Manipulation bzw. die „Dosis“: Mit einem hohen Ausmaß an manipulativem Handeln verärgert man langfristig Interaktionspartner.
|11|Personen mit PD weisen ein recht hohes Maß an manipulativem Interaktionsverhalten auf: Sie realisieren dazu Images (d. h. sie produzieren bestimmte „Bilder“, Annahmen, Überzeugungen) von sich beim Interaktionspartner (IP), die keineswegs mit der „Realität“ übereinstimmen müssen! Und sie senden Appelle, d. h. sie veranlassen IP zu bestimmten Handlungen, ohne dass die IP diese „Manöver“ verstehen oder durchblicken (vgl. Sachse, 2004b, 2004c, 2007a, 2014a; Sachse & Sachse, 2006; Sachse, Sachse & Fasbender, 2010).
Klienten mit PD zeichnen sich nun dadurch aus, dass sie solche manipulativen Interaktionshandlungen nicht nur in hohem Ausmaß aufweisen, sondern dass sie diese auch in die therapeutische Interaktion einbringen: Sie verwickeln damit Therapeuten in Interaktionsspiele. Erkennen die Therapeuten dies nicht und/oder können sie nicht konstruktiv damit umgehen, können sie in große therapeutische Probleme geraten.
In welchem Ausmaß die Klienten ihre Therapeuten manipulieren, ist von der Art der Störung (Klienten mit histrionischer Störung manipulieren stark, Klienten mit selbstunsicherer Störung manipulieren nur schwach) sowie von der Stärke der Störung abhängig.
2.6 Tests
Klienten mit PD verwenden manchmal sogenannte „Tests“ (Silberschatz et al., 1989, 1990; Weiss et al., 1986): Tests sind Verhaltensweisen, mit deren Hilfe der Klient feststellen will, ob ein Therapeut „echt“ ist, ob er das Beziehungsangebot ernst meint, ob er zuverlässig ist u. ä.
Um das zu testen, wird der Therapeut z. B. kritisiert: Dem Klienten geht es aber nicht um Kritik, er will auch therapeutische Inhalte nicht mit dem Therapeuten diskutieren; er will „nur“ feststellen, wie der Therapeut damit umgeht. Besteht der Therapeut den Test, dann erhält er vom Klienten deutlich Beziehungskredit; „fällt der Therapeut aber durch“, dann kann es sein, dass der Klient die Therapie beendet.
Tests sind somit gewissermaßen „Nagelproben“ für die Therapie, und ein Therapeut sollte wissen, welche Arten von Tests auf ihn zukommen können und wie er sie bestehen kann.
2.7 Probleme für die Therapeuten
Aus den angegebenen Klienten-Charakteristika resultieren oft typische Probleme für Therapeuten.
|12|Klienten mit Persönlichkeitsstörungen weisen meist zu Therapiebeginn keine „Änderungsmotivation“ auf: Sie sehen ihr Handeln meist nicht als problematisch an und haben keine Intention, ihre Struktur zu verändern.
Die Klienten weisen oft sogar eine „Stabilisierungsmotivation“ auf: Sie kommen oft in Therapie, um ihr System mit Hilfe des Therapeuten zu stabilisieren, d. h. sie machen Therapie, um ihr System nicht ändern zu müssen (Sachse, 2015b).
Therapeuten haben oft große Schwierigkeiten, dies zu erkennen; einerseits, weil es von den Klienten nicht explizit gemacht wird, und andererseits, weil die Therapeuten gar nicht wissen, wie man die Motivation der Klienten im Prozess analysieren kann.
Klienten mit PD sind oft beziehungsmotiviert: Sie kommen in Therapie, um eine bestimmte Beziehung angeboten zu bekommen.
Die Klienten sind aufgrund ihrer Stabilisierungsintention und ihrer Beziehungsmotivation zwar zur Therapie motiviert, sie sind aber nicht motiviert, an der Veränderung ihrer Annahmen, Motive, Ziele usw. zu arbeiten.
Strebt der Therapeut eine solche Bearbeitung an, wird er vom Klienten oft blockiert: Klienten verfügen über eine Reihe von Strategien, um Bearbeitung systematisch zu vermeiden und Therapeuten systematisch zu blockieren.
Kennt und versteht ein Therapeut diese Strategien nicht, fühlt er sich matt gesetzt, hilflos und reagiert oft ärgerlich auf den Klienten; seine Interventionen verschlimmern dann in aller Regel das Problem.
Klienten thematisieren ihre Beziehungsprobleme meist nicht; der Therapeut kann sie daher oft nur schwer erkennen. Er versteht dann nicht, dass das Problem des Klienten eben nicht nur aus „Panik“ o. ä. besteht, sondern dass es sich um ein massives Interaktionsproblem handelt.
Da ein Therapeut oft nicht erkennt, worum es sich bei dem Problem handelt und/oder keine geeigneten Interventionen hat, um das Problem deutlich zu machen, ist er hilflos, blockiert und langfristig frustriert.
Therapeuten konzentrieren sich dann oft auf die Probleme und Ziele, die die Klienten explizit angeben: z. B. Panik, Abhängigkeiten, Somatisierungsstörungen usw.
Der Therapeut wendet dann spezifische Methoden zur Behandlung dieser Störungen an und stellt fest, dass diese nicht so wirken, wie sie „normalerweise“ wirken (gar nicht oder sie verschlimmern das Problem oder es tauchen ständig neue Probleme auf oder der Klient wendet die Methode gar nicht an usw.).
Der Therapeut, der nur ein eingeschränktes Modell vom Klientenproblem hat, versteht diese inner-therapeutischen Probleme nicht; er kann sich nicht auf den Klienten einstellen; manchmal fordert er vom Klienten, dass sich dieser auf den Therapeuten/die Therapie einstellt; dies ist jedoch meist wenig erfolgreich.
Selbst wenn ein Therapeut erkennt, dass der Klient eine Persönlichkeitsstörung aufweist, dann weiß er sehr oft nicht, welche therapeutischen Konse|13|quenzen daraus resultieren sollen, da er kein spezifisches Analyse- und Handlungs-Wissen für diese Klienten besitzt.
Auf diese Weise kann diesen Klienten sehr oft nicht effektiv therapeutisch geholfen werden.
Klienten mit Persönlichkeitsstörungen sind jedoch nicht nur deshalb schwierige Klienten, weil sie einige Eingangsvoraussetzungen nicht mitbringen, die sich für die Therapie als hilfreich erweisen. Das Hauptproblem für die Therapeuten besteht darin, dass die Klienten Beziehungsprobleme aufweisen und diese in der Beziehung zum Therapeuten aktuell in der Therapie „agieren“: sie thematisieren oder bearbeiten diese Probleme nicht, sie „leben“ diese Probleme in der Therapie. Damit wird der Therapeut unvermittelt, ohne dass er dies verhindern kann und oft auch ohne dass er dies richtig versteht, von einem „Partner in einem Therapieteam“ zu einem „Teil des Problems“.
Es ist daher bei der Entwicklung einer effektiven Therapiekonzeption für Klienten mit Persönlichkeitsstörungen von zentraler Bedeutung, den Therapeuten Möglichkeiten zum Umgang mit den unmittelbar im Therapieprozess auftretenden Interaktionsproblemen an die Hand zu geben. Eine effektive Therapie für diese Klienten muss daher in sehr hohem Ausmaß eine prozessorientierte, interaktionsorientierte Therapie sein.
|14|3 Ein allgemeines psychologisches Funktionsmodell für Persönlichkeitsstörungen
3.1 Einleitung
In diesem Kapitel wird ein allgemeines psychologisches Funktionsmodell für Persönlichkeitsstörungen vorgestellt: Das Modell der Doppelten Handlungsregulation. Dieses Modell spezifiziert, welche psychologischen Variablen bei PD eine Rolle spielen, wie diese Variablen interagieren und welche Konsequenzen aus den Interaktionen resultieren.7 Das Modell der Doppelten Handlungsregulation stellt damit ein theoretisches Rahmenmodell für Persönlichkeitsstörungen dar.
3.2 Das Modell der Doppelten Handlungsregulation
3.2.1 Einleitung
Grundlage dieses Modells ist die Annahme, dass Persönlichkeitsstörungen als Beziehungs- oder Interaktionsstörungen aufgefasst werden können. Zwar sind Persönlichkeitsstörungen komplexe Störungen, die Handeln, Denken, Fühlen, spezifische Formen der Informationsverarbeitung usw. einschließen; dennoch kann man annehmen, dass dysfunktionale Überzeugungen über Beziehungen, dysfunktionale interaktionelle Intentionen, dysfunktionale Arten der Beziehungsgestaltung den Kern der Störung bilden (vgl. Abbildung 1).
Das Modell heißt Modell der „doppelten“ Handlungsregulation, weil davon ausgegangen wird, dass es zwei Handlungsebenen gibt:
Die „Motivebene“ oder Ebene der authentischen Handlungsregulation;
die „Spielebene“ oder Ebene der manipulativen oder intransparenten Handlungsregulation.
Auf der Motivebene folgt die Person ihren „tatsächlichen“ Motiven und Zielen, ihren „Annäherungszielen“, also solchen Zielen, deren Erreichung positive Af|15|fekte erzeugt und Zufriedenheit nach sich zieht. Diese Effekte befriedigen das Motiv und führen dazu, dass das Motiv langfristig „gesättigt“ wird und an Relevanz abnimmt.
Abbildung 1: Das Modell der doppelten Handlungsregulation
Auf dieser Ebene handelt die Person auch „authentisch“, d. h. sie handelt so, dass ein Interaktionspartner ihre Ziele erkennen oder rekonstruieren kann: Die Person „meint was sie sagt“ und handelt so, dass ihr Handeln prinzipiell mit den Motiven in Einklang steht.
Auf der Spielebene verfolgt die Person bereits interaktionelle Ziele, die nicht die „wirklichen“ Motive abbilden, sondern explizite, oft fremdmotivierte Ziele im Sinne von Vermeidungszielen sind: Die Normen und Regeln bilden meist gar nicht das ab, was die Person „eigentlich“ möchte und was sie tatsächlich zufrieden stellt. Normen, das muss einem Therapeuten immer klar sein, sind Grundlagen extrinsischer Motivation (vgl. Deci, 1975, 1980; Deci & Ryan, 1980a, 1980b, 1982, 1985, 2000) und erfüllen damit auch alle psychologischen Charakteristika einer solchen Motivation.
Schon in diesem Sinne handelt die Person hier also nicht „authentisch“. Sie handelt auf dieser Ebene aber auch insofern nicht authentisch, als sie Interaktions|16|partner auch täuscht: Sie sendet nämlich hier Images, und diese Images sind meistens entweder übertrieben oder schlicht unzutreffend. Indem sie den Interaktionspartnern aber solche Bilder „vormacht“, täuscht die Person die Interaktionspartner (mehr oder weniger) systematisch. Aufgrund des Images wird der Interaktionspartner dann durch die Appelle zum Handeln veranlasst: Da er dann aber die Images der Person „glaubt“ und annimmt, handelt er im Grunde aufgrund falscher Voraussetzungen: Er wird dabei zu Handlungen veranlasst, die er ohne das Image (also ohne die Täuschung) möglicherweise gar nicht ausgeführt hätte. Der Appell selbst, das muss man sehen, ist dann wieder transparent, d. h. dem Interaktionspartner wird (mehr oder weniger) deutlich mitgeteilt, was er tun oder nicht tun sollte.
Dies ist ein zentraler Aspekt manipulativen Handelns: Durch manipulatives Handeln soll ein Interaktionspartner zu Handlungen veranlasst werden, von denen der Manipulierende annimmt, dass er diese von sich aus nicht ausführen würde.
3.2.2 Die Ebene der authentischen Handlungsregulation oder Motivebene
Das Modell geht davon aus, dass eine Person schon als Kind oder Jugendlicher eine Reihe von zentralen Beziehungsmotiven aufweist, wie das Motiv nach Anerkennung, Wichtigkeit, Verlässlichkeit, Solidarität, Autonomie und Grenzen/Territorialität.8
Das Motiv nach Anerkennung ist das Motiv, von anderen (relevanten) Personen positives Feedback zu erhalten, also das Feedback zu erhalten, „ok“ zu sein, liebenswert zu sein, über positive Eigenschaften zu verfügen, als Person geschätzt zu werden.
Das Motiv nach Wichtigkeit ist das Motiv, im Leben einer anderen Person eine wichtige Rolle zu spielen und dies rückgemeldet zu bekommen: Man möchte für eine andere (relevante) Person eine Bedeutung haben.
Das Motiv nach Verlässlichkeit ist das Motiv, sich darauf verlassen zu können, dass eine Beziehung stabil, überdauernd und belastbar ist.
Das Motiv nach Solidarität ist das Motiv, dass man von einer anderen (relevanten) Person Hilfe, Unterstützung, Zuspruch, Schutz u. a. bekommt, wenn man dies benötigt.
Das Motiv nach Autonomie ist das Motiv, dass andere (relevante) Personen respektieren, dass man eigene Entscheidungen trifft, in wesentlichen Bereichen selbstbestimmt handelt und damit auch für sich selbst Verantwortung übernimmt.
|17|Das Motiv nach Grenzen/Territorialität ist das Motiv, dass andere (relevante) Personen akzeptieren, dass man eigene persönliche Domänen mit Grenzen definieren kann, die man schützen darf und in die andere nicht ohne eigene Erlaubnis eindringen dürfen (z. B. die Domäne „eigener Körper“, „eigenes Zimmer“, eigener Schreibtisch“ u. a.).
Dabei bilden diese Motive eine Hierarchie, d. h. für eine bestimmte Person ist ein Motiv zentral (hoch in der Hierarchie), weitere noch wichtig und andere sind relativ unwichtig (welche Beziehungsmotive jeweils zentral sind, kennzeichnet auch eine spezifische PD).
Diese Motive sind bei einer Person auf der Ebene „interaktioneller Ziele“ konkretisiert bzw. „operationalisiert“ in konkrete, situationsbezogene Ziele. So ist z. B. das Motiv „Wichtigkeit“ operationalisiert in Ziele wie:
Ich möchte von anderen Aufmerksamkeit erhalten.
Ich möchte von anderen wahrgenommen werden.
Ich möchte von anderen ernst genommen werden.
Ich möchte von anderen respektiert werden.
Ich möchte von anderen gesehen werden.
Ich möchte von anderen Signale der „Zugehörigkeit“ erhalten u. ä.
Die Person richtet nun ihr Handeln, insbesondere ihr interaktionelles Handeln danach aus, die zentralen Motive bzw. die daraus abgeleiteten interaktionellen Ziele zu befriedigen oder, genauer gesagt, von anderen befriedigt zu bekommen (denn es sind „Beziehungsmotive“ und die können nur durch andere Personen befriedigt werden!). Dazu nutzt die Person beim Handeln Verarbeitungs- und Handlungskompetenzen und, je nach dem, wie effektiv sie handelt, erfährt sie positive Konsequenzen (andere verhalten sich motiv-komplementär = motiv-befriedigend) oder negative Konsequenzen (andere verhalten sich nicht motiv-komplementär oder sogar motiv-verletzend).
Diese Ebene heißt „Ebene der authentischen Handlungsregulation“, weil auf dieser Ebene die Person meist so handelt, dass ihre interaktionellen Ziele dem Interaktionspartner transparent werden (können), der Interaktionspartner also weiß (oder rekonstruieren kann), was für Ziele die Person hat, Effekte antizipieren kann und damit weiß, worauf er sich einlässt. Oftmals ist eine Befriedigung von Motiven auch nur dann zu erreichen, wenn dem Interaktionspartner die Intentionen der Person klarwerden (so kann eine Frau nicht, auch nicht positiv, auf ein Annäherungsverhalten eines Mannes reagieren, wenn sie sein Verhalten gar nicht als „Annäherung“ identifizieren, also seine Absichten gar nicht verstehen kann!).
Um so zu handeln, dass die Handlungen zu positiven Konsequenzen führen können, benötigt eine Person Kompetenzen. Man kann hier zwischen Handlungskompetenzen und Verarbeitungskompetenzen unterscheiden (Sachse, 1999a).
|18|Handlungskompetenzen setzen sich zusammen aus einem Wissen über Handlungsstrategien („Was kann ich in bestimmten Situationen tun, um bestimmte Ziele zu erreichen?“) und der Fähigkeit, Strategien flexibel zu modifizieren und anzupassen. Die Handlungskompetenz einer Person ist umso höher, je größer ihr Repertoire an Handlungsstrategien ist und je flexibler (und schneller) sie diese Strategien adaptieren kann.
Verarbeitungskompetenzen beinhalten die Fähigkeit, Situationen, vor allem soziale Situationen gut und schnell analysieren und verstehen zu können, und sie beinhalten insbesondere die Fähigkeit zur sozialen Empathie: Die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinversetzen zu können, (schnell) zu erkennen, was ein Interaktionspartner will, welche Einstellungen er hat, auf welche Verhaltensweisen er positiv reagiert u. a. Verarbeitungskompetenzen haben damit viel mit einer „Theory of Mind“ (Fodor, 1978; Förstl, 2007; Premack & Woodruff, 1978) zu tun: Personen, die schnell gute Rekonstruktionen von einem Interaktionspartner bilden können, können ihr Handeln (falls sie über entsprechende Strategien verfügen!) gut auf diesen einstellen und so mit hoher Wahrscheinlichkeit positive Interaktionseffekte erzielen. Personen, die das nicht können, treten dagegen ständig „ins Fettnäpfchen“.
Werden Beziehungsmotive bzw. interaktionelle Ziele durch komplementäres Handeln von Interaktionspartnern befriedigt, dann stellt sich ein Gefühl von Zufriedenheit ein.9 Werden Motive über längere Zeit konsistent befriedigt, nimmt ihre Relevanz in der Regel ab: Sie sinken in der Motivhierarchie ab, andere Motive werden wichtiger und übernehmen die „Exekutive“ in stärkerem Maße (Kuhl, 1983, 2001).
Werden zentrale Motive dagegen über sehr lange Zeit frustriert, dann bleiben sie hoch in der Hierarchie bzw. sie steigen sogar in der Hierarchie auf (Kuhl, 1983, 2001): Je massiver sie frustriert werden, desto wichtiger werden sie! Und wenn sie zentral wichtig bleiben, dann dominieren sie die Exekutive sehr lange, was bedeuten kann, dass andere Motive nicht mehr ausreichend befriedigt werden können. Und dies wiederum hat die Folge, dass ein Zustand von mehr oder weniger großer Unzufriedenheit entsteht.
Frustrierte Motive bleiben also hoch in der Motivhierarchie!
Wie noch deutlich werden wird, führt das Verhalten von persönlichkeitsgestörten Klienten dazu, dass sie ihre zentralen Beziehungsmotive nicht befriedigen und, da sie aber anderen Motiven nicht folgen, auch andere Motive nicht wirklich zufrieden stellen: Daher weisen Personen mit PD im Allgemeinen einen Zustand allgemeiner, hoher Unzufriedenheit auf.
|19|3.2.3 Dysfunktionale Schemata
Schemata sind abstrahierte, generalisierte Überzeugungen einer Person, die sich in der Biographie durch Schlussfolgerungen aus Erfahrungen bilden: Sie werden („bottom up“) durch Situationsaspekte automatisch aktiviert und beeinflussen dann („top down“) die aktuelle Informationsverarbeitung, Situationsinterpretation und Handlungsregulation einer Person (vgl. Crocker et al., 1984; Mandler, 1979; Rumelhart, 1980).
Dysfunktionale Schemata sind solche, die dazu führen, dass eine Person ungünstig denkt und handelt und damit für sich (hohe) Kosten erzeugt.10
3.2.3.1 Selbst- und Beziehungsschemata
Auf der zweiten Ebene des Modells nehmen wir an, dass es dysfunktionale Schemata gibt, die die Informationsverarbeitung und Handlungsregulation von Personen stark determinieren (vgl. Beck et al., 1990). Zum Begriff und zur Funktion von Schemata siehe Sachse.11
Wir gehen davon aus, dass man zwei Arten dysfunktionaler Schemata unterscheiden kann: Selbst-Schemata und Beziehungsschemata (siehe dazu Sachse, Breil, & Fasbender, 2009). Selbst-Schemata sind solche, die Annahmen der Person über sich selbst enthalten wie „ich bin ein Versager“, „ich bin nicht wichtig“ u. a. sowie Kontingenzannahmen und Bewertungen dazu. Beziehungsschemata sind solche, die Annahmen der Person über Beziehungen enthalten, darüber, wie Beziehungen funktionieren, was man in Beziehungen zu erwarten hat sowie wiederum Kontingenzannahmen und Bewertungen dazu (z. B.: „In Beziehungen wird man abgewertet.“, „Beziehungen sind nicht verlässlich.“ u. a.).
Diese Schemata sind dysfunktional, da sie zu negativen Erwartungen führen, aber vor allem auch zu negativen Interpretationen von Situationen, negativen Affekten u. a. Sie determinieren eine schnelle, hoch automatisierte Informationsverarbeitung und führen zu etwas, was wir „hyperallergische Reaktionen“ nennen: Minimale situative Auslöser rufen schnell heftige (affektive) Reaktionen hervor. So kann z. B. jemand, der ein Schema hat „ich bin nicht wichtig“ auf eine minimale Unaufmerksamkeit eines Interaktionspartners heftig verletzt und gekränkt reagieren.
3.2.3.2 Zur Entwicklung dysfunktionaler Schemata
Eine zentrale Grundannahme des Modells ist, dass sich dysfunktionale Schemata in der Biographie durch die interaktionellen Erfahrungen herausbilden, die Kinder und Jugendliche mit relevanten Bezugspersonen im Hinblick auf ihre zentralen Beziehungsmotive machen (vgl. Nowacki, 2009).
|20|Wir nehmen an, dass Personen als Kinder oder Jugendliche hoch relevante Erfahrungen mit zentralen Beziehungspartnern (meist den Eltern) machen, die die Befriedigung zentraler Beziehungsmotive betreffen. Diese Erfahrungen wirken sich, wahrscheinlich aus biologischen Gründen, sehr stark und sehr nachhaltig aus, z. B. auf die Entwicklung von Selbst- und Beziehungsschemata.
Das Kind macht z. B. mit dem Motiv Wichtigkeit positive Erfahrungen, wenn es
von den Eltern ernst genommen wird,
von den Eltern Aufmerksamkeit erhält,
Signale von „wir verbringen gerne Zeit mit Dir“, „wir sind gerne mit Dir zusammen“ erhält,
es Signale der Art „Du bist eine Bereicherung für unser Leben“ erhält.
Erhält das Kind solches Feedback konsistent, über längere Zeit hinweg, dann bilden sich positive Schemata.
Es bildet sich ein positives Selbstschema der Art:
Ich bin wichtig.
Ich habe anderen etwas zu bieten usw.
Und es bildet sich ein positives Beziehungsschema der Art:
In Beziehungen wird man ernst genommen.
In Beziehungen wird man wahrgenommen und erhält Aufmerksamkeit usw.
Erhält das Kind jedoch negatives Feedback im Hinblick auf das Motiv Wichtigkeit, dann erhält es Botschaften wie:
Wir haben keine Zeit für Dich.
Wir kümmern uns nicht um Dich.
Wir hören Dir nicht zu.
Wir geben Dir keine Aufmerksamkeit.
Wir nehmen Dich nicht ernst usw.
Oder sogar Botschaften wie:
Du störst uns.
Es wäre besser für uns, Du wärst nicht da.
Ohne Dich hätte ich Karriere machen können usw.
Erhält das Kind solches Feedback konsistent über lange Zeit, dann bildet sich ein negatives Selbstschema:
Ich bin nicht wichtig.
Ich habe anderen nichts zu bieten.
Oder sogar:
Ich bin toxisch für andere.
Ich bin für andere eine Last.
|21|Und es bildet sich ein negatives Beziehungsschema wie:
In Beziehungen wird man nicht ernst genommen.
In Beziehungen erhält man keine Aufmerksamkeit.
In Beziehungen hört einem keiner zu usw.
Die systematische Frustration der Beziehungsmotive hat aber nicht nur Einfluss auf die Schemabildung: Nach dem oben Gesagten hat dies auch zur Folge, dass die frustrierten Motive hoch in der Motivhierarchie bleiben bzw. dass sie sogar durch die Frustration subjektiv immer bedeutsamer werden: Durch systematische Frustration kann ein bestimmtes Beziehungsmotiv überhaupt erst zu dem alles dominierenden Motiv werden!
Solche Schemata, so kann man annehmen, kristallisieren sich langsam heraus: Schemata bilden sich aus Schlussfolgerungen von Erfahrungen, wodurch sich auch aus leicht negativem Feedback über längere Zeit stark negative Schemata bilden können.
Haben sich die Schemata erst einmal herausgebildet, dann determinieren sie, wenn sie aktiviert sind, stark die Informationsverarbeitung und Handlung mit. Schemata führen dabei oft zu hyper-allergischen Reaktionen: Hat jemand z. B. ein Schema „in Beziehungen wird man nicht respektiert“, dann reagiert er „hyper-allergisch“ auf alle Handlungen anderer Personen, die sich als „mangelnder Respekt“ interpretieren lassen. Das heißt die Person reagiert darauf schnell und heftig je nach Art ihres Schemas, entweder traurig oder ärgerlich.
Schemata führen somit dazu, dass eine Person auf minimale Stimuli heftig reagieren kann!
Diese Ebene der dysfunktionalen Schemata ist nun eine Ebene, die Personen mit Persönlichkeitsstörungen (PD) kennzeichnet (Beck et al., 1993): Klienten mit bestimmten Persönlichkeitsstörungen weisen charakteristische Arten von Schemata auf. So ist z. B. ein Schema „ich bin nicht wichtig“ kennzeichnend für Personen mit histrionischer PD; ein Schema der Art „ich bin ein Versager“ ist charakteristisch für eine Person mit narzisstischer Störung (vgl. Sachse, 2002, 2004a, 2004c, 2006c, 2006d).
Da Schemata offenbar aus der Frustration bestimmter Motive entstehen, ist zu erwarten, dass die zentralen, frustrierten Motive der Person, die immer noch hoch in der Hierarchie stehen, und die zentralen negativen Schemata der Person gegensätzlich formuliert sind. Ist das frustrierte Motiv Wichtigkeit, dann heißt das zugehörige Schema „ich bin nicht wichtig“. Zentrale Beziehungsmotive und zentrale dysfunktionale Schemata sind deshalb inhaltlich stark miteinander verbunden: Das eine leitet sich aus dem anderen ab!
|22|Schemata sind also in gewisser Weise die Negation des relevanten Beziehungsmotivs.
3.2.4 Die Ebene der intransparenten Handlungen oder Spielebene
3.2.4.1 Lösungen
Wir gehen jedoch davon aus, dass die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung mit der Ausbildung negativer Schemata keineswegs abgeschlossen ist. Wir gehen vielmehr davon aus, dass eine Person, die im oben beschriebenen Sinne schwierigen, frustrierenden Interaktionserfahrungen ausgesetzt ist, in der Regel nicht passiv resignieren wird, sondern dass sie in vielen Fällen versuchen wird, dafür aktiv eine Lösung zu entwickeln. Und diese Lösungen sind dann der spannendste Teil der Persönlichkeitsstörungen.
Ein zentraler Teil von Persönlichkeitsstörungen lässt sich als Lösung für frühe interaktionelle Probleme auffassen.
Diese „Lösungen“ machen nun die zweite Handlungsebene im Modell der Doppelten Handlungsregulation aus: Die Ebene der sogenannten „intransparenten“ Handlungen oder die „Spielebene“.
3.2.4.2 Zur Entwicklung der intransparenten Handlungsebene
Die Entwicklung dieser Handlungsebene beginnt für Kinder/Jugendliche mit einer schwierigen, andauernden Interaktionssituation: Wichtige Interaktionspartner frustrieren andauernd wichtige Beziehungsbedürfnisse. Auf diese schwierige Situation müssen sie nun reagieren.
Kinder z. B., deren zentrales Beziehungsmotiv durchweg frustriert wird, haben im Prinzip zwei Möglichkeiten:
Sie können resignieren und zu Handeln aufhören, sich anpassen oder eine depressive Entwicklung durchmachen, oder
sie können versuchen, Handlungen zu entwickeln, mit deren Hilfe sie ihre Interaktionspartner doch dazu kriegen, ihnen zumindest Aspekte ihrer Motive zu befriedigen.
Wir nehmen an, dass nur diese zweite Strategie zur Entwicklung einer PD oder zumindest eines Persönlichkeitsstils führt. Wir nehmen auch an, dass Menschen, |23|auch Kinder, in der Regel aktive, problemlösende Organismen sind: Deshalb ist dieser zweite Weg sehr viel wahrscheinlicher als der erste.
Die Personen entwickeln nun langsam, Schritt für Schritt Strategien, mit deren Hilfe sie wichtige Interaktionspartner doch dazu bewegen können, bestimmte interaktionelle Ziele zu befriedigen: Diese Strategien entwickeln sich, wenn (und nur wenn!) sie erfolgreich sind, und damit sehen die Personen diese Strategien dann auch zwingend als „gute Lösungen“ für schwierige Situationen an: Damit werden die Strategien dann auch mit Sicherheit ich-synton, also als Teil der eigenen Person wahrgenommen und nicht als störend, dysfunktional oder problematisch.
Ich-Syntonie resultiert daraus, dass bestimmte, zentrale Aspekte der PD den Personen selbst als hilfreich, günstig, positiv erscheinen und somit gar nicht als problematisch wahrgenommen werden können.
Diese Strategie, Interaktionspartner doch dazu zu veranlassen, bestimmte Aspekte wichtiger Motive zu befriedigen, hat weitreichende Implikationen:
Die Interaktionspartner (meist die Eltern), die dem Kind die Motive nicht befriedigen, haben offenbar keine Intention, dies zu tun oder sogar eine Intention, dies nicht zu tun.
Deshalb müssen sie vom Kind dazu gebracht, dazu veranlasst werden, dies zu tun, und zwar, ohne dass sie von sich aus eine Intention dazu hätten oder sogar gegen ihre Intention, es nicht zu tun.
„Sie zu veranlassen“ kann aber nicht heißen, sich authentisch zu verhalten, denn das hat offenbar bisher nicht funktioniert.
„Sie zu veranlassen“ kann somit nur heißen, sich strategisch zu verhalten, und das bedeutet, sie zu manipulieren: Sie zu etwas zu veranlassen, was sie eigentlich gar nicht wollen.
Der Begriff „Manipulation“ ist hier gar nicht wertend gemeint, sondern ausschließlich in seinem psychologischen Sinne: Jemand wird manipuliert, wenn er durch ein strategisches Handeln einer anderen Person dazu veranlasst wird, etwas zu tun, was er selbst gar nicht tun will. Und solche Strategien sind meist intransparent: Der Manipulierte durchschaut die eigentlichen Ziele des Manipulators nicht, er durchblickt nicht, worum es „eigentlich“ geht. Nach Begriffen der Transaktionsanalyse und der „self-handicapping-Forschung“ bezeichnen wir ein solches manipulatives Handeln als „Spiel-Handeln“ oder kurz als „Spiel“ (englisch: „games“ oder „interactional manouvers“; vgl. Berne, 1961, 1967; Mummendey, 1995).
|24|Ein manipulatives Handeln ist ein Handeln, das dazu dient, Interaktionspartner zu Verhalten zu veranlassen, das sie von sich aus nicht ausführen würden (bzw. von dem der Handelnde annimmt, dass sie es nicht ausführen würden), und zwar mit Strategien, deren tatsächlichen Zweck der zum Verhalten Veranlasste nicht durchschaut.
Auf diese, im Alltagsprozess sowie in der Psychotherapie sehr wesentlichen Aspekte von Manipulation und Spiel wird im Kapitel 3.3 genauer eingegangen.
3.2.4.3 Kompensatorische Schemata
Auf der Spielebene gibt es kompensatorische Schemata: Diese dienen dazu, dysfunktionale Schemata (auf der Schemaebene) zu kompensieren bzw. dafür zu sorgen, dass diese sich nicht als wahr erweisen.
Zum einen gibt es kompensatorische Selbstschemata, die positive oder (kompensatorisch) übertriebene Selbstannahmen enthalten; es gibt kompensatorische Normschemata, die (oft übertriebene) Ziele (in Form von „muss-Sätzen“) enthalten, und es gibt kompensatorische Regelschemata, die (ebenfalls oft überzogene) Anweisungen an andere enthalten. Wir (Sachse, Breil & Fasbender, 2009) haben diese Schemata als „kompensatorisch“ bezeichnet, weil ihr Sinn im Wesentlichen darin besteht, die negativen Inhalte der Selbst- und Beziehungsschemata auf der Schemaebene „auszubügeln“ oder dafür zu sorgen, dass die dort spezifizierten Inhalte und Konsequenzen nicht eintreten.
3.2.4.3.1 Kompensatorische Selbstschemata
Kompensatorische Selbstschemata sind solche, die (als Ausgleich zu den negativen Selbstschemata) positive oder sogar übertrieben positive Aussagen über die eigene Person enthalten.
Eine Person, die ein negatives Selbstschema der Art „Ich bin ein Versager“, „Ich kann Erwartungen nicht erfüllen“, Ich bin inkompetent usw. hat, entwickelt manchmal ein kompensatorisches Schema (entweder illusionärer oder realistischer Art) mit Annahmen wie:
Ich bin erfolgreich.
Ich bin hoch-intelligent.
Ich bin hoch leistungsfähig.
Die beiden Selbstschemata sind dann voneinander getrennt und hemmen sich meist gegenseitig (vgl. Sachse, 1999a, 2001b, 2002, 2004b): Wenn eines dieser Schemata aktiviert ist, ist das andere gehemmt. Die Person „switcht“ dann von einem Schema zum anderen und damit auch von einem „state of mind“ in den |25|anderen. Kompensatorische Selbstschemata enthalten keine Ziele, sondern „Zustandsaussagen“, also Aussagen der Person über sich selbst.
3.2.4.3.2 Normative Schemata und Vermeidungsziele
Eine zweite Art kompensatorischer Schemata sind „normative Schemata“: Normative Schemata enthalten Anweisungen darüber, wie die Person sein sollte oder sein muss: Sie enthalten damit Ziele der Person (im Sinne expliziter Ziele, vgl. Püschel & Sachse, 2009). Normative Schemata sind somit interaktionelle Ziele auf der Spielebene.
Normative Schemata sind solche, die „Anweisungen“ der Person an sich selbst enthalten, wie z. B.: „Sei erfolgreich.“, „Sei der Beste.“, „Sei die Wichtigste.“, „Vermeide auf alle Fälle Blamagen.“, „Vermeide alle Situationen, in denen Du kritisiert werden könntest.“
Normative Schemata enthalten somit Ziele in der Form von Vorschriften: „Sei XY.“, „Du musst XY.“, „Du darfst nicht XY.“ u. a. Dabei können diese Anweisungen für die Person in unterschiedlich starkem Ausmaß verbindlich sein, was wiederum davon abhängt, wie die Kontingenzebene dieser Schemata definiert ist (vgl. Sachse, Püschel et al., 2008).
Die Kontingenzebene normativer Schemata enthält zuerst Annahmen darüber, welche negativen Konsequenzen (die die dysfunktionalen Schemata androhen) durch die Befolgung der Anweisungen nicht eintreten, z. B.:
„Wenn Du der Beste bist, dann wird Dich niemand abwerten.“
„Wenn Du der Beste bist, wird sich niemand von Dir abwenden.“
Da die Kontingenzen somit zuerst das „Ausbleiben“ der in den dysfunktionalen Schemata angedrohten Konsequenzen spezifizieren, nennen wir diese Schemata „kompensatorisch“.
Die Kontingenzebene kann jedoch auch negative Konsequenzen für den Fall androhen, dass man die Norm nicht erfüllt: Und hier können einmal die gleichen Konsequenzen angedroht werden, die schon das dysfunktionale Schema spezifiziert hat, es können jedoch darüber hinaus noch mehr Konsequenzen spezifiziert werden. Und diese Konsequenzen können nun leicht bis mittelschwer sein: „Wenn Du nicht erfolgreich bist, dann mag Dich niemand.“ Oder sie können auch massive, existentielle Katastrophen androhen, z. B.: „Wenn Du Fehler machst, bist Du moralisch völlig verwerflich und gehörst nicht mehr zu den Menschen.“ Damit können die normativen Schemata noch weitaus schlimmere Konsequenzen androhen als die dysfunktionalen Schemata.
Es ist hier sehr wichtig zu sehen, dass alle diese Normen Ziele definieren, die Annahmen der dysfunktionalen Schemata (vor allem der Selbstschemata) kompen|26|sieren: Sagt das Schema z. B. „Ich bin ein Versager“, dann enthält das normative Schema Aussagen wie: „Sei erfolgreich.“, „Zeige Dich als intelligent.“, „Sei der Beste.“ (oder: „Vermeide Kritik.“): Dies sind alles Ziele, die die negativen Annahmen der dysfunktionalen Schemata falsifizieren oder dafür sorgen sollen, dass diese „nicht wahr werden“. Damit sind die normativen Schemata wieder sehr eng inhaltlich mit den dysfunktionalen Schemata verbunden, und, was noch wichtiger ist: Die Ziele sind per definitionem alles Vermeidungsziele!
Man will nämlich nicht erfolgreich sein, weil es so viel Spaß macht, erfolgreich zu sein (was ein Annäherungsziel wäre!) und man will nicht der Beste sein, weil man dies genießen würde. Nein: Man will erfolgreich und der Beste sein, weil man dadurch beweisen will, dass man kein Versager ist! Alle normativen Ziele streben also keine positiven Zustände oder positive Affekte an, nein: Sie streben die Aufhebung oder Vermeidung negativer Zustände oder Affekte an!
Das gilt z. B. auch für Ziele wie: „Erhalte Aufmerksamkeit.“, „Sei die Wichtigste.“. Auch hier will man dies, weil man (aufgrund der dysfunktionalen Schemata) annimmt, man sei nicht wichtig und man erhalte keine Aufmerksamkeit. Man ist also nicht intrinsisch motiviert, man strebt keine positiven Effekte an, sondern man strebt immer die Aufhebung oder Vermeidung negativer Effekte an.
Alle Ziele normativer Schemata sind Vermeidungsziele.
Vermeidungsziele funktionieren psychologisch anders als Annäherungsziele (vgl. Ebner & Freund, 2009; Elliot & Covington, 2001; Kuhl, 1983, 2001): Die Verfolgung und Erreichung von Annäherungszielen befriedigt zentrale Motive und führt zu einem Zustand der Zufriedenheit (Brunstein, 1993, 1995, 2001; Brunstein et al., 1995, 1998), zu einem langsamen Absinken des Motivs in der Motiv-Hierarchie (Kuhl, 1983, 2001) und damit zu einem allmählichen Nachlassen der Bemühungen.
Dagegen führt das Verfolgen und Erreichen von Vermeidungszielen zur Reduktion von Angst und Anspannung (C–), jedoch nicht zu einer Sättigung zentraler Motive und damit auch nicht zu einem Zustand von Zufriedenheit (Brunstein, 1993, 2001; Brunstein & Schultheiß, 1996; Brunstein et al., 1996, 1998; Kuhl, 2001; Kuhl & Koole, 2005): Das zentrale Motiv Anerkennung bleibt trotz aller Verfolgung von Vermeidungszielen hoch in der Motiv-Hierarchie!
Während die Erreichung von Annäherungszielen zu positiven Affekten und langfristig zu einer „Sättigung“ der Motive (und damit zu einem Absinken der Motive in der Motivhierarchie) sowie dem Gefühl von Zufriedenheit führt, führt das Erreichen von Vermeidungszielen nur zu einem Verschwinden negativer Affekte oder Emotionen (von Spannung, Unwohlsein oder Angst), jedoch nicht zu einer Sättigung von Motiven, damit auch nicht zu einem Gefühl von Zufriedenheit und damit langfristig auch nicht zu einem Absinken des Motivs in der Motivhierarchie: Ob|27|wohl die dysfunktionalen Schemata sich aus den Beziehungsmotiven ableiten und sich die normativen Schemata aus den dysfunktionalen Schemata ableiten, ist die Person überwiegend damit beschäftigt, den normativen Zielen zu folgen und ihr Handeln danach auszurichten. Damit erreicht sie zwar immer wieder die Reduktion negativer Affekte und damit auch eine ständige Bekräftigung ihres Handelns, sie erreicht jedoch keine Befriedigung der zugrundeliegenden Beziehungsmotive mehr! Diese Motive bleiben weiterhin hoch in der Motivhierarchie, sie bleiben weiterhin dominant, egal wie viel die Person auch tut!
Durch das Verfolgen kompensatorischer Ziele auf der Spielebene werden die grundlegenden Beziehungsmotive nicht befriedigt und bleiben damit hoch in der Motivhierarchie.
Das strategische Handeln der Person, das darauf angelegt ist, die Ziele auf dieser Ebene zu befriedigen, schafft damit zwar ständig Effekte, führt aber nie zu einer wirklichen Motivbefriedigung. Und damit ist dieses Handeln auch unstillbar (im Sinne von Gollwitzer, 1987, 1999): Da die Anregung dysfunktionaler Schemata immer wieder zu negativen Affekten und Effekten führt, muss man immer wieder von Neuem handeln, um die Vermeidungsziele zu erreichen: Die damit erreichten Effekte erzeugen immer wieder Erleichterung und „Linderung“, verändern das System als solches aber in gar keiner Weise.
Alle kompensatorischen Ziele sind unstillbar.
Ein zweiter wichtiger Aspekt, der dafür sorgt, dass durch kompensatorisches Handeln die zentralen Beziehungsmotive nicht in der Hierarchie absinken, ist, dass man durch strategisches Handeln praktisch per definitionem immer nur Feedback für das Handeln bekommt, aber nicht Feedback als Person: Man bekommt nicht Aufmerksamkeit als Person, sondern man bekommt Aufmerksamkeit, weil man spaßig und unterhaltsam ist.
Die Beziehungsmotive auf der Motivebene implizieren aber alle den Wunsch, Feedback als Person zu bekommen, also als Person wichtig zu sein! Durch strategisches Handeln kann man es aber nie erreichen, als Person wichtig zu sein, man kann nur erreichen, für Handeln Aufmerksamkeit zu bekommen.
Damit können erneut die Effekte, die man durch strategisches (kompensatorisches) Handeln bewirken kann, das zentrale Beziehungsmotiv nicht befriedigen: Egal, was immer man auf der Spielebene auch tut, egal, wie stark man sich auch anstrengen mag, egal, wen auch immer man manipulieren mag: Es reicht niemals aus, um das zentrale Beziehungsmotiv zu sättigen und damit einen Zustand von Zufriedenheit zu erreichen!
|28|Und man muss noch einen weiteren Faktor bedenken: Selbst wenn die Person mal an einen Partner geraten würde, der ihr Feedback als Person geben würde („Du bist mir wirklich wichtig.“), dann würde das Schema („Ich bin nicht wichtig.“) als Filter fungieren: Die Person könnte dieses Feedback sehr wahrscheinlich gar nicht wirklich glauben! Somit kann sich auch „authentisches Feedback“, falls es erfolgen sollte, nicht motiv-befriedigend auswirken!
Dennoch wirkt das strategische Handeln befriedigend, und damit wird es ja auch ständig verstärkt: Denn wenn man etwas tut, um Aufmerksamkeit zu erreichen, dann erreicht man Aufmerksamkeit! Und damit reduziert man den negativen Affekt, der durch das Schema „ich bekomme keine Aufmerksamkeit“ erzeugt wird! Das bedeutet aber, dass man natürlich die Ziele, die man auf der Spielebene verfolgt, meist (oder zumindest ab und zu!) auch erreicht! Dies führt immer wieder zu einer Bekräftigung: Zwar befriedigt man das Motiv nicht, aber man befriedigt das Vermeidungsziel – und das ist besser als nichts. Eine Klientin hat das mal sehr treffend ausgedrückt, indem sie sagte: „Aufmerksamkeit zu bekommen ist, als wäre man hungrig, bekäme aber immer wieder etwas Leckeres zu trinken.“ – Eine wirklich treffende Formulierung! Man bekommt immer wieder etwas, was auch wichtig ist, aber satt wird man davon nicht!
3.2.4.3.3 Regelschemata: Vorschriften für Interaktionspartner
Neben selbst- und normativen Schemata gibt es auf der Spielebene jedoch noch eine Art kompensatorischer Schemata: Regel-Schemata (vgl. Sachse, Breil & Fasbender, 2009).
Regel-Schemata enthalten keine Regeln, die die Person selbst befolgen soll, sondern Regeln, die andere, die Interaktionspartner befolgen sollen! Regel-Schemata enthalten somit interaktionelle Erwartungen, wie z. B.: „Andere haben mich respektvoll zu behandeln.“ Oder: „Ein Partner hat mir rund um die Uhr Aufmerksamkeit zu geben.“
Auf der Kontingenzebene solcher Schemata stehen dann auch keine Katastrophen, die für die Person selbst eintreten könnten, sondern Konsequenzen, die dem Interaktionspartner von der regelsetzenden Person drohen, z. B.: „Wenn mich jemand nicht respektvoll behandelt, darf ich wütend reagieren.“ Oder: „Wenn mein Partner mir keine Aufmerksamkeit gibt, mache ich ihm eine Szene.“
Regel-Schemata kompensieren insbesondere die negativen Beziehungserwartungen der dysfunktionalen Beziehungsschemata: Hat eine Person das Schema „in Beziehungen wird man nicht respektiert“, dann entwickelt sie auf der Spielebene eine (mehr oder weniger starke) Erwartung an Interaktionspartner, die genau dieser Annahme widerspricht: „Dein Partner hat mich respektvoll zu behandeln – und wehe nicht!“
|29|Diese Regel-Schemata führen nun dazu, dass Personen, die diese aufweisen, in Situationen, in denen Interaktionspartner gegen diese Regel verstoßen, nicht primär verletzt oder gekränkt reagieren (wie bei einer Aktivierung der dysfunktionalen Schemata), sondern wütend und ärgerlich. Denn dieses Schema besagt ja,
dass ihnen Respekt zusteht und sie ihn erwarten dürfen und
dass sie das Recht haben, darauf sauer zu reagieren und den „Regel-Verletzer“ zu bestrafen.
Die hyperallergische Reaktion bei der Aktivierung von Regel-Schemata ist somit nicht Kränkung, sondern Ärger: Was bedeutet, dass eine Person hier bei geringfügigem „Vergehen“ von Interaktionspartnern maximal heftig wütend reagieren kann.
Es sind vor allem diese Regel-Schemata und das daraus resultierende Handeln, das Personen mit PD massive interaktionelle Probleme einbringt: Denn Interaktionspartner sehen über kurz oder lang nicht wirklich ein, dass sie sich nach den Regeln ihres Partners verhalten müssen (vor allem dann nicht, wenn dieser sich auch sonst wenig reziprok verhält!) und sie sehen nicht ein, dass sie sich, oft wegen Kleinigkeiten, massive Vorwürfe gefallen lassen sollten.
Je ausgeprägter das Regel-Setzer-Verhalten einer Person ist, desto größer sind deren interaktionelle Probleme.
3.3 Manipulation und Spiel
3.3.1 Einleitung
Wir wollen uns hier mit sogenanntem manipulativem Handeln beschäftigen, also mit Handeln, bei dem Personen versuchen, Interaktionspartner (IP) zu Verhalten zu veranlassen, das sie (so) nicht freiwillig oder aus eigenem Antrieb ausführen würden und zwar auf eine intransparente, den IP täuschende Weise.
Manipulative Strategien werden von allen Personen ausgeführt: Man kann sie daher prinzipiell als „normal“ bezeichnen: Jeder von uns benutzt bei Zeiten manipulative Strategien, um seine Ziele zu erreichen. Das Ausmaß, in dem Personen IP manipulieren, unterscheidet sich allerdings von Person zu Person sehr stark: Manche Personen verwenden Manipulationen nur „in geringen Dosen“, andere manipulieren massiv.
Manipulative Strategien spielen allgemein bei Personen mit Persönlichkeitsstörungen eine wesentliche Rolle und zwar umso stärker, je stärker eine Störung ausgeprägt ist.
|30|Bei psychopathischer Persönlichkeitsstörung (PSY) sind Manipulationen von besonderer Bedeutung, da diese Personen in sehr hohem Ausmaß manipulieren und da sie in besonders unangenehmer Weise manipulieren: IP können sich meist gegen diese Strategien nur sehr schlecht abgrenzen.
Daher ist es von außerordentlicher Bedeutung, solche Strategien genau zu kennen, zu verstehen und Strategien zur Verfügung zu haben, konstruktiv damit umzugehen.
3.3.2 Der Begriff der Manipulation
Es wird hier von Manipulation oder manipulativen Strategien gesprochen: Es muss absolut klar sein, dass damit noch überhaupt keine Wertung und auch überhaupt keine Abwertung des Handelns gemeint sein sollen! Denn man sollte sich klarmachen: