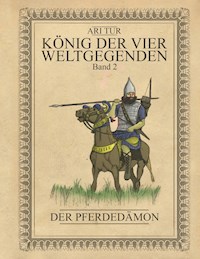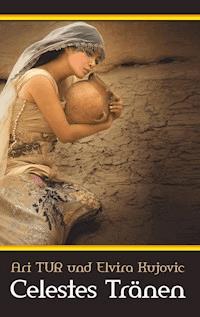8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der Wunschtraum des assyrischen Königs Tukulti-Ninurta I. (1233 - 1197 v. Chr.) scheint sich zu erfüllen: Endlich erkennen ihn die mächtigsten Herrscher jener Zeit als ebenbürtiger Großkönig an. Nur einer verweigert ihm diesen Respekt: der König von Babylon. Der Assyrer brennt deshalb darauf, das übermächtige Babylon zu erobern. Als die Wahrsager endlich günstige Vorzeichen verkünden, holt er zum entscheidenden Schlag aus. In den Kriegswirren erhalten Senni und sein Freund Banu einen geheimen Auftrag, der sie von den Sümpfen des südlichen Meerlandes zum König der Seevölker am Oberen Meer führt. Erschreckende Nachrichten lassen sie in die Heimat zurückkehren. Eine uralte Prophezeiung, das Omen der Finsternis, breitet sich über dem Reich des Königs der vier Weltgegenden aus. Trifft der vom Hohepriester heraufbeschworene Fluch der großen Götter auch die beiden Freunde, die ihrem König treu ergeben sind?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Für Karin
In Erinnerung an glückliche Tage im Orient
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Im Tempel der Sebettu
Im Bann der Liebesgöttin
Löwengesicht
Im Netz der Flammenbraut
Die Macht des Harems
Der Leibwächter
Betrogene Betrüger
Skorpion im Flammenbett
Der Ränkeschmied
Die neue Königsresidenz
Die Verschwörung
Dämonen-Jagd
Flucht aus dem Harem
Verhasstes Versteckspiel
Neue Erfindungen
Das Gewand des Schreckens
Die Wüstenblume
Der Heilige Hain
Die Trägerin der Schlangen
Die Missgeburt
Die kassitischen Beutelträger
Kampf der Großkönige
Der Aufstand
Zu viele Mäuler!
Das Omen der Finsternis
Der Erbsohn
Wer ist König?
Krieg ohne Sieg
Der Wohnsitz Gottes
Der elamische Thronräuber
Der Fürst von Elam
Das Tor Gottes
König der vier Weltgegenden
Im Schatten der Macht
Marduks Fluch
Die goldenen Tränen
Die heilige Waffe
Verräterische Freunde
Der Zorn der Götter
Die Krone des Argwohns
Das Heldenlied
Das Kraut des Lebens
Der König des Seevolks
Der Gebieter des Wassers
Liebeszauber
Die Spur des Pferdedämons
Der Falbe des Oberherrn
Schlimmer Verdacht
Das magische Fett
Die Opfergerste
Die Last der Mühlsteine
Der gepanzerte Bogenschütze
Das Ritual der Pferde
Gang in die Unterwelt
Goldenes Haar
Die Weihe der Waffen
Der Trank der Götter
Das Herz der Stadt
Spurensuche
Der verlorene Geist
Der König der Nacht
Der Schatz des Bierbrauers
Die Krone der Braukunst
Der geheime Bund der Priesterschaft
Chronologie
Lesen altorientalischer Namen
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Tukulti-Ninurta I. (1233 – 1197 v. Chr.) – König der vier Weltgegenden Zeichnung von Vlad Hnatovskiy
1. Vorwort
Der archäologische Roman ›König der vier Weltgegenden‹ schildert in Band 1 (›Der Blaue Fuchs‹) die Entdeckung eines assyrischen Tontafelarchivs in der syrischen Wüste durch ein Forscherteam der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Die nachfolgenden Bände – Bd. 2 (›Der Pferdedämon‹), Bd. 3 (›Die Elamische Schlange‹), Bd. 4 (›Das Omen der Finsternis‹) und demnächst auch Bd. 5 – sind der altassyrischen Geschichte gewidmet und basieren auf Keilschrifttexten, die zumeist an das Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus datieren.
Der Autor selbst stieß im Jahr 1992 während einer archäologischen Expedition in Tell Chuēra in Nordost-Syrien, in einer antiken Stadtruine namens arbe auf ein assyrisches Tontafelarchiv.1 Diese Keilschrifttafeln ermöglichen einen Einblick in die Welt der damaligen Bewohner der Stadt. Da solche wissenschaftlichen Forschungsberichte von Fachleuten für Fachleute geschrieben werden, bleiben sie dem interessierten Publikum meist verschlossen. Die vorliegende Romanserie ist der Versuch, wissenschaftliche Ergebnisse in Form einer archäologischhistorischen Saga ›lesbar‹ zu machen. Die Hauptfiguren der assyrischen Geschichte haben tatsächlich gelebt und sind gemäß ihren Tätigkeiten und Handlungen charakterisiert worden. So ist ein Geschichtsbuch der anderen Art entstanden, das zumeist auf Keilschrifttexten aus der Zeit des assyrischen Königs Tukulti-Ninurta I. (1233 – 1197 v. Chr.) basiert.
Der Autor dankt Barbara Ninnemann, Karin Klein und Lothar Schwarz für die Durchsicht des Manuskripts, Dr. Stefan Jakob (Uni Heidelberg) und den Mitgliedern der Autorengruppe Schreiberberg aus Saarbrücken für die zahlreichen Anregungen und Diskussionsbeiträge während des Entstehungsprozesses.
Im Februar 2020
1 Harald Klein, Die Grabung in der mittelassyrischen Siedlung; in: Winfried Orthmann et al., Ausgrabungen in Tell Chuēra in Nordost-Syrien I. Vorbericht über die Grabungskampagnen 1986 bis 1992. Vorderasiatische Forschungen der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung Band 2 (Saarbrücken 1995), Seite 185 – 201.
2. Im Tempel der Sebettu
Der Barbier steht im Türrahmen und schüttelt ungläubig den Kopf: »Das achte Regierungsjahr unseres Königs Tukulti-Ninurta2 steht für mich unter einem schlechten Stern: Das ist nun zum zweiten Mal in kürzester Zeit, dass ein Kunde mir beim Haareschneiden davonläuft, wenn ich bloß den Namen der hübschen Hohepriesterin der Liebesgöttin Ištar erwähne. Dieses Weibsstück scheint allen Männern den Kopf zu verdrehen! Was hat Senni so in Wallung gebracht? Ich habe ihm doch nur erzählt, dass kürzlich ein Hüne, der widerlich nach Pferdeschweiß stank, sich nach Ašdu erkundigt hatte. Kaum hatte ich dem Riesen Auskunft erteilt, stürzt der Kerl, ohne zu zahlen zur Tür hinaus. Und nun auch noch Senni! Langsam verstehe ich die Welt nicht mehr!«
Senni hat kein Ohr mehr für den Barbier. Im Rennen reißt er dem wartenden Nūr-Šamaš die Zügel seines Pferdes Aspa aus den Händen und stürmt, das Tier hinter sich herziehend, die Gasse hinauf.
»Beeil dich!«, ruft er Banūs Sohn zu. »Wir müssen auf dem schnellsten Weg zu deinem Vater! Kikkuli will der Hohepriesterin Ašdu etwas antun!«
Der junge Elamier stutzt im ersten Augenblick über das Verhalten von Senni und läuft ihm aufgeregt hinterher:
»Was ist denn los, Oheim? Wer ist Kikkuli? Und warum ist die Hohepriesterin in Gefahr?«
Senni, voll der Angst, dass es bereits zu spät für Ašdus Rettung ist, antwortet ungehalten: »Kikkuli war einst mein Ziehvater und Ašdu seine Sklavin. Sie ist ihm entflohen. Und nun will der Pferdedämon sie zurück!«
»Kikkuli ist ein Dämon?« Nūr-Šamaš glaubt, sich verhört zu haben. »Ist Kikkuli kein Mensch aus Fleisch und Blut?«
Erst jetzt wendet sich Senni dem Jungen zu: »Keine Angst! Dieser Mann ist ein Mensch wie du und ich, aber in seinen Adern fließt das schwarze Blut von Dämonen. Nur so ist die böse Macht zu erklären, die immer wieder von ihm Besitz ergreift. Wenn der Pferdedämon in ihm erwacht, ist er von Sinnen. Dann, mein Junge, solltest du ihm nicht zu nahe kommen. Merke dir das!«
Eingeschüchtert nickt ihm der junge Elamier zu. Bei dem Gedanken, einem leibhaftigen Pferdedämon zu begegnen, läuft es ihm eiskalt den Rücken hinunter. Wie sieht so ein Pferdedämon überhaupt aus? Wirre Vorstellungen schießen ihm durch den Kopf: Ein Mann mit einem Pferdekopf, oder gar ein Ungetüm – halb Mensch, halb Pferd?
Sennis Rufe reißen ihn aus seinen Gedanken: »Los! Schneller, Nūr-Šamaš! Wir müssen auf schnellstem Weg deinen Vater finden! Als Wachsoldat hat er Zugang zum Tempelbezirk. Vielleicht kann uns Banū sogar den Zutritt zum Allerheiligsten verschaffen!«
Banū sitzt zum ersten Mal seit langer Zeit vor der Tür seines Hauses und blinzelt in die Sonne. Endlich keinen Dienst! Endlich Ruhe! Der Elamier atmet die frische Brise ein, die gerade durch die Gassen des elamischen Wohnviertels weht. Er schließt die Augen und saugt die Luft in sich hinein. Vom Hof her dringt das Klappern eines Holzlöffels zu ihm nach draußen. Bēltuja, seine Frau, summt ein Liedchen bei der Küchenarbeit, das der Bogenschütze schon seit vielen Jahren nicht mehr vernommen hat. Er lehnt den Kopf an die Hauswand und schlummert ein – doch nur für einen kurzen Augenblick! Aus der Ferne schallen laute Rufe, die der Schlafende zunächst gar nicht wahrnimmt. Unsanft wird er aus seinen Träumen gerissen:
»Wach auf, Banū! Er ist da! Er will mit Sicherheit Ašdu etwas antun! So wach doch auf, Banū!«
Als der Elamier die Augen aufschlägt, kniet Senni vor ihm und schüttelt ihn an den Schultern.
»Verdammt! Was ist denn los, Senni, dass du mich so rüde weckst? Stehen Feinde vor den Toren?«, fragt er auf Elamisch. Ungehalten befreit sich Banū aus dem Griff seines Freundes und erhebt sich, die müden Glieder streckend. Gähnend reibt er sich die Augen und schnauzt Senni ungehalten an: »Hat man hier denn nie Ruhe? Habe gerade friedlich in der Sonne gedöst, da fällst du über mich her wie ein wütender Wolf! Was ist denn los?«
»Er ist zurück! Er ist in der Stadt!«, keucht Senni, vom schnellen Laufen noch außer Atem. »Ich bin mir sicher, er ist schon bei Ašdu!«
Banū fällt ihm ins Wort: »Langsam, langsam! Von wem sprichst du, Senni? Wer soll bei der Hohepriesterin sein?«
»Er natürlich!«, pustet der Angesprochene hervor. »Kikkuli, der Pferdedämon! Er ist hier in dieser Stadt. Ein Hüne, der nach Pferd roch, wollte sich vom Barbier rasieren lassen. Die Beschreibung des Mannes passt ganz genau: Es muss Kikkuli sein. Und als der vom Barbier erfuhr, dass Ašdu hoch oben auf dem Tempelberg als Hohepriesterin wirkt, ist er aufgesprungen und zur Tür hinaus. Ich sage dir, der Unhold will Ašdu, seine ehemalige Sklavin, wieder in seinen Besitz bringen!«
Banū schaut seinem Freund mit ernster Miene ins Gesicht und strafft seinen Körper. Wie der Funke von aneinandergeschlagenen Feuersteinen springt das Leben in seine Glieder und vertreibt die bleierne Müdigkeit aus seinen Armen und Beinen.
»Nūr-Šamaš, bring mir meinen Bogen und den Pfeilköcher! Spute dich, mein Sohn!«
Kaum ist Banūs Sohn zurück, muss Senni all seine Überredungskunst anwenden, um den Jungen davon zu überzeugen, dass er sie nicht begleiten kann, sondern eine andere Aufgabe übernehmen muss:
»Du suchst Ašdus Bruder ersi auf! Du findest ihn in der Unterstadt im ›Roten Haus‹ bei der Schenkin. Sag ihm, dass Kikkuli in der Stadt sei. Warne ihn vor dem Pferdedämon! Auch ersi muss auf der Hut sein, denn Kikkuli hat auch noch mit ihm eine Rechnung zu begleichen! Seine heimliche Flucht vom Gestüt wird er ihm ebenso wenig verzeihen wie seiner Schwester!«
Kurze Zeit später hetzen die Freunde zu Fuß durch die engen Gassen, bis sie zur breiten Straße gelangen, die die Stadt von Ost nach West durchschneidet. Am Tor zur Oberstadt stellen sich ihnen die Wachsoldaten in den Weg, aber nicht, um ihnen den Zugang zu verwehren, sondern um den langweiligen Dienst durch ein Schwätzchen zu versüßen. Doch Banū und Senni lassen sich nicht aufhalten: »Ein anderes Mal, Kameraden!«, ruft ihnen Senni zu. »Wir haben es sehr eilig!«
Endlich stehen sie vor der mächtigen Lehmziegelmauer, die den Heiligen Bezirk von den assyrischen Herrenhäusern der Oberstadt trennt. Eine Zehnerschaft Schwerbewaffneter versieht ihren Dienst an der hölzernen Eingangspforte. Obwohl der wachhabende Offizier Senni und Banū kennt, herrscht er sie an: »Was wollt ihr hier? Ich brauche euch beiden doch nicht zu sagen, dass der Zugang nur der Priesterschaft und den Oberherren der Stadt erlaubt ist. Kommt an Feiertagen wieder, wenn sich diese Pforte für alle Stadtbewohner öffnet!«
Senni würde ihm am liebsten auf der Stelle an die Kehle springen, doch Banū hält ihn zurück. Der Hurriter besinnt sich und fragt höflich:
»Hauptmann, ist hier ein hochgewachsener Mann vorbeigekommen. Ein Riese, der deine Männer um Haupteslänge überragt?«
Der Anführer der Wachsoldaten schüttelt den Kopf.
»Er stinkt extrem nach Pferdeschweiß und trägt eine Reitpeitsche am Gürtel.«, ergänzt Senni.
Wieder schüttelt der Mann den Kopf: »Solch ein Kerl wäre mir aufgefallen! Der war nicht hier – und wenn er hier aufgetaucht wäre, dann hätten wir ihm den Zutritt zum Tempel verwehrt!«
Senni fällt ein Stein vom Herzen. Dennoch erkundigt er sich nach dem Wohlbefinden der Hohepriesterin.
»Senni, die schöne Ašdu hat dir wohl den Kopf verdreht. Wieso fragst du nach ihr?«, wirft einer der umherstehenden Krieger ein, die feixend ihre Lanzen umklammern. »Wenn du sie aber treffen möchtest, musst du dich zum ehemaligen Tempel der Mitanni begeben. Dorthin ist sie vor geraumer Zeit in Begleitung von zwei Tempeldienerinnen aufgebrochen. Sie wollen überprüfen, was alles an dem Bau renoviert werden muss. Der alte Tempel soll den Sebettu, den ›Siebengottheiten‹, geweiht werden. Die Frauen haben uns erzählt, dass sie dort einen fremden Kaufmann treffen wollen, der in Aussicht gestellt hat, die Kosten für den Wiederaufbau zu übernehmen.«
Senni bleibt im ersten Moment wie angewurzelt stehen. Seine Beine scheinen wie gelähmt, seine Sinne wie benebelt: »Das ist das Machwerk des Pferdedämons!«, schreit er aus Leibeskräften. »Das ist eine teuflische List! Kikkuli – er und kein anderer hat Ašdu in eine Falle gelockt. Banū, auf der Stelle müssen wir zum Tempel der Sebettu! Beeil dich! Auf zum alten Tempel der Mitanni!«
Abb. 1: Mitanni-Heiligtum von arbe (Tell Chuēra)
Senni wartet nicht mehr ab, ob sein Freund ihm folgt. Mit gezückter Waffe rennt er die breite Straße entlang, die zum halbverfallenen Heiligtum der ehemaligen Herren dieser Stadt führt. Die Mitanni haben dort die Sebettu, Gottheiten, die als das Siebengestirn am nächtlichen Himmel erscheinen, verehrt. Zwar sind diese Götter auch den Assyrern heilig, doch viel wichtiger sind für sie ihre heimatlichen Hauptgötter – allen voran Gott Aššur und Göttin Ištar, denen gleich nach der Eroberung der Festung arbe prächtige Tempel errichtet wurden. So kümmerte sich jahrelang niemand mehr um das Sebettu-Heiligtum der verhassten Mitanni, das immer mehr verfiel. Kein Wunder also, dass Ašdu dem verlockenden Ruf eines wohlhabenden Kaufmanns folgte, der ihr anbot, den geweihten Platz wieder in Ordnung zu bringen. Nun steht Senni vor dem Gebäude, von dessen Seitenwänden der Lehmverputz gebröckelt ist. Wind und Regen haben bereits tiefe Risse in die Außenhaut des Hauptraums geschlagen, der gut zehn bis zwölf Schritte lang und drei bis vier Schritte breit ist. Er kennt den Tempel noch aus Jugendjahren, als ihn sein damaliger Ziehvater Kikkuli mit hierher nahm. Um in das Innere der Cella zu gelangen, muss ein seitlich vorgelagerter Torraum durchquert werden. Doch eine massive Holzpforte blockiert den Zugang. Senni rüttelt an der Tür – nichts rührt sich! Kein Laut, außer seinem eigenen Keuchen ist zu vernehmen. Er trommelt mit den Fäusten gegen das Portal:
»Ašdu, bist du da drinnen? Hört mich irgendjemand?«
Keine Antwort. Nicht das geringste Geräusch dringt zu ihm nach draußen. Banū ist nun ebenfalls eingetroffen. Völlig außer Atem stützt er sich mit einer Hand an der Wand ab:
»Ich bin Bogenschütze und kein Läufer!«, pustet er Senni entgegen. »Hast du Ašdu gesehen?«
Senni schüttelt nur den Kopf und rüttelt abermals wie von Sinnen an der verschlossenen Pforte, bis ihn Banū an der Schulter packt und ihm den Zeigefinger auf die Lippen legt. Senni verharrt reglos und lauscht gemeinsam mit seinem Freund in die Stille. Beide halten den Atem an. Ein leises Wimmern, kaum hörbar, dringt an ihre Ohren. Banū zeigt auf einen Gebäudetrakt links vom Haupteingang, der früher als Stall für die Opfertiere diente. Der Elamier zieht seinen Dolch aus der Scheide und schleicht zum Nebengebäude, dicht gefolgt von Senni. Mit seiner Linken öffnet er langsam die lieblos aus Holzplanken zusammengezimmerte Tür. Das Licht der Sonne fällt blitzartig in den Raum und vertreibt die Dunkelheit mit gleißenden Strahlen. Die Helligkeit huscht zunächst über den Boden, erklimmt die rückwärtige Wand, bis sie den gesamten Raum mit Licht durchflutet. Die Freunde treten vorsichtig ein. Niemand ist zu sehen. Rechts und links von ihnen hölzerne Verschläge, in denen zur Zeit der Mitanni-Herrschaft das Schlachtvieh gehalten wurde. Überall liegt Stroh, vermischt mit vertrocknetem Tierkot. Ein modriger Geruch liegt in der Luft. Sie tasten sich vorsichtig nach vorne. Sennis Augen suchen jeden Winkel ab, bis Banū ihm ein Zeichen gibt, sich nicht vom Fleck zu rühren. Ein leises Rascheln ist zu hören. Es scheint aus der hinteren Raumecke zu kommen. Banū pirscht auf leisen Sohlen voran. Unwillkürlich umklammert Senni den Griff seines Schwertes noch fester. Seine ganze Aufmerksamkeit ist nun auf die Stelle gerichtet, die sein Freund jeden Moment erreichen wird. Der Elamier beugt seinen Körper leicht nach vorne, spannt seine Muskeln und schnellt im nächsten Moment wie eine Raubkatze nach vorne. Banū holt zum Stoß aus, doch sogleich lässt er den Arm sinken und tritt einen Schritt zur Seite. Senni ist sofort bei ihm, doch offenbart sich ihm ein grausiger Anblick: Auf dem strohbedeckten Boden liegen die blutüberströmten Körper zweier Frauen. Die Tracht ihrer Gewänder weisen sie als Tempeldienerinnen aus. Senni legt seine Waffe zur Seite und beugt sich über die Erste. Vorsichtig wendet er ihren Oberkörper zur Seite. Ein tiefer Schnitt durch die Kehle hat sie getötet. Er wendet sich der zweiten Frau zu. Aus einer klaffenden Bauchwunde strömt das Blut, doch sie lebt noch! Mit schmerzverzerrtem Gesicht krallen sich ihre Finger in Sennis Arm. Ihre Lippen öffnen sich. Leise, fast kaum wahrnehmbar, beginnt die Verletzte zu stammeln. Mühsam presst sie einige Worte heraus:
»Ašdu – er hat sie ... mit sich genommen. Hilf meiner Herrin!«
»Wer hat das getan?« Senni ist völlig außer sich. Die Angst um seine Geliebte bringt ihn schier um den Verstand. »Wer hat deine Herrin entführt? Wie sah er aus?«
»Ein Riese«, haucht die Tempeldienerin. Ein kurzes Aufbäumen – dann fällt ihr Körper zurück und der Griff ihrer Hand löst sich von Sennis Arm. Alles Leben weicht aus ihren Gliedern.
»Es gibt keinen Zweifel: Ašdu ist in der Hand von Kikkuli, dem Pferdedämon! Er kann noch nicht weit sein, Banū. Vielleicht finden wir ihn im Tempel!«
Senni packt sein Schwert und stürmt hinaus. Hinter dem Stall ist die Umfassungsmauer des Heiligtums halb verfallen, an einer Stelle sogar ein wenig eingestürzt. Die beiden Freunde zwängen sich durch die Öffnung und umrunden das Gebäude, immer auf der Hut vor einem Angriff. Endlich stehen sie vor dem Eingang zum Allerheiligsten. Die Pforte ist nur angelehnt. Dumpf dröhnend dreht sie sich in den Angeln, als Senni die Tür aufstößt. Banū betritt als Erster den dunklen Raum. Ein Luftsog drängt an den Freunden vorbei ins Freie und trägt den penetranten Geruch eines schwitzenden Pferdes in ihre Nasen. Senni flüstert seinem Freund zu:
»Er ist hier! Ich kann den Pferdedämon riechen!«
»Wen kannst du riechen?«, will Banū wissen und saugt die Luft durch seine Nase. Angewidert verzieht er sein Gesicht und flüstert: »Seltsamerweise stinkt es hier im Heiligtum nach abgestandenem Schweiß von Pferden!«
»Genau!«, antwortet Senni, »das ist der Gestank des Pferdedämons, der böse Odem von Kikkuli! Sei auf der Hut – er ist hier!«
Durch einen schmalen Belüftungsschlitz fällt ein fahler Lichtstrahl genau auf den Altar, der rechts von ihnen an der Schmalseite der Cella steht. Sieben sitzende Gottheiten mit hohen Hörnermützen, dem Zeichen ihrer Göttlichkeit, starren ihnen aus ihren leblosen Steinaugen entgegen. Unwillkürlich hemmt Senni seine Schritte und betrachtet für einen kurzen Augenblick die bartlosen Figuren. Drei von ihnen halten kleine Kinder auf ihren Schößen, die vier anderen Tiere unterschiedlichster Art.
Abb. 2: Relief der Sebettu aus arbe
Als Kind hatte ihm sein Vater unnu von diesen sieben Göttinnen erzählt, die Unheil und Schrecken unter den Menschen verbreiten. Sie seien auch dafür verantwortlich, wenn der Mondgott sein Antlitz verdunkelt. Wenn das passiert, sei das ein böses Omen! Größtes Unglück sei aber bei Mondfinsternissen im Verzug, hatte ihm sein Vater eingebläut, weshalb Senni noch heute den Sebettu größten Respekt zollt. Als ob sie ihn mit ihren ausdruckslosen Augenhöhlen dazu zwingen würden, verneigt er sich vor dem Kultbild.
»Er ist nicht hier!«, hört er hinter sich Banūs Stimme. »Ich habe bereits alles abgesucht. Keine Spur von einem Pferdedämon. Wenn er hier war, ist er uns entkommen!«
Mit einem abschätzenden Blick auf das Altarbild bemerkt Banū: »Dieses Volk der Mitanni hat seltsamen Göttinnen gehuldigt. Die sehen aus, als ob sie die Kinder auf ihren Armen fressen wollen!«
»Hüte deine Zunge!«, entgegnet ihm Senni frostig. »Auch wenn es nicht die Götter sind, die du verehrst, so sind es dennoch mächtige Wesen, die du nicht verspotten solltest!«
Kaum ist Sennis Stimme verhallt, da hören sie, wie sich jemand an der Tür zu schaffen macht. Die beiden Freunde sind seit langem Kampfgefährten. Ein kurzer Blick genügt, und jeder weiß, was er zu tun hat: Senni bezieht links von der Eingangstür, der Elamier auf der rechten Seite Stellung. Beide heben ihre Waffen in Kopfhöhe, bereit zum Todesstoß. Als sich die Pforte öffnet, presst Senni seinen Rücken noch dichter an die Wand und hält den Atem an. Sein Auge fixiert den Türspalt, der sich langsam vergrößert. Wenn es Kikkuli ist, werde ich ihn mit einem Hieb den Kopf vom Rumpf trennen, schwört sich Senni leise und umklammert mit eisernem Griff sein Schwert. Zuerst fällt ein Schatten in den Raum, dann folgt zaghaft eine Gestalt. Senni holt aus, doch Banū springt nach vorne, stößt den Ankömmling unsanft zur Seite und fällt dem Hurriter laut schreiend in den Arm:
»Halt ein! Es ist Nūr-Šamaš, mein Sohn!«
Senni kommt nun aus der Deckung und brüllt den auf der Erde liegenden Jungen an:
»Was schleichst du dich an uns heran? Um Haaresbreite hätte ich dir den Schädel gespalten! Bedanke dich bei deinem Vater, der den tödlichen Hieb verhindert hat!«
Erst jetzt nimmt Senni wahr, dass auch ersi, Ašdus Bruder, vor der Tür steht. Vom Schrecken gezeichnet, stammelt der:
»Du hast nach mir geschickt, Senni. Du ließest mir ausrichten, dass der Pferdedämon, der grässliche Kikkuli, in der Stadt sei. Meine Schwester sei in Gefahr. Von den Wachen am Tor haben wir erfahren, dass ihr Ašdu zum Tempel der Sebettu gefolgt seid – deshalb sind wir hier. Wo ist nun meine Schwester? Ist Kikkuli wirklich hier in arbe?«
Senni sammelt sich schnell und hilft Nūr-Šamaš auf die Beine. Aufmunternd klopft er ihm auf die Schultern:
»Verzeih mir meinen Zorn, junger Freund, aber ich war im ersten Augenblick wie von Sinnen, denn ich hatte Kikkuli in der Tür erwartet und nicht dich! Danke den Sebettu, die wohl nicht wollten, dass Blut auf der Schwelle ihres Heiligtums vergossen wird!«
Dann wendet er sich ersi zu:
»Ja, der Pferdedämon ist zurück. Und nicht nur das: Kikkuli hat deine Schwester in seine Gewalt gebracht. Wir haben bereits den gesamten Kultplatz durchsucht. Gefunden haben wir nur die Opfer des Ungeheuers. Im Stall nebenan liegen zwei ermordete Tempeldienerinnen aus dem Gefolge deiner Schwester. Von Ašdu aber keine Spur!«
ersi ringt um Fassung. Kreidebleich wankt er von einem Bein auf das andere:
»Senni, nach alledem, was dieser Mann uns dreien auf seinem Gestüt angetan hat, bist du uns wie ein Bruder. Befreie Ašdu aus den Klauen des Pferdedämons! Nur du kannst sie retten!«
Im nächsten Augenblick versagen ihm die Beine. ersi stützt sich an der Außenmauer des Tempels ab und gleitet an der Wand zu Boden.
»Kümmere dich um ihn!«, befiehlt Banū seinem Sohn auf Elamisch, »und alarmiere die Wachen! Wir nehmen die Verfolgung des Übeltäters auf! Lass uns keine Zeit verlieren, Senni!«
Draußen auf der Straße erkundigen sie sich bei einem fahrenden Händler, ob er einen Hünen gesehen habe, einen hochgewachsenen Mann mit einer Reitpeitsche am Gürtel.
»So ein Riese wäre mir bestimmt aufgefallen«, gibt er zur Antwort, »die Einzige, die mir begegnet ist, war eine alte Vettel, die ihr Gesicht unter einem schwarzen Mantel verborgen hielt. Unfreundlich war sie. Grüßte noch nicht einmal! Sie schob einen mit Tüchern beladenen Karren vor sich her. Ich wunderte mich nur, dass die Alte ohne Hilfe einen so schweren Wagen drücken konnte.«
»Die Frau schob einen schwer beladenen Karren – mutterseelenalleine sagst du?«
Der Fahrende nickt und zeigt die Straße hinunter: »Dort hinten ist sie in die Gasse eingebogen.«
Die beiden Freunde zögern keinen Augenblick und hetzen in die Richtung, in die der Händler zeigt. Der setzt kopfschüttelnd seinen Weg fort: »Lauter Verrückte rennen durch die Stadt! Früher war das Leben einfach beschaulicher – und die Bewohner waren freundlicher!«
Der um etliche Jahre jüngere Senni rennt wesentlich schneller als Banū. Als der Elamier um die Ecke biegt, ist sein Freund bereits am Ende der Gasse angelangt und ruft ihm zu: »Da ist der Karren! Komm schnell, Banū!«
Sie finden das hölzerne Gefährt verlassen vor. Kein Mensch weit und breit. Achtlos mitten im Weg stehengelassen, obgleich mit allerlei Tand und Tüchern beladen. Senni will schon weiter, als sein Blick auf einen Stoffballen fällt, der unter all dem Trödel liegt. Von seinem Freund, dem assyrischen Tuchhändler Labnānu, hat er gelernt, wie kostbar Stoffe sind. Nicht umsonst werden Kriegsgefangene stets ihrer Kleidung beraubt oder Gewänder als Bezahlung an Palastbeamte ausgegeben. Auf dem Karren liegt ein ganzer Stoffballen unfachmännisch zusammengerollt unter Schüsseln und Näpfen. Kein Kaufmann würde so mit seiner Ware umgehen! Instinktiv schiebt Senni das Geschirr beiseite, um sich den Stoffballen näher anzuschauen. Er tastet das Gewebe ab. Sofort wird ihm klar: In den Stoff ist etwas eingerollt.
»Banū, pack mit an! Das ist ein menschlicher Körper!«
In Windeseile entzurren sie das Bündel, das von dicken Stricken zusammengehalten wird. Vorsichtig entwirren sie die Stoffbahnen, bis ein schwarzer Haarschopf zum Vorschein kommt. Es ist Ašdu, die Hohepriesterin der Göttin Ištar, Sennis Angebetete! Behutsam entfernen sie den Knebel aus dem Mund der Bewusstlosen.
»Sie atmet nur noch schwach. Sie braucht dringend die Hilfe eines Heilkundigen!«
Aus den umliegenden Häusern sind inzwischen zahlreiche Anwohner herbeigeströmt und umlagern neugierig den Karren.
»Haltet keine Maulaffen feil! Ruft lieber einen Arzt!«, herrscht sie Senni ungeduldig an. Ein älterer Mann löst sich aus der Gruppe:
»Lass mich das machen! Bringt die Frau zu mir ins Haus! Gleich da drüben! Ich kümmere mich um sie.«
»Bist du ein Beschwörer?«, will Senni von ihm wissen.
»Nein, mein Freund, nur ein Wundarzt, der sich auf das Heilen von Verletzungen jeglicher Art versteht. Einen Beschwörer, der Dämonen und unheilvolle Geister vertreiben kann, findest du im Tempel unter der Priesterschaft. Ich kann nur die Wunden säubern und verbinden, die dieses bedauernswerte Geschöpf davongetragen hat. Wer hat ihr das überhaupt angetan?«
»Das war ein wahrer Unhold. Ein Dämon der Unterwelt. Kikkuli mit Namen. Wir werden ihn zur Strecke bringen. Nimm dich der Frau an. Gewähre ihr die beste Behandlung! Ich komme für alle Kosten auf, alter Mann!«
Während man Ašdu zum Haus des Arztes bringt, setzen Senni und Banū die Verfolgung des Geflüchteten fort. Zwei Straßen weiter liegt ein schwarzer, stark verschlissener Umhang auf dem Boden. Sie halten zwei Bauern an, die auf dem Weg zur Feldarbeit sind. Nein, sie hätten keinen Riesen gesehen, geben sie zur Auskunft. Auch eine Frau, die aus dem Fenster des Nachbarhauses hinauslehnt, hat keinen Fremden erblickt. Senni erkundigt sich noch hier und da. Der Pferdedämon ist wie vom Erdboden verschluckt. Im Wirrwarr der unübersichtlichen Gassen verliert sich die Spur des Gejagten wie ein Phantom zwischen den Gemäuern. Fluchend machen sich die Freunde auf den Weg zum nahegelegenen Nord-Tor. Dort bitten sie den Hauptmann der Wachsoldaten, ein strenges Auge auf alle Fremdlinge zu richten. Gesucht werde ein Mitanni, ein Bär von einem Mann. Ein Hüne mit einer Reitpeitsche am Gürtel, der gegen den Wind nach Pferdeschweiß stinkt. Der Kommandeur verspricht, die Augen offen zu halten:
»Ein Riese kann sich vor uns nicht verstecken, Senni!«, prahlt er großspurig.
»Eine Maus könnte nicht durch dieses Tor schlüpfen, ohne dass wir es bemerken würden.«
Abb. 3: Tell Chuēra /arbe:
Gasse der mittelassyrischen Siedlungsschicht
Senni und Banū durchqueren die gesamte Stadt und alarmieren die Besatzungen eines jeden Stadttores. Bei einbrechender Dunkelheit machen sie sich auf den Rückweg - Banū ins elamische Viertel, Senni bricht vom Westtor auf, zurück zum Haus des Arztes, der die Pflege von Ašdu übernommen hat. Hier in der Unterstadt sind die Häuser so eng aneinandergebaut, dass sich ihre Dächer berühren. Beim Laufen muss Senni immer wieder seinen Kopf einziehen, um nicht an weit in die Gasse hineinragende Dachbalken zu stoßen. Die einbrechende Nacht überzieht die Stadt sehr schnell mit Dunkelheit. Lichtscheues Gesindel treibt sich dann hier zuhauf herum. Senni hält deshalb mit seiner Rechten den Griff seines Dolches umklammert – allzeit bereit, einen Angriff abzuwehren. Wenn er jemandem begegnet, behält er ihn so lange im Auge, bis derjenige außer Reichweite ist. An einer Hausecke steht eine junge Frau mit zerzausten Haaren, in einem schäbigen Gewand. Als sie Senni erblickt, hebt sie ihren Rock und gibt den Blick auf ihren nackten Unterleib frei:
»Hoher Herr, komm zwischen die Schenkel einer Mitanni!«, lockt sie mit verführerischer Stimme. »Eine Nacht mit einer Mitanni-Frau hat noch kein Mann jemals vergessen!«
Senni weicht ihr aus und huscht zur anderen Straßenseite. Dabei achtet er nicht darauf, dass just in diesem Augenblick ein anderer Mann um die Ecke biegt, der einen wollenen Umhang um Kopf und Schultern geschwungen hat. Ungewollt rempelt Senni den Entgegenkommenden an und bringt diesen aus dem Tritt. Dabei verrutscht dessen Überwurf. Völlig überrascht blickt er in das Gesicht von Bürgermeister Šumīja!
»Was führt dich des Nachts in diese finstere Ecke der Stadt?«, erkundigt sich Senni neugierig, »dazu ohne jegliche Begleitung!«
»Das könnte ich dich genauso fragen, Hurriter!«, blafft der Bürgermeister zurück, »scher dich um deine Angelegenheiten und lass mich zufrieden!«
Unwirsch stößt er Senni zur Seite und entschwindet in der Dunkelheit. Bevor Šumīja in ein nahegelegenes Gässchen abbiegt, in dem es penetrant nach Urin stinkt, versichert er sich, dass Senni ihm nicht folgt. Erst dann schleicht er zu einer halbverwitterten Holzpforte, an die er drei Mal klopft: zwei Mal kurz, nach einer kurzen Pause noch einmal fester. Auf das vereinbarte Zeichen wird ihm geöffnet und Šumīja verschwindet in dem heruntergekommenen Schuppen. Beim Eintreten hält er sich unwillkürlich die Nase zu. Der beißende Körpergeruch des vor ihm stehenden Hünen raubt ihm den Atem.
»Es ist an der Zeit, dass du endlich kommst, Bürgermeister!«, knurrt dieser ihn mit seiner Bassstimme an, »ich muss noch in dieser Nacht aus der Stadt. Man ist mir dicht auf den Fersen. Am Tempel der Sebettu konnte ich nur mit knapper Not entkommen und musste zu meinem Leidwesen meine Beute zurücklassen. Aber die hole ich mir beim nächsten Mal! Sorge dafür, dass ich heute Nacht die Wache passieren kann! Du weißt, wenn sie mich erwischen, dann fällst auch du, Bürgermeister!«
Senni hat ganz andere Gedanken im Kopf, als dem Bürgermeister, den er auf den Tod nicht ausstehen kann, nachzuspionieren. Sein Ziel ist das Haus des Arztes. Inständig hofft er, dass Ašdu den Angriff überlebt hat. Sein Herz rast, als er vor der Tür des Anwesens steht und anklopft. Für Senni dauert es eine Ewigkeit, bis ihm endlich geöffnet wird.
»Wie geht es ihr? Ist meine Ašdu am Leben?«
Er wartet die Antwort des Hausherrn nicht ab, sondern drängt an ihm vorbei durch den schmalen Flur in den Innenhof, um den zahlreiche Räume gelagert sind.
Abb. 4: Tell Chuēra /arbe: Isometrische Darstellung eines Wohnhauses
Ein paar Frauen, die um einen Herd hocken und ein Essen zubereiten, schreien auf, als ein fremder Mann so urplötzlich vor ihnen erscheint.
»Wo ist Ašdu?«, will Senni wissen.
Der Arzt beruhigt die erschrockenen Frauen:
»Keine Angst, meine Lieben, das ist Senni. Er hat der Hohepriesterin das Leben gerettet. Wenn er sie nicht auf dem Karren entdeckt hätte, wäre sie wohl an ihrem Knebel erstickt.«
Die Frauen erheben sich und verneigen sich vor Senni.
»Ašdu lebt also? Ich muss zu ihr!« Sennis Worte klingen nun eher flehend.
Der Hausherr legt ihm die Hand auf die Schulter:
»Du darfst sie sehen, aber sie braucht Ruhe, um sich zu erholen. Ich habe ihr einen Trank bereitet, der sie schlafen lässt. Ich führe dich zu ihr, aber du darfst sie nicht wecken!«
Senni ist einverstanden, zieht vor dem Eingang seine Schuhe aus und folgt dem Arzt in eine kleine Kammer. Zu seiner Überraschung sitzt dort ersi und hält die Hand seiner Schwester, die schlafend auf einem Bett liegt.
»Ihr geht es gut«, flüstert ersi, »Dank der Heilkunst des Arztes wird sie den Angriff unseres Peinigers überstehen!«
Senni greift nach der Öllampe, die auf einem Tischchen steht und nähert sich vorsichtig der Bettstatt. Ašdus Antlitz erscheint ihm flackernden Licht noch schöner als jemals zuvor. Seine Linke greift nach dem Beutelchen, das ihm einst Ašdu geschenkt hat, und das er noch immer an einer Lederschnur um den Hals trägt. Darin verwahrt er seit vielen Jahren die Tonscherbe, in der er damals den Namen seines Vaters unnu einritzte. Die ersten Schriftzeichen, die ihm ersi auf dem Hof des Kikkuli beigebracht hatte. Auch wenn es Außenstehenden ungebührlich erscheint, haucht Senni der Schlafenden einen Kuss auf die Stirn.
»Sie ist mir wie eine Schwester!«, erklärt er dem verwunderten Arzt, der die Augenbrauen nach oben zieht. ersi bestätigt:
»Wir sind wie Geschwister aufgewachsen – unzertrennlich bis an unser Lebensende!«
Der Hausherr nickt und lächelt:
»Kommt ihr beiden, lasst eure Schwester ruhen! Draußen im Hof erwartet euch eine bescheidene Mahlzeit. Meine Frau und meine Töchter haben das Abendmahl zubereitet. Wir würden uns glücklich schätzen, wenn ihr unsere Gäste sein würdet.«
ersi und Senni bedanken sich für die Einladung, denn den beiden knurrt schon der Magen nach dem ereignisreichen Tag. Die Töchter des Arztes stellen den beiden Freunden eine tönerne Schüssel, randvoll mit Wasser, zu Füßen.
»Ihr wollt euch sicherlich vor dem Essen reinigen. Tücher zum Trocknen liegen auf dem Schemel neben euch bereit. Ihr dürft auch das Duftöl in dem Fläschchen benutzen.«
Kichernd ziehen sich die jungen Frauen zurück, immer wieder zu den Männern herüberblinzelnd, die sich den Schweiß von der Haut waschen. Noch bevor sie sich zum Hausherrn gesellen können, kommt eines der Mädchen zurück, kniet sich vor ihnen nieder, wäscht und salbt ihnen die Füße.
»Nun seid ihr bereit, das abendliche Mahl mit uns einzunehmen. Folgt mir bitte!«
Der Arzt bittet die beiden Freunde, neben ihm auf bequemen Polstern Platz zu nehmen. Dann erscheint die Hausherrin, gefolgt von zwei Knaben, die einen schweren Tontopf herbeischleppen. Behutsam setzen sie diesen in der Mitte der Gesellschaft auf dem Boden ab und verkeilen ihn mit Steinen, damit er nicht umkippt. Das Gefäß ist bis zum Rand mit einer dampfenden Brühe gefüllt. Die Köchin taucht eine hölzerne Kelle hinein und füllt nach und nach für jeden eine Schale. Der Hausherr zerteilt derweil nach alter Sitte das Fladenbrot in gleich große Stücke und reicht zunächst den beiden Gästen, dann den Familienmitgliedern jeweils ein Stück Brot. Nachdem er den Göttern für die Speisen gedankt hat, bittet er die Anwesenden, sich die Suppe munden zu lassen.
Senni und erši stürzen sich mit Heißhunger auf die warme Mahlzeit, eine kräftige Brühe mit Fleischbrocken, die mit viel Salz gewürzt ist.
Die Hausherrin freut sich, dass es den Gästen schmeckt, erläutert aber fast entschuldigend, dass dies ein sehr bescheidenes Mahl sei:
»Wir waren auf euren Besuch nicht vorbereitet! Deshalb müsst ihr mit dieser Salzsuppe vorliebnehmen.«
»Sehr lecker!«, beruhigt ersi die Köchin, »es schwimmen sogar Fleischbrocken in der Brühe! Das hat man nicht alle Tage! Aber diese Salzsuppe schmeckt nach einem ganz besonderen Gewürz. Kannst du mir bitte verraten, mit was du die Brühe verfeinert hast?«
Sie lacht: »Meine Salzsuppe hat bislang noch jedem gemundet! Ich habe heute Nachmittag beim Metzger eine Hammelkeule gekauft und diese in einem Sud mit reichlich Fett und sehr viel Salz aufgekocht. Den besonderen Geschmack geben aber Zypressenzapfen, die meine Töchter gestern von den Bäumen am Flussufer gesammelt haben. Wenn das Fleisch so weich ist, dass es vom Knochen fällt, gebe ich die getrockneten Zapfen zusammen mit Kümmel, Koriander, einem Stängel Lauch und Kräutern hinzu.«3
Senni bemüht sich, die Kochkunst ebenfalls zu loben: »Einfach ausgezeichnet! Auf meinen Reisen kehre ich am Rand der Berge immer wieder in einer Herberge ein. Wenn ich noch einmal dort übernachte, muss ich dem Küchenmeister von dieser Köstlichkeit berichten!«
Die Gastgeber sind höchst zufrieden, dass die Salzsuppe bei ihren Gästen so großen Anklang findet. Da es schon spät in der Nacht ist, bieten sie ihnen kurzerhand an, in ihrem Haus zu übernachten, was die beiden gerne annehmen.
»Dann könnt ihr euch gleich morgen früh davon überzeugen, wie es eurer Schwester geht!«, frohlockt der Arzt in seiner warmherzigen Art.
Während sich die beiden Freunde todmüde zur Nachtruhe begeben, treffen sich in einer finsteren Gasse der Unterstadt zwei in Umhänge gehüllte Gestalten. Der Kleinere von beiden huscht von Hauswand zu Hauswand, immer zwei bis drei Schritte voran, um sich zu vergewissern, ob die Luft rein ist. Dann winkt er die zweite Gestalt zu sich heran, die ihm mit weit nach vorne gebeugtem Oberkörper folgt. So pirschen sich beide durch die Gassen bis sie zum Westtor gelangen.
»Warte hier, bis ich dir das Zeichen gebe!«, flüstert der Kleine. Die zweite Gestalt richtet sich nun auf und drückt den hünenhaften Körper eng an eine dunkle Hauswand. Mit grimmigem Blick verfolgt er jede Bewegung des Kleineren, der, flink wie eine Maus, sich bis zu einem Gebäude vorwagt, das nur einen Steinwurf vom Wachturm des Westtores entfernt liegt. Ein Pfiff ertönt – leise, doch in der Stille der Nacht deutlich für jeden in der Umgebung hörbar. Eine Weile lang geschieht nichts. Zunehmend wird der Hüne unruhiger, während der Kleinere fast reglos auf seinem Posten verharrt. Wie aus dem Nichts löst sich plötzlich ein Schatten aus dem Haus der Wachsoldaten. Sehr zögerlich, sich nach allen Seiten umschauend, kommt ein Mann in voller Rüstung auf den Kleineren zu. Es ist der Hauptmann der Wachsoldaten, dem der Kleine nach kurzem Gespräch einen Beutel zusteckt. Aufgeregt winkt er anschließend dem Hünen zu, ihnen zu folgen. Zwei weitere Soldaten treten aus dem Wachgebäude heraus, einen geflochtenen Korb auf den Schultern tragend. Sie stapfen die Treppe hinauf zur Mauerkrone, befestigen ein Seil am Korb, das sie an einer Zinne vertäuen. Inzwischen ist der Hüne bei der Gruppe eingetroffen.
»Steig in den Korb!«, flüstert der Kleine, »wir lassen dich hinunter. Das schwere Tor zu öffnen, würde zu viel Aufmerksamkeit erregen!«
Der Riese packt ihn am Hals und wettert erbost:
»Bürgermeister, du willst mich doch wohl nicht in einem Korb die hohe Stadtmauer hinablassen? Was, wenn das Seil reißt?«
»Beruhige dich, Kikkuli, nicht so laut!«, antwortet der schmächtige Stadtbeamte, »hat dich Šumīja schon jemals enttäuscht? Meine Helfer hier sind mir treu ergeben. Du kannst ihnen vertrauen, denn du bist nicht der Erste, den wir auf diese Art heimlich aus der Stadt schaffen! Bislang ist noch niemand zu Schaden gekommen. Mit diesem Geflecht werden normalerweise schwere Lasten, wie Lehmziegel oder Steine, für den Ausbau der Mauer nach oben gezogen. Die Seile halten dein Gewicht. Keine Sorge!«
Die drei Soldaten hieven den Korb über die Brüstung der Stadtmauer.
»Steig ein! Wir haben nicht ewig Zeit. Wir müssen schnellstens wieder zurück auf unsere Posten!«, drängt ihr Anführer voller Ungeduld.
Widerwillig klettert Kikkuli in den Korb, den die Männer, unter der Last ächzend, Stück für Stück nach unten gleiten lassen. Am Boden angekommen, entschwindet der Pferdedämon, wilde Flüche ausstoßend, wie ein unsichtbarer Geist in der nächtlichen Finsternis.
2 Das 8. Regierungsjahr des assyrischen Königs Tukulti-Ninurta I. entspricht nach unserer Zeitrechnung dem Jahr 1226 vor Christus.
3 Bottéro, Jean, La plus vieille cuisine du monde. Éditions Louis Audibert. (Paris 2002), Seite 107, Bouillon au sel.
3. Im Bann der Liebesgöttin
Das Gebell von Hunden weckt Senni aus einem Halbschlaf. Gähnend erhebt er sich von seinem Lager. Er hat das Gefühl, als habe er die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Zudem flogen wirre Fantasien durch seine Träume, an die er sich nur noch vage erinnern kann. Sein Schädel brummt, als ob sich ein Bienenschwarm darin breitgemacht hätte. Sein Blick fällt auf die andere Seite des Raumes. Die Bettstatt, die die Hausherrin für seinen Freund ersi hergerichtet hat, findet er verlassen. Senni schlüpft in sein Wams und tritt vor die Tür. Die aufgehende Sonne schickt ihre ersten Strahlen über die Mauer des Innenhofes. Senni ahnt, wo er seinen Freund finden kann. Er klopft leise an die Tür des benachbarten Raumes, in der man gestern Ašdu zur Ruhe gebettet hat. Da niemand antwortet, öffnet er leise und schiebt seinen Kopf durch den Türspalt. Er hat sich geirrt: ersi ist nicht hier, aber er vernimmt das sanfte Atmen von Ašdu, deren betörendes Duftöl ihm in die Nase steigt. Es ist warm in dem winzigen Zimmer, aber nicht stickig, da frische Luft durch ein Fensterchen hineinströmt, das mit einem dünnen Vorhang verhängt ist. Wie glutrote Finger tasten sich die Strahlen der rasant aufgehenden Sonne in den Raum, wandern über den Boden hinüber zum Lager von Ašdu. Sennis Augen folgen dem Weg der Sonnenstrahlen, die nun über den makellosen Körper der jungen Frau streifen, sie abzutasten scheinen. Ašdu ist nur mit einem leichten Untergewand bekleidet, das ihr im Schlaf von den Schultern gerutscht ist. Ihre pechschwarzen Haare fallen in langen Strähnen um ihr schmales Gesicht. Die Sonne greift nun nach dem hinreißend schönen Körper, fließt über den nur halbverdeckten Busen hinunter zum Schoss. Senni kann seinen Blick nicht mehr abwenden. Gierig verschlingen seine Augen das Ebenmaß von Ašdus Körper. Er spürt, wie die Begierde in ihm aufsteigt. Er will, er muss diese Frau besitzen! Er macht einen Schritt nach vorne, streckt seine Rechte aus, um den Busen zu berühren. In diesem Augenblick erwacht Ašdu. Senni schreckt zurück, doch Ašdus smaragdgrüne Augen ziehen ihn magisch an. Sie fixiert ihn nur kurz, lächelt ihm zu, ohne ihren halbnackten Körper vor seinen Blicken zu verbergen. Noch bevor Senni seine ausgestreckte Hand zurückziehen kann, hat sie ihn gepackt und zieht ihn zu ihrer Bettstatt. Sanft streicht ihre Linke durch sein Haar, zieht Sennis Kopf zu sich hinunter. Als Ašdus Lippen die seinen berühren, lodert in Senni ein Feuer auf, das er noch nie zuvor verspürt hat. Noch mehr, als sie ihre Schenkel öffnet und Senni in heftiger Umarmung an ihren Körper presst. Senni schwinden die Sinne, er kann nicht mehr klar denken, sondern fühlt, spürt die weiblichen Reize seiner Angebeteten.
Abb. 5: Ašdus Augen
»Einmal nur«, flüstert sie ihm ins Ohr, »nur ein einziges Mal in unserem Leben dürfen wir den Zauber meiner Herrin, der Liebesgöttin Ištar, kosten!«
Dann versinken sie ineinander in blinder Gier, lassen ihren Gefühlen ungehemmt ihren Lauf.
Als Stimmen vom Hof in den Raum dringen, stößt Ašdu ihren Geliebten sanft von sich:
»Niemand darf hiervon erfahren! Hast du mich verstanden, Senni? Niemand! Auch mein Bruder nicht!«
Senni nickt verstört, nicht fähig einen klaren Gedanken zu fassen. Hastig ordnen sie ihre Kleider. Es klopft. Senni macht einen Schritt zur Seite, während Ašdu, aufrecht sitzend, den Ankömmling hereinbittet. Es ist der Hausherr, der Arzt, gefolgt von Ašdus Bruder ersi. Beide werfen Senni einen verwunderten, fast vorwurfsvollen Blick zu. Im Halbdunkel erkennen sie nicht, dass Senni errötet. Schnell wendet sich der Arzt der jungen Frau zu: »Du hast dich sichtlich erholt, Hohepriesterin«, stellt er lapidar fest und begutachtet noch einmal kurz die Schwellung an Ašdus Kopf. »Das vergeht. Der Unhold hat dich wohl mit einem Schlag betäubt, dir aber wohl ansonsten kein Leid zugefügt.«
»Mir geht es schon viel besser!«, antwortet Ašdu.
»Schwester, dann kannst du gleich wieder zurück zum Tempel, wo du in Sicherheit bist!«, wirft ersi ein, »ich habe schon früh die Wachen verständigt. Eine Abteilung wartet draußen mit einem Wagen auf dich, um dich sicher zum Ištar-Tempel zu geleiten. Ich habe Angst, dass Kikkuli erneut zuschlägt. Mit Sicherheit wird er seine Klauen immer wieder nach dir ausstrecken. Wir müssen künftig auf der Hut sein, denn nun weiß der Pferdedämon, wo er dich zu suchen hat, geliebte Schwester!«
Senni steht wie gelähmt im Innenhof, unfähig etwas zu sagen, als Ašdu durch die Hauptpforte hinaus auf die Straße tritt, um den bereitstehenden Streitwagen zu besteigen. Im Vorbeigehen hat Ašdu ihm noch einen wehmütigen Blick zugeworfen. Ašdus Augen, haben ihn schon immer wie Hexenwerk betört. Versunken in Gedanken an seine Geliebte, den Hauch ihres Duftöls noch in der Nase, das ihn stets an Blumen auf einer Frühlingswiese erinnert, holt ihn die Stimme des Arztes wieder zurück in die Gegenwart: »Junger Freund, du bist dem Bann der Liebesgöttin verfallen. Zu eurer beiden Wohl, beschwöre ich dich: Lass ab von der Hohepriesterin. Wenn deine Tat ruchbar wird, seid ihr beide des Todes!«
Senni will widersprechen, doch der Arzt zieht ihn zur Seite: »Kein Wort! Kein Wort der Entschuldigung, kein Wort der Erklärung! Ich weiß alles und werde schweigen wie ein Grab. Damit niemand etwas erfährt, habe ich das Leinentuch von Ašdus Bettstatt bereits einer Dienerin zum Waschen gegeben, bevor meine Frau eure verräterischen Spuren entdeckt. Ich habe der Wäscherin erklärt, dass die Flecken von einem krankhaften Ausfluss stammen, und das Tuch deshalb ordentlich gereinigt werden müsse.«
Wortlos ergreift Senni die Hand des Arztes und drückt ihm als Zeichen der Ehrerbietung einen Kuss auf den Handrücken, bevor er dessen Haus verlässt.
4. Löwengesicht
Die Einwohner von arbe treibt es schon früh am Morgen hinaus aus ihren Häusern, hin zum Basar, wo nicht nur Waren ihre Besitzer wechseln, sondern auch neueste Nachrichten, aber auch Tratsch und Klatsch ausgetauscht werden. Wie ein Lauffeuer hat es sich herumgesprochen, dass die Hohepriesterin der Liebesgöttin entführt und zwei ihrer Tempeldienerinnen ermordet wurden. An den Marktständen, auf dem Basar, in den Einkaufspassagen der Sūks, schmalen Gassen, in denen sich Verkaufsläden mit gleichartigen Waren aneinanderreihen, drehen sich die Gespräche von Kaufleuten und Kunden nur um dieses eine Thema: Wer steckt hinter der abscheulichen Tat? Gerüchte keimen auf. Manche behaupten, ein Ungeheuer gehe um, andere deuten die Ermordung des Tempelpersonals als Vorzeichen großen Unglücks, das über die Stadt und die Bevölkerung hereinbrechen werde. Ein Mann, der in der Nähe des Westtores wohnt, schwört felsenfest, dass im Morgengrauen Geister von der Stadtmauer gesprungen seien.
Senni, der sich auf den Weg zu seinem Freund Banū gemacht hat, hört im Vorübergehen, wie eine Frau einer anderen erzählt, dass ihre Freundin ihr beim Leben ihrer Kinder versichert habe, dass der Mord an den Tempeldienerinnen das Werk von finsteren Mächten gewesen sei. Ihre Freundin habe mit eigenen Augen den Dämon gesehen. Riesig sei er gewesen, hochgewachsen wie ein Straußenvogel in der Steppe. Als Senni dies vernimmt, bleibt er sofort stehen:
»Verzeih mir, dass ich dich anspreche, obwohl wir uns nicht kennen.«
Die Frauen schauen ihn zunächst erschrocken an, treten einen Schritt zurück und strecken ihm abwehrend ihre Arme entgegen.
»Keine Angst!«, beschwichtigt er die beiden, »ich habe nur zufälligerweise deine Beschreibung des Dämons vernommen. Weißt du mehr über ihn?«
»Ich? Ich weiß gar nichts!«, antwortet die Angesprochene, »da musst du dich an meine Freundin halten. Die hat ihn gesehen ... und gerochen! Der Dämon muss erbärmlich gestunken haben. Wohl wie der Kadaver einer verwesenden Mähre!«
»Er hat nach Pferd gerochen?«, will Senni wissen.
»Frag sie selbst! Da kommt sie geradewegs auf uns zu.«
Eine Frau mittleren Alters, einen Tragekorb auf dem Kopf balancierend, quält sich durch die Menschenmassen der engen Gasse.
»Komm her! Erzähl dem Mann von deiner Begegnung mit dem stinkenden Dämon!«
Die Ankommende setzt den Korb auf dem Boden ab, wischt sich den Schweiß aus der Stirn und mustert Senni von oben bis unten:
»Du schmächtiger Kerl möchtest dieses stinkende Ungeheuer fangen?«, fragt sie schnippisch, »das Monstrum ist doppelt so groß wie du!«
Mit hämischem Grinsen wartet sie auf die Reaktion des Hurriters.
»Lass das meine Sorge sein!«, wiegelt Senni ab, »sag mir lieber, wo genau du ihn gesehen hast!«
Die Frau kratzt sich am Kopf und antwortet:
»Die Straße hinunter, dann die zweite nach rechts und dann ein kleines Stück der Nase nach. Vor dem Haus, dessen Tür mit einem blauen Kreis gekennzeichnet ist, hat mich der Dämon zu Boden geschleudert. Ich dachte zuerst, ein Pferd hätte mich getreten, doch es war ein riesiger Wüterich, der auf zwei Beinen davonlief. Mehr kann ich dir nicht sagen. Meine Knochen tun jetzt noch weh!«
»Ich danke dir für die Auskunft!«, antwortet Senni und rennt los.
Entsetzt schreit ihm die Frau hinterher:
»Geh nicht dort hin! In diesen Teil der Unterstadt wagt sich niemand! Halte dich lieber fern von diesem Ort!«
Doch Senni schlägt die Warnung in den Wind und steht schon bald vor der Pforte mit dem aufgemalten Kreis. In der Tat eine düstere Wohngegend! Heruntergekommene Häuser stehen hier so eng zusammen, dass noch nicht einmal ein Ochsenkarren zwischen ihnen hindurchfahren könnte. Die Gassen sind noch finsterer, weil sich kaum ein Sonnenstrahl hierher verirrt. Menschen in zerlumpter Kleidung schleichen an Senni mit gesenkten Köpfen vorüber. Niemand würdigt ihn eines Blickes! Nur zwei nicht gerade vertrauenswürdig aussehende Gestalten, die sich in einer dunklen Nische herumdrücken, mustern ihn von Kopf bis Fuß. Senni umklammert instinktiv den Griff seines Dolches und beobachtet die beiden aus den Augenwinkeln. Sie tuscheln sich etwas zu. Der eine nickt, während der andere sich langsam auf Senni zubewegt, sein Kumpan hinterdrein!
»Was hat der feine Herr hier bei uns zu suchen?«, schnauzt ihn der erste an, »spionierst du jemandem nach?«
Der zweite Mann stellt sich nun breitbeinig neben seinen Freund, einen schweren Knüppel in der Hand.
»Fremde mögen wir hier nicht, Bürschchen!«, wettert der Wortführer, »wer ungefragt hier eindringt, muss ein Scherflein entrichten, damit ihm nichts zustößt! Also öffne deinen Beutel und spende großzügig!«
Der Keulenträger hebt seine hölzerne Waffe und droht:
»Raus mit dem Zaster, bevor mir der Geduldsfaden reißt!«
Senni zückt seinen Dolch, weicht ein wenig zurück und stößt dabei mit dem Ellenbogen heftig an die Tür mit dem blauen Kreis. Noch bevor es zum Kampf kommt, öffnet sich hinter ihm die Pforte. Erschrocken macht der erste Angreifer zwei Schritte zurück. Der Zweite lässt im gleichen Augenblick seinen Knüppel fallen und beide nehmen, so schnell sie können, Reißaus. Verwundert schaut Senni den beiden Halunken hinterher. Ein seltsam fauliger Geruch weht über seine Schultern in seine Nase. Senni dreht sich um und erschaudert beim Anblick eines Mannes, dessen Gesicht dem eines Löwen gleicht. Zerzauste Haare wallen wie wildes Gestrüpp um seinen Schädel. Die überbreite Nase ist von tiefen Kerben zerfurcht, die Wangen und das Kinn sind von dicken Narben übersät. Die braun gescheckte Haut ist so dünn, dass Senni die Adern darunter zu erkennen glaubt. Senni würde am liebsten sofort die Beine in die Hand nehmen, doch der Mann lächelt gequält, streckt Senni seine fingerlose Rechte entgegen und sagt mit freundlicher Stimme:
»Komm herein! Was führt dich in diese Gegend? Menschen deines Schlages klopfen höchst selten an meine Tür.«
Senni verharrt mit offenem Mund. Seine Beine sind wie gelähmt beim Anblick der seltsamen Gestalt.
»Du hast wohl noch nie einen Aussätzigen gesehen?«, fragt der Löwengesichtige.
Senni fällt es wie Schuppen von den Augen: Das Mal an der Tür – der blaue Kreis: das Zeichen der Aussätzigen. Kikkuli hatte ihm vor vielen Jahren davon berichtet, aber gesehen hat er noch nie einen, der davon befallen ist.
»Die Leute reden viel«, krächzt der Mann, »sie sagen, dass Dämonen in uns wohnen, weil die Krankheit unsere Hände und Füße zu Krallen verformt. Aber diese Menschen mit ihren bösen Mäulern haben keine Ahnung!«
Wieder bittet der Narbengesichtige mit seinen verkrüppelten Händen, ihm ins Haus zu folgen. Senni zögert. Zu viel hat man ihm über Aussätzige erzählt. Eine Berührung genüge, um selbst von dem Dämon befallen zu werden.
»Ich sehe, was du denkst! Du brauchst keine Angst zu haben: Mein Dämon ist längst ausgetrieben. Ich musste die schmerzhaften Rituale des Geisterbeschwörers über mich ergehen lassen. In ein Erdloch draußen vor der Stadt haben sie mich als Kind verbannt. Wie ein räudiger Hund musste ich mich von Abfällen ernähren, die man über die Stadtmauer warf. Erst als die Mitanni aus der Stadt geflohen waren, hat man mir erlaubt, zurückzukehren, um in diesem Haus zu leben. Ich musste aber versprechen, dass ich es nicht verlasse. Als du vorhin an die Tür geklopft hast, dachte ich, es sei die Barmherzige, die mir jeden Tag etwas zu essen auf die Schwelle stellt. Komm, leiste mir ein wenig Gesellschaft. Ich würde so gerne wieder eine menschliche Stimme hören, um zu erfahren, was in der Welt vor sich geht!«
Senni zögert zunächst, der Einladung Folge zu leisten. Doch dann fasst er sich beim jämmerlichen Anblick des Löwengesichtigen ein Herz und folgt ihm in einen fensterlosen Raum, in den Licht nur durch einen Rauchabzug der Herdstelle einfällt. Zu Sennis Überraschung sind in einer Ecke bemalte Tongefäße gestapelt. Dazwischen lugt hier und da der Rand eines Kupfernapfs hervor. Sogar ein Henkelkrug aus purem Silber glänzt im faden Licht der Lampen. An der gegenüberliegenden Wand ein niedriges Podest. Darauf zwei brennende Öllampen, die eine handmodellierte Figur aus Ton flankieren. Die Statuette stellt eine nackte Frau dar, deren Körper mit zahlreichen Ketten aus winzigen Perlen behangen ist.
»Wie ich sehe, verehrst du auf deinem Hausaltar die Liebesgöttin Ištar.«
Der Löwengesichtige nickt.
»Aber woher hast du all die Kostbarkeiten, die dort in der Ecke aufgetürmt sind? In einer solch bescheidenen Behausung hätte ich einen derartigen Reichtum nicht erwartet«, bekennt Senni.
Sein Gegenüber bemüht sich zu lächeln, doch sein vernarbtes Gesicht erlaubt ihm nur, die wulstigen Lippen ein wenig zu bewegen. Indes beginnen seine Augen zu leuchten:
»Wie du siehst, bin ich ein wohlhabender Mann. Aber was nützen mir all die Schätze, wenn ich nicht frei unter Menschen leben darf? Ich kann froh sein, dass mir die Nachbarn erlauben, in dieser Hütte mein Dasein zu fristen. Alle fürchten sich vor mir wegen meines Äußeren und halten Abstand. ›Löwengesicht‹ nennen mich alle hier im Viertel. Viele zögern sogar, beim ersten Mal ihren Fuß über meine Schwelle zu setzen. Doch ich will nicht klagen, denn die Göttin hat sich meiner angenommen und mir eine besondere Gabe verliehen.«
»Eine göttliche Gabe?« Senni zieht die Augenbrauen nach oben: »Welche Befähigung hat dir die Schutzgöttin dieser Stadt in den Schoß gelegt?«
»Ich bin ein Seher, junger Freund«, antwortet der Mann, »an gewissen Tagen gewährt mir meine Herrin Ištar Einblick in die Zukunft eines Fürbittenden. Das rettete mir das Leben! Anfangs kamen nur die armen Leute zu mir, die sich die Weissagungen der Priester im Tempel nicht leisten konnten. Sie haben mir diese Hütte überlassen, damit ich ihnen von Zeit zu Zeit ihr Schicksal verkünde. Im Gegenzug versorgen sie mich mit allem, was ich zum Leben brauche. Doch inzwischen schätzen auch hohe Herren aus der Oberstadt meine Dienste. Sie entlohnen mich reich, wie du siehst.« Mit der verstümmelten Hand weist er auf den Berg von Gerätschaften in der Ecke des Raumes. »Doch was soll ich mit all dem Reichtum, wenn ich ihn nicht mit anderen teilen darf? Würdest du aus einer meiner Schalen trinken wollen, wenn ich dir darin Wasser anbiete?«
Senni spürt den lauernden Blick des Löwengesichtigen. Was soll er ihm antworten? Hat der Aussätzige nicht vorhin behauptet, der Dämon sei ihm ausgetrieben worden? Senni geht zu dem Stapel mit Gefäßen, nimmt einen Trinkbecher zur Hand und reicht sie dem Narbengesicht:
»Einen Schluck Wasser bitte!«
Die Augen des anderen beginnen zu funkeln wie der Stern der Ištar am nächtlichen Firmament. Mit seinen verkrüppelten Händen balanciert er den Napf zu einer Amphore und füllt ihn dort mit Wasser. Mit großen Augen verfolgt er, wie Senni die Schüssel bis zum Grunde leert.
»Ich danke dir für den erfrischenden Trank.«
Mit einer leichten Verneigung stellt der Hurriter das Gefäß auf einem Holztisch in der Mitte des Raumes ab.
Der Löwengesichtige betrachtet ihn mit einer gewissen Bewunderung:
»Du bist auch der Einzige, der es gewagt hat, aus einem meiner Gefäße zu trinken. Verrate mir bitte, wie du heißt, damit ich künftig meinen neuen Freund bei seinem Namen nennen kann!«
»Puhasenni, doch die meisten rufen mich Senni.«
Der Aussätzige schlurft mit seinen plumpen Füßen zur Herdstelle und hält die verstümmelten Hände, fingerlose Stümpfe, über das Feuer:
»Meine alten Knochen lechzen nach Wärme«, seufzt der Aussätzige, »doch du bist noch jung, Senni, und hast das Leben noch vor dir. Aber nun sage mir, was dich in dieses Viertel geführt hat, in das sich Leute deines Standes – bis auf eine Ausnahme – nur mit Geleitschutz wagen.«
Senni wird hellhörig: »Welche Ausnahme?«, will er wissen.
»Euer Bürgermeister, dieser Šumīja – lässt sich des Öfteren hier blicken. Ich selbst habe ihn bereits zwei Mal in der Gasse nebenan verschwinden sehen. Was er dort zu suchen hat, kann ich dir nicht sagen. Doch es wundert mich, dass ein Beamter hier immer ohne seine Soldaten auftaucht.«
»Bist du dir sicher, dass er es war, den du da gesehen hast?«, hakt Senni nach.
»Aber ja!«, antwortet der Narbenmann, »die Nachbarn haben sich schon das Maul zerrissen, dass es gerade der Bürgermeister sei, der ohne jegliche Vorsichtsmaßnahmen – sogar des Nachts – hier seine finsteren Geschäfte verrichten würde.«
»Finstere Geschäfte? Unser Bürgermeister? Hier in diesem Viertel?«
Senni bleibt die Spucke weg.
»Keiner weiß genau, was er hier treibt, aber es zieht ihn immer zu einem Haus am Ende der kleinen Gasse gleich nebenan.«
»Weißt du, wer dort wohnt?«, erkundigt sich Senni.
Der Angesprochene schüttelt den Kopf:
»Ich lebe zwar schon eine geraume Zeit hier. Aber die zwielichtigen Gestalten, die sich dort herumtreiben, scheinen das Tageslicht zu scheuen. Noch nie habe ich jemanden aus nächster Nähe gesehen, ausgenommen in der gestrigen Nacht. Ich hörte Geschrei vor meiner Tür und schaute nach. Eine Frau lag auf dem Boden, mitten auf der Straße. Sie schrie, als ob sie einen leibhaftigen Dämon gesehen hätte. Ich sah einen Riesen davoneilen.«
»Einen Riesen? Konntest du sein Gesicht erkennen?«, will Senni wissen.
»Nein, habe ihn nur von hinten gesehen, als er davonrannte. Aber groß war er – hoch wie ein Pferd, und er stank auch so wie ein Gaul nach langem Galopp durch die Mittagshitze.«
»Kikkuli!« Der Name seines dämonischen Ziehvaters kommt unbewusst über seine Lippen. »Das war mit Sicherheit kein Abgesandter der Finsternis, sondern Kikkuli, mein früherer Dienstherr. Das Scheusal war also hier, ganz in der Nähe und hat sich nun in Sicherheit gebracht. Wir können die Suche also einstellen. Aber ich schwöre dir bei dem Abbild der Göttin Ištar auf deinem Altar: Ich werde meinen Peiniger eines Tages zur Strecke bringen!«
»Dann lass mich dir helfen, junger Freund«, krächzt der Aussätzige, »lass uns in deine Zukunft schauen.«
Er bittet Senni, sich vor den Hausaltar zu stellen, nimmt ein Säckchen Mehl von einem Regal und streut auf dem Boden einen weißen Kreis um Sennis Füße.
»Was auch passiert: Du verlässt diesen Kreis unter keinen Umständen!«
Senni nickt und folgt mit den Augen jeder Bewegung des Alten, der zunächst das restliche Mehl in einen Napf füllt, den er Senni überreicht.
»Lass das Töpfchen nicht fallen, denn ich muss nun noch Emmerähren4 unter das Mehl mischen.«
Der Aussätzige watschelt zum Regal und kehrt mit einer Ähre zurück. Er steckt sich den Halm in den Mund und schabt mit seinen Fingerstümpfen die Körner in das Gefäß. Senni bewundert, wie geschickt er, trotz seiner Behinderung, diese Arbeit verrichtet.
»Jetzt gut mischen!«
Senni befolgt die Anweisung des Löwengesichtigen, der in der Zwischenzeit mit seinen verkrüppelten Händen ein Holzbrett zum Mehlkreis schiebt, was ihm sichtlich Mühe bereitet. Anschließend legt er sich einen bunt bestickten Mantel über Kopf und Schultern, baut sich vor Senni auf und beginnt zu singen. Dabei wiegt er seinen Körper im Takt der Melodie hin und her, bis er in einen Dämmerzustand verfällt. Plötzlich schießen seine Arme nach vorne. Wie eine Zange packen seine verkümmerten Hände das Gefäß und stülpen den Inhalt mit Schwung auf das am Boden liegende Brett.5 Achtlos schiebt er den Napf zur Seite und beugt sich über den weißen Mehlhaufen, aus dem der goldgelbe Emmer an einigen Stellen deutlich herausragt. »Die Lage der Getreidekörner ist entscheidend für die Deutung des Schicksals«, flüstert der Löwengesichtige. Nachdem er die Schüttung eingehend begutachtet hat, schaut er Senni in die Augen. Der kann dem stechenden Blick, der wie ein Feuerstrahl hinter den wulstigen Augenbrauen herausschießt, nicht ausweichen. Auch wenn Senni den Kopf am liebsten zur Seite wenden möchte, er vermag es nicht. Der hypnotische Blick des Narbengesichts hält ihn gefangen. Senni spürt, wie er in seine Gedanken eindringt. Ohne, dass er es beeinflussen kann, fliegen Senni die Ereignisse der letzten Stunden durch den Kopf. Der monotone Gesang des Aussätzigen wird immer lauter und bedrohlicher, bis er jäh endet.
»Geheime Liebe!«
Die ersten Worte presst der Löwengesichtige wie in Trance hervor.
Noch einmal beugt er sich über den Mehlhaufen und stößt einzelne Worte hervor:
»Rache – Pferd – Dämon.« Nach einer kleinen Pause: »Eine Schlange – da ist eine Schlange aus einem fernen Land!«.
Ein Röcheln dringt aus seiner Kehle – gerade so, als ob ihm jemand an die Gurgel ginge.
»Du und die ...«
Der Löwengesichtige spricht nicht weiter, reißt die Augen weit auf und sinkt erschöpft zu Boden. Senni kniet nieder, stets darauf bedacht, den Mehlkreis nicht zu verlassen. Er packt den vor ihm Kauernden an den Schultern und spürt durch den Stoff des Umhangs, wie dünn und zerbrechlich dessen Körper ist. Sofort lockert er seinen Griff und spricht leise auf ihn ein:
»Was ist mit dir? Was hat dich so sehr erschreckt?«
Der Alte hebt den Kopf und antwortet mit leiser Stimme:
»Das Licht fiel von der Seite des Sonnenuntergangs auf das Brett. Der Emmer lugt dort heraus: Ein gutes Zeichen für deine sehr nahe Zukunft. Vieles wird sich in nächster Zeit für dich zum Guten wenden! Doch in der Mitte hat das Mehl alle Körner überdeckt, wie den Rachegedanken, den du tief in deinem Herzen nährst. Ich sah einen Dämon auf einem Pferd sitzend. Vielleicht weißt du selbst am besten, was das bedeutet.«
Senni nickt nur stumm. Seine Fäuste ballen sich, wenn er nur einen Gedanken an Kikkuli verschwendet.
»Aber die Mehrzahl deiner Gedanken kreisen derzeit um die Liebe. Du bist voll davon, junger Hurriter. Du quillst förmlich über vor Liebe. Doch der Emmer zum Sonnenuntergang hin, zeigt eine unglückselige Verbindung. Ein großer Teil des Emmers liegt auf dieser Seite zugeschüttet unter dem weißen Staub. Nur ein einziges Körnchen lässt die Hoffnung auf erfüllte Liebe keimen. Doch niemand darf von eurer Liebe Kenntnis erlangen. Deshalb hat das Schicksal den Emmer unter dem Mehl vergraben. Das ist alles, was ich dir zu sagen habe.«