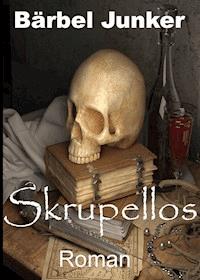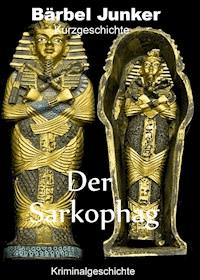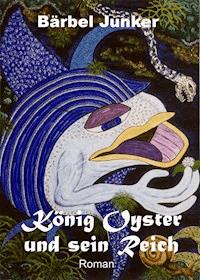
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ist König Oysters Reich wirklich dem Untergang geweiht? Oder gelingt es Olmokan, dem Hüter der Meere, das drohende Unheil abzuwenden? Zwölf Glastropfen sind das Geheimnis von Olmokans Magie. Neun davon stahl ihm vor fünfzehn Jahren Cliff Knudsen, der aus Profitgier seinen todbringenden Giftmüll ins Meer entsorgte und König Oysters Reich zu zerstören drohte. Olmokan bestrafte ihn und fiel danach in einen komaähnlichen Schlaf. Und die Meeresbewohner veränderten sich! Manche wurden der Sprache mächtig, andere mutierten zu monströsen Kreaturen. Doch die meisten von ihnen gewannen ihre Lebensfreude zurück. Und dann taucht eines Tages Cliff Knudsens Sohn Hasso auf und gefährdet ihren Lebensbereich aufs Neue. Doch dieses Mal greift der Meeresgott ein! Er erschafft für Olmokan das schlangenhafte Zauberwesen Anieba, die ihm ebenso helfen soll wie der Journalist Dennis Parker, dessen Lebensgefährtin Nadja Lowinsky und deren siebenjähriger Sohn Tommy. Doch davon ahnen diese nichts, als sie die Hallig Okkerland betreten, auf der sie die fünfjährige Lisa und der alte Hans erwarten. Olmokan erwacht! Und die Suche nach den magischen Tropfen beginnt. Den fünf Menschen aber offenbart sich eine Wunderwelt jenseits aller Vorstellungskraft. Mit sprechenden Meeresbewohnern wie der uralten, weisen Schildkröte Mora, der mutigen Monsterkrabbe Risko, der eitlen Königsschlange Xzostra, dem überheblichen Riesenkrokodil Krokan und den vielen anderen. Alleine Tommy und die kleine Lisa halten die Rettung und den Fortbestand der Unterwasserwelt in ihren schwachen Händen. Doch wird es ihnen gelingen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bärbel Junker
König Oyster und sein Reich
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ZUM BUCH
PROLOG
DAS GROSSE TREFFEN
SPIEL IM RIFF
HANNIBAH DER ALLIGATOR
ADAMOS UND SEIN SOHN ENIBA
DER PLAN
FÜNF TAGE SPÄTER
BARNIBU SPRICHT MIT XZOSTRA
ROBBY UND IHRE BRÜDER
ANKUNFT AUF OKKERLAND
IN DER FRIESENSTUBE
UNHEIMLICHE BEGEGNUNG
ROBBY BERICHTET WEYTOLUS
TOMMYS TRAUM
DER TAG DANACH
FUNKELNDE GLASTROPFEN
BEGEGNUNG AM PIER
DIE VILLA
GOLDY IN GEFAHR!
DER ALTE HANS
OLMOKAN
BOTZO UND RAPUCKO
ABTRANSPORT DER GIFTFÄSSER
LAGEBESPRECHUNG
ROBBY IN NOT
MORAS RETTUNG
HASSO KNUDSEN SCHWÖRT RACHE
NADJA SPRICHT MIT XZOSTRA
AUF DER SUCHE
TSCHELKI
GESPRÄCH MIT ANIEBA
DAS TREFFEN
BEGEGNUNG
OLMOKANS MAGIE
ERFÜLLTE VERSPRECHEN
MAGISCHE TROPFEN
MAGIE
DER ZWÖLFTE TROPFEN
TISENKA
METAMORPHOSE
RÜCKKEHR
OLMOKANS ENTSCHEIDUNG
EIN REICH VOLLER WUNDER
DER ENTSCHLUSS
EPILOG
Leseprobe
Impressum neobooks
ZUM BUCH
Ist König Oysters Reich wirklich dem Untergang geweiht? Oder gelingt es Olmokan, dem Hüter der Meere, das drohende Unheil abzuwenden?
Zwölf Glastropfen sind das Geheimnis von Olmokans Magie. Neun davon stahl ihm vor fünfzehn Jahren Cliff Knudsen, der aus Profitgier seinen todbringenden Giftmüll ins Meer entsorgte und König Oysters Reich zu zerstören drohte. Olmokan bestrafte ihn und fiel danach in einen komaähnlichen Schlaf.
UND DIE MEERESBEWOHNER VERÄNDERTEN SICH!
Manche wurden der Sprache mächtig, andere mutierten zu monströsen Kreaturen. Doch die meisten von ihnen gewannen ihre Lebensfreude zurück. Und dann taucht eines Tages Cliff Knudsens Sohn Hasso auf und gefährdet ihren Lebensbereich aufs Neue.
Doch dieses Mal greift der Meeresgott ein! Er erschafft für Olmokan das schlangenhafte Zauberwesen Anieba, die ihm ebenso helfen soll wie der Journalist Dennis Parker, dessen Lebensgefährtin Nadja Lowinsky und deren siebenjähriger Sohn Tommy. Doch davon ahnen diese nichts, als sie die Hallig Okkerland betreten, auf der sie die fünfjährige Lisa und der alte Hans erwarten.
Olmokan erwacht! Und die Suche nach den magischen Tropfen beginnt. Den fünf Menschen aber offenbart sich eine Wunderwelt jenseits aller Vorstellungskraft.
Mit sprechenden Meeresbewohnern wie der uralten, weisen Schildkröte Mora; der mutigen Monsterkrabbe Risko; der eitlen Königsschlange Xzostra, dem überheblichen Riesenkrokodil Krokan und vielen anderen.
Alleine Tommy und die kleine Lisa halten die Rettung und den Fortbestand der Unterwasserwelt in ihren schwachen Händen.
PROLOG
Auch in dieser Nacht träumte der siebenjährige Tommy denselben Traum wie in den vergangenen Nächten zuvor.
„Hilf uns, Menschenjunge! Bitte, hilf uns!“, flehte die kleine weiße Robbe.
„Wer bist du?“, flüsterte Tommy traumverloren in die Stille seines Kinderzimmers.
„Ich heiße Robby“, wisperte die kleine Robbe.
„Und wie kann ich dir helfen?“
„Du wirst es zu gegebener Zeit erfahren“, mischte sich eine glockenhelle Stimme ein.
Tommy fuhr erschrocken herum und sah sich einem schneeweißen, schlangenhaften Wesen gegenüber.
„Wow!“, entfuhr es ihm. „Bist du aber schön! Bist du eine Fee?“
„So etwas ähnliches“, erwiderte das blumenhafte Schlangenwesen lächelnd.
„Sag dem Jungen endlich worum es geht, Anieba“, grollte der riesenhafte Schatten neben ihr, von dem weder ein Anfang, noch ein Ende auszumachen war.
„Später, mein Guter. Später, sobald er bei uns ist.“
„W...wer i...ist das?“, stotterte Tommy ängstlich.
„Ich bin Olmokan, der Beschützer und Retter der Meere, du Knirps“, knurrte der bislang lediglich als Umriss zu erkennende Schatten und gewann von einer Sekunde auf die andere an Substanz. Lange, tentakelartige Gliedmaßen manifestierten sich aus dem Nichts und zuckten auf den ängstlich zurückweichenden Jungen zu. “Komm her zu mir“, grollte Olmokan.
„Nein! Nicht! Hilfe!“, schrie Tommy und ... wachte in den Armen seiner Mutter auf.
„Mami?“
„Schschscht. Ist ja schon gut, Liebling. Du hast nur schlecht geträumt. Wir sind ja bei dir.“
„War es wieder derselbe Traum?“, fragte Dennis, der Lebensgefährte von Tommys Mutter Nadja.
Tommy nickte zitternd. „Sie wollen, dass ich ihnen helfe“, murmelte er.
„Aber Liebling. Es war doch nur ein böser Traum“, beruhigte ihn seine Mutter.
DAS GROSSE TREFFEN
„Sie stehlen uns unsere Heimat!“ dröhnte des Königs tiefe Stimme durch den weitläufigen perlmuttfarbenen Kuppelsaal, und ein kräftiger Schlag seiner Flossen unterstrich eindrucksvoll seine Empörung.
„Ja, ja! König Oyster hat recht!“, schrie erregt ein sich hektisch windender Aal.
„Sie verschmutzen unsere Gewässer. Sie jagen unsere Brüder und Schwestern und vernichten mit ihren Schleppfangnetzen erbarmungslos jedwedes Leben, das ihnen in die Quere kommt“, klagte ein alter, korpulenter Barsch.
„Mein Jüngster hat sich neulich seine zarten Flossen an einer Konservendose aufgeschnitten“, weinte eine hagere Makrelenmutter.
„Ja, und meine schöne Tochter Marissa hat sich erst gestern an einem gezackten Flaschenhals die Spitze ihrer Schwanzflosse abgetrennt“, rief lautstark eine Paradiesbarbe aus der hintersten Reihe.
„Jetzt ist sie fürs Leben entstellt, bekommt vielleicht keinen Mann und keine Kinder und das alles nur, weil die Menschen nicht nur alleine ihre Umwelt missachten, sondern auch noch skrupellos den Lebensraum anderer Lebewesen ruinieren. Wir müssen diese Ungeheuer stoppen!“, schrie sie, und ihr normalerweise kobaltblauer Kopf lief vor Wut und Empörung violett an.
„Hör mit dem Gejammer auf, Kaja“, forderte eine seltsam unausgeglichene Stimme aus dem Hintergrund. Eben noch schrill wie eine Kreissäge, klang sie in der nächsten Sekunde, als säße ihr Sprecher in einem tiefen Brunnen.
„Na, erlaube mal! Ich verbitte mir deine ...“ Die Paradiesbarbe verstummte so abrupt, als hätte ihr jemand die Stimmbänder gekappt. Diese Stimme! Sie begriff und schwieg.
Hektische Unruhe, von der Mitte des Saales ausgehend, setzte sich bis in die vorderste Reihe fort. Schlanke und dicke, gedrungene und feingliedrige, korpulente und spindeldürre, schwammige und sehnige Leiber drifteten hastig zur Seite und machten Platz für Risko, die Riesenkrabbe.
Ach, was rede ich denn da! Riesenkrabbe ist doch völlig untertrieben. Nein, Monsterkrabbe trifft Riskos Aussehen wohl eher. Oder wie würdet ihr eine mutierte Krabbe mit einem Körperdurchmesser von mindestens einem Meter, zuzüglich der Scheren und was sonst noch alles so dazu gehört, bezeichnen?
Risko kämpfte sich mühsam bis zur ersten Reihe durch. Mühsam deshalb, weil er sich so vorsichtig bewegte, als bestünden seine Meeresmitbewohner aus empfindlichstem Meißner Porzellan, welches so leicht zerbricht.
Und diese Sorge war gar nicht so abwegig, denn die ungewollte Mutation hatte Risko nicht nur stark gemacht, sondern ihm außerdem auch noch scharfkantige Auswüchse beschert, mit denen er andere schwer verletzen konnte. Und genau davor fürchtete er sich!
Endlich erreichte Risko keuchend sein Ziel. Wenige Schritte vom Thron entfernt blieb er stehen. Nachdem er sich ehrerbietig vor seinem König verbeugt hatte, wandte er sich der erwartungsvoll auf das Kommende harrenden Menge zu.
„Obwohl der Verlust einer Schwanzflossenspitze natürlich sehr schlimm ist“, begann er, „ist es doch nichts gegen das, was die Menschen uns Krabben und vielen anderen Meeresbewohnern angetan haben, denn unsere Veränderungen beweisen nur allzu deutlich, dass kein Wasserlebewesen vor den Abfallgiften skrupelloser Menschen sicher ist und jeder, ich betone JEDER! tagtäglich damit rechnen muss, selbst irgendwann einmal zu mutieren.
Bereits ein einziges undichtes Giftfass kann Elend und Tod über uns bringen, ganz zu schweigen von den Substanzen, die ungehindert ins Meer abgelassen werden. Niemand kennt die Spätfolgen dieser Substanzen. Keiner kann voraussehen, welche Auswirkungen sie auf unsere Kinder und Kindeskinder haben werden.
Verflüchtigen sie sich? Zersetzen sie sich? Vermag das Meer sie zu absorbieren? Oder werden die Meeresbewohner eines Tages nur noch aus schrecklichen Monstern bestehen? Zugegeben, diese Vision ist wahrlich grauenhaft. Doch ist sie wirklich so abwegig?“
„Nein, ist sie nicht“, brummte eine schwergewichtige Seekuh.
„Leider nicht“, fügte ihr noch weitaus wuchtigerer Ehemann hinzu.
„So auszusehen wie Risko, wäre wahrlich schauderhaft“, flüsterte Portza, eine üppig blau und weiß gemusterte Königsschlange mit gefährlich spitzen Zähnen, ihrer Begleiterin, einer gestreiften Wasserschlange namens Flonka, zu. Aber so leise sie auch gesprochen hatte, Risko hatte es dennoch gehört.
„Ja, Portza, ich weiß sehr wohl, dass wir Riesenkrabben schaurig aussehen“, sagte er traurig. „Wir sind dazu verurteilt mit der Mutation zu leben wie so viele andere auch und glaube mir, das ist wahrlich nicht leicht“, sagte der Krabbenmann ernst.
Nach seinen Worten herrschte sekundenlang Grabesstille, bevor der Tumult wie ein Orkan losbrach.
„Wir müssen uns wehren!“, kreischte ein Kabeljau.
„Er hat recht!“, schrie einstimmig die Menge. „Wir müssen ihnen Einhalt gebieten! Das Maß ist endgültig voll! Es ist an der Zeit …
„Ruhe im Saal!“, donnerte König Oyster.
Schlagartig wurde es mucksmäuschenstill. Barsche und Muränen; Flundern und Aale; Seepferdchen und Stinte; Thunfische und Delphine; Seeschildkröten und Goldfische; Rochen und Schwertfische; Wale und Seekühe; Krokodile und Meeresschlangen; Vogelfische und Kraken; Alligatoren und Kleinstlebewesen; sowie all die anderen zahlreichen Meeresbewohner der unterschiedlichsten und ungewöhnlichsten Formen, Farben und Muster, von keines Menschen Auge jemals gesehen, sie alle senkten beschämt ob ihrer Unbeherrschtheit den Blick.
König Oyster musterte seine Untertanen streng. Und obwohl er sein Volk von ganzem Herzen liebte und ein überaus gütiger und verständnisvoller Herrscher war, regierte er mit strenger Hand und der nötigen Konsequenz, falls es erforderlich war. Gewalt duldete er ebenso wenig wie Unbeherrschtheit. Ordnung und Gehorsam, Anstand und Sitte mussten sein, waren lebenswichtig, wenn so viele verschiedenartige Geschöpfe miteinander leben und auskommen sollten.
Schließlich sah man ja am Beispiel der Menschheit, wohin Disziplinlosigkeit und Gewalt, Egoismus und die Gier nach dem Besitz des Nächsten, dazu noch der Verlust jeglicher Moral und Ethik führten.
In seinem Reich würde er derartige Zustände niemals dulden! Hier unten im Reich der Wasserlebewesen ehrten und respektierten sie die Weisheit des Alters, während die Menschheit dieses so wichtige und wertvolle Gefühl ebenso wie viele andere fast verloren hatte.
Sie umsorgten ihre kranken und gebrechlichen Mitbewohner liebevoll und ließen sie ebenso wenig allein wie ihren Nachwuchs, der mit Verständnis und Güte, doch nötigenfalls auch mit Konsequenz und Strenge, erzogen wurde.
Spiel und Spaß waren zwar auch sehr wichtig, doch nicht ausschließlich. Auch das Pflichtbewusstsein und besonders die Achtung vor jedwedem Leben nahmen einen hohen, sehr hohen, Stellenwert ein. Außerdem waren natürlich auch noch...
„Sieh doch nur, Andros! Was für eine besonders schöne Schnecke“, unterbrach eine vergnügte Stimme abrupt des Königs Gedanken.
König Oyster drehte verärgert den schweren Kopf in Richtung des Störenfrieds. Seine schweren Lider senkten sich halb über die Augen. Seine breiten Lippen spitzten sich als wolle er pfeifen, und sein Brustkorb spannte sich unter einem gewaltigen Atemzug.
„Robby!“
Tosend wie ein Orkan brach sich seine befehlsgewohnte Stimme an den Muschel- und Glaswänden und ließ nicht nur diese erbeben.
„Robby! Hierher!“
Klick. Klack. Klick. Klack.
Zarte Muscheln lösten sich von den Wänden, sanken lautlos hinab, um für alle Zeiten im weichen Sand des sich unaufhörlich wandelnden Meeresbodens zu versinken. Seepferdchen klammerten sich Halt suchend aneinander. Schlanke Aalleiber drifteten hilflos unter der gewaltigen, Schallwellen erzeugenden Stimme ihres Herrschers in alle vier Himmelsrichtungen auseinander.
Kinder klammerten sich in wilder Panik an ihren Fischeltern fest. Sprotten und andere leichtgewichtige Meeresbewohner taumelten schwerelos wie Blütenstaub zur gewölbten Glaskuppel des Saales empor.
Schnecken und Muscheln zogen sich blitzschnell in ihre Häuser zurück. Muränen und anderes Getier vergruben sich hastig im Sand. Und selbst die nicht gerade leichtgewichtigen Delphine schwankten ein wenig haltlos hin und her. Ein nochmaliges, jetzt jedoch bereits gedämpftes:
„Robby, komm sofort hierher!“
Klick. Klack.
Eine letzte Muschel versinkt im ockerfarbenen Sand.
Ein weißer Schatten huscht pfeilschnell an der atemlos verharrenden Menge vorbei und passiert wendig und äußerst elegant den schmalen Durchgang, hinter dem eine geschwungene gläserne Empore der Dachkuppel entgegenstrebt.
Und hier, auf seinem Thron, über dem das mit Juwelen und Perlen geschmückte Auge der Weisheit und der Gerechtigkeit über die Entscheidungen des Herrschers der Unterwasserwelt wacht, erwartet König Oyster den Störenfried. Der weiße Schatten gleitet gewandt neben ihn.
„Hier bin ich, Großvater. Ich habe dir etwas mitgebracht“, verkündet die sanfte Stimme seiner Enkeltochter. Ein behutsamer Flossenschlag. Etwas Weiches gleitet in des Königs vierfingrige, auf der Sessellehne ruhende Hand.
Er senkt den Kopf und schaut. Eine Blume, so weiß wie frisch gefallener Schnee, gesprenkelt mit seegrünen und aquamarinblauen Tupfern. Wie schön, denkt der König, der Blumen bewundert. Dieses liebe Mädchen! Er verkneift sich mühsam ein gerührtes Lächeln.
„Was sollte dieser Lärm, Robby?“, fragt er stattdessen streng. „Hier findet eine wichtige Versammlung statt, falls dir das entgangen sein sollte. Wir haben Probleme, mein Kind. Große Probleme! Du, als die Thronerbin, solltest wahrlich mehr Interesse zeigen; schließlich besteht das Leben nicht nur aus Spiel und Spaß.“
Robby senkte beschämt den Kopf. Ach, herrjeh! Die Versammlung! Die hatte sie doch glatt vergessen.
„Wo seid ihr gewesen, du und deine Brüder?“, fragte der König streng.
„Wir...wir haben Menschen beobachte“, kam es leise wie ein Hauch aus Robbys Mund.
„Menschen?! Wann? Wo?“
„I...im Plank...Planktongrund“ stotterte Robby wohl wissend, dass sie und ihre Brüder dort nichts zu suchen hatten.
„Planktongrund?! Habe ich das richtig verstanden, Robby? Sagtest du wirklich Planktongrund? Diese Gegend ist doch für jedermann, hörst du, Robby:
Für JEDERMANN! gesperrt.“
„Ich weiß, Großvater“, flüsterte das kleine Robbenmädchen zitternd vor Scham, und eine dicke Träne, schillernd wie Perlmutt, rollte, eine feuchte Spur hinterlassend, ihre weiche Wange hinab.
„Ach Gottchen! Die arme Kleine. Ich würde sie zu gerne tröstend an mein Herz drücken“, seufzte eine dicke Feuerqualle gerührt.
„Sie ist aber auch zu niedlich“, säuselte Flonka, die gestreifte Wasserschlange, entzückt.
„Zum Fressen süß“, zischelte ihre Artgenossin Portza spöttisch. „Wäre sie nicht die Thronfolgerin und würde sie nicht zu unserer Gemeinschaft gehören dann, ja dann ...!“ Sie beendete den Satz zwar nicht, aber ihre hornigen Kiefer mahlten vielsagend aufeinander.
„Hi, hi“, kicherte die Feuerqualle. „Lass das lieber nicht den König hören, meine Liebe, sonst ...“ Sie verstummte verlegen unter dem vorwurfsvollen Blick eines urweltlich anmutenden Geschöpfes mit riesigen, weiß umrandeten Telleraugen.
„Hör auf zu weinen“, flüsterte der König seiner Enkelin zu. „Wir wollen unserem Volk doch kein Schauspiel bieten.“
Robby hob den runden weißen Kopf und sah ihn um Vergebung heischend an.
„Ist ja schon gut, Kleines“, murmelte der König. Unter seinen schweren, violettfarbenen Lidern hervor betrachtete er sein Enkelkind. Seltsam, dachte er wie schon so oft. Seltsam, dass die Nachkommen meiner Rasse bis zu ihrem vierten Lebensjahr wie ganz normale Robben aussehen mit dem einzigen Unterschied, dass ihr Fell weiß ist und dass wir erst mit zunehmendem Alter die uns vorherbestimmte Gestalt annehmen. Und auch seltsam ist, überlegte er weiter, dass ausschließlich den Mitgliedern meiner Familie, der Königsfamilie, zusätzlich zu ihren Flossen auch noch zwei menschenähnliche Arme mit vierfingrigen Händen wachsen.
Noch war davon nichts bei Robby zu sehen. Aber in wenigen Jahren würde auch sie sich verändern, ebenso wie ihre Brüder, und ihm zum Verwechseln ähnlich sehen. Bis auf die Rückenstreifen selbstverständlich.
Denn nur in der Anzahl der violettfarbenen Bogen oberhalb dieser Streifen unterschieden sich die Angehörigen der Königsfamilie voneinander. Doch das vermochten Außenstehende natürlich nicht zu erkennen, wo doch dieses Unterscheidungsmerkmal selbst innerhalb seines Clans nicht selten zu Missverständnissen führte.
„...und da haben wir es gesehen, Großvater“, schreckte ihn die Stimme seiner Enkelin aus seinen Gedanken auf.
„Bitte, was? Was habt ihr gesehen?“, fragte der König verwirrt.
„Die Fässer, Großvater. Viele, viele große Fässer.“
„Ähnelten sie denen, die ich euch beschrieben habe?“
„Ja, Großvater. Es sind orangefarbene Behälter mit einem dicken Kreuz und einem weißen Totenkopf in der Mitte.“
„Bist du sicher, Kind?“
„Ganz sicher, Großvater“, beteuerte Robby.
„Was war das für ein Schiff? Dasselbe wie beim letzten Mal?“, wollte der König wissen.
Robby nickte.
„Habt ihr es verfolgt?“
Robbys weißes Fellgesicht verfärbte sich rosa vor Verlegenheit.
„Sag die Wahrheit, Robby. Habt ihr?“
Seine Enkelin nickte zaghaft. „Wir sind hinterhergeschwommen“, flüsterte sie schuldbewusst.
„Selber Ort? Selbe Stelle?“, fragte der König knapp.
Erneutes Nicken.
„Hmmm, das muss endlich ein Ende haben“, murmelte der Herrscher mit sorgenvoll gerunzelter Stirn. Leises Plätschern, Wortfetzen und zaghaftes Räuspern lenkten seine Aufmerksamkeit wieder auf seine Untertanen, die ihn beobachteten. Ich muss eine Entscheidung fällen, überlegte der König. Doch zuerst einmal muss ich in Ruhe nachdenken. Also gut.
„Alle mal herhören“, rief er. „In fünf Tagen treffen wir uns erneut hier. Bis dahin habe ich einen Plan ausgearbeitet wie wir uns und unsere Heimat vor den Übergriffen der Menschen schützen können. Haltet die Augen offen und benachrichtigt auch eure entfernt lebenden Verwandten und Bekannten. Wir benötigen jede Hilfe, die wir kriegen können.
Und beachtet die Grenzen, damit ihr nicht in irgendeinem Netz oder einer Fischfabrik endet“, warnte er. „So, die Versammlung ist geschlossen. Geht jetzt wieder an eure Arbeit und lasst es euch bis zu unserem Treffen gut gehen. Robby, du rufst deine Brüder und kommst mit ihnen nach“, befahl er seiner Enkelin.
Seine Hände stießen sich von den Armlehnen seines Thronsessels ab. Geräuschlos schwebte sein runder, gedrungener Körper in die Höhe. Schwerelos legte er sich auf die Seite, schwamm auf den rechter Hand liegenden Durchgang zu seinem Palast zu und ... stoppte abrupt kurz davor. Hastig warf er einen Blick über die Schulter zurück. Der Kuppelsaal leerte sich schnell. War er bereits fort? Nein! Glück gehabt!
„Adamos!“
Des Königs sonore Stimme durchquerte den Raum und drang mühelos zu dem Gerufenen vor.
„Ja, hier bin ich.“ Der kobaltblaue Wal mit der auffallenden, silbrig-weiß gemusterten Nasen- und Augenpartie hob fragend den mächtigen Kopf.
„Bitte, komm einen Moment hierher zu mir, Adamos“, rief der König, und der schwergewichtige Wal kam eilig der Aufforderung nach; schließlich ließ man seinen Gebieter nicht warten.
„Stets zu Diensten, Majestät.“ Liebe und Achtung vor der Rechtschaffenheit seines geliebten Königs ließen ihn ehrerbietig das Haupt senken.
„Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich“, sagte König Oyster.
„Jederzeit, Majestät.“
„Gut, mein Bester. Also, ich möchte, dass du deinem gesamten Clan Botschaften sendest und sämtliche, heute hier nicht vertretenen Clans benachrichtigst.“
SPIEL IM RIFF
„Hi, hi, die Luftbläschen kitzeln so schön“, kicherte Marissa, und ihre beiden Freundinnen stimmten fröhlich in ihr Lachen ein. Die drei Paradiesbarben-Mädchen hatten sich zum Spielen zwischen ein üppig bewachsenes Korallenriff zurückgezogen, wo sie ungestört waren.
Alle drei Fischmädchen waren gleich gemustert, jedoch von unterschiedlicher Farbe, bis auf die leuchtend rote, salmiförmige Schwanzflosse, die ein Kennzeichen ihrer Rasse war.
Marissas Gesicht war rosa und zu den herzförmig geschwungenen roten Lippen hin hellblau gefärbt, während Podima ein orangefarbenes, zum Mund hin in ein warmes Gelb übergehendes Gesicht hatte und Xzessas Gesichtsfarben laubgrün und türkisfarben waren.
Die Schwanzflossen der drei farbenprächtigen Fischkinder arbeiteten wie emsige kleine Rotoren, um ihre Körper regungslos in der von ihnen gewünschten Position zu halten. Nur die arme Marissa, durch ihre fehlende Schwanzflossenspitze ein wenig gehandicapt, schwankte ab und an ein wenig hin und her.
„Lasssssst mich mitssssspielen“, zischelte es plötzlich neben Podimas Gesicht, und eine laubgrüne Schlange mit leuchtend gelben Augen wand sich geschmeidig unter einer Wasserpflanze hervor.
„Das geht nicht“, beschied Xzessa die unerwünschte Spielgefährtin.
„Wiesssssso nicht?“, zischelte die Schlange.
„Das liegt doch ganz klar auf der Flosse“, mischte sich Marissa ein. „Du kannst keine so schön kitzelnden Luftbläschen machen wie wir.“
Die grüne Schlange musterte sie schweigend. „Ich heisse Sssumella“, sagte sie um Freundschaft werbend.
„Na und? Was können wir dafür?“, erwiderte Podima kühl.
„Wie heisssst ihr denn?“, versuchte es Sumella erneut.
„Das geht dich nichts an“, giftete Marissa. „Hau endlich ab, du blöde, hässliche Schlange, und störe uns nicht länger.“
Die Schlange zuckte anfangs vor so viel Unfreundlichkeit erschrocken zurück. Doch kurz darauf näherte sie sich erneut. Lange fixierte sie mit ihren schmalen Augen die drei unfreundlichen Barbenmädchen.
„Ihr ssseid sssooo schööön“, zischelte sie endlich. „Eure Farben leuchten ssso wunderbar hell und ssstrahlend wie dasss Ssssonnenlicht am Firmament. Eure äußerliche Schönheit hat mich geblendet. Ich nahm an, euer Charakter sssei ebenssso licht und schön.
Doch ich habe mich getäuscht, denn ihr sseid in eurem Innersten ebensssoo schwarz und ssso bössse wie die Menschenkinder, die andersssartige und andersssfarbige, kränkliche oder auch nur unansssehnlichere Kinder alsss sssie esss sssind vertreiben und nicht an ihren Ssspielen teilhaben lassen.
Ich kann zwar keine Luftblasssen machen“, fuhr sie bitter fort. „Doch dafür besssitze ich andere mannigfaltige Talente. Ihr ssolltet euch für eure Herzlosigkeit schämen“, sagte Sumella und glitt davon.
„Blöde Ziege“, murmelte Marissa. Doch innerlich hatten sie Sumellas Worte schwer getroffen. Sie schämte sich, und ein leises Stimmchen in ihrem Kopf fragte: „Weshalb lasst ihr nie andere Fisch- oder Schlangenkinder mitspielen, Marissa? Könnte es sein, dass du deshalb zur Strafe deine Schwanzflossenspitze verloren hast?“
Ja, überlegte das Paradiesbarbenmädchen, sollte wirklich meine Unfreundlichkeit Schuld an der Verstümmelung sein? Und ihre Freude am Spiel erlosch.
„Ich habe keine Lust mehr“, rief sie Xzessa und Podima zu. „Ich mache mich auf den Heimweg.“ Und bevor ihre beiden Freundinnen antworten konnten, schwamm sie hastig davon.
HANNIBAH DER ALLIGATOR
In einem stillen Winkel auf dem Meeresgrund, versteckt zwischen Felsen und Pflanzen, Blumen und Korallen, hatten sich sechs äußerliche und charakterlich sehr unterschiedliche Geschöpfe eingefunden.
„Was meint ihr?“, fragte Hannibah, der starke und wendige Alligator. „Wird König Oyster uns und unsere Welt retten? Und was noch wichtiger ist: Wollen wir ihm dabei helfen?“
„Hannibah, schiel nicht schon wieder nach dem Thron. Sei lieber froh darüber, dass wir einen so gütigen Herrscher haben“, rügte die Schildkröte Mora mit sanfter Stimme.
„Pah! Wer will schon den blöden Thron“, blaffte Hannibah. „Aber du kannst einem mit deiner niemals endenden Weisheit und Güte manchmal ganz schön auf die Nerven gehen.“
„Lass Mora zufrieden, du Flegel, sonst bekommst du es mit mir zu tun“, warnte Trukku, der kleine leuchtende Vogelfisch.
„Ich lach mich gleich tot“, kicherte Wada, die weiße Rundkopfschlange, spöttisch. „Du Knirps bist ja kaum so groß wie Hannibahs rechtes Auge.“
„Das ist wohl wahr“, mischte sich Durada, die Armmolchfrau mit den Telleraugen, ein. „Groß ist Trukku nicht, aber du vergisst doch hoffentlich seine giftige Schnabelspitze nicht, oder? Ein winziger Stich nur und du, meine liebe Wada, lästerst niemals wieder.“
Wada zuckte erschrocken zusammen.
„Ja, ja“, murmelte die alte Mora und wiegte bedächtig den faltigen Kopf.
„Ich liebe unseren klugen König“, zirpte Loba, die winzige Schmetterlingsraupe.
„Loba hat ganz recht“, meldete sich die weise Mora zu Wort. „Seht euch doch nur einmal das Durcheinander bei den Menschen an und das, obwohl sie doch auch Könige oder jedenfalls so etwas Ähnliches haben. Wie heißen diese Menschenherrscher doch noch gleich?“, grübelte die Schildkröte angestrengt.
„Die heißen Regierungsbeamte oder Minister oder so ähnlich“, tat sich Wada, die weiße Rundkopfschlange, wichtig. „Und glaubt mir“, fuhr sie fort, „die sind habgierig und nicht besonders nett.“
„Ja, diese Menschen sind seltsame Geschöpfe“, nickte Mora.
„Bin ich froh, liebe Mora, dass ich kein Mensch geworden bin, sondern nur eine winzige Raupe“, zirpte Loba fröhlich.
„Oh ja, meine Kleine. Wie recht du hast.“
„Ach was, Papperlapapp“, schimpfte Hannibah. „Die lassen es sich eben gut gehen. Schließlich ist sich jeder selbst der Nächste. Wenn diese Menschen nicht ständig ihren Dreck und Unrat bei uns abladen würden, hätte ich gar nichts gegen sie.“
„Nicht?! Du bist genau so dumm wie du groß bist, Hannibah“, schimpfte Trukku, der Vogelfisch. Sein gelb und blau gemusterter Hals funkelte vor Erregung, und die unzähligen Leuchtpünktchen auf seinem Gefieder strahlten winzigen Glühbirnen gleich. „Menschen! Pah! Die sind egoistisch und böse. Die denken nur an sich. Andere bedeuten ihnen nichts.“
„Aber nicht alle Menschen sind böse“, warf Durada, der Armmolch mit den Telleraugen, ein.
„Nicht?! Wieso nicht?“, zirpte Loba überrascht.
„Ach, das ist lange her“, murmelte Durada verlegen, als sich fünf Augenpaare plötzlich auf sie richteten und sie unverhofft im Mittelpunkt des Interesses stand.
„Ich habe damals etwas beobachtet“, murmelte Durada.
„Und was war das?“, mischte sich neugierig geworden nun auch noch Hannibah ein. „Mein Gott, Durada! Nun zier dich doch nicht so! Komm, erzähle es deinem lieben Hannibah.“
„Also gut, wenn ihr es unbedingt wissen wollt“, gab sich die Armmolchfrau geschlagen. „Der Tag war wunderschön“, begann Durada. „Warm war es, das Meer spiegelglatt, und die Sonne strahlte mit den Juwelen am Thron unseres Herrschers um die Wette. Ich hatte es mir auf einer Sandbank bequem gemacht und ließ mir den Rücken von den Sonnenstrahlen wärmen.
Nicht weit von mir entfernt vergnügte sich ein Rudel Robben mit einem leeren Schneckengehäuse. Knapp einen Steinwurf entfernt, zogen mehrere Wale vorbei. Ich war glücklich und zufrieden und genoss die Schönheit dieses Tages.
Ich muss wohl eingeschlafen sein.
Klägliches Wimmern schmerzerfüllten Lebens riss mich abrupt aus dem Schlaf. Erschrocken richtete ich mich auf. Was war geschehen?
Und dann sah ich sie!
Menschen! Überall Menschen!
Am Strand aufgeregt hin und her eilend. In Booten stehend. Was taten diese Leute? Was wollten sie? Woher kamen sie so plötzlich? Verwirrt und ängstlich beobachtete ich weiter.
Unermüdlich sprangen immer und immer wieder Menschen aus den Booten ins Wasser, suchten aufgeregt, wurden fündig, legten das Gefundene in die wartenden Boote und suchten weiter. Was für schwarze Dinger sammeln die da eigentlich ein? fragte ich mich verständnislos.
Und dann begriff ich endlich!
Robben! Vögel! Schildkröten!
Die Menschen sammelten vom Öl verklebte Meeresbewohner ein und schafften sie eilig an den Strand, wo wiederum andere Menschen sie ihnen hastig abnahmen und mit den ölverschmierten Tieren zu großen Behältern eilten. Sie legten unsere bedauernswerten Brüder und Schwestern in eine Flüssigkeit, in der Hoffnung, sie damit vom Öl zu befreien.
Es klappte nicht immer, aber etliche Meeresbewohner wurden durch die Hilfe der Menschen tatsächlich gerettet. Später habe ich dann mit einigen der Überlebenden gesprochen.
Die Menschen haben uns sehr fürsorglich behandelt, erzählten sie mir. Manche Menschen weinten sogar, wenn einer von uns starb, berichteten sie weiter.
Sie sind nicht alle schlecht, sagten sie erstaunt über diese unerwartete Erkenntnis. Und doch sage ich die Wahrheit, wenn ich hier und jetzt behaupte, dass es auch gütige und verantwortungsbewusste Menschen gibt“, beendete Durada ihre unglaubliche Geschichte.
„Ich glaube das nicht“, sagte Hannibah entschieden und schwamm davon.
„Ich auch nicht“, schloss sich Wada seiner Meinung an und eilte ihm hinterher.
„Aber ich glaube dir, Durada“, sagte die gütige Mora.
„Und ich auch“, stimmte Trukku ihr zu.
„Meine Erfahrung hat mich gelehrt“, fuhr die weise Schildkröte fort, „dass niemals alle Angehörigen einer Rasse böse sind. Es gibt unter ihnen stets Gute und Böse. Denn glaubt mir, meine lieben Freunde, gäbe es nur das Schlechte und Verkommene auf dieser Welt, wäre das Leben nicht mehr lebenswert.
Ohne die Hoffnung auf das Gute, ohne Liebe und Zärtlichkeit, Gnade und Gerechtigkeit, würden unsere Seelen verkümmern, und wir wären dem Untergang geweiht. Obwohl ich jedoch zugeben muss, dass das Böse leider nur allzu oft die Oberhand gewinnt“, fügte sie traurig hinzu.
„Das hast du aber schön gesagt, liebe Mora“, seufzte Loba und machte sich eifrig über ein weiteres, besonders zartes, Blättchen her.
ADAMOS UND SEIN SOHN ENIBA
Währenddessen eilte Adamos, der Wal, nach Hause zu seinem Sohn Eniba. Es blieb nicht allzu viel Zeit für die ihm vom König übertragenen Aufgaben, und bevor er sich auf den Weg machen konnte, gab es noch viel zu tun.
Zuerst einmal muss ich für Eniba einen Babysitter finden, überlegte er. Am besten bringe ich ihn so lange bei seiner Tante Leonora unter. Die hat ein Herz für Kinder, und Eniba liebt sie sehr seitdem er nach dem grausamen Tod seiner Mutter – die von einem der gewaltigen Walfangschiffe gefangen und sofort, zu was auch immer, verarbeitet worden war – bei ihr gelebt hat. Er hatte seinen Sohn erst wieder zu sich nehmen können, nachdem der schlimmste Schmerz über den Tod seiner geliebten Frau abgeklungen war.
In der Nähe seiner Höhle kreuzten drei blaue Delphine Adamos´ Weg. „Sagt es euren Freunden und Verwandten“, rief er ihnen zu. „In fünf Tagen findet die nächste wichtige Zusammenkunft im Kuppelsaal statt.“
„Geht in Ordnung“, riefen die Delphine fröhlich zurück.
„Komm wieder her, Goldy. Bitte, lass uns doch weiterspielen. Ich habe es doch nicht so gemeint“, hörte Adamos seinen Sohn rufen. Sehen konnte er ihn noch nicht, denn eine Felsnase verwehrte ihm den Blick auf seine Höhle.
Adamos umschwamm das Hindernis mit kräftigem Flossenschlag und hatte jetzt freie Sicht auf sein Zuhause und auf seinen Sohn, der betreten einem schimmernden Goldfisch hinterherblickte, der sich, ohne auf die Bitten Enibas zu reagieren, immer weiter entfernte.
„Dann eben nicht, du Spielverderber“, maulte Eniba und schwamm zu seinem Vater. „Hallo Papi. Wieso bist du schon wieder zurück?“, fragte er.
„König Oyster hat die Versammlung vorzeitig abgebrochen“, brummte Adamos. „Ich muss mich beeilen, denn ich habe für den König sehr wichtige Aufträge zu erledigen. Du bleibst währenddessen bei deiner Tante. Übermorgen bin ich wieder zurück.“
„Muss ich jetzt gleich zu Tante Leonora?“
Adamos nickte.
„Aber ich wollte doch noch ein bisschen mit Flunschi spielen“, sträubte sich Eniba.
„Hast du mich gerufen?“, fragte der winzige, violettfarbene Fisch und kam unter einer Seeanemone hervor geschwommen.
Doch bevor der junge Wal antworten konnte, übernahm das sein Vater für ihn. „Nein, Flunschi“, sagte Adamos energisch. „Eniba hat dich nicht gerufen. Er bleibt die nächsten Tage bei seiner Tante, und du, sieh zu, dass du nach Hause kommst.“
„Aber ich ...“
„Kein aber, Flunschi. Du schwimmst jetzt brav und ohne Widerrede nach Hause“, befahl Adamos streng.
Der violettfarbene Fisch wurde seinem Namen nur allzu gerecht. Er zog einen Flunsch und schwamm beleidigt davon.
„Hol deine Sachen, Eniba. Ich muss los“, drängte Adamos.
„Schau, Papi, da kommt Schebus“, sagte Eniba auf einen vorbei´-gleitenden gemusterten Rochen deutend.
„Sehr gut. Der kommt mir gerade recht“, murmelte Adamos. „Schebus, unterrichte doch bitte deinen Clan, dass in fünf Tagen eine neuerliche Zusammenkunft im Kuppelsaal stattfindet. Es ist sehr wichtig“, rief Adamos dem Rochen zu.
„Hab schon davon gehört, Adamos“, rief Schebus zurück. „Wir werden da sein“, versprach er und schwebte so leicht wie eine Feder davon.
Adamos nickte zufrieden und wandte sich seinem Sohn zu. „Was ist? Worauf wartest du?“, fragte er. „Ich dachte, du hättest bereits gepackt.“
Eniba drehte sich wortlos um und schwamm in die Höhle hinein.
„Ja, ja, mein guter Adamos. Die Jungen brauchen eine zwar gütige, jedoch konsequente Hand bei der Erziehung“, sagte die weise Mora, die sich lautlos genähert hatte.
„Das ist wohl wahr“, seufzte Adamos. „Nett, dass du vorbei gekommen bist, Mora. Aber heute habe ich leider keine Zeit für einen Plausch. Ich muss mich sputen. Habe noch eine Menge zu erledigen. Einen schönen Tag, meine Liebe“, wünschte er, bevor er ebenfalls in der Höhle verschwand.
Die alte Schildkrötenlady sah ihm lächelnd hinterher. „Jaja, diese ungeduldige Jugend“, murmelte sie gütig. „Da wird man ja schon vom Zuhören müde. Ein kleines Nickerchen wäre jetzt genau das Richtige für mich“, führte sie ihr Selbstgespräch fort. „Also, auf nach Hause“, grummelte Mora und paddelte gemächlich davon.
DER PLAN
König Oyster saß grübelnd in seinem Arbeitszimmer und beobachtete die zahlreichen Leuchtfische, die ihm Licht spendeten. Er hatte Kopfschmerzen, und seine Augen brannten wie Feuer.
„Schwarm zwei, drei, vier und fünf kann sich für heute frei nehmen“, befahl er.
„Schwarm eins und sechs hält sich in der Vorhalle zur Verfügung. Für den Rest des Abends genügt mir die Leuchtmuschel als Lichtquelle“, fuhr er fort. „Also, meine lieben Freunde, worauf wartet ihr noch?“, fragte der König ungeduldig, als er das Zögern seiner Lichtdiener bemerkte.
„Wirklich nur die Leuchtmuschel, Hoheit? Wird das nicht zu dunkel sein?“, wagte der Leuchtfisch-Geschwaderkommandant einzuwenden.
„Unsinn“, brummte der König. „Tut, was ich euch befohlen habe. Und jetzt ab durch die Mitte.“
Die Leuchtfischgarde formierte sich, salutierte mit einem synchronen, zackigen Flossenschlag und verließ schnurstracks den Raum. König Oyster sah ihnen schmunzelnd hinterher. „Sie sind wirklich rührend um mich besorgt“, murmelte er und wandte sich wieder seinen Sorgen zu.
Zwei Fragen stellen sich vorrangig, überlegte er. Und zwar: Wie werde ich die im Planktongrund lagernden Giftfässer wieder los? Und wie schütze ich mein Reich und mein Volk vor der Willkür und Gewissenlosigkeit der Menschen? „Gehe ich gewaltsam vor?“, dachte er laut weiter. „Oder verlasse ich mich lieber auf meine Klugheit und auf meine List?“
„Gewalt bringt nie etwas Gutes, Majestät. Das hat uns doch die Vergangenheit zur Genüge gelehrt“, sagte Weytolus, der Großwesir, und außerdem des Königs Freund und engster Berater.
König Oyster zuckte bei dessen unverhofftem Auftauchen erschrocken zusammen. Natürlich hatte er wie immer Weytolus nicht kommen hören, und obwohl er seinem Großwesir das Privileg eingeräumt hatte, zu kommen und zu gehen wann immer es diesem beliebte, ging ihm dessen unverhofftes Auftauchen manchmal doch ganz schön auf die Nerven. Vielleicht sollte ich ihn der normalen Hofordnung unterstellen, überlegte der König. Aber dann ist Weytolus gekränkt, und das möchte ich auf keinen Fall.
„Wenn du dich doch bloß nicht immer so heimlich still und leise anschleichen würdest, Weytolus“, beschwerte er sich. „Irgendwann bekomme ich bei deinem plötzlichen Auftauchen einen Herzschlag und falle tot um.“
„Ich habe mein Erscheinen durch hörbares Räuspern rechtzeitig angekündigt, Majestät“, sagte der Großwesir pikiert.
„Das muss ich wohl überhört haben.“
„Jawohl, Hoheit. Das habt Ihr ganz offensichtlich. Ihr wart so in Gedanken versunken, dass Euch höchstens ein Meeresbeben in die Gegenwart zurückgebracht hätte“, erwiderte Weytolus sichtlich gekränkt.
„Hmm. Soso. Ein Meeresbeben, meinst du. Das hätte uns gerade noch gefehlt“, brummte der König. „Male bloß nicht den Teufel an die Wand, mein Freund.“
„Das war doch nur so eine Redensart von mir, Hoheit“, beschwichtigte ihn Weytolus. „Schaut, ich habe Euch frische Blumen mitgebracht.“ Und noch während er sprach, schüttelte er das Füllhorn, welches er stets mit sich führte, und Hunderte pastellfarbener Blütenköpfe lösten sich aus dem Behältnis und schwebten vor des Königs Augen als zartfarbig schimmernder Teppich lautlos zu der bogenförmig gewölbten Decke empor.
„Zauberhaft. Ganz zauberhaft“, murmelte König Oyster, der Blumen über alles liebte.
„Ich bin glücklich, Majestät, Euch bei all Euren Sorgen eine kleine Freude bereitet zu haben“, sagte Weytolus bescheiden.
„Sorgen. Ja, mein Lieber. Sorgen habe ich weiß Gott“, seufzte der König.
„Eure Klugheit wird uns eine Lösung für unsere Sorgen finden lassen“, erwiderte sein Großwesir.
„Unsere Sorgen?“
„Ja, Hoheit. Eure Sorgen sind auch die meinen, und ich werde Euch bei deren Lösung mit Rat und Tat zur Seite stehen“, versprach Weytolus selbstbewusst.
„Mit Klugheit werden wir es schaffen, meinst du?“
„Ja, Majestät. Nur mit Klugheit und mit List.“
„So, meinst du. Schön wäre es ja, denn ich hasse Gewalt. Doch was nützt die eigene Friedfertigkeit, wenn der Gegner nicht darauf eingeht, sondern die Gewalttätigkeit auf seine Fahne geschrieben hat“, seufzte er deprimiert.
Die unter der Kuppeldecke schwebenden Blüten verhielten sich, als hätten sie des Königs sorgenvolle Worte verstanden; jedenfalls reagierten sie so.
Der Blütenteppich senkte sich plötzlich, schwebte auf den König zu und verharrte etwa einen Meter über dessen Kopf. Ein besonders schönes, in zarten Pastellfarben schimmerndes Exemplar löste sich aus der Masse und ließ sich auf des Königs rechter Hand nieder.
„Wunderschön“, murmelte König Oyster, und ein weiches Lächeln verklärte sein Gesicht. Die Blüte zwischen Zeige- und Mittelfinger balancierend spürte er, wie seine Depression so schwerelos wie ein Schmetterling davon flog. Vorsichtig legte er die Blüte in eine Alabasterschale und stellte diese auf seinen rosafarbenen, aus einer Riesenmuschel geformten Schreibtisch. „Du bist wahrlich ein Zauberer, Weytolus“, sagte er lächelnd.
„Ach nein, Majestät, das ist des Lobes zu viel. Ich wollte doch nur ...“
„Doch, doch, mein Lieber“, unterbrach ihn sein König. „Du bist mir in all den Jahren ein treuer Freund gewesen. Glaube mir, mein Bester, ich weiß sehr wohl, was ich an dir habe.
Ich bin sehr froh, dich als Freund und Berater an meiner Seite zu wissen“, sagte er mit seltener Offenheit. „Besonders jetzt, bei all den Schwierigkeiten, die ich auf uns zukommen sehe“, fügte er bedrückt hinzu.
Weytolus errötete vor Freude und Stolz über des Königs Lob.
„Du meinst also, wir sollten gewaltlos gegen die rücksichtslosen Umtriebe der Menschen vorgehen?“, fragte der König und kam mit dieser Frage zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen zurück, bevor sein Großwesir so unvermutet aufgetaucht war.
Dieser kannte die Sprunghaftigkeit seines Herrschers und ließ sich keine Sekunde lang verblüffen. „Ja, Hoheit. Mit Klugheit und List werden wir am Ende die Sieger sein“, erwiderte Weytolus überzeugt. „Wir müssen die Menschen mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten schlagen.“
„Und wie stellst du dir das vor?“
„Ganz einfach, Majestät. Wir müssen sie bei ihrer Habgier und bei ihren Ängsten packen“, erwiderte sein Großwesir.
„Aber wir können doch nicht die ganze Welt verändern!“, rief der König.
„Nein, Hoheit, das steht leider nicht in unserer Macht“, bedauerte Weytolus. „Aber wir können den Lebensraum unseres Volkes schützen.“
„So? Und wie soll das vor sich gehen? Bildest du dir etwa ein, die Menschen ließen sich vertreiben?“, fragte König Oyster ironisch.
„Vertreiben? Nein, Majestät, so etwas zu denken wäre mehr als unrealistisch“, erwiderte der Großwesir gelassen. „Doch kennt Ihr zufällig das unter den Menschen geläufige Sprichwort, welches in etwa besagt: Willst du bei deinem Gegner etwas erreichen, dann versuche es mit Zuckerbrot und Peitsche?“
König Oyster schüttelte den Kopf. „Nein, kenne ich nicht. Aber kennst du, mein friedliebender Freund, den Menschenspruch: Auge um Auge, Zahn um Zahn?“
„Oh ja, Majestät. Dieser Ausspruch ist mir wohl bekannt“, nickte Weytolus. „Doch glaubt mir, eine derartige Vorgehensweise hat noch niemals etwas Gutes bewirkt. Hass zieht Hass nach sich, und der Gewalt folgt noch mehr Gewalt, immer und immer mehr, bis alles im Chaos versinkt.“
Der König hatte seinem Großwesir aufmerksam zugehört. Als dieser schwieg, lehnte er sich in seinem blattförmigen, in den schönsten Grüntönen des Universums schimmernden Sessel zurück, schloss die Augen und lauschte still in sich hinein.
Schweigen senkte sich wie eine schalldichte Decke über den Raum. Alles und jedes schien den Atem anzuhalten; kein noch so leises Geräusch war zu vernehmen.
Der Herrscher der Unterwasserwelt überlegte, suchte nach einer Lösung für den Fortbestand seines Volkes und seines Reiches. Und für diesen Augenblick des Insichversinkens, des Suchens, schien die Welt stillzustehen, schien dem König eine Atempause gönnen zu wollen.
Zehn Minuten vergingen. Dreißig Minuten. Fünfundvierzig Minuten. Eine Stunde. Des Königs schwere, violettfarbene Augenlider hoben sich nur wenige Millimeter, um Sekunden später plötzlich wie eine Jalousie hochzuschnellen. Ein gewaltiger Atemzug dehnte seinen imposanten Brustkorb, und ein zufriedener Seufzer brachte den vorm Eingang hängenden Muschelvorhang zum Klingen.
„Ich habe eine Idee“, durchdrang König Oysters sonore Stimme die bleischwere Stille des Raumes, vertrieb diese, und schaffte Platz für den normalen Fortgang des täglichen Lebens.
„Ich werde mir die Gier und die Angst der Menschen zu Nutze machen und dafür sorgen, dass die Umwelt für uns und auch für künftige Generationen lebensfähig bleibt. Und ich werde erreichen, dass die Zuflüsse zu meinem Reich endlich sauberer werden und es auch bleiben.“
„Und der Planktongrund? Was soll mit den dort lagernden Giftfässern geschehen, Majestät?“
„Ganz einfach: Wir bringen sie den Menschen zurück. Die Wale werden dafür sorgen.“
„Zurückbringen?! Und wenn sie die Fässer erneut im Planktongrund oder an anderer Stelle versenken?“, fragte Weytolus skeptisch.
„Das werden sie nicht, Weytolus.“
„So, meint Ihr, Hoheit? Und was sollte sie davon abhalten, wenn ich fragen darf?“
„Ihre Furcht und ihre Geldgier“, lächelte der König.
„Furcht, Hoheit?“
„Ja, Weytolus, Furcht! Denn sollten die Menschen meinem Vorschlag nicht zustimmen, werde ich Olmokan, den Hüter der Meere, um Hilfe bitten.“
„OLMOKAN?!
Oh Gott der Meere, sei uns gnädig“, flüsterte der Großwesir entsetzt.
„Keine Sorge. Vertrau mir. Ich habe einen Plan. Komm her zu mir, mein treuer Weytolus. Nein, noch näher. Ich werde ihn dir erklären. Und wenn wir Erfolg haben, wird unser Überleben gewährleistet sein.“
FÜNF TAGE SPÄTER
Alle waren sie gekommen! Aus den entlegensten Winkeln waren sie angereist. Selbst diejenigen Meeresbewohner hatten sich auf den Weg gemacht, die unter dem Einfluss der Meeresverschmutzung und Verseuchung monströs verändert und schuldlos zu wahren Horrorgeschöpfen mutiert waren.
Nach jahrelanger Abgeschiedenheit in ihren Verstecken lebend, hatten sie diese verlassen, um sich zur größten und wichtigsten Versammlung aller Zeiten aufzumachen, in der es um Untergang oder Fortbestand aller Meeresbewohner ging.
Gewaltige Monsterkrabben, deren Vorfahren einstmals ganz gewöhnliche Krabben waren; Riesenfische mit rasiermesserscharfen, weit aus den Mäulern herausragenden Zähnen; zweiköpfige Fische mit skalpellscharfer, schwertförmiger Rückenflosse; Kraken, groß wie ein Fußballstadion, deren zig meterlange, mit unzähligen kürbisgroßen Saugnäpfen besetzte Tentakel Schiffe zum Kentern bringen konnten; und ellenlange, dreiäugige Wesen mit rasiermesserscharfen Dornen auf borkigen Rücken. Sie alle strebten einträchtig Seite an Seite dem gewaltigen Unterwasserkomplex König Oysters zu.
Doch was mussten sie sehen? Was war mit ihrer einstmals so schönen Heimat geschehen? Was, um des Meeresgottes Willen, war während der Zeit ihrer Zurückgezogenheit mit ihrer Welt passiert? fragten sie sich entsetzt. Und viele wären am liebsten wieder in ihre Abgeschiedenheit zurückgekehrt, hätte sie ihr Verantwortungs-bewusstsein und ihr Gemeinschaftssinn nicht davon abgehalten.
Als Müllhalde bot sich ihnen der einstmals so saubere Meeresgrund dar. Zwar waren ihnen Schiffswracks und vermodernde Anker nicht fremd. Aber wieso entsorgten die Menschen ihren Wohlstandmüll im Meer? Was hatten Getränkedosen und Flaschen, Autowracks und Kühlschränke, Möbelstücke und verrostete Fahrräder, Fässer mit gefährlichen Chemikalien und was nicht noch alles mehr auf dem Meeresboden zu suchen?
Geschah es aus Gedankenlosigkeit? Oder Dummheit? Vielleicht aus Gewinnsucht? Wahrscheinlich traf alles zu, jedoch am meisten wohl Letzteres. Denn wann ging es bei den Menschen einmal nicht ums Geld?
Die armen verunstalteten Geschöpfe seufzten bitter und sehnten sich zurück zu ihren Verstecken. Aber dorthin konnten sie vorläufig nicht, denn ihr König brauchte sie. Er benötigte ihre Hilfe, um sein Volk zu retten und nur das alleine zählte. Also hatten sie ihren Weg fortgesetzt, waren Tag und Nacht geschwommen, um den Palast ihres Königs rechtzeitig zu erreichen.
Oh ja, dachte König Oyster. Adamos hat ganze Arbeit geleistet, hat wieder einmal eindrucksvoll seine Vertrauenswürdigkeit und Loyalität bewiesen.
Zufrieden schaute er von seinem Thronsessel auf sein Volk herab. Er hatte um ihr Erscheinen gebeten und kaum einer seiner Untertanen hatte sich dieser Aufforderung entzogen.
Wale aller Größen; Wasserschlangen; vergnügt plappernde Delphine; quicklebendige Robben; Kleinstmeereslebewesen; Fische verschiedenster Art; Haie sowie die armen mutierten Wassergeschöpfe dümpelten friedlich inmitten der übrigen Meeresbewohner.
Der Artenreichtum; die Vielfalt der Formen, teils harmonisch, teils regelrecht bizarr; die unterschiedlichen Größen; dazu die kaum vorstellbare Farbpalette der Anwesenden könnten einen Maler schier um den Verstand bringen, dachte der König beeindruckt.