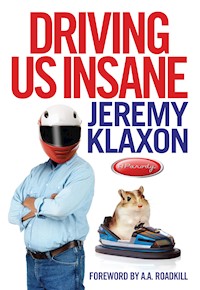9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kingmaker
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Der Auftakt eines mitreißenden Historienepos über die Rosenkriege von Bestsellerautor Toby Clements
Kloster St. Mary, England, 1460. In einer klirrend kalten Februarnacht kreuzen sich die Wege von Thomas und Katherine, einem Mönch und einer Nonne. Thomas rettet die junge Frau vor einer Schar Angreifer aus höchster Gefahr. Dabei verletzt er den Sohn des mächtigen Sir Riven schwer, der fortan auf Rache sinnt. Als Sir Riven und seine Männer ins Kloster einfallen, müssen Thomas und Katherine fliehen - und geraten mitten hinein in die blutigen Auseinandersetzungen der Häuser York und Lancaster, in die Rosenkriege, deren Ausgang sie schon bald mitbestimmen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 944
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Karte
Vorbemerkung zu den Stammbäumen
Stammbäume
Dramatis Personae
Vorwort
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Teil 2
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Teil 3
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Teil 4
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Teil 5
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Teil 6
32. Kapitel
33. Kapitel
Teil 7
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Danksagung
Über den Autor
Toby Clements ist Autor und Buchkritiker. Schon als Grundschüler spürte er eine ungeheure Faszination für die englischen Rosenkriege, die lange, blutige Auseinandersetzung zwischen den Adelshäusern Lancaster und York. Seitdem hat er so gut wie jedes Buch gelesen, das es zu diesem Thema gibt. Mit der Veröffentlichung von KRIEGDER ROSEN: WINTERPILGER, dem ersten Teil seiner Saga um die Rosenkriege, geht für Toby Clements daher ein Kindheitstraum in Erfüllung. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in London.
TOBY CLEMENTS
Kriegder Rosen
WINTERPILGER
HISTORISCHER ROMAN
Aus dem Englischen von Holger Hanowell
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Toby Clements
Titel der englischen Originalausgabe: »Kingmaker: Winter Pilgrims«
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Judith Mandt
Textredaktion: Dr. Lutz Steinhoff, München
Stammbäume: Reinhard Borner
Karte: Copyright © Darren Bennett
Titelillustration: © getty-images/De Agostini Picture Library;
© iStockphoto/Peter Zelei; © shutterstock/Andrey Kuzmin;
© Lee Gibbons; © Penguin Random House UK
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur; Hamburg
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1486-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Karen,
VORBEMERKUNGZUDEN STAMMBÄUMEN
Der Anspruch des Hauses Lancaster auf den Thron über die Linie des 3. Sohnes von König Edward III. (John, 1. Duke of Lancaster, geb. 1340) stützt sich auf bestimmte Besitztümer (Kronlande) und auf die Überzeugung, die Krone könne nicht in weiblicher Linie vererbt werden (konkret: über Philippa Mortimer, Tochter von Lionel, 1. Duke of Clarence). Folglich kommt aus Sicht des Hauses Lancaster der nächste Verwandte in männlicher Linie zum Zuge, also die Linie von John, 1. Duke of Lancaster.
Der Anspruch des Hauses York hingegen stützt sich auf die Nachfahren des 2. Sohnes von König Edward III. (Lionel, 1. Duke of Clarence, geb. 1338). Die Anhänger Yorks waren sehr wohl der Überzeugung, dass die Krone über die weibliche Linie, also über Philippa Mortimer, vererbt werden könne.
Das Haus Tudor wiederum ignoriert die Frage der weiblichen Erbfolge – über Lady Margaret Beaufort – ebenso wie den Umstand, dass John Beaufort, der 1. Earl of Somerset, illegitim geboren wurde.
DRAMATIS PERSONAE
Die Auflistung bietet einen Überblick über die wichtigsten Romanfiguren, wobei die historischen Personen jeweils mit * gekennzeichnet sind.
Politische Lager während der Rosenkriege
Wichtigste Anführer des Hauses York im Jahre 1460 (der weißen Rose zuzuordnen)
*Richard Plantagenet, 3. Duke of York, ältester Thronanwärter des Hauses York (stirbt 1460 in der Schlacht von Wakefield)
*Edward Plantagenet, Earl of March, Sohn des Duke of York, ab 1460 4. Duke of York (später König Edward IV.)
*Edmund Plantagenet, Earl of Rutland, zweiter Sohn des Duke of York (stirbt 1460 in der Schlacht von Wakefield)
*Richard Neville, 5. Earl of Salisbury, mächtiger Magnat (hingerichtet nach der Schlacht von Wakefield)
*Richard Neville, 16. Earl of Warwick, Sohn des Earl of Salisbury, Captain von Calais, später bekannt unter dem Namen »Warwick der Königsmacher«, da er Edward IV. auf den Thron hilft
*William Neville, 1. Earl of Kent, Baron Fauconberg, Bruder des Earl of Salisbury, klein, reizbar, guter Soldat
*William Hastings, Freund des Earl of March
Wichtigste Anführer des Hauses Lancaster im Jahre 1460 (spätestens ab 1485 der roten Rose zuzuordnen)
*König Henry VI., Sohn Henrys V., besitzt einen schwachen Willen und gilt nach Ende des Hundertjährigen Krieges als geistig umnachtet
*Margarete von Anjou (Marguerite d’Anjou), willensstarke Gemahlin König Henrys VI.
*Henry Beaufort, 3. Duke of Somerset, Günstling Margaretes, guter Soldat, berüchtigt
Des Weiteren standen die meisten Magnaten des Landes auf der Seite des Hauses Lancaster, darunter etwa Humphrey Stafford (1. Duke of Buckingham), Henry Holland (3. Duke of Exeter), John Talbot (2. Earl of Shrewsbury), James Butler (5. Earl of Ormond), Henry Percy (3. Earl of Northumberland), Edmund Grey (Ruthyn, 1. Earl of Kent) sowie Thomas de Scales (7. Baron Scales), Thomas de Ros (9. Baron de Ros of Helmsley), Robert Hungerford (3. Baron Hungerford) und John Clifford (9. Baron de Clifford).
Thomas Everingham, Mönch des Ordens des heiligen Gilbert of Sempringham
Katherine, Nonne des Ordens des heiligen Gilbert of Sempringham
Gefolgsleute von Sir John Fakenham aus Marton Hall, Lincolnshire:
Richard Fakenham, Sir Johns Sohn
Geoffrey, ein gutmütiger, beleibter Kämpfer
Goodwife Popham, dessen Frau und Haushälterin auf Marton Hall
Liz, dessen Tochter
Walter, ein alter Haudegen
Dafydd und Owen, zwei Brüder aus Wales
Red John, Brampton John, Little John Willingham, Black John, Thomas, Hugh, Simon Skettle
Henry, ein Bogenschütze aus Kent
Robert Daud, ein Ablasshändler aus Lincoln
Mistress Daud
Sir Giles Riven, Ritter aus Lincolnshire
Edmund Riven, Sohn von Sir Giles
Morrant, der Riese
Lady Margaret Cornford, Tochter von Lord Cornford
Wichtige Schlachten der Rosenkriege bis 1461 (mit militärischen Befehlshabern)
Erste Schlacht von St. Albans (First Battle of St Albans) Hertfordshire, 22. Mai 1455: Richard Plantagenet, 3. Duke of York (Haus York), und Edmund Beauford, 2. Duke of Somerset (Haus Lancaster, stirbt in der Schlacht); Sieg des Hauses York
Schlacht von Ludlow (Battle of Ludford Bridge) in Shropshire, 12. Oktober 1459: Margaret of Anjou (Lancaster) und Richard, Duke of York (York); Sieg des Hauses Lancaster
Schlacht von Northampton (Battle of Northampton), 10. Juli 1460: Richard Neville, 16. Earl of Warwick (York), und Henry VI. und andere Adlige (Lancaster); Sieg des Hauses York
Schlacht von Wakefield und Sandal Castle (Battle of Wakefield), 30. Dezember 1460: Richard of York und Richard Neville, Earl of Salisbury (York, beide sterben), und Henry Beaufort, Duke of Somerset, Henry Percy, Earl of Northumberland, und John Clifford (Lancaster); bedeutender Sieg des Hauses Lancaster
Schlacht von Mortimer’s Cross in der Nähe von Wigmore, Herefordshire (Battle of Mortimer’s Cross), 2. Februar 1461: Edward, Earl of March (York) und Sir Owen Tudor (hingerichtet) und Jasper Tudor, Earl of Pembroke (Lancaster); bedeutender Sieg des Hauses York
Zweite Schlacht von St. Albans (Second Battle of St Albans), Hertfordshire, 17. Februar 1461: Margaret of Anjou (Lancaster) und Richard Neville, Earl of Warwick (York); Sieg des Hauses Lancaster
Schlacht bei Ferrybridge (Battle of Ferrybridge), Yorkshire, 28. März 1461: Richard Neville, Earl of Warwick (York) und John Clifford und John Neville (Lancaster); unentschieden, gilt als kleines Scharmützel vor der großen Schlacht von Towton
Schlacht von Towton (Battle of Towton), Yorkshire, 29. März 1461: Edward IV. (York) und Henry Beaufort, 3. Duke of Somerset (Lancaster); entscheidender Sieg des Hauses York
VORWORT
Während der 1450er Jahre war England in einem erbärmlichen Zustand. Der Hundertjährige Krieg mit Frankreich hatte mit einer Demütigung geendet, in Städten und Grafschaften waren Recht und Ordnung zusammengebrochen, und auf See wimmelte es von Piraten, sodass der Wollhandel, der einst für volle Geldkassetten gesorgt hatte, zum Erliegen gekommen war. Unterdessen litt König Henry VI. immer öfter an geistiger Umnachtung, und da es keinen starken Führer gab, war der Königshof zum Zankapfel zweier Lager geworden: Dem einen stand die Königin vor – eine willensstarke französische Dame namens Margarete von Anjou –, an der Spitze des anderen stand Richard, Duke of York, mit seinen mächtigen Verbündeten, den Earls of Warwick und Salisbury.
Die Beziehungen zwischen den beiden Lagern zerbrachen im Jahre 1455, woraufhin jede Partei ihre Verbündeten zu den Waffen rief. Bei einem schnell ausgeführten ersten Zusammenstoß im Schatten der Abtei von St Albans in Hertfordshire wurde der Günstling der Königin, Edmund Beaufort, der 2. Duke of Somerset, getötet. Der Duke of York und dessen Verbündete trugen den Sieg davon.
Aber die Vormachtstellung des Hauses York war nur von kurzer Dauer. Gegen Ende der Dekade war der König wieder genesen, und die Königin sicherte sich erneut die Kontrolle über den Hof. Unerbittlich sannen die Söhne der Edlen, die bei St Albans gefallen waren, um ihrer Väter willen auf Rache.
Im Jahre 1459 rief die Königin den Duke of York und dessen Verbündete zum Hof nach Coventry, wo sie sich ihrer Machtposition sicher war. Wieder hob der Duke of York, der um sein Leben fürchten musste, das Banner und scharte seine Verbündeten um sich. Die Königin tat – auf Geheiß des Königs – dasselbe, sodass am Vorabend des St Edward’s Day im Oktober desselben Jahres beide Seiten abermals zu Felde zogen, bei der Brücke von Ludford, unweit von Ludlow, in der Grafschaft Shropshire.
Als der Duke of York und die Earls of Warwick und Salisbury sich verraten fühlten und erkannten, dass ihre Lage hoffnungslos war, flohen sie außer Landes – der Duke of York nach Irland, die Earls of Warwick und Salisbury nach Calais, jenseits des Ärmelkanals.
Und während die Verbündeten der Königin weiterhin das Land ausbeuten, warten die Menschen in England: Sie warten auf die Vorboten des Frühlings, sie warten, dass die Männer aus dem Exil zurückkehren, sie warten, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen erneut ausbrechen.
TEIL 1
KLOSTER ST MARY, HAVERHURST,COUNTYOF LINCOLN
FEBRUAR 1460
1. KAPITEL
Als die Nacht am dunkelsten ist, tritt der Dekan zu ihm. In der einen Hand hält er ein Binsenlicht, in der anderen einen langen Stab. Damit stößt er ihn an, um ihn zu wecken.
»Auf, Bruder Thomas«, flüstert er. »Der Prior will dich sehen.«
Es ist noch zu früh für die Prim, wie Thomas weiß, und daher hofft er, dass der Dekan ihn liegen lässt, wenn er sich weiterhin schlafend stellt. Vielleicht weckt der Dekan stattdessen einen anderen Mönch, etwa Bruder John oder Bruder Robert, der wieder schnarcht. Augenblicke später zieht ihm jemand die Decke weg, und die Kälte der Nacht erfasst ihn. Thomas richtet sich auf und versucht, nach der Decke zu greifen, aber der Dekan hat sie längst zur Seite geworfen.
»Nun komm schon«, sagt er. »Der Prior erwartet dich.«
»Was will er denn?«, möchte Thomas wissen. Ihm ist jetzt schon so kalt, dass seine Zähne klappern. Die Wärme des Schlafes weicht aus seinem Körper.
»Das wirst du schon sehen«, sagt der Dekan. »Und nimm dein Gewand mit, auch deine Decke. Nimm einfach alles mit.«
Im matten Schein des Lichts sieht Thomas von dem Gesicht des Dekans nur die zusammengezogenen Brauen und die Konturen der krummen Nase. Schemenhaft zeichnet sich das Haupt des Mannes vor den von Reif bedeckten Schieferschindeln des Daches ab. Thomas holt seine vom Frost steife Kutte hervor und sucht rasch nach seiner Kappe und den Holzpantinen. Die Decke legt er sich eng um die Schultern.
»Komm endlich«, drängt der Dekan. Auch dessen Zähne klappern.
Thomas erhebt sich und folgt ihm durch das Dormitorium. Leise steigen sie über die schlafenden Brüder hinweg und nehmen die steinernen Stufen, die hinunterführen zur Zelle des Priors. Den Eingang erhellt eine Bienenwachskerze in einer Wandhalterung. Der alte Mann liegt auf seinem dicken Strohlager. Drei Decken hat er sich bis unters Kinn gezogen.
»Gott sei mit Euch, Vater«, sagt Thomas.
Der Prior winkt ab, ohne dabei die Hände unter der Decke hervorzunehmen.
»Hast du es noch nicht gehört?«, fragt er.
»Was, Vater?«
Der alte Mann erwidert nichts und deutet mit einer knappen Kopfbewegung zu dem geschlossenen Fensterladen. Thomas hört nur den Dekan, der hinter ihm steht, atmen und das leise Klappern seiner eigenen Zähne. Plötzlich dringt von draußen ein anschwellendes Kreischen in die Zelle, ein lang gezogener hoher Klagelaut, der ins Ohr schneidet. Thomas schaudert. Einer Eingebung folgend, bekreuzigt er sich.
Der Prior lacht leise.
»Das ist nur ein Fuchs«, sagt er. »Was hast du denn gedacht? Eine verlorene Seele? Einer der kleineren Teufel?«
Thomas schweigt.
»Wahrscheinlich steckt er auf der anderen Seite des Flusses im Unterholz fest«, sagt der Dekan, »denn dort hat einer der Laienbrüder Fallen aufgestellt. John war das, glaube ich.«
Wieder herrscht Schweigen. Warum rufen sie dann nicht diesen John, denkt Thomas bei sich, den Mann, der für die Fallen verantwortlich ist? Soll er doch losgehen und den Fuchs von seinen Qualen erlösen.
»Beeile dich also, Bruder Tom«, sagt der Dekan.
Thomas begreift, was sie von ihm verlangen.
»Ich soll das machen?«
»Ja, du«, erwidert der alte Prior. »Oder hältst du dich für zu fein für so etwas?«
Thomas schweigt, aber im Stillen ist er davon überzeugt, dass das nicht zu seinen Aufgaben gehört.
»Sieh her, so musst du es machen«, erklärt der Dekan ihm und deutet mit seinem Stab an, wie man einem Fuchs am besten einen Stoß auf den Schädel versetzt. »Du musst ihn genau oberhalb der Augen treffen.«
Der Dekan hat an den Kriegen auf französischem Boden teilgenommen, und er soll, so erzählt man sich jedenfalls, einen Mann getötet haben. Vielleicht sogar zwei. Wortlos reicht er Thomas den robusten Stab, der fast so groß ist wie Thomas selbst. An einem Ende ist das Holz dunkel verfärbt, als habe man damit in einem großen Kessel gerührt.
»Und denk dran, das tote Tier mitzubringen!«, ruft der Prior hinter ihnen her, während der Dekan Thomas schon aus der Zelle führt. »Ich möchte nämlich das Fell haben und der Infirmarius das Fleisch, hörst du?«
Im flackernden Lichtschein, den die Lampe des Dekans verbreitet, gelangen sie über mehrere Stufen in das Refektorium, wo es Thomas sofort zu den noch glühenden Kohlen der Feuerstelle zieht. Aber da hat der Dekan schon die andere Seite des Saals erreicht und den Riegel der Tür zur Seite geschoben.
»Bei Gott!«, entfährt es ihm, als er die Tür öffnet.
Draußen herrscht eine klirrende Kälte, die einen Menschen töten kann, eine Kälte, bei der kein Vogel mehr fliegt und Mühlsteine zu bersten drohen.
»Geh nur, junger Tom«, sagt der Dekan. »Je eher es getan ist, desto eher bist du zurück. Ich warte mit heißem Wein auf dich.«
Thomas will etwas erwidern, aber da schiebt der Dekan ihn schon über die Schwelle hinaus in die Kälte und macht die Tür sofort hinter ihm zu.
Großer Gott. Eben hat er noch friedlich geschlafen, ziemlich warm, und hat vom Sommer geträumt, und jetzt das!
Die Kälte beißt im Gesicht, sie lässt ihn leicht schwindeln. Er zieht sich das Gewand enger um die Schultern und zögert einen Augenblick lang, dann macht er sich auf den Weg und geht quer über den Innenhof in Richtung des Tors, wo oft die Bettler stehen. Seine Pantinen klacken auf dem hart gefrorenen Boden.
Mit steifen Fingern öffnet er das Tor und tritt hinaus. Im Osten kündigt sich schon blass die Morgendämmerung an. Der Schnee, der das Marschland bedeckt, strahlt ein Licht aus, das kalt und bläulich erscheint. Weiter südlich, an der Flussbiegung, ist das Mühlrad erstarrt: Aus der Ferne sieht es aus, als habe es den Mund geöffnet, um noch etwas zu sagen. Dahinter liegen die Backstube, die Brauerei und die Gehöfte der Laienbrüder wie verlassen da. Ihr Mauerwerk ist von Reif überzogen, die Dächer ächzen unter der Schneelast. Nichts regt sich. Kein Lufthauch.
Dann wieder der Schrei des Fuchses, dünn und schneidend wie eine Klinge. Thomas fröstelt und wendet sich zum Torhaus um, als ließe man ihn wieder ein, sodass er zu seinem Nachtlager zurückkehren darf. Doch dann reißt er sich zusammen und zwingt sich loszugehen. Zögerlich macht er einen Schritt, dann noch einen, wobei er im Schutz der Mauer bleibt und so lange ihrem Verlauf folgt, bis er die alte Handelsstraße als dunkle Linie in der verschneiten Landschaft erkennt. Sie verläuft durch das Marschland in Richtung Cornford und des Sees dahinter. Thomas denkt daran, dass es eine Zeit gab, als es auf dieser Straße selbst an einem Morgen wie diesem geschäftiges Treiben gab. Kaufleute pflegten in Richtung Boston zu fahren, die Fuhrwerke beladen mit Wolle, die im Hafen auf Schiffe verladen und nach Calais gebracht wurde. Oft nahmen Pilger diese Straße auf ihrem Weg zum Schrein des heiligen Hugo in Lincoln. In diesen Tagen jedoch, da Gesetzlosigkeit im Lande herrscht, ist jeder, der zu dieser frühen Stunde unterwegs ist, entweder ein Narr oder ein Schurke oder gar beides.
Als Thomas das Frauenkloster erreicht, verspürt er ein Brennen an den Schienbeinen. Seine Frostbeulen pochen, und seine Finger fühlen sich bei der Eiseskälte schon so geschwollen und steif an, dass er weiß, an diesem Tag wird er keinen Federkiel mehr in der Hand halten können. Daher wird er auch keine Fortschritte bei seinem Psalter machen. Selbst die Zähne und das Zahnfleisch schmerzen in der kalten Luft.
Vor dem Tor des Frauenklosters bleibt er einen Augenblick lang stehen, wirft zögerlich einen Blick auf die Mauern, obwohl er weiß, dass er das eigentlich nicht darf, und löst sich schließlich aus dem Schatten des Klosters. Er geht quer über ein Feld, auf dem die Laienbrüder im späten Frühjahr Roggen ausbringen werden. Durch den Schnee zieht sich ein alter Pfad, und ungefähr eine Achtelmeile folgt Thomas Fußspuren bis hinunter zum Dunghaufen am Fluss. Hier endet der Pfad an einer Stelle, an der es viele Fußabdrücke und gebrochenes Eis gibt, als habe dort jemand Wasser geschöpft.
Thomas klettert über die Uferböschung bis hinunter zur Eisfläche, auf der Nebelschleier liegen. Vorsichtshalber stampft er mit einem Bein prüfend auf, obwohl er weiß, dass die Eisschicht so dick ist, dass sie sogar einen Bären oder einen Ochsen tragen würde. Selbst ein Fuhrwerk könnte auf dem zugefrorenen Fluss fahren. Dennoch beeilt er sich, die Eisfläche zu überqueren, dann drängt er sich am anderen Ufer durch das von Reif überzogene Schilfrohr. Gerade als er die Böschung hinaufklettert, schreit der Fuchs wieder, rau und schmerzerfüllt. Thomas hält wie erstarrt inne. Dann ist der Schrei verklungen.
Noch einmal zögert er, wirft einen Blick zurück zum Kloster, sieht die aus Stein erbauten niedrigen Gebäude, die sich um den Turm der Kirche drängen. Deutlich erkennt er die Umrisse des Refektoriums. Aus dem undichten Dach steigt Rauch auf in den blassgrauen Himmel, und Thomas wünscht sich, er wäre jetzt sicher und geborgen hinter diesen Mauern. Dort würde er sich zur Prim vorbereiten oder vielleicht noch schlummern und vom kommenden Sommer träumen.
Verflucht sei der Prior! Verflucht sei er dafür, dass er ihn geweckt und ihm diese Aufgabe aufgebürdet hat.
Und warum er? Warum haben sie ihn dafür bestimmt? Warum nicht diesen John, der die Fallen aufgestellt hat? Thomas ist Kopist, ein Buchmaler, kein Laienbruder und schon lange kein Junge vom Lande mehr. Heute wollte er eigentlich Blattgold auf einen der Großbuchstaben auftragen und die Verzierung mit Bruder Athelstans Polierstift verfeinern, dessen Spitze aus einem Hundezahn gefertigt ist. Doch jetzt sind seine Finger steif gefroren.
Ob genau das die Absicht des Priors gewesen ist? Thomas beginnt zu begreifen. Der Prior will ihn Demut lehren und seinen Stolz brechen. Gestern Abend sagte er etwas in dieser Richtung, als er beim Nachtmahl wider die Sünden predigte. Thomas hatte währenddessen das Gefühl, dass der alte Mann ihn mehr als einmal mit einem vielsagenden Blick bedachte. Aber er hatte sich nichts dabei gedacht. Er hatte nicht zerknirscht genug dreingeblickt, daran musste es gelegen haben. Eine Lektion, wieder einmal.
Er stapft weiter durch den Schnee, der immer tiefer wird. Die Schneedecke, die sich seit Martini gebildet hat, ist unberührt. Thomas kämpft sich durch die weißen Massen, die ihm jetzt schon bis zu den Knien reichen, er strauchelt und versucht das Gleichgewicht zu halten. Schon bald sind seine Kleider durchnässt. Weiter geht es, die leichte Anhöhe hinauf, bis er schließlich nur noch wenige Schritte von dem dichten Unterholz entfernt ist. Das Atmen schmerzt. Vorsichtig späht er durch das Geflecht der Zweige. Er kann nichts erkennen, da es dunkel ist im Dickicht, aber irgendetwas ist dort. Seine Nackenhaare stellen sich auf. Vorsichtig schiebt er mit seinem langen Stock einen Ast zur Seite.
Plötzlich gibt es einen dumpfen Knall. Ein Dröhnen. Thomas hört einen Schrei, ein Reißen und dann wildes Flügelschlagen. Aus dem Halbdunkel kommt etwas auf ihn zu, schwarz wie die Nacht, hält auf sein Gesicht zu, hat es auf seine Augen abgesehen!
Thomas stößt einen Schrei aus. Er duckt sich, holt mit dem Stab aus, um sich zu schützen, und wirft sich in seiner Angst in den Schnee.
Eine Krähe. Unheilvoll krächzend fliegt sie davon.
Das Herz schlägt ihm bis zum Hals. Er hört seine eigene Stimme, sie gibt irgendetwas Unverständliches von sich. Als er sich schließlich aufrichtet und hinkniet, sind seine Hände blau, sein Gewand ist wie gemustert vom Schnee.
Die Krähe hat sich inzwischen auf einem schneebedeckten Pfosten unweit des Dunghaufens niedergelassen.
»Elender Vogel!«, schimpft Thomas und droht mit seinem Stab. »Verfluchtes Biest!«
Die Krähe beachtet ihn nicht. Auf einmal hört er die Glocke im Kloster, und vom Fluss steigt dichter Nebel auf, dicht wie ein Pelz. Thomas blickt wieder zum Dickicht, er ist fest entschlossen, sich dorthinein zu wagen, aber er findet keinen Weg durch das dichte Gestrüpp. Mit dem Stab drischt er auf die Ranken ein, dann geht er um das Dickicht herum, und schließlich entdeckt er einen Weg. Die Fußspuren sind wahrscheinlich die von Laienbruder John. Thomas duckt sich unter den ersten ausladenden Zweigen hindurch und kämpft sich weiter vor. Dornen reißen an seinem Gewand, Schnee löst sich von den Zweigen über ihm und rieselt herab. Er stolpert über einen umgestürzten Baum und steht dann am Rande einer kleinen Lichtung. Irgendetwas zwingt ihn, stehen zu bleiben. Dann erblickt er den Fuchs, in der Düsternis ist er nur zu erahnen. Matt hebt sich der rötliche Pelz von der Umgebung ab.
Thomas wagt sich einen Schritt vor.
Hals und Vorderpfote des Tiers haben sich in einer Drahtschlinge verfangen, der Draht selbst hängt vom Ast einer Hainbuche herunter. Der Fuchs stützt sich auf die Hinterpfoten, er ist halb erdrosselt, halb erfroren. Seine schmale Schnauze ist ihm auf die blutige Brust gesackt. Den Schnee unter sich hat das Tier in seinem Todeskampf weggekratzt, sodass dunkler Boden zu sehen ist. Überall sind Blutflecken und Büschel von rotem Fell.
Thomas schlägt das Kreuz und bleibt stehen. Er lauscht. Er hört irgendwelche Laute. Dann wird er gewahr, dass sie von dem Fuchs kommen, der noch lebt und mühsam nach Luft schnappt. Jedes Einatmen gleicht einem Rasseln, jedes Ausatmen endet in einem rauen Wimmern.
In diesem Augenblick scheint das Tier ihn zu wittern und hebt den Kopf.
Thomas keucht auf. Unwillkürlich weicht er einen Schritt zurück.
Der Fuchs hat keine Augen mehr, die Augenhöhlen sind voller Blut.
Die Laute der Krähe dringen bis in das Dickicht.
»Dieser verfluchte Vogel«, stößt Thomas zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Wieder bekreuzigt er sich.
Der Fuchs lässt den Kopf wieder auf die Brust sinken.
Thomas wappnet sich. Entschlossen tritt er vor, holt mit dem Stab aus und stößt zu – genau wie der Dekan es ihm gezeigt hat. Ein Knacken. Der Fuchs erzittert in der Schlinge. Blut sickert in den Schnee und hinterlässt ein zartes Muster. Das Tier zuckt noch einmal, stößt einen rasselnden Seufzer aus und ist tot.
Thomas zieht den Stab zurück, dessen stumpfes Ende in der zertrümmerten Schädeldecke gesteckt hat und das nun mit Fetzen des Gehirns verschmiert ist. Er wischt den Stab in der Schneewehe unter der Hainbuche ab. Jetzt, da er die Aufgabe hinter sich gebracht hat, bleibt er noch einen Augenblick lang stehen, dann schlägt er ein letztes Kreuzzeichen über dem toten Fuchs. Er segnet das Tier als Geschöpf des Herrn und will schon wieder gehen, als ihm die Anweisung des Priors wieder in den Sinn kommt.
Seufzend legt er den Stab zur Seite und versucht herauszufinden, wo die Schlinge verläuft, angefangen bei dem Ast, an dem sie befestigt ist, bis hinunter zu dem feuchten Gewirr der Gemeinen Waldrebe. Ein mühsames Unterfangen, denn seine Finger sind beinahe taub, und der Knoten der Drahtschlinge ist vereist.
Inzwischen ist Thomas auf die Knie gesunken, er tastet weiter nach dem Knoten und spürt dabei die raue Borke des Baums an seinem Ohr. Den Knoten bekommt er einfach nicht auf. Er bräuchte sein Messer und verflucht sich für seine Vergesslichkeit. Auf einmal hört er Geräusche. Es sind Männerstimmen, überlagert von schwerem Hufschlag auf der Straße, die nach Cornford führt.
2. KAPITEL
Der Tag ist schon fast angebrochen, als Schwester Katherine mit dem Eimer aus der Zelle der Priorin geht. Sie tritt hinaus auf den Hof, wo ihr die Kälte den Atem verschlägt.
»Gott sei mit dir, Schwester Katherine.«
Die Worte kommen von Schwester Alice, der jüngsten Nonne im Konvent. Sie ist noch nicht lange hier. Sie hat sich in ihren Umhang gehüllt, ihr Gesicht ist halb verborgen hinter einer Wolke aus weißem Atem.
»Und Gott sei mit dir, Schwester Alice. Wie ich sehe, bist du nicht in der Kapelle.«
»Zuerst ein kleiner Spaziergang«, sagt Schwester Alice mit einer Bestimmtheit, als wäre es die natürlichste Sache von der Welt. Katherine zieht die Stirn kraus. Seit sieben Jahren geht sie diesen Weg, tagein, tagaus, und nicht ein Mal hat jemand sie dabei begleitet. Und so freut sie sich, Gesellschaft zu haben. In der Nacht hat ein Tier jämmerlich geschrien, und Katherine spürt, dass sie immer noch voller Unruhe ist.
»Ich heiße deine Gesellschaft willkommen, Schwester Alice«, sagt sie. Sie hält den Eimer ein Stück von ihrem Bein weg, während Alice ihr mit dem Riegel am Tor hilft. Eine zähe Flüssigkeit schwappt im Eimer, und warmer Dampf steigt nach oben und streicht Katherine über das Handgelenk. Ihre Haut prickelt.
Jenseits des Tors brechen sie bei jedem Schritt durch die Kruste des Schnees, der während der Nacht hart gefroren ist. Dichter Nebel liegt über dem Fluss. Eine Krähe verlässt ihren Ruheplatz auf einem Pfosten.
Plötzlich bleibt Alice stehen.
»Ich habe Vögel schon immer gehasst«, sagt sie. »Es liegt an den Federn.«
Katherine fragt sich, wie es wohl wäre, wenn man Zeit hätte für solch einen Luxus.
Sie setzt ihren Weg fort, ihre Schritte sind laut in der gefrorenen Stille. Als sie die Stelle unten am Fluss erreichen, wo der Schnee vor dem Dunghaufen platt getreten ist, stellt Katherine fest, dass irgendwer vor Kurzem hier gewesen sein muss – vielleicht einer der Laienbrüder. Frische Fußspuren führen hinüber zum anderen Ufer des Flusses. Sie stellt den Eimer ab und nimmt den Deckel vom Fass. Eiszapfen, die sich am Rand gebildet haben, knacken und zerspringen. Für Katherine ist das ein Vorteil des Winters, denn in dieser Jahreszeit schwirren keine lästigen Fliegen um die Öffnung des Fasses herum. Wenn es warm ist, raubt einem der Gestank beinahe den Atem. Schwester Alice will ihr den Eimer reichen, doch sie rutscht aus, und um ein Haar lässt sie ihn fallen.
»Lass mich das machen«, sagt Katherine.
»Aber ich will doch nur helfen.«
Wieder fragt Katherine sich, warum Alice überhaupt hier ist. Nicht hier am Flussufer, in der Hand den Eimer mit den Ausscheidungen der Priorin, nein – warum sie im Kloster ist. Sie ist zu jung und zu hübsch, um innerhalb der Klostermauern auf den Tod zu warten, wie alle anderen Schwestern es tun. Sie ist viel zu dünn, das mag sein, aber das sind alle in diesen schweren Zeiten, abgesehen vielleicht von der Priorin und von Schwester Joan. Dennoch, auch wenn Alice mit dem Eimer mit Kot dasteht und einen Tautropfen an der Spitze ihrer geröteten Nase hat, wirkt sie irgendwie entrückt und weltfern. Die Kleidung von Alice weist keinerlei Flecken oder Flicken auf, und die Perlen ihres Rosenkranzes bestehen aus edlem Elfenbein – vielleicht das Geschenk eines geliebten Verwandten. Alice strahlt eine Leichtigkeit aus, ganz so, als schwebe sie über dem Boden.
»Warum bist du hier, Schwester Alice?«, fragt Katherine.
»Das habe ich doch gerade gesagt«, erwidert sie. »Weil ich helfen möchte.«
»Nein, nein, ich meine, warum bist du hier? Im Kloster?«
Ein Lächeln spielt um Alices Mundwinkel.
»Oh«, sagt sie. »Ich bin eine Braut Christi.«
Sie hält Katherine die Hand hin, um ihr den goldenen Ring an ihrem Finger zu zeigen.
»Was ist mit dir? Bist du nicht auch eine Braut Christi?«
Katherine weiß nicht, ob Alice nur Spaß machen will, und denkt über ihre Herkunft nach: Als kleines Kind wurde sie im Almosenhaus zurückgelassen, mit nichts als einem Geldbeutel und ein paar Briefen. Und inzwischen ist ihr die Aufgabe zugefallen, jeden Morgen den Eimer der Priorin zu leeren.
»Ich?«, antwortet sie gedehnt. »Ich bin wie das hier.«
Damit kippt sie den Unrat in das Fass, wobei sie achtgibt, dass die festen Brocken nicht mit hineinfallen. Ohne groß darüber nachzudenken, leert sie die Reste über dem Dunghaufen aus: drei oder vier braune Brocken im Schnee. Die beiden Nonnen treten einen Schritt zurück. Alice fröstelt.
Sie machen kehrt und gehen über das Feld zurück zum Kloster.
»Warum musst du immer den Nachttopf der Priorin leeren?«, fragt Alice.
»So ist es nun mal.« Mehr sagt Katherine nicht dazu.
Alice liegt anscheinend noch eine Frage auf der Zunge, aber sie schweigt. Wahrscheinlich gehen ihr zu viele Fragen auf einmal im Kopf herum, sodass sie sich nicht entscheiden kann, welche sie zuerst stellen soll. Schweigend gehen sie nebeneinander her und hören auf ihre Schritte und das rhythmische Klacken von Alices Rosenkranz. Das Atmen kommt ihnen lauter vor als es in Wirklichkeit ist, und Katherine ist in Gedanken versunken. Daher hört sie den Hufschlag von der Straße erst, als es schon zu spät ist.
Erschrocken bleibt sie stehen. Ihr Herz schlägt schneller.
Reiter. Mehr als einer. Mehr als zwei.
»Rasch«, flüstert sie.
Sie gibt Alice ein Zeichen, dann raffen sie die Röcke und laufen los. Sie hört einen Mann rufen. Großer Gott. Sie haben sie entdeckt. Sie hastet weiter. Die Männer lenken ihre Pferde von der Straße hinunter, nehmen die Abkürzung über den zugefrorenen Fluss und versuchen, Katherine und Alice den Weg abzuschneiden. Noch haben die beiden Frauen das Bettlertor nicht erreicht. Es sind vielleicht nicht mehr als hundert Schritte, aber Katherine und Alice kommen in ihren Pantinen nicht so schnell voran. Die Röcke behindern sie beim Laufen, und der Eimer ist schwer. Katherine traut sich nicht, ihn fallen zu lassen, weil sie sich vor der Schelte der Priorin fürchtet. Dann stürzt Alice und stößt einen Schrei aus. Schon ist Katherine bei ihr und zieht sie wieder hoch. Inzwischen haben die Reiter das Feldstück erreicht und johlen, als sei dies ein spaßiger Zeitvertreib: Sie jagen ihre Pferde durch den Schnee, jeder versucht, die anderen zu überholen.
Katherine wirft einen Blick über die Schulter und eilt weiter, aber da ist der erste Reiter schon fast bei ihnen. Katherine duckt sich, weil sie einen Schlag fürchtet, aber der Reiter prescht an ihnen vorbei. Kurz darauf steht er in den Steigbügeln und zügelt sein Pferd, das sich daraufhin aufbäumt. Der Mann versperrt ihnen den Rückweg zum Kloster.
Das Pferd ist riesig, es hat ein braunes Fell, und es schlägt mit den Hufen aus. An der Mähne und um die Nüstern herum glitzern Eiskristalle. Die Augen des Tiers wirken so groß wie Fäuste. Der Reiter ist jung, aber kräftig. Helle Begeisterung spiegelt sich auf seinem Gesicht, wie bei einem Jäger, der sich freut, die Beute gestellt zu haben. Der junge Mann lacht. Ohne nachzudenken, tritt Katherine einen Schritt zur Seite, holt aus und schleudert den schweren Holzeimer mit aller Kraft auf den Reiter.
Als der Eimer den Mann trifft, dringt ein hässliches Geräusch an Katherines Ohren, als würde eine Falltür zuklappen.
Der Reiter taumelt und stürzt über die Kruppe des Pferdes zu Boden, die Hände gegen das Gesicht gepresst. Alice kreischt, denn das Pferd macht einen Satz nach vorn. Gerade noch rechtzeitig können sich die beiden Frauen in Sicherheit bringen, da sprengt das Tier auch schon an ihnen vorbei.
Der Mann schreit vor Schmerz. Er rollt sich auf den Rücken und zieht die Beine an, nimmt die Hände aber nicht vom Gesicht. Blut rinnt ihm durch die lederbehandschuhten Finger. Katherine sieht überall Blut: im Schnee, auf dem weißen Wappenrock des Mannes.
Inzwischen ist der zweite Reiter bei ihnen. Der Mann sitzt auf einem Grauschimmel und trägt einen langen roten Umhang. In der Rechten hält er ein Schwert.
Mutig stellt Katherine sich schützend vor Alice und sieht dem Reiter in die Augen. Sie verspürt keine Angst mehr.
Der Mann kommt näher und holt mit seinem Schwertarm zum Schlag aus. Katherine weicht nicht von der Stelle. Doch dann geschieht etwas. Ein dunkler Schatten nähert sich. Irgendetwas trifft den Reiter am Kopf, es ist wie ein dumpfer Schlag. Der Mann im Sattel schwankt, er lässt das Schwert fallen, sackt in sich zusammen und fällt vom Pferd. Die Schneedecke knirscht unter seinem Gewicht. Das Pferd macht kehrt und trabt davon.
Wie aus dem Nichts taucht plötzlich noch ein Mann auf. Er kommt zu Fuß. Er trägt ein schwarzes Gewand, an den Füßen hat er Holzpantinen. Es ist einer der Mönche, und er kommt vom Fluss her. Aufgeregt schwenkt er die Arme und ruft den Frauen etwas zu. Der Saum seiner Kutte bauscht sich oberhalb der bloßen Knie.
Der dritte Reiter zügelt sein Pferd und wendet sich dem Mann zu. Auch der vierte Reiter, ein Riese von einem Mann, zögert und hält sein Kaltblut an.
Katherine packt Alice bei der Hand, und gemeinsam laufen sie in Richtung Tor. Der Ordensbruder bleibt stehen, rutscht beinahe aus, dann folgt er den beiden Frauen. In der Zwischenzeit hat der dritte Reiter einen Kriegshammer aus einer Satteltasche geholt und treibt seinem Pferd die Sporen in die Flanken. Der vierte Mann – der Riese – springt von seinem Pferd und verfolgt die drei Flüchtenden zu Fuß. Er trägt keine Schuhe, ist aber so geschwind wie ein Wolf. Dabei schwingt er eine furchtbare Streitaxt und brüllt aus vollem Halse.
Katherine hat das Bettlertor erreicht und zieht Alice hinter die schützenden Mauern. Dann stürmt auch der Ordensbruder durch den Spalt des Tors. Katherine drückt sich von innen gegen die Eichentür und schlägt sie dem Riesen vor der Nase zu. Rasch schiebt sie den schweren Riegel vor. Die Eichenplanken und der Riegel erzittern, als der Riese sich von außen mit der Schulter gegen die Tür wirft. Aber sie hält. Noch.
Katherine tritt einen Schritt zurück. Sie ringt nach Atem. Das Blut rauscht in ihren Ohren. Sie bekreuzigt sich und wirft dann einen verstohlenen Blick zu dem Ordensbruder. Er steht vornübergebeugt, hat die Hände auf die Knie gestützt und versucht, wieder zu Atem zu kommen. Stoßweise weicht die Luft aus seinem Mund, wie bei einem Blasebalg. Dann richtet er sich wieder auf und sieht Katherine an. Ihre Blicke begegnen sich. Er hat blaue Augen und rötliches Haar.
Dann hört Katherine Alices Stimme. Alice hockt auf der rutschigen Erde, auf der hier und da Stroh ausgestreut liegt, zeigt auf die Pantinen des Bruders, wendet sich halb ab und hält sich eine Hand vor die Augen, um den Mann nur ja nicht ansehen zu müssen.
»Er muss weg!«, sagt sie mit Nachdruck.
Alice hat recht. Katherine will sich gar nicht ausmalen, wie die Strafe für sie drei aussehen wird, wenn man ihn hier entdecken würde. Doch eine weitere Stimme unterbricht ihre Gedanken. Jemand ruft von der anderen Seite der Mauer.
»Bruder Mönch?«
Es ist eine kräftige näselnde Stimme eines gebildeten Mannes, der es gewohnt ist, Befehle zu erteilen.
»Bruder Mönch? Schwester Nonne? Ich weiß, dass Ihr mich hören könnt. Ihr habt meinen Jungen schwer verletzt, Schwester Nonne, und mich habt Ihr von meinem Pferd gestoßen, Bruder Mönch. Bei meiner Ehre, das kann ich nicht durchgehen lassen. Kommt auf der Stelle heraus, damit wir es zu Ende bringen können. Dann werde ich weiterreiten, als wäre nichts geschehen. Hört Ihr mich, Schwester Nonne? Bruder Mönch?«
Er steht anscheinend dicht hinter der Mauer, genau auf der anderen Seite der Tür, nicht einmal eine Armspanne entfernt. Zwei, drei Herzschläge lang ist es still, dann ertönt die Stimme aufs Neue.
»Wohlan, Schwester Nonne und Bruder Mönch, da Ihr nicht gewillt seid herauszukommen, werde ich bei Euch eindringen. Und wenn mir das gelungen ist, so seid versichert: Ich werde Euch finden. Zuerst werde ich Euch aufspüren, Bruder Mönch, und dann wird mein Mann Morrant Euch töten. Danach suche ich Euch, Schwester Nonne, Euch und das flennende Mädchen. Wenn Morrant fertig ist mit Euch, werde ich Euch an ebendiese Tür nageln, hinter der Ihr Euch verbergt, und dann werde ich ein Feuer anzünden unter Euch. Ihr werdet den Allmächtigen anflehen, dass er Euch von Euren Qualen erlöse. Hört Ihr mich?«
Hufschlag von jenseits der Tür verrät ihnen, dass die Reiter davongaloppieren. Katherine schaut auf ihre nassen Holzpantinen, deren Spitzen unter dem durchnässten Saum ihres Ordensgewands hervorlugen. Alice wimmert.
»Ich darf nicht hier sein«, murmelt der Mönch. »Ich muss gehen.«
Sie sieht ihn ein letztes Mal an. Er ist ein großer Mann, einen halben Kopf größer als sie, hat breite Schultern und trägt das rötliche Haar kurz. Mittendrin hat er eine kreisrund geschorene Stelle. Abgesehen von den Reitern ist er wahrscheinlich der erste Mann, den sie aus nächster Nähe zu Gesicht bekommen hat. Sie ist versucht, die Hand nach ihm auszustrecken, um sein Gesicht zu berühren.
Er wendet sich ab, eilt über den Hof zu der Mauer, die das Kloster teilt, und klettert auf das Dach des Holzschuppens. Seine Pantinen rutschen auf dem Schnee weg, aber er zieht sich mit beiden Händen hoch und klettert hinüber. Vorher hält er kurz inne und wirft einen Blick zurück, dann ist er nicht mehr zu sehen. Er ist wieder in seiner Welt. Erst jetzt verspürt Katherine den Wunsch, sich bei ihm zu bedanken.
»Wir müssen es der Priorin erzählen«, jammert Alice, die sich die ganze Zeit nicht von der Stelle bewegt hat. »Wir müssen alle Schwestern warnen.«
»Nein!«, sagt Katherine und hilft ihr auf. »Nein, das können wir nicht. Das geht nicht. Wir müssen es für uns behalten, wir dürfen niemandem davon erzählen. Das nimmt kein gutes Ende.«
Sie blickt sich um, blickt hinauf zu den Fenstern und zu den anderen schmalen Öffnungen im Mauerwerk. Ob jemand den Mönch gesehen hat? Nein, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls ist niemand zu sehen.
»Aber was ist mit all diesen Drohungen?«, hält Alice dagegen. »Mit diesen fürchterlichen Sachen, die der Mann gesagt hat?«
»Niemand kann uns etwas anhaben«, erwidert Katherine, »solange wir im Schutz der Klostermauern bleiben. Danken wir Gott für den Ordensbruder, wer auch immer er ist. Und beten wir, dass niemand hier ihn gesehen hat.« Nach einer kurzen Pause fügt sie hinzu: »Wir werden Buße tun, Schwester. Eintausend Mal das Ave Maria und zweitausend Mal das Credo vor dem Schrein der Heiligen Jungfrau. Und wir wollen auf Speise verzichten bis zum Fest des heiligen Gilbert.«
Alice nickt verunsichert. Anscheinend weiß sie nicht, dass das Fest des heiligen Gilbert schon in ein paar Tagen ist.
»Ich bin sicher, dass das dem Herrn gefallen wird«, sagt Alice schließlich, und es scheint, als wolle sie noch etwas hinzufügen, aber in diesem Augenblick läutet die Glocke zur Prim. Die beiden Frauen sehen einander an, dann klopfen sie sich den Schnee vom Gewand. Sie richten den Schleier, schieben die Hände in die weiten Ärmel und begeben sich in den Kreuzgang und in die Sicherheit der Kirche.
Keine der beiden hört, wie über ihnen ein Fensterladen leise zugezogen wird.
3. KAPITEL
»Alarm!«, ruft er. »Alarm!«
Die Dämmerung bricht an, und die Mönche versammeln sich gerade zur Prim im Westflügel des Kreuzgangs. Verschreckt wie eine Herde Kühe, die einen bellenden Hund hört, schauen sie sich um. Nur der Dekan tritt einen Schritt vor.
»Was gibt es, Bruder Thomas?« Er stemmt die Hände in die Seiten, seine Miene verfinstert sich.
»Draußen sind Reiter.« Thomas deutet in die Richtung, aus der er gerade kommt. Er bekommt kaum Luft, so schnell ist er gerannt. »Sie sind bewaffnet. Und sie halten auf das Kloster zu.«
Ein Ruck geht durch den Dekan, als hätte er auf einen Augenblick wie diesen gewartet.
»Bruder John!«, ruft er streng. »Bruder Geoffrey! Sichert das Haupttor! Bruder Barnaby, läute die Glocke, damit die Laienbrüder Bescheid wissen! Und kräftig läuten, hörst du? Bruder Athelstan, die Priorin soll das Tor im Nonnenkloster sichern und alle Fenster verschließen. Die Schwestern sollen sich in der Kapelle einfinden. Bruder Anselm, du bringst Schreibrohr und Tinte und etwas Papier zur Priorin in die Schreibstube. Bruder Wilfred, der Stallbursche soll ein Pferd satteln. Und sag Bruder Robert, dass ich ihn hier brauche.«
Drei Mönche bekommen die Aufgabe, die Bücher aus der Bibliothek in die Schreibstube zu bringen, zwei sollen mit Äxten in die Vorratskammer eilen, bereit, die Weinfässer zu zerschlagen und den Wein zu verschütten, für den Fall, dass die Angreifer die Mauern des Klosters überwinden. Die Glocke im Glockenturm läutet Sturm.
»Wie viele sind es, Bruder?«, fragt der Dekan.
»Vier, glaube ich, aber einer von ihnen ist übel zugerichtet.«
»Hast du ihn verletzt?«
Thomas zögert. Er traut sich nicht, die Begegnung mit den beiden Nonnen zu erwähnen.
»Ja, ich war’s, Bruder. Möge Gott mir vergeben.«
»Guter Mann«, sagt der alte Soldat. »Ich bin sicher, dass der Herr dir vergeben wird.«
Der Prior steht vor der mit Eisen beschlagenen Tür der Schreibstube und runzelt die Stirn. Er trägt nur die Albe; sein weißes Haar, das wie ein Kranz um seinen Kopf liegt, ist unordentlich. Er blinzelt fragend.
»Warum wird so heftig geläutet, Bruder Stephan?«
»Wir werden angegriffen, Vater. Vier bewaffnete Männer haben Bruder Thomas aufgelauert, als er außerhalb des Klosters war.«
Der Blick des Priors fällt auf Thomas.
»Was wollten diese Männer von dir?«
»Der Anführer hat gedroht, das Kloster zu belagern und mich zu töten.«
Der Prior wendet sich wieder an den Dekan.
»Habt Ihr unsere Schwester, die Priorin, schon benachrichtigt? Trefflich. Und sämtliche Tore und Fenster sind verriegelt?«
»Schon geschehen, ehrwürdiger Vater, ich habe allerdings noch nicht in Cornford um Hilfe gebeten.«
Der Prior sieht nachdenklich aus.
»In so einem Fall ist es schwer zu entscheiden, wie wir vorgehen sollen«, sagt er, mehr zu sich selbst als zum Dekan und zu Thomas. »Ich bin mir nicht im Klaren darüber, wo Sir Giles steht, wenn es um seine Verpflichtungen gegenüber unserem Haus geht.«
Bruder Anselm kommt zurück und bringt Schreibrohr und Tinte. Der Prior scheint einen Entschluss gefasst zu haben. »Wie dem auch sei«, sagt er und nimmt die Schreibfeder und das Papier. »Bitten wir in Cornford um Hilfe, und warten wir ab, was geschieht.«
»Bruder Robert kann das Schreiben überbringen.«
Als der Prior nickt, wendet der Dekan sich wieder an Thomas. »Steig hinauf in den Glockenturm, Tom, und schau nach, ob du diese Männer noch sehen kannst.«
Thomas eilt durch die Schreibstube in das Kirchenschiff, wo Bruder Barnaby nach wie vor kräftig am Glockenzug zieht. Noch nie ist Thomas die Leiter hinaufgeklettert. Seine Pantinen wirken klobig auf den Sprossen, und er klammert sich so stark an die Holmen, dass sich immer wieder Rinde löst und auf Barnaby herunterrieselt.
»Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus …«
Ungefähr hundert Sprossen muss er hochsteigen, dann führt die Leiter zu einer Luke, durch die er auf die grob behauenen Holzbohlen gelangt, die von Vogelkot übersät sind. Dicht über Thomas’ Kopf schwingt die Glocke mit ohrenbetäubendem Dröhnen hin und her. Vorsichtig kriecht er zu dem schneebedeckten Fenstersims an der nördlichen Mauer und blickt hinaus.
Nichts.
Jenseits der Klostermauern hat sich ein milchig weißer Nebel über das Marschland gelegt, eine wabernde Schicht, die über allem schwebt, sodass er kaum zu erkennen vermag, wo die Grenze ist zwischen den Feldern und dem Himmel. Nur die dichten Zweige der Weißdornhecken kann er erahnen. Hier und da reißen die Nebelschwaden im auffrischenden Wind auf – sie sehen aus wie ein Strudel aus weißen Wirbeln. Einen Augenblick lang erkennt er undeutliche Umrisse, dann ist wieder alles in Schleier gehüllt.
Thomas blickt aus den anderen Fensteröffnungen des Glockenturms, aber ganz gleich, welche Himmelsrichtung er wählt, der Ausblick ist immer gleich. Keine Spur von den Reitern. Er sieht, wie das Bettlertor rasch geöffnet und wieder geschlossen wird, um die Laienbrüder hereinzulassen. Wegen des warnenden Glockengeläutes haben sie ihre Gehöfte verlassen.
Das Pendeln der Glocke wird immer schwächer, und schließlich ertönen keine Schläge mehr, doch sie hallen noch lange in Thomas’ Ohren nach.
»Bruder Thomas!«
Der Dekan steht im Innenhof des Kreuzgangs. »Ist irgendetwas zu sehen?«
»Nichts, Bruder!«
Thomas hört das Klacken von Hufeisen, als ein Pferd über den gepflasterten Hof geführt wird. Im Sattel sitzt Ordensbruder Robert, ziemlich widerwillig, wie Thomas erkennen kann.
Der Dekan ruft wieder. »Kannst du die Straße sehen? Ist sie frei?«
Thomas wartet mit der Antwort. Die Nebelschleier sind an einer Stelle aufgerissen, wie ein Fenster, durch das er die schneebedeckten Felder sehen kann. Er wartet, bis er auch die Straße an mehreren Stellen überblicken kann, doch der Nebel bleibt unstet, er bläht sich auf und legt sich wie ein Tuch über die Straße und die Böschung des Flusses. Thomas sieht nur die Furchen auf dem Weg, die die Fuhrwerke hinterlassen haben.
»Nichts!«, ruft er nach unten.
Der Dekan gibt das Zeichen, das Tor zu öffnen, woraufhin Bruder Robert sein Pferd antreibt und das Kloster verlässt. Der Dekan segnet den Boten, indem er das Kreuz schlägt, aber im nächsten Augenblick fällt das Tor schon wieder zu und der Riegel wird vorgeschoben. Thomas sieht, wie Robert das Pferd auf der Straße in leichten Trab setzt. Robert hat Kopf und Schultern eingezogen und verschmilzt alsbald mit dem Nebel.
Thomas ist noch nie zuvor im Glockenstuhl gewesen, er hat das Kloster noch nie zuvor von oben gesehen. Jetzt erkennt er, dass die ganze Anlage von einer Mauer in zwei Hälften geteilt wird. Auf diese Weise ist der Kreuzgang der Mönche getrennt vom Kreuzgang der Nonnen. Zu einer Berührung kommt es nur in dem kleinen achteckigen Backsteinhäuschen, das in die Mauer eingelassen ist und in dem sich ein Drehfenster befindet, durch das die beiden Hälften des Klosters miteinander in Verbindung treten können. Die Aufsicht über dieses Fenster hat der älteste Mönch der Ordensgemeinschaft. Durch dieses Fenster, das so beschaffen ist, dass die Ordensbrüder und Ordensschwestern einander nicht sehen können, gelangen Nahrung oder Wäsche von den Schwestern zu den Brüdern und umgekehrt. Auch im Mauerwerk der Kapelle gibt es eine Öffnung, die allerdings kleiner ist und durch die während der Messe die geweihte Hostie gereicht werden kann. Auf diese Weise, könnte man sagen, speisen die beiden Ordensgemeinschaften sich gegenseitig.
Thomas kann Bruder Barnaby sehen, der gerade durch den Kreuzgang schreitet. Barnaby schaut zu ihm herauf und winkt. Eine schon fast ungehörige Geste der Zusammengehörigkeit. Thomas muss lächeln. Barnaby ist beinahe so etwas wie ein Freund für ihn, ein gutmütiger Bursche, der Sohn eines Wollhändlers. Aber Barnaby spricht dem Ale zu und vertraut sich so gut wie jedem an.
Seine Gedanken führen Thomas zu den frühen Morgenstunden zurück. Er hat die Reiter erst gehört, als sie ihren Pferden die Sporen gaben. Sein erster Gedanke war, sich flach auf den Boden zu werfen. Doch dann sah er die beiden Ordensschwestern. Er hätte den Blick abwenden müssen, denn so verlangt es die Regel des heiligen Gilbert. Thomas kann sich im Nachhinein auch nicht erklären, was in jenem Augenblick in ihn gefahren ist.
Warum ist er losgestürmt, zumal es mehrere Reiter waren? Er begreift es nicht. Er muss den Verstand verloren haben. Er ist Buchmaler, Zeichner. Immerzu sitzt er im Skriptorium und beugt sich über den Psalter, er zeichnet die Umrisse vor, trägt Gesso als Grundierung auf, arbeitet mit Tinte und Farben, poliert das hauchdünne Blattgold. Das ist das, was er tut. Das ist das, was er ist.
Gleichwohl hat er gespürt, wie eine unerklärliche Wut ihn erfasste, und so ist er losgestürmt und hat seinen Stab geschleudert. Tief in seinem Innern wusste er, dass er den Reiter treffen würde. Und so war es auch: Der Stab traf den Mann genau am Hinterkopf.
Jetzt entsinnt er sich der üblen Drohungen, die der Reiter jenseits der Eichentür ausgestoßen hat. Irgendetwas an diesen Drohungen lässt ihn nicht los, und es sind nicht die grässlichen Einzelheiten. Was hat es damit auf sich? Thomas versucht, sich an den genauen Wortlaut zu erinnern, doch es will ihm nicht gelingen.
Wie lange er schon im Glockenstuhl ausharrt, auf den Knien genau unter der Glocke, vermag er nicht zu sagen. Die alltäglichen Abläufe im Kloster sind unterbrochen, und die Gebetszeiten können nicht eingehalten werden, solange die Ordensbrüder entlang der Mauer ausharren und die Schwestern sich im Schutz der Kirche verstecken.
Thomas denkt über die beiden Nonnen nach. Er hat nur das Gesicht der einen Schwester erkennen können. Das Gesicht der Nonne, die den Eimer geworfen hat. Sie schien zu allem entschlossen zu sein, ja, so würde er sie beschreiben. Die andere Schwester könnte er nur wegen ihres wunderschön gearbeiteten Rosenkranzes wiedererkennen. Es waren die ersten Frauen, die er seit fünf Osterfesten gesehen hat.
Kurz darauf verspürt er ein Ziehen im Magen, er muss dringend etwas essen. Und erleichtern muss er sich auch. Doch da hört er irgendetwas. Er spitzt die Ohren.
Was mag das sein? Nur der Wind im Glockenstuhl? Nein. Die Laute kommen aus der Ferne, sie erinnern an regelmäßige Trommelschläge. Von Osten wehen sie heran. Im Nebel kann er nach wie vor nichts erkennen. Doch die dumpfen Klänge werden allmählich lauter. Noch vermag Thomas nicht zu sagen, was sich hinter diesen Klängen verbirgt. Jetzt mischen sich andere Geräusche darunter, ein Rascheln, ein Kratzen und ein Mahlen.
Dann sieht er es.
Zuerst hat er den Eindruck, die Straße bekomme festere Umrisse, hebe sich dunkler aus dem Weiß der Felder heraus. Als der Nebel aufreißt, der über das Marschland zieht, erhascht Thomas plötzlich einen Blick auf einen Reiter.
Doch Ross und Reiter wirken wie ein Trugbild, eine flüchtige Erscheinung, denn schon ziehen sich die Nebelschleier wieder zu. Thomas zweifelt schon, ob er wirklich etwas gesehen hat.
Da ist er wieder! Nicht so deutlich wie zuvor, aber trotzdem.
Kurz darauf taucht der Reiter tatsächlich aus dem Nebel auf. Und jetzt ist er so nah, dass Thomas ihn erkennen kann. Er sitzt auf einem grauen Pferd. Sein Umhang ist rot. Hinter ihm folgt ein großer Mann auf einem Kaltblut. Dahinter rumpelt ein Karren über den Weg, beladen mit Stroh, auf beiden Seiten je ein Reiter. Auch hinter dem Fuhrwerk erkennt Thomas Reiter, in Zweierreihen, sodass er schon bald nicht mehr abschätzen kann, wie viele Reiter es insgesamt wohl sind. Das Ende der langen Reihen vermag er nicht zu erkennen, da es im Nebel verborgen bleibt. Womöglich zieht sich die Kolonne schier endlos durch die Marsch.
Alle Männer tragen einen weißen Wappenrock. Einige halten eine lange Pike in den Händen, andere haben sich einen Kriegshammer oder eine Hippe über die Schulter gelegt. Einer der Reiter trägt ein Banner, das – steif gefroren – herabhängt.
Thomas will schlucken, aber sein Mund ist ganz trocken. Er springt auf, packt den Klöppel der Glocke und fängt an, wie wild zu läuten.
Wieder taucht der Dekan im Innenhof auf.
»Sie kommen!«, ruft Thomas. »Viele, zu Pferd!«
»Wie viele ungefähr?«
»Das kann ich nicht sagen. Einige Hundert womöglich.«
Der Dekan ist betroffen. Thomas blickt noch einmal hinüber zur Straße. Hätte er den Reiter mit dem roten Umhang nicht wiedererkannt, könnte er sich noch an die Hoffnung klammern, dass die Soldaten auf dem Weg zu einem Einsatz vorbeiziehen würden. Doch der Reiter mit dem roten Umhang sitzt stolz auf seinem grauen Ross, direkt hinter ihm der Riese. Erst jetzt erkennt Thomas, dass irgendwer auf dem mit Stroh beladenen Karren liegt. Der Mann hält sich das Gesicht und zuckt bei jedem Rumpeln zusammen.
Der Mann im roten Umhang verschwindet aus Thomas’ Blickfeld, als er von der Mauer beim Tor verdeckt wird. Rufe erschallen. Die Laienbrüder, die am Tor ausharren, blicken um sich und warten auf Anweisungen des Dekans. Thomas kann nicht verstehen, was gesprochen wird. Der Dekan wirkt wie erstarrt. Dann bedeutet er den Laienbrüdern, das Tor zu öffnen, und der schwere Querbalken wird entfernt.
Was tun die denn da? Diese Narren.
»Haltet ein!«, ruft Thomas. Niemand beachtet ihn. Man hat ihn vergessen.
Die Torflügel schwingen auf, und der Mann mit dem roten Umhang und der Riese reiten in den Hof hinein. Ehrfürchtig weichen die Laienbrüder zurück. Die beiden Reiter bringen ihre Pferde vor dem Torhaus zum Stehen. Noch sitzen sie im Sattel und schweigen. Dann taucht der Prior auf und geht auf die Reiter zu. Daraufhin steigt der Mann mit dem roten Umhang vom Pferd. Seine Bewegungen wirken steif. Ist er verletzt? Der Reiter spricht mit dem Prior, heftig bewegt er Arme und Hände und deutet auf sein Gesicht. Der Prior hört wie gebannt zu und wendet sich dann dem Dekan zu. Dieser schüttelt den Kopf. Doch dann schaut er herauf zum Glockenstuhl. Derweil schreitet der Riese durch das Tor hinaus und kommt wenige Augenblicke später zurück: Er führt das stämmige Pferd am Zügel, das den Karren zieht.
Der Infirmarius geht zum hinteren Teil des Wagens, klettert auf die Ladefläche und beugt sich über den im Stroh liegenden Verletzten. Er macht sich an dem Verband zu schaffen, woraufhin der Mann auf dem Strohlager heftig zusammenzuckt. Auf Geheiß des Infirmarius läuft einer der Laienbrüder los, um etwas aus der Krankenstube zu holen.
All diese Bewegungen verfolgt Thomas aufmerksam und ohne zu verstehen, was sie bedeuten sollen.
Jetzt folgt der Mann mit dem roten Umhang dem Prior ins Almosenhaus. Thomas sieht, wie die Tür hinter ihnen zufällt. Nur Augenblicke später taucht der Prior wieder auf und spricht mit dem Dekan, der draußen gewartet hat.
Der Dekan ruft herauf: »Bruder Thomas! Komm. Du musst aussagen!«
Thomas kriecht zurück zu der Luke. Er muss sich damit abfinden, dass seine Kutte inzwischen mit Vogelkot verschmiert ist. Von einer unguten Vorahnung erfasst, klettert er die Leiter nach unten. Sein Herz schlägt schneller. Ihm ist ein bisschen schwindelig, sodass er Mühe hat, sich an den Sprossen festzuhalten. Immer wieder rutscht er mit den Pantinen ab.
Im Kreuzgang wartet der Dekan auf ihn.
»Worauf hast du dich nur eingelassen, Bruder?«, fragt er. »Sir Giles Riven ist hier, und das dort drüben auf dem Wagen ist sein Sohn. Sir Giles behauptet, ein Mönch habe ihn heute in der Früh auf offener Straße angegriffen. Das kannst nur du gewesen sein.«
Thomas schüttelt den Kopf. »Gott ist mein Zeuge, ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen.«
Der Dekan schweigt und geht voraus über den Innenhof des Kreuzgangs. Thomas spürt, dass die anderen Ordensbrüder hinter ihnen her sehen. Schon verbreiten sich Gerüchte hinter vorgehaltener Hand. Thomas hat Mühe, einen Fuß vor den anderen zu setzen, so aufgeregt ist er. Sie gehen an dem Riesen vorbei, der sie mit leerem Blick anstiert. Der Dekan klopft an die Tür des Almosenhauses, und sie treten ein.
Sir Giles Riven wärmt sich vor dem angefachten Feuer, in der Hand einen Krug, aus dem Dampf aufsteigt. Auf Thomas, der sonst nur den Anblick seiner Ordensbrüder gewöhnt ist – mit Tonsuren und abgenutzten Kutten von der alltäglichen Arbeit –, wirkt ein Mann wie Sir Giles fremdartig. Sein kurzer wattierter Wappenrock, der die Farbe von Rosenblättern hat, schimmert im Halbdunkel. Seine Beinkleider bestehen aus fein gesponnener Wolle, die blau gefärbt ist. Er trägt Reitstiefel aus Leder und an der Seite ein Schwert.
Sir Giles ist so groß wie der Prior, aber er ist sehr viel stämmiger und kräftiger als dieser. Das Haupthaar reicht ihm bis zu den Ohren. Er hat breite Schultern und kräftige Oberschenkel, die ihn als geübten Reiter ausweisen. Thomas bemerkt, dass er auf den Fußballen leicht vor- und zurückwippt, als wolle er jeden Augenblick einen Schritt nach vorn machen.
Er richtet seinen Blick auf Thomas. Sir Giles’ Haut ist rau und gerötet von der Kälte, und seine Zähne sind zerstört von Zuckerwerk und Trockenfrüchten, die sich nur die Wohlhabenden leisten können. Auf einer Wange hat er einen Bluterguss, ein Auge ist leicht geschwollen. Das andere Auge ist undurchdringlich.
»Dies ist Bruder Thomas, Mylord«, sagt der Prior. Seine Hände suchen Halt an dem Kreuz, das er um den Hals trägt. »Er war heute in der Frühe außerhalb des Klosters.«
»Hm«, macht Sir Giles. »Sieht nicht gerade Furcht einflößend aus, hab ich recht?«
»Oh nein, Mylord, er ist Buchmaler. Seine Fertigkeiten sind ein Geschenk Gottes. Er arbeitet an einem ganz wundervollen Psalter.«
Sir Giles Riven gibt ein grunzendes Geräusch von sich, leert den Krug und stellt ihn auf dem Tisch ab.
»Es würde uns viel Zeit ersparen, wenn wir ihn gleich auf der Stelle töten würden, glaube ich«, sagt er grummelnd.
Der Prior ist entsetzt. »Sollten wir nicht zunächst der Wahrheit auf den Grund gehen?«, fragt er zögerlich.
»Was hätten wir davon?«, entgegnet Sir Giles unwirsch. »Ich weiß, was ich gesehen habe.«
»Nun. Also, Bruder Thomas«, beginnt der Prior, er brabbelt beinahe, »Sir Giles Riven hat erklärt, dass er und seine Männer heute Morgen auf offener Straße in Sichtweite unserer Mauern von einem gemeinen Räuber angegriffen wurden. Weiter sagt er, dass dieser Räuber gekleidet war wie ein Mönch unseres Ordens und dass dieser Räuber und seine Begleiter – über die wir später noch reden müssen – seinen Sohn Edmund schwer verletzt haben.«
Sein Sohn. Sein Junge. Darum geht es also. Deswegen hatte die Drohung so viel Gewicht. Thomas steht schweigend da, wie man es von einem Mönch von St Gilbert erwartet, und der Prior sieht ihn nicht an, während er spricht. Sir Giles reibt sich die Hände über dem Feuer, während die Flammen zum Leben erwachen und um die Scheite züngeln.
»Nun?«, fragt der Prior. »Hast du etwas dazu zu sagen?«
Thomas kann kaum sprechen. »Das ist eine Lüge«, sagt er schließlich.
Ein Lächeln zeichnet sich auf Sir Giles’ Zügen ab, doch es ist nicht freundlich. »Ihr bezichtigt mich, die Unwahrheit zu sagen?«, fragt er.
Thomas fällt keine Antwort ein, die diesen Mann besänftigen könnte und die die Situation beruhigen würde.
»Ja«, sagt er.
»Soso«, sagt Sir Giles. »Aha.«
Der Prior öffnet den Mund, um etwas zu sagen, er weiß aber nicht, was, daher schweigt er mit beklommener Miene. Trotz des auflodernden Feuers scheint der Raum sich zu verdunkeln. Wie selbstverständlich schenkt Sir Giles sich heißen Gewürzwein nach.
»Ich will Euch sagen, was nun geschehen wird«, beginnt er. »Stirbt mein Junge noch heute Abend, wird Morrant – der große Bursche da draußen – Euch morgen bei Tagesanbruch die Augen rausreißen und die Eier abschneiden. Dann werde ich Euch dem Feuer übergeben, und wir werden mit den Füßen anfangen. Und das alles soll im Innenhof Eures Kreuzgangs geschehen, damit alle Mönche es sehen und riechen können.«
»Aber Sir! Er ist Geistlicher«, wendet der Prior ein. Mehr kann er nicht tun. »Er lebt in einem Kloster. Er muss sich vor einem kirchlichen Gericht verantworten.«
Sir Giles tut diesen Einwand mit einer Handbewegung ab.
»Ich habe keine Zeit für Eure kirchliche Gerichtsbarkeit«, sagt er. »Ich bin auf dem Weg nach Coventry, um die Königin zu treffen, und ich verlange, dass diese Angelegenheit bis morgen zur Messe beigelegt ist. Dann werde ich abziehen.«
»Und wenn Euer Sohn überlebt?«, fragt der Dekan voller Hoffnung.
Sir Giles denkt nach.
»Wenn mein Junge überlebt, wird mir das Anlass zur Freude sein. Und um diese Fügung gebührend zu feiern, werde ich Genugtuung verlangen und auf einem Gerichtskampf bestehen. Was sagt Ihr dazu, Bruder Mönch? Damit erweise ich Euch die Ehre, wie ein Mann zu sterben. Und Euch, ehrwürdiger Vater, beweise ich damit, dass Gottes Wille geschieht.«
Der Prior sucht nach Worten und wirft Thomas einen schnellen Blick zu. Schließlich nickt er. »So sei es«, flüstert er.
Wenig später ist wieder die Glocke zu hören, und das langsame, regelmäßige Läuten weist darauf hin, dass alles geregelt ist. Thomas jedoch weiß, dass der Prior ihn – ohne lange zu überlegen – zum Tode verurteilt hat.
»Und natürlich muss ich mein Versprechen gegenüber diesen beiden Schwestern halten, nicht wahr, Bruder Mönch?« Sir Giles setzt wieder dieses unheilvolle Lächeln auf.