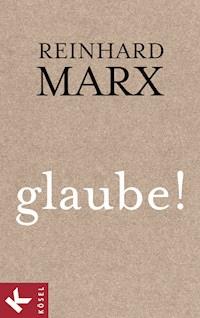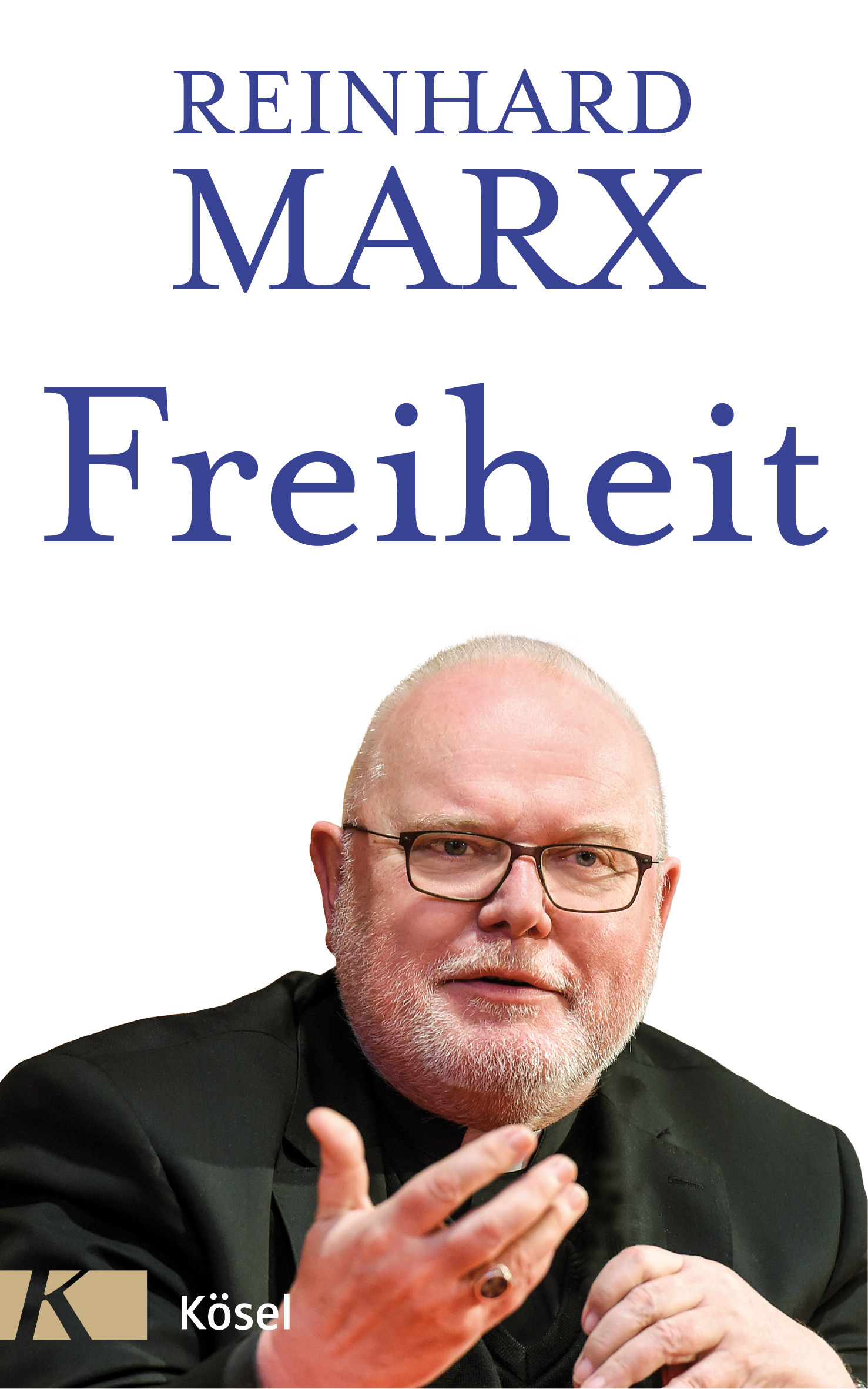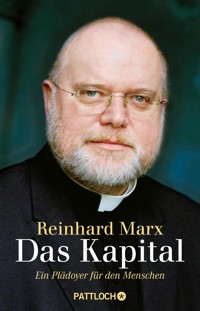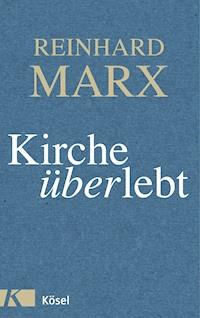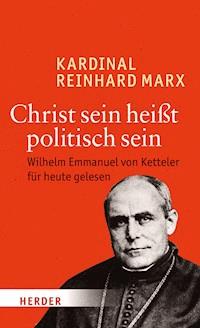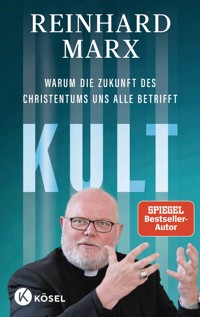
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Christentum hat wesentliche Bedeutung für die Zukunft unserer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft!
Ist das Christentum in unserem Kulturkreis ein Auslaufmodell? Hat es noch Konjunktur angesichts vieler zurecht bestehender kritischer Anfragen an die Kirche? Und falls ja, was macht die Kirche überhaupt relevant für die heutige Zeit?
Reinhard Marx hält dem Pessimismus des Untergangs die provokante Forderung entgegen: Das Christentum ist Kult! Er denkt darüber nach, warum und wie sich das Wesen des Christentums in der kultischen Feier der Glaubensgemeinschaft bewahrheiten und erfahren lässt. Die Feier der Eucharistie öffnet den Blick für die je notwendige Verwandlung der Welt. Eine solche Kult-Feier des Lebens und der Hoffnung muss sich auch auswirken auf Ethik und Soziallehre, auf die Reform der Kirche und ist so ein Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft und zur Stärkung der Demokratie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ist das Christentum in unserem Kulturkreis ein Auslaufmodell? Hat es noch Konjunktur angesichts vieler zurecht bestehender kritischer Anfragen an die Kirche? Und falls ja, was macht die Kirche überhaupt relevant für die heutige Zeit?
Reinhard Marx hält dem Pessimismus des Untergangs die provokante Forderung entgegen: Das Christentum ist Kult! Er denkt darüber nach, warum und wie sich das Wesen des Christentums in der kultischen Feier der Glaubensgemeinschaft bewahrheiten und erfahren lässt. Die Feier der Eucharistie öffnet den Blick für die je notwendige Verwandlung der Welt. Eine solche Kult-Feier des Lebens und der Hoffnung muss sich auch auswirken auf Ethik und Soziallehre, auf die Reform der Kirche, und ist so ein Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft und zur Stärkung der Demokratie. Die Zukunft des Christentums hat wesentliche Bedeutung für unsere demokratisch-freiheitliche Gesellschaft.
REINHARD MARX
KULT
WARUM DIE ZUKUNFT DES CHRISTENTUMS UNS ALLE BETRIFFT
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit konnte eine gendergerechte Schreibweise nicht durchgängig eingehalten werden. Bei der Verwendung entsprechender geschlechtsspezifischer Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung jedoch ausdrücklich alle Geschlechter angesprochen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlag: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Autorenfoto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoemann/SVENSIMON
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-32473-5V002
www.koesel.de
Für alle, mit denen ich zusammen Eucharistie feiern darf
»Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet,
bei dem werde ich eintreten
und Mahl mit ihm halten und er mit mir.«
(Offb 3,20)
Inhalt
1 Einblicke
2 Verschwindet Religion?
3 Also: Wie steht es um die Kirche heute?
4 Was ist das: Christentum?
5 Christentum ist Kult!
6 Das Unsagbare feiern
7 Von der Notwendigkeit des Nutzlosen
8 »The rest is silence«
9 Kult und Kunst
10 Kirche als Sakrament – ein klares Profil
11 Kirche sein in neuer Qualität
12 Synodale Kirche – ein Weg in die Zukunft
13 Frei werden
14 Ortsbestimmung für die Kirche
15 Ausblicke
16 Zum Schluss
Literaturhinweise
Abdrucknachweise
Abkürzungsverzeichnis
Anmerkungen
1
Einblicke
Mit dem Jahr 1989 begann eine neue Epoche der Weltgeschichte und so wie ich dachten viele: Eine bessere Zeit bricht an mit positiven Entwicklungen für Deutschland und die gesamte Welt. Heute, gut 35 Jahre später, macht sich Ernüchterung breit: die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels und Artensterbens, die Folgen der Covid-Pandemie, die bis heute nachwirkende weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, Kriege, Gewalt, Terror, globale Machtkämpfe, stetig zunehmende Migration weltweit. Man fragt sich: Wo sind die Kräfte des Zusammenhalts? Was ist mit Solidarität? Erreichen wir noch einmal Frieden? Und aus meiner speziellen Profession und Verantwortung als Theologe und Bischof frage ich mich natürlich auch: Wie steht es bei all dem um die Bedeutung und den Beitrag der Religion?
Seit Jahren gibt es Diskussionen, wie lange die beiden (noch) großen Kirchen in Deutschland ihre Bedeutung behalten werden. Von den messbaren Zahlen her scheint sich ein unaufhaltsamer Niedergang abzuzeichnen, dem viele Akteure innerhalb und außerhalb der Kirchen relativ ratlos zusehen. Zwar gibt es vielfältige Überlegungen, wie dieser Prozess aufzuhalten sei, Unternehmensberatungen begleiten die Verantwortlichen in der Kirche, Philosophie und Theologie entwerfen Modelle und innerkirchlich gehen die Debatten über Erneuerung, Modernisierung und Evangelisierung weiter. Somit stelle ich mich also in die Reihe der vielen, die über die Zukunft der Kirchen, ja der Religion insgesamt nachdenken. Dabei ist mir bewusst, dass es hier nicht nur um die Zukunft der Religionen oder speziell der christlichen Kirchen geht, sondern um die Zukunft der Gesellschaft. Denn Freiheit und Demokratie sind keine Selbstläufer. Wer will voraussagen, wie sich die offene Gesellschaft, die Demokratie in den nächsten Generationen entwickeln, sich stabilisieren oder unter Spannungen gefährdet werden? Spielt dabei die Präsenz von Religion eine Rolle?
Der Anspruch dieses Essays ist nicht der einer wissenschaftlichen Abhandlung, sondern einer nachdenklichen Intervention. Sie schließt an meinen Denk- und Glaubensweg und an viele vorhergehende Äußerungen zu gesellschaftlichen und theologischen Fragen an. Im Rückblick sehe ich zugleich Entwicklung und Kontinuität. Schon in meiner Dissertation waren Kirche und Gesellschaft sowie die Ortsbestimmung der Kirche in der Moderne die Leitmotive, die mich seitdem immer wieder beschäftigt haben. Durch meine Aufgabenfelder wurde die politische und sozialethische Thematik stärker, die auch hier bedeutsam ist. Für mein Dafürhalten bilden meine Bücher, die bei Kösel erschienen sind, einen Zusammenhang: Glaube, Kirche, Freiheit und Kult. Denn: Wie kann der christliche Glaube heute wirksam werden? Welche Gestalt soll die Kirche in einer offenen Gesellschaft haben, und wie sollte eine vom Christentum, von der Katholischen Soziallehre geprägte Gesellschaft aussehen? Ich hoffe, dass ich diese Überlegungen nun weiterführen kann. Dieses Buch soll auch ein gewisser Weckruf sein, denn es ist zumindest für mich klar, dass sich mit dem Verschwinden der Religionen, mit der nachlassenden Kraft insbesondere des Christentums ein Einschnitt vollzieht, der tiefgreifende Folgen hat. Daran zweifeln auch nicht die Kritiker, ja »Verächter« der Religion. Denn auch für sie ist nicht klar, ob dieses Verschwinden zu einer größeren Aufklärung, einem Zeitalter der Vernunft führt oder »alte Geister« heraufziehen lässt, die regressiv einer »Prämoderne« zuneigen. Auch im Politischen deutet sich einiges an neuer Regression an. Und ich bin sehr besorgt über die europaweiten und auch weltweiten Entwicklungen hin zu Rechtspopulismus, Nationalismus und rückwärtsgewandter Abgrenzung. Insbesondere weil, wie es Sonja Angelika Strube thematisiert, »antimoderne Theologien Andockstellen für neurechte Ideologien« sein können.1
Das fordert die Gläubigen und die Kirchenverantwortlichen heraus, sich dem zu stellen und eindeutig Position zu ergreifen, denn es ist ein »Bekenntnisfall für das Christentum« (Strube), die Menschenwürde zu verteidigen. Darum war die Erklärung der deutschen Bischöfe vom Februar 2024, dass völkischer Nationalismus und Christentum unvereinbar sind, ein wichtiger Beitrag, dem sich viele Menschen anschließen konnten.2
Die Zukunft der Religionen
Mir ist bewusst, dass der Titel dieses Buches provozieren kann. Es geht mir nicht um einen Eyecatcher, sondern um eine programmatische Aussage. Denn was immer wir uns vorstellen über die Zukunft der Religionen, wie wir ihren Rückgang oder ihr Verschwinden deuten, es geht am Anfang um eine grundsätzliche Klärung, was denn Kern der Religionen und im Besonderen – aus meiner religiösen Beheimatung heraus – Kern des Christentums ist. Dabei betreibe ich keine vergleichende Religionswissenschaft, sondern will vertiefen, was ich meine, wenn ich vom Christentum rede. Dass ich in besonderer Weise den Blick auf die katholische Kirche werfe, für die ich als Bischof Mitverantwortung trage, wird nicht überraschen. Doch ich hoffe, dass sich weitere ökumenische Perspektiven erkennen lassen und ebenso interreligiöse Bezüge.
Eine der für mich sehr bedeutenden Ikonen des 20. Jahrhunderts ist das Bild vom Treffen der Religionen in Assisi. Johannes Paul II. hat 1986 zum ersten Mal alle Religionen der Welt zu einem gemeinsamen Friedensgebet nach Assisi eingeladen. Für uns als junge Priester war das ein Hoffnungszeichen: Alle Religionen sind im Kern auf das Gute hin orientiert und deshalb eine Ressource des Friedens und der Verständigung. Auch wurde durch das Treffen von Assisi der Dialog zwischen den Religionen merklich vorangebracht. Hans Küng beförderte ab Mitte der 1980er Jahre mit dem »Projekt Weltethos« den Gedanken, dass ein Weltfrieden den Frieden zwischen den Religionen braucht und aus dem Dialog der Religionen ein gemeinsames Weltethos entstehen kann: »Kein Friede unter den Nationen ohne einen Frieden unter den Religionen, kurz: kein Weltfriede ohne Religionsfriede!«3 All diese Bewegungen waren vom Optimismus geleitet, der die Entwicklung hin zu einer immer größeren Verständigung auch der Religionen unumkehrbar erscheinen ließ.
Fast 40 Jahre später erleben wir doch etwas ganz anderes: In allen Religionen hat die Tendenz zu einer stärker fundamentalistischen Grundorientierung zugenommen, das normative Projekt der Moderne, die Vorstellung von einer immer intensiveren Aufklärung und stärker säkular geprägten Demokratisierung ist weltweit zumindest ins Stocken geraten. Die revolutionäre Erfahrung von 1989 und die Hoffnung, dass Demokratie, Menschenrechte, Freiheit und Gerechtigkeit sich endgültig als realistische Optionen für die Zukunft durchsetzen würden, haben sich als brüchig erwiesen, jedenfalls aus heutiger Perspektive.
In den 1990er Jahren wurden besonders zwei Beiträge sehr diskutiert, die den Blick in die Zukunft auf unterschiedliche Weise darstellen: Francis Fukuyamas »Das Ende der Geschichte« und Samuel Huntingtons »Kampf der Kulturen«4. Auch davon ausgehend hat mich die Zukunftsfrage beschäftigt und ich war hoffnungsvoll und überzeugt, dass sich die Dynamik der Freiheit nicht mehr aufhalten ließe. Nicht nur meine Hoffnung war: Am Ende werde sich ein politisches System der verantwortlichen Freiheit durchsetzen, basierend auf der Achtung der Menschenrechte und geteilter Werte, und gesichert durch gewisse Strukturen einer globalen Weltinnenpolitik. Doch stattdessen sind Rechtspopulismus, Nationalismus, politische Spannungen zwischen Großmächten und vor allem neue Kriege und eine militärische Kampfrhetorik wieder erstarkt.
Den Diskurs prägen jetzt Themen wie Identität, Sicherheit und Macht. Diese Fragen treiben sehr viele Menschen sorgenvoll um und beschäftigen Wissenschaft und Politik. Wie es dazu kommen konnte und was das bedeutet, kann ich allein aus meiner Perspektive natürlich nicht umfassend behandeln; ich will aber danach fragen, was das für die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung von Religion und vor allem für ihre Präsenz bedeutet. Erkennbar ist jedenfalls der Versuch, Religion politisch zu instrumentalisieren – auch kulturpolitisch im Sinne der Stärkung einer nationalen Identität –, und die Religionen lassen sich oft auf diese Instrumentalisierung ein und unterwerfen sich in gewisser Weise nationalen und politischen Interessen. Das wiederum wirft die Frage nach den Religionen selbst auf, danach, wie sie sich verstehen, was ihr jeweiliger Kern ist, welche Ausrichtung sie haben. Entgegen einem allgemeinen Religionsbegriff, der vielleicht auf Cicero zurückgeht, meine ich, dass stärker auch die empirisch fassbare Realität der einzelnen Religionen beachtet werden muss, ebenso wie ihr jeweiliges Selbstverständnis. Die Religionen sind auch zu befragen: Ist ihr Kern vereinbar mit den Ideen von Freiheit, Toleranz, Anerkennung auch des jeweils anderen?
Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Religionsbegriff eher weit gefasst ist, und die einzelnen Religionen sich hinsichtlich ihrer Gottesbilder und ihrer Konzeptionen von Mensch und Gesellschaft unterscheiden. Ein neues Gespräch, ein erneuerter Dialog setzt voraus, dass die Religionsgemeinschaften und auch die Kirchen sagen, wie sie sich selbst verstehen. Davon ausgehend lässt sich dann im Dialog das Gemeinsame und das Trennende klären. Ökumene und interreligiöse Gespräche führen nicht weiter, wenn man nur den kleinsten gemeinsamen Nenner anzielt und keine vertiefende Verständigung sucht. Der kleinste gemeinsame Nenner birgt die Gefahr von Unklarheit, Einförmigkeit, Nivellierung, woraus wohl kaum eine gesellschaftlich relevante und wirksame Kraft entstehen kann. Unschärfe und Allgemeinplätze lassen kein Profil erkennen, das markante und weitergehende Impulse und Debatten auslösen kann.
Das Wesen des Christentums
Für mich stellt es sich so dar: Das Wesen des Christentums ist das Christusereignis, das sichtbar wird in der kultischen Feier von Tod und Auferstehung Jesu von Nazareth. Christentum und Kult gehören aufs Engste zusammen. Die Frage nach der Bedeutung des Kultes für die Zukunft des Christentums beschäftigt mich seit vielen Jahren. Wir sehen, dass vieles, was ursprünglich die Kirche mit initiiert hat, mittlerweile auch vom Staat, vom Gemeinwesen übernommen und damit als gesamt-gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird. Das gilt etwa für Bildung, Gesundheit, sozialstaatliche Absicherung in Situationen von Armut, Alter, Pflege und Arbeitslosigkeit, und erstreckt sich auch in den Bereich von Kunst und Kultur, die sich aus dem Bereich des Religiösen emanzipiert haben. Das heißt nicht, dass diese vielfältigen Bereiche nicht auch weiterhin mit einer kirchlichen Profilierung bedeutsam sind für das Handeln der Kirche. Im Zentrum steht aber doch das, was gerade in der katholischen und auch in der orthodoxen Tradition als Sakramentalität der Kirche bezeichnet wird. Es geht letztlich darum, ob Gott wirklich existiert und ob es irgendeine von Menschen denkerisch erschließbare und real erfahrbare Möglichkeit gibt, Gott zu begegnen. Diese Annahme, die im Glauben getroffen wird, führt zum Kern des Christentums, der sich in der gottesdienstlichen Feier ereignet.
Der Begriff »Kult« nimmt Bezug auf die ganze Religionsgeschichte, die Feier des Opfers, die Bemühungen des Menschen, die Götter zu erreichen, zu beeinflussen und von der Erde in den Himmel, die Welt der Götter, vorzustoßen. Der christliche Kult nimmt das auf, integriert vieles, aber es verändert sich auch etwas Grundlegendes: Denn nicht der Mensch kann durch seine Anstrengungen die Begegnung mit Gott ermöglichen, sondern nur Gott selbst kann sich dem Menschen vorstellen, sich menschlichem Denken erschließen und sich auf menschliche Weise erfahrbar machen. Alles andere ergibt sich von da her, auch die Ethik, die Organisation der Religion, ihr Beitrag zum Gemeinwesen usw.
Ohne die »göttliche Initiative« gäbe es keine Begegnung von Gott und Mensch. Und genau das findet sich im Kern der christlichen Kultfeier: Wir feiern in der Liturgie, dass Gott auf den Menschen zugeht und sich erfahrbar macht. Diesen Kult nennt die Kirche die Feier des Pascha-Mysteriums: die Feier von Leben, Sterben und Auferstehen Jesu von Nazareth. Winfried Haunerland formuliert es so: »Wenn Liturgie als Feier des Paschamysteriums bezeichnet wird, dann wird die Liturgie insgesamt (…) als Vergegenwärtigung des Erlösungsgeschehens auf den Punkt gebracht. Gleichzeitig aber verweist der Begriff auch auf die christusförmige Existenz der Christen und greift damit weit über das Christusereignis in der Vergangenheit hinaus.«5 Anders ausgedrückt: In der Liturgie und den kultischen Feiern öffnet sich der Himmel, Gott zeigt sich als Vater aller Menschen und darin erschließt sich ein neues Leben, eine neue Schöpfung, die zur Verwandlung der Welt führt.
Ich bin überzeugt, dass der Kult wesentliches Herzelement des Christentums ist. Ohne die Feier der Eucharistie, in der eine neue Realität bezeugt und erfahren wird, kann die Kirche nicht bestehen. Eucharistie ist als sakramentale Feier Opfer und Mahl zugleich, und sie ist Sendung!
Das ist gerade nicht vereinbar mit Kirchenbildern von Weltflucht oder spirituellem Eskapismus. Deshalb will ich deutlich machen, dass ein christlicher Kult ohne politische Ausrichtung ins Leere läuft, denn der Kult will eine neue Welt erstehen lassen und Kräfte freisetzen zur Verwandlung all dessen, was in unserer Welt noch nicht gut und heil ist. Das ist das Programm Jesu von Nazareth. Bei seiner Antrittsrede in seiner Heimatstadt Nazareth geht Jesus als gläubiger Jude am Sabbat in die Synagoge und liest dort aus der Buchrolle des Jesaja: »Der Geist des Herrn (…) hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.« (Lk 4,18 f.) Viele kennen das noch deutlicher aus der Bergpredigt (vgl. Mt 5 – 7). Das ist kein (partei-)politisches Programm im engen Sinne, aber es ist ein Programm der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Hoffnung.
Deswegen ist eines meiner Hauptanliegen herauszustellen, dass die Eucharistie als »Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens«, wie es das Zweite Vatikanische Konzil in der Kirchenkonstitution »Lumen gentium« (LG 11) formuliert, Veränderung, Verwandlung, Erneuerung des Lebens und der Welt will und somit in diesem Sinne eine politische Sendung hat. Es geht auch, aber bei Weitem nicht nur, um »schöne« Liturgien. Es geht vor allem um den geweiteten Blick auf einen »neuen Himmel und eine neue Erde« (Offb 21,1).
Darum ist für mich auch die Katholische Soziallehre nichts anderes als auf die konkrete Situation angewandtes Evangelium. Denn – und dem können vermutlich doch sehr viele Menschen zustimmen – das Paradies auf Erden schaffen wir Menschen nicht, aber wir können versuchen, unsere Welt besser zu gestalten. Als Christen und Christinnen tun wir dies in der Perspektive des Evangeliums.
Umso beunruhigender ist es, dass gerade Traditionalisten und eine neue konservative katholische Rechte, einschließlich eines katholischen Rechtspopulismus, den Kult und christliche Positionen vereinnahmen als Instrumente für eine »konservative Revolution«. Kirche und Kult werden in dieser Logik zu »Bollwerken« gegen die moderne Welt eingeschworen, die vielleicht nicht immer und in allem zum Besseren geführt hat. Grundsätzlich verstehen wir selbstverständlich die moderne Welt als »Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit«6, wie es Hegel (1770 – 1831) in seinen »Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte« formuliert. Das Christentum ist kein Bollwerk gegen die Welt, keine zeitlose mit alten Riten ummauerte Festung gegen etwas, sondern dieser Kult ist Kraftquelle und Ort der Erneuerung der Welt im Geiste Jesu. Auch deswegen wähle ich bewusst den Begriff Kult und trete für eine Erneuerung und Vertiefung dieses kultischen Zentrums kirchlichen Handelns ein; gerade auch, weil seitens der Moderne und der Aufklärung eher »kultkritisch« argumentiert und das Christentum auf Ethik reduziert wurde und wird.
Ich lade dazu ein, diesen Grundgedanken in verschiedenen Perspektiven zu entfalten und kritisch zu prüfen, und möchte Anregungen geben zum persönlichen Nachdenken und dazu ermutigen, meiner These zu widersprechen. Die Zukunft des Christentums ist für alle, auch für Anders-Gläubige und Nicht-Gläubige, von außerordentlicher Bedeutung und deshalb braucht es eine vielfältige Debatte darüber.
2
Verschwindet Religion?
Die kleine Stadt meiner Kindheit in den 1950er Jahren: geprägt von Religion! Jedenfalls kam es mir so vor. Man konnte der Religion in Gestalt der katholischen Kirche gar nicht ausweichen. Geseke war geprägt von drei Pfarreien, der alten Stadtpfarrei, der Stiftspfarrei und der Pfarrei St. Marien, die ein Neubaugebiet mit Arbeiterschaft und vielen Flüchtlingen umfasste. Gleichrangige Persönlichkeiten neben Bürgermeister und Stadtdirektor waren der Stadt- und der Stiftspfarrer. Kaum jemand konnte sich diesem katholischen Milieu entziehen. Ich besuchte die staatliche Katholische Knabenschule in Geseke. Erst auf dem Gymnasium, das sich zu meiner Schulzeit im Aufbau befand, war ich dann gemeinsam mit Mädchen und mit evangelischen Mitschülern und Mitschülerinnen im Unterricht. Der Besuch des Sonntagsgottesdienstes war für die meisten in Geseke damals wohl selbstverständlich. Zur Identität der Stadt gehörten der Katholizismus und der praktizierte Glaube. Obwohl mein Vater im Hinblick auf Predigten und kirchliche Praxis sehr kritisch war, habe ich für mich das katholische Leben, erst recht als Kind, nicht hinterfragt: Das war so und es sollte so bleiben. Aber es blieb eben nicht so. Seit Mitte der 1960er Jahre kam der Umbruch, wie in allen Teilen Deutschlands und Westeuropas, und die kritischen Auseinandersetzungen auch mit der Kirche begannen; das ging bis in die Schulklassen hinein. Innerhalb von einer Generation brach der Besuch des Sonntagsgottesdienstes um ein Drittel bis zur Hälfte ein. Diese Entwicklung stellte sich vor allem bei den Jüngeren, bei den Männern und bei gebildeten Teilen der Bevölkerung ein, natürlich auch bei uns in Geseke und anderswo. Diesen Befund ergeben auch Studien des Instituts für Demoskopie Allensbach und entsprechende Umfragen. Ewald Frie beschreibt in seinem wunderbaren Buch »Ein Hof und elf Geschwister« eindringlich, wie sich Glaube und Alltag im Lauf der Jahre beständig wandeln.7
Ein zentraler Begriff dieses Prozesses ist Säkularisierung. Dazu kam eine durch die Emanzipationsbewegungen der 1960er und 1970er Jahre und bis heute forcierte Individualisierung, sodass die Einzelnen mit ihren Vorstellungen von Leben und Werten stärker zum Zug kamen und auch freier ihre individuelle Lebensgestaltung verfolgen konnten, ohne soziale Sanktionen zu befürchten. Diese Entwicklung wurde von vielen als Niedergang empfunden. Und dieses negative Narrativ hält bis heute an. Die Kirche wird dabei als Verliererin, als vor-modern, rückständig und zunehmend als »privates Bedürfnis« ins Abseits gerückt. Damals stellte man sich noch nicht unmittelbar die Frage, in welch größerem Zusammenhang diese Entwicklung steht oder ob sie »nur« einmündet in einen erneuten Kampf der Kirche gegen den Fortschritt der Gesellschaft.
Aber: Konnte und kann diese Entwicklung nicht vielmehr eine Herausforderung sein zur wirklichen Erneuerung auch des Christentums? In Anerkennung der Tatsache, dass eine geschlossene Welt, ein soziologisch homogenes religiöses Milieu in einer modernen und vielfältigen Gesellschaft gar nicht möglich und vielleicht gar nicht wünschenswert ist?
Diese Fragestellung durchzieht eigentlich meine ganze persönliche Biografie und die sieben Jahrzehnte meiner Lebensspanne und wird auch nach mir nicht beendet sein. Ich nehme wahr, dass die Einsicht in der Kirche und in der Gesellschaft im Lauf der Zeit zunimmt, dass es keinen Rückschritt geben kann und darf in eine »geschlossene Welt«, weil eine solche Weltvorstellung mit der Idee der Freiheit letztlich unvereinbar ist.
Handelt es sich denn um ein Verschwinden der Religion oder um eine Transformation und Weiterentwicklung? Dieser in den Sozialwissenschaften diskutierten Frage nachzugehen, ist auch ein Anliegen dieses Buches. Insofern geht es im Ansatz auch um einen selbstkritischen (Rück-)Blick auf mein Leben und mein Wirken als Priester und Bischof in all den Jahrzenten. Habe ich doch nostalgisch festgehalten, an dem, was vergangen ist? Will ich bewahren, was war? Wie baue ich an dem, was kommt und sich erst in Zukunft entfalten wird? Manche Auffassungen, die ich als Seminarist und junger Priester noch für eindeutig und klar hielt, sehe ich nach Jahrzehnten heute anders.
Gewalt und sexueller Missbrauch in der Kirche
Das gilt fraglos und in besonderer Weise für die bittere Katastrophe von Gewalt und sexuellem Missbrauch durch Amtsträger der Kirche. Das Leid von Betroffenen erschüttert mich zutiefst und hat meinen Blick auf die Kirche verändert. Die Begegnungen und Gespräche mit ihnen, ihre Lebenswege und Schicksale verdeutlichen mir immer wieder neu, wie wichtig und unerlässlich es ist, dass wir alle Kraft und Anstrengung aufbringen, um uns den Ursachen und Folgen von Missbrauch entschieden zu stellen und diese zu bearbeiten. Alle Untersuchungen und Gutachten der letzten Jahre, nicht nur in Deutschland und anderen Ländern westlicher Prägung, zeigen schwere individuelle Schuld von Tätern, persönliches Versagen von Amtsträgern, administrative und organisatorische Fehler, und darüber hinaus auch ein institutionelles und systemisches Versagen der Kirche. Das stellt eine bleibende Anfrage an die gesamte Kirche und an die Theologie, auch wenn manche das immer noch nicht anerkennen wollen. Viele Fragestellungen, die in der Aufarbeitung des Missbrauchs gründen, hat der Synodale Weg der Kirche in Deutschland vorangebracht und wichtige Impulse auch für die Weltkirche gesetzt. Die Diskussionen der letzten Jahre haben mein Kirchenbild und meine Sicht auf das Amt in der Kirche, auf Kleriker und Laien, auf Machtstrukturen und klerikalistische Fehlentwicklungen und auch auf die Frage nach einer zeitgemäßen und menschendienlichen Verkündigung des Evangeliums verändert und geschärft.