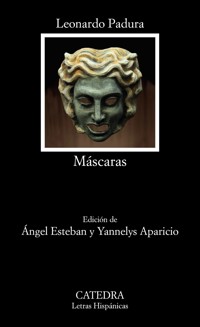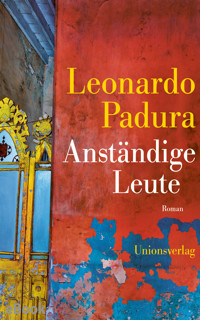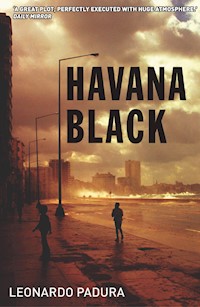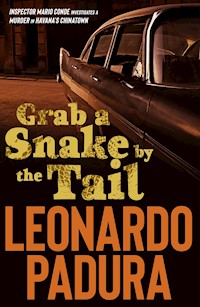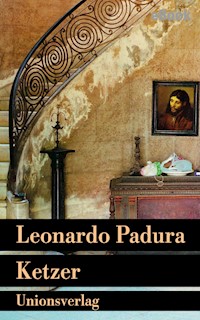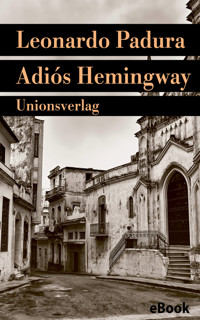9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Bosque de La Habana wird am 6. August, am Tag der Verklärung Jesu, die Leiche eines Transvestiten gefunden. Als sich herausstellt, dass es sich bei dem Toten um Alexis Arayán, den Sohn eines Diplomaten, handelt, will sich bei der Polizei keiner die Finger an dem Fall verbrennen. Nur Mario Conde, für sechs Monate zum Erkennungsdienst strafversetzt, ist froh, nicht mehr länger Karteikarten ausfüllen zu müssen, und springt ohne zu zögern ein. Seine Ermittlungen führen ihn zu Marqués, einem exzentrischen und legendären Theaterregisseur, der als Homosexueller geächtet in einem zerfallenden Haus lebt. Kultiviert, intelligent und mit feiner Ironie begabt, führt dieser Conde in eine verborgene Welt ein und treibt gleichzeitig ein listiges Verwirrspiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
In Havanna wird die Leiche eines Transvestiten gefunden. Als sich herausstellt, dass es sich bei dem Toten um den Sohn eines Diplomaten handelt, will sich bei der Polizei keiner die Finger an dem Fall verbrennen. Mario Conde springt ein – und gerät in ein listiges Verwirrspiel, das ihn in eine verborgene Welt führt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Labyrinth der Masken
Kriminalroman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
Havanna-Quartett »Sommer«
E-Book-Ausgabe
Mit 3 Bonus-Dokumenten im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 7 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel Máscaras bei Tusquets Editores, Barcelona.
Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Pro Helvetia.
Originaltitel: Máscaras (1997)
© by Leonardo Padura Fuentes 1997
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Robert Polidori
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30488-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 11:21h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
LABYRINTH DER MASKEN
Vorbemerkung1 – Die Hitze ist eine schreckliche Plage, die alles …2 – Das Schlimmste von allem war das Gefühl der …3 – Achtundzwanzig Jahre«, rechnete El Conde4 – Da war das Gesicht. Er konnte es fast …5 – Kein Verbrechen zahlt sich aus. Das war die …Mehr über dieses Buch
Leonardo Padura: Wie eine Romanfigur entsteht
Thomas Wörtche: Die Revolution und ihre Außenseiter
Noemí Madero: Kriminalroman, Sozialroman: Das Havanna-Quartett
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Karibik
Zum Thema Lateinamerika
Und wieder einmal so, wie es sein muss: Für Dich, Lucía
Vorbemerkung
In diesem Roman habe ich mir die dichterische Freiheit genommen, mehr oder weniger ausführlich aus Texten von Virgilio Piñera, Severo Sarduy, Dashiell Hammett, Abilio Estévez, Antonin Artaud, Eliseo Diego, Dalia Acosta und Leonardo Padura sowie aus verschiedenen halbamtlichen Dokumenten und aus Passagen der Evangelien zu zitieren. Einige der Zitate habe ich verändert, andere sogar verbessert, und fast immer habe ich die sonst üblichen Anführungszeichen weggelassen.
Folgenden Freunden möchte ich dafür danken, dass sie ihre Zeit und ihr Talent der Lektüre und Korrektur meines Manuskriptes gewidmet haben: Lourdes Gómez, Ambrosio Fornet, Alex Fleites, Norberto Codina, Arturo Arango, Rodolfo Pérez Valero, Justo Vasco, Gisela González, Elena Núñez und natürlich Lucía López Coll. Schließlich weise ich wie immer darauf hin, dass Personen und Ereignisse in diesem Buch meiner Fantasie entsprungen sind, auch wenn sie der Realität ziemlich nahe kommen sollten. Mario Conde ist kein Polizist, sondern eine Metapher, und sein Leben spielt sich im virtuellen Raum der Literatur ab.
Leonardo Padura
Sommer 1989
PÄDAGOGE: Nein, es gibt keinen Ausweg.
OREST: Bleibt nur der Sophismus.
PÄDAGOGE: Das ist richtig. In einer so dünkelhaften Stadt wie dieser, mit Ruhmestaten, die niemals vollbracht, mit Denkmälern, die niemals errichtet, mit Tugenden, die von niemandem je besessen wurden, in solch einer Stadt ist der Sophismus die ideale Waffe. Wenn eine jener weisen Frauen dir sagt, sie sei eine fruchtbare Schöpferin von Tragödien, so wage nicht, ihr zu widersprechen; behauptet ein Mann, er sei ein hervorragender Kritiker, so bestätige ihn in seiner Lüge. Wir befinden uns, vergiss das nicht, in einer Stadt, in der alle Welt betrogen sein will.
Virgilio Piñera, »Electra Garrigó«, III. Akt
Zuallererst ist es wichtig festzustellen, dass das Theater, genau wie die Pest, ein Fieberwahn und ansteckend ist.
Antonin Artaud, »Das Theater und sein Double«
Wir alle benutzen Masken.
Batman
1
Die Hitze ist eine schreckliche Plage, die alles und alle heimsucht. Die Hitze senkt sich wie ein weiter Mantel aus roter Seide herab, geschmeidig und zäh umhüllt sie Körper, Bäume und Dinge, um ihnen das böse Gift der Verzweiflung und des langsamen, sicheren Todes einzuflößen. Die Hitze ist ein Urteil, gegen das weder Berufung eingelegt noch mildernde Umstände geltend gemacht werden können. Sie scheint es darauf abgesehen zu haben, das gesamte Universum zu zerstören, auch wenn nur die gottlose Stadt oder das verfluchte Viertel in ihren tödlichen Strudel gerissen werden sollen. Die Hitze ist eine Qual für die räudigen Straßenköter, die in der Wüste herumirren auf der Suche nach einer Wasserpfütze; für die Greise, die sich auf ihren müden Beinen und noch müderen Krücken durch die Hundstage schleppen in ihrem täglichen Kampf ums nackte Weiterleben; für die einst so majestätischen, nun aber von der Geißel ansteigender Temperaturen gebeugten Bäume; für den leblosen Staub an den Bordsteinen, der sich nach dem lange ausbleibenden Regen oder nach einem einsichtigen Wind sehnt, bereit, sich von ihnen wieder zum Leben erwecken zu lassen und sich in Schlamm oder in Staubwolken, in Sturzbäche oder Drecklawinen zu verwandeln. Die Hitze zermalmt alles, sie tyrannisiert die Welt, zerstört das, was noch nicht verloren ist, und erzeugt nichts als Wut und Rachsucht, die teuflischsten Neid- und Hassgefühle, so als wäre ihr einziges Ziel das Ende der Welt, der Geschichte, der Menschheit, der Erinnerungen …
Scheiße noch mal, murmelte er, so eine verdammte Hitze. Er nahm die Sonnenbrille ab, um sich den Schweiß vom Gesicht zu wischen, und spuckte auf die Straße. Der zähe Speichel rollte über den durstigen Staub, der ihn gierig aufsaugte. Der Schweiß brannte ihm in den Augen. Mario Conde richtete den Blick gen Himmel und flehte darum, eine gnädige Wolke möge sich erbarmen. Plötzlich attackierte lautes Stimmengewirr sein Hirn. Ein mehrstimmiger Chor der Rache oder des Triumphes erfüllte die Luft, so als wäre er jäh aus der Erde hervorgebrochen, um gegen die Nachmittagshitze zu protestieren. Für einen Moment übertönte er den Lärm der Autos und Lastwagen, die über die Calzada röhrten, und setzte sich hartnäckig im Gedächtnis des Teniente fest. Mario ging bis zur nächsten Straßenecke, und erst da sah er sie. Während die einen feierten, sich auf die Schultern klopften und herumgrölten, beschimpften sich die anderen in gleicher Lautstärke, allerdings mit entsprechend feindseligen Mienen, wobei sie sich gegenseitig die Schuld daran gaben, dass Erstere sich vor Glück kaum einkriegten. Die einen haben gewonnen, die anderen verloren, schloss Mario messerscharf. Er blieb stehen und sah sich das Spektakel an, das von den Jungen zwischen zwölf und sechzehn Jahren veranstaltet wurde. Alle Hautfarben waren vertreten, und es gab Dicke und Dünne, Große und Kleine unter ihnen. Wenn vor zwanzig Jahren jemand wie ich ein solches Geschrei vernommen hätte und an dieser Straßenecke stehen geblieben wäre, dachte El Conde, dann hätte er genau dasselbe gesehen wie ich jetzt: Jungen aller Hautfarben, Dicke und Dünne, Große und Kleine, und der da, der am lautesten herumschrie vor Ärger oder vor Freude, das wäre bestimmt der kleine Condesito gewesen, der Enkel von Rufino Conde. Den Teniente überkam das Gefühl, dass die Zeit hier stehen geblieben war. Genau diese Seitenstraße hatte nämlich schon damals als Baseballfeld gedient, auch wenn für kurze Zeit mal ein treuloser Fußball gesichtet oder ein abtrünniger Basketballkorb an einen der Strommasten genagelt worden war. Dann hatte jedoch bald wieder der Baseball – mit dem Schlagstock oder mit der Hand, über vier Ecken, mit drei rolling-un-fly oder gegen die Wand – ohne große Diskussion die Herrschaft über jene flüchtigen Modeerscheinungen übernommen. Baseball war eine ansteckende Krankheit, eine chronische Leidenschaft, von der Mario und seine Freunde dauerhaft und heftig befallen gewesen waren.
Trotz der Hitze eigneten sich die Augustabende bestens für ein Baseballspiel an der Ecke. Die Sommerferien sorgten dafür, dass sich alle Welt zu jeder Tageszeit auf der Straße herumtrieb. Man hatte nichts Besseres zu tun, und die unermüdliche Sonne erlaubte es, eine richtig spannende Partie auch noch weit nach acht Uhr zu Ende zu spielen. In letzter Zeit jedoch hatte El Conde nur selten Gelegenheit gehabt, solchen Partien zuzuschauen. Offenbar bevorzugten die Jungen aus dem Viertel andere, weniger Kraft raubende und weniger Schweiß treibende Zerstreuungen als die, in der glühenden Sommersonne stundenlang zu rennen, den Ball zu schlagen und herumzuschreien. Mario fragte sich, womit sich die Jungs heutzutage die langen Nachmittage und Abende vertrieben. Wir jedenfalls haben ständig Baseball gespielt, erinnerte er sich. Und dann fiel ihm ein, dass nicht mehr viele von ihnen hier im Viertel wohnten. Während die einen wegen kleinerer oder größerer Delikte im Gefängnis aus- und eingingen, hielten sich andere an so unterschiedlichen Orten wie Alamar, Hialeah, Santiago de las Vegas, Union City, Cojímar oder Stockholm auf. Und einer hatte inzwischen sogar eine Reise ohne Wiederkehr zum Friedhof Colón angetreten. Armer Marquitos … Selbst wenn sie, die von damals, es also wollten, wenn sie noch genügend Kraft in Armen und Beinen hätten, dachte er, selbst dann könnten sie keine ordentliche Baseballpartie dort an der Ecke austragen. Das Leben hatte diese Möglichkeit, wie so viele andere, zunichte gemacht.
Freudengeheul und Zähneknirschen waren vergessen, und die Jungen beschlossen, eine weitere Partie zu spielen. Zwei von ihnen, allem Anschein nach die Anführer der Gruppe, stellten die Mannschaften neu zusammen. Diesmal sollte ein ausgewogeneres Kräfteverhältnis dafür sorgen, dass der Kampf um den Sieg unter gerechteren Bedingungen stattfinden konnte. Da hatte Mario eine Idee. Er würde sie bitten, ihn mitspielen zu lassen. Die acht Stunden im Büro des Erkennungsdienstes der Polizeizentrale hatten ihn zwar ziemlich mitgenommen, aber es war erst sechs Uhr nachmittags und er verspürte noch keine Lust, in die Hitze seines einsamen Heimes zurückzukehren. Das Beste würde es sein, sich bei einem spannenden Baseballspiel zu entspannen. Wenn sie ihn ließen.
Er ging zu dem Holzbrett, das ihnen als home-plate diente, und sprach Felicios Sohn an. Der schwarze Felicio war einer von denen, die früher immer mit ihm gespielt hatten. El Conde hatte ihn schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen, und so nahm er an, dass er wieder mal im Knast gelandet war. Der Sohn war genauso schwarz wie sein Vater und hatte auch jenen durchdringenden, säuerlichen Schweißgeruch geerbt, an den Mario sich noch so gut erinnerte. Zu oft war er ihm in die Nase gestiegen, wenn er mit Felicio unterwegs gewesen war. »Rubén«, sagte er zu dem Jungen, der ihn überrascht ansah, »was meinst du, kann ich wohl ein bisschen bei euch mitspielen?«
Der Junge starrte ihn an, als hätte er ihn nicht richtig verstanden. Dann sah er zu seinen Freunden hinüber. El Conde hielt eine Erklärung für angebracht. »Hab schon lange nicht mehr gespielt, und jetzt hätte ich Lust, mal wieder ein paar Bälle zu fangen …«
Rubén wandte sich den anderen zu, um die Verantwortung für diese folgenschwere Entscheidung nicht alleine tragen zu müssen. In diesem Land ist es besser, alles mit allen zu besprechen, dachte Mario, während er auf den Urteilsspruch wartete. Die Gruppe war offenbar geteilter Meinung, und die Entscheidung ließ lange auf sich warten. »Okay«, sagte Rubén schließlich in seiner Funktion als Vermittler. Doch weder er noch die anderen Jungen schienen begeistert von der erteilten Spielerlaubnis.
Während noch über die Zusammenstellung der beiden Mannschaften diskutiert wurde, zog Mario das Hemd aus und krempelte die Hosenbeine zweimal um. Zum Glück hatte er heute seine Dienstpistole nicht dabei. Er legte das Hemd über das Mäuerchen vor dem Haus, in dem Enrique gewohnt hatte. El Gallego. Wie lange war der jetzt schon tot? Zehn Jahre, zwanzig, tausend? Mario wurde Rubéns Mannschaft zugeteilt. Als er sich dann aber mitten unter den Halbwüchsigen wiederfand, mit freiem Oberkörper wie sie, merkte er, wie absurd und widernatürlich das alles war. Er spürte die ironischen Blicke der Jungen auf seiner Haut und dachte, dass er ihnen wohl wie der erste Missionar vorkommen musste, der auf einen abgeschieden lebenden Indianerstamm gestoßen war. Ein Fremder mit fremder Sprache und fremden Gewohnheiten, für den es nicht leicht sein würde, sich in der verschworenen Gemeinschaft zurechtzufinden, die ihn weder gerufen noch gewollt hatte und ihn nicht verstehen konnte. Außerdem wussten bestimmt alle, dass er Polizist war, und bei dem uralten Verhaltenskodex in diesem Viertel war es ihnen sicher nicht gerade angenehm, von anderen beim gemeinsamen Baseballspiel mit einem Bullen gesehen zu werden, auch wenn der ein noch so guter Freund ihrer Väter oder älteren Brüder war. Ja, bestimmte Dinge änderten sich nicht an dieser Ecke.
Seine Mitspieler gingen bereits auf ihre Plätze. Mario nahm sein Hemd vom Mäuerchen und näherte sich Rubén. Er wollte ihm den Arm um die Schultern legen, hielt sich dann aber zurück, als er an die Schweißschicht dachte, die die Haut des Jungen überzog. »Entschuldige, Rubén, aber mir ist eben eingefallen, dass ich gleich angerufen werde. Ich spiel ein andermal mit …«, sagte er.
Und entfernte sich in Richtung Calzada. Er fühlte, wie ihm die inzwischen tief stehende rote Sonne unbarmherzig Haut und Seele verbrannte. Über seinem Haupt konnte er das Flammenschwert sehen, Zeichen der Vertreibung aus dem unwiderruflich verlorenen Paradies, das einmal seines gewesen war, es jetzt aber nicht mehr war und nie mehr sein würde. Wenn diese Straßenecke ihm nicht mehr gehörte, was blieb ihm dann überhaupt noch? Das schmerzliche Gefühl, fremd zu sein, fremdartig, anders, überkam ihn mit einer solchen Macht, dass er sich an den letzten Rest seines Stolzes klammern und sich beherrschen musste, um nicht anzufangen zu laufen. Und erst jetzt, als er sich wieder der Hitze bewusst wurde, die für ein Baseballspiel an der Ecke denkbar ungeeignet war, erst jetzt begriff er, warum ihn die Jungen nicht mitspielen lassen wollten. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen, dachte er, die kleinen Strolche spielen um Geld …
»Was ist los, Mario?«
»Weiß nicht. Ich glaub, ich bin müde.«
»So ’ne Hitze, was?«
»Eine Scheißhitze.«
»Siehst auch Scheiße aus, du.«
»Glaub ich wohl.« El Conde hustete und spuckte durchs Fenster auf den Hinterhof. Der dünne Carlos musterte ihn achselzuckend vom Rollstuhl aus. Wenn sein Freund so eine Stinklaune hatte, war es besser, ihn nicht zu beachten, das wusste er. Er war immer schon der Meinung gewesen, dass El Conde ein verdammter Jammerlappen und unverbesserlicher Erinnerungsfetischist war, ein autistischer Masochist und hart gesottener Hypochonder, einer von denen, die man beim besten Willen nicht trösten kann. Und heute Abend verspürte der Dünne keine große Lust, Zeit und Nerven zu opfern, um zu ergründen, welche melancholische Attacke seinen Freund nun wieder quälte. »Willst du Musik auflegen?«, fragte er ihn.
»Und du?«
»War ja nur ’ne höfliche Frage. Nur um irgendwas zu machen.«
Mario ging zu den Musikkassetten, die nebeneinander auf dem obersten Regalbrett aufgereiht waren. Er überflog die Titel und Interpreten, doch der zusammengewürfelte Musikgeschmack des Dünnen erstaunte ihn inzwischen kaum noch. »Was möchtest du hören? Die Beatles? Chicago? Fórmula V? Los Pasos? Creedence?«
»Creedence natürlich.«
Darüber wurden sie sich immer schnell einig. Ihnen beiden gefielen die kraftvolle Stimme von John Fogerty und die simplen, ursprünglichen Gitarrenklänge von Creedence Clearwater Revival. »Das ist und bleibt die beste Version von Proud Mary.«
»Kein Thema.«
»Er singt wie ein Schwarzer. Ach, was sag ich! Er singt wie ein Gott, verdammt noch mal.«
»Jawohl, wie ein Gott, verdammt noch mal«, wiederholte der andere.
Überrascht sahen sie sich an. Beiden war in diesem Moment mit schrecklicher Deutlichkeit die zwanghafte Wiederholung bewusst geworden, die ihr Leben bestimmte. In den nun fast zwanzig Jahren ihrer Freundschaft hatten sie diesen Dialog immer und immer wieder geführt, mit denselben Worten, und immer hier in diesem Zimmer, dem Zimmer des Dünnen. Die regelmäßige Wiederbelebung der immer gleichen Sätze vermittelte ihnen das Gefühl, das verzauberte Reich zyklisch wiederkehrender, sich nie ändernder Zeit zu betreten, wo man sich der Vorstellung des Reinen und Immerwährenden hingeben konnte. Doch unzählige sichtbare Zeichen wiesen neben anderen, hinter Schamgefühl, Angst, Groll und sogar Zärtlichkeit verborgenen darauf hin, dass das einzig Bleibende die Stimme von John Fogerty und die Gitarren von Creedence waren. Die drohende Kahlköpfigkeit des Teniente Mario Conde und die krankhafte Fettleibigkeit des dünnen Carlos – der inzwischen alles andere als dünn war –, Marios unerbittliche Melancholie und Carlos’ irreversible Behinderung, all das waren, neben tausend anderen, schlagende Beweise für ein elendes, immer verheerenderes Desaster.
»Hast du den roten Candito in letzter Zeit mal gesehen?«, fragte Carlos seinen Freund, als der Song zu Ende war.
»Ist schon ’ne Ewigkeit her.«
»Neulich war er hier. Das Geschäft mit den Sandalen hat er aufgegeben, hat er mir gesagt.«
»Und wo hängt er jetzt drin?«
Der Dünne starrte auf den Kassettenrecorder, so als hätte ihn irgendetwas an dem Apparat oder an der gerade laufenden Musik plötzlich abgelenkt.
»Was hast du, Bär?«
»Nichts … Er verkauft jetzt Bier, unter der Hand …«
El Conde schüttelte grinsend den Kopf. Er konnte auf hundert Kilometer Entfernung förmlich riechen, worauf sein Freund hinauswollte.
»Und er hat mich gefragt, warum wir nicht mal auf einen Sprung bei ihm vorbeikommen, du und ich …«
El Conde schüttelte wieder den Kopf und grinste.
»Du weißt doch, dass ich mich nicht auf so was einlassen kann, Dünner. Was der macht, ist illegal, und wenn was passiert …«
»Ach, red doch keinen Stuss, Mario. Guck mal, bei der Hitze, und so scheiße, wie du heute aussiehst … Und zum Roten ist es doch nur ’n Katzensprung … Los komm, nur auf ’n paar Bierchen …«
»Ich kann nicht, Alter. Ich bin Polizist, Mann, vergiss das nicht.« Mario wedelte mit den hilflosen Armen seines schwachen Willens und funkte SOS. »Hör auf damit, Dünner.«
Aber der Dünne hörte nicht auf.
»Mensch, ich würd so schrecklich gerne rübergehen, und ich hab gedacht, ich könnte dich animieren. Ich komm doch nie hier raus, das weißt du doch, und ich langweile mich zu Tode. Wie ’ne Kröte unterm Stein … Ein kühles Bierchen, Mario, auf meinen Geburtstag, ja? Du bist doch gar kein richtiger Polizist mehr, du …«
»Was hab ich doch für ’n Scheißfreund! Dein Geburtstag ist erst nächste Woche, Dünner …«
»Ist ja gut, ist ja gut. Wenn du nicht willst, dann gehen wir eben nicht.«
El Conde schob den Rollstuhl des Dünnen bis vor den Eingang des Wohnhauses. Er wischte sich den Schweiß von Gesicht und Nacken. Die Arme waren ihm schwer und schmerzten von der Anstrengung, die zweihundertfünfzig Pfund seines Freundes zehn Karrees weit, einschließlich zwei Steigungen mit dem anschließenden Gefälle, vor sich her geschoben zu haben. Er sah in den Hausflur hinein, von dem viele Türen abgingen. Ganz hinten durchbrach eine flackernde Birne das Halbdunkel. Das weißlich schimmernde Licht der Bildschirme fiel aus den offen stehenden Wohnungstüren, und die Stimmen der aktuellen Fernsehserie hallten durch den Flur. »Sag, Mama, wer ist schuld an all dem, was geschehen ist? Bitte, Mama, sag es mir«, flehte ein Mädchen, dem bestimmt furchtbare Dinge zugestoßen waren in jenem in Kapitel aufgeteilten Leben, das sich für die Realität ausgab. Mario steckte sein Taschentuch wieder ein und schob den Rollstuhl zu der einzigen Tür, die geschlossen war. Dabei zog er den Kopf ein und blickte zu Boden, um sich möglichst unsichtbar zu machen. Ich bin immer noch Polizist, dachte er auf dem Weg zu dem illegalen, aber verlockenden Bier, das ihm die ersehnte Abkühlung verschaffen und ihn alles andere vergessen lassen würde.
Er klopfte, und die Tür öffnete sich, als hätte man auf sie gewartet. Cuqui, die kleine Mulattin, die zurzeit bei Candito wohnte, hatte nur den Arm auszustrecken brauchen, um den Türknauf zu drehen. Wie alle anderen im Haus sah auch sie sich die Serie im Fernsehen an, und auf ihrem Gesicht spiegelte sich das Erschrecken der Protagonistin wider, die soeben die ganze schreckliche Wahrheit herausgefunden hatte. Ich bin schuld an allem, wollte Mario sagen, doch er beherrschte sich.
»Kommen Sie rein, kommen Sie rein«, forderte die junge Frau sie freundlich auf, doch ihre Stimme klang unsicher wie die der Serienheldin. Sie konnte die Wahrheit einfach nicht glauben, und vielleicht ließ sie die Besucher deshalb nicht aus den Augen, während sie ins Wohnungsinnere rief: »Candito, Besuch!«
Wie in einem Kasperltheater streckte der rote Candito den Kopf durch den Vorhang, der die Küche vom Wohnraum abtrennte. Der Teniente begriff sogleich den Code. »Besuch« bedeutete etwas anderes als »Gäste« oder »Kundschaft«, und darum wohl wagte sich Candito nur vorsichtig aus seiner Höhle. Als der Mulatte aber den »Besuch« erblickte, lächelte er und kam zu ihnen. »Mensch, Carlos, hast du ihn doch noch überredet?«, rief er und drückte seinen beiden alten Schulfreunden die Hand.
»Ich hab dir doch gesagt, wir kommen, und hier sind wir.«
»Gut, dann kanns ja losgehen, ich hab noch was da. Cuqui, reiß dich von deiner Soap los und mach ’n paar Sandwiches fertig, mach schon … Jedes Mal wenn ich da hinguck, reden die denselben Schmus …«
Candito rückte die Möbel zur Seite, um Platz zu schaffen für den Rollstuhl des Dünnen, schlug den Küchenvorhang zurück und öffnete die Tür, die auf den Innenhof führte. Dort standen sechs Tische, alle besetzt. El Conde blieb wie angewurzelt stehen. Candito nickte ihm aufmunternd zu, aber Mario sah sich von der Küche aus erst mal die Gäste an. Fast alles Männer, nur drei Frauen. Er versuchte die Gesichter zu erkennen. Instinktiv fasste er sich an den Gürtel, um sich zu vergewissern, dass er seine Pistole zu Hause gelassen hatte. Er kannte jedoch keinen der Gäste, was ihn beruhigte. Jeder der Anwesenden hätte ihm schon mal bei einem Verhör in der Zentrale begegnet sein können, und es hätte ihm gar nicht gefallen, so jemanden an einem Ort wie diesem hier wieder zu treffen.
Die runden Tischplatten waren aus falschem Marmor, die Untergestelle aus Gusseisen. Batterien leerer Bierflaschen standen auf den Tischen. Eine helle Lampe tauchte die Szene in kaltes Licht, und ein Kassettenrecorder versorgte sie lautstark mit schmerzerfüllten Klageliedern von José Feliciano, dessen Stimme die der Gäste zu übertönen versuchte. Zwei Blechkanister schwitzten neben der Waschstelle in der glühenden Hitze. Candito ging zu einem Tisch im Hintergrund, an dem zwei Furcht erregende Gestalten saßen. Er flüsterte ihnen etwas zu. Die beiden nickten und standen auf. Der eine von ihnen war ein blonder Hüne von über einsachtzig, mit überlangen Armen und einem Gesicht, das von ebenso vielen Kratern überzogen war wie die Mondoberfläche. Der andere, kleiner und so schwarz, dass er schon beinahe bläulich wirkte, musste der direkte Nachfahre und Universalerbe des Cromagnon-Menschen sein. Darwins Evolutionstheorie wurde von seinem enorm vorstehenden Oberkiefer und der niedrigen Stirn aufs Schönste illustriert, was die gelblich wässrigen Augen eines Urwaldtieres noch unterstrichen. Candito forderte El Conde mit einer Geste auf, Carlos’ Rollstuhl an den frei gewordenen Tisch heranzuschieben, und mit einer anderen bedeutete er den beiden Männern, drei Bier zu bringen.
»Was hast du zu den Höhlenmenschen gesagt?«, fragte Mario leise, während sie sich setzten.
»Keine Sorge, Conde, keine Sorge. Hier kennt dich keiner, oder? Die beiden sind meine Geschäftspartner.«
El Conde wandte sich zu dem großen Blonden um, der mit dem Bier kam, es auf den Tisch stellte und sich wortlos wieder entfernte.
»Deine Leibwächter, was?«
»Meine Partner, Condesito, für was auch immer.«
»Hör mal, Candito«, schaltete sich jetzt der Dünne ein, »was kostet eigentlich das Bier?«
»Kommt drauf an, Carlos, hängt ganz vom Einkaufspreis ab. Im Moment ist nur schwer dranzukommen, ich verkaufs für drei Pesos. Aber das hier geht aufs Haus, klar? Keine Widerrede!«
Cuqui brachte einen Teller mit Schinken- und Käsesandwiches, dazu jede Menge Gebäck. Candito lächelte sie breit an. »Okay, negra, jetzt kannst du dir wieder deine Soap angucken«, sagte er und verabschiedete sie mit einem klatschenden Klaps auf den Po.
Das kalte Bier beruhigte Marios gereizte Nerven ein wenig. Schade nur, dass er die erste Flasche fast auf einen Zug geleert hatte, ohne Atem zu holen. Jetzt störte ihn lediglich die laute Musik und das ungute Gefühl, das er empfand, weil er mit dem Rücken zu den anderen Gästen saß. Natürlich verstand er, dass Candito die übrigen Tische im Auge behalten musste. Als der Blonde – Effizienz war wieder auf die Insel zurückgekehrt – seine leere Flasche gegen eine volle austauschte, beschloss El Conde, sich zu entspannen.
»Und, Conde, was machst du so?«, fragte Candito zwischen vielen kleinen Schlucken. »Hast dich lange nicht mehr hier blicken lassen.«
El Conde probierte den Schinken. »Man hat mich zur Schreibtischarbeit verdammt, weil ich mich mit einem Kollegen rumgeprügelt hab, mit irgendso ’m Vollidioten. Ich muss Karteikarten ausfüllen und darf keinen Schritt nach draußen tun … Aber du hast ja auch die Branche gewechselt, stimmts?«
Candito trank einen langen Schluck aus seiner Flasche.
»Nicht zu ändern, Conde. Unsereiner muss wissen, wann er aufhören muss, bevor die Kacke am Dampfen ist. Das mit den Sandalen wurde mir langsam zu heiß, verstehst du, und, na ja, da hab ich eben den Job gewechselt. Du weißt ja, das Leben ist knallhart, und wer keinen Peso in der Tasche hat, ist in den Arsch gekniffen, hab ich Recht?«
»Wenn du hierbei geschnappt wirst, kriegst du Ärger. Mindestens ’ne satte Geldstrafe, darauf kannst du Gift nehmen … Und wenn ich hier gesehen werd, komm ich für den Rest meines Lebens nicht mehr raus aus dem Scheißbüro.«
»Vergiss es, Conde, es gibt keinen Ärger, wenn ichs dir doch sage.«
»Und, gehst du immer noch in die Kirche?«
»Ja, hin und wieder. Gewisse Leute muss man sich warm halten … Die Polizei zum Beispiel …«
»Red keinen Scheiß, Roter.«
»Hört auf damit, Leute«, mischte sich der Dünne ein. »Das Bier kommt super. Sag dem Riesenbaby, er soll mir noch eins bringen.«
Candito hob die Hand und rief: »Noch drei.«
Wieder bediente sie der Blonde. Aus dem Recorder war nun die volltönende Säuferstimme von Vicentico Valdés zu hören – er behauptete gerade zu wissen, wo die Ohrringe waren, die dem Mond fehlten –, und während El Conde sein drittes Bier trank, merkte er, wie er langsam ruhiger wurde. Die mehr als zehn Jahre Polizistendasein hatten eine innere Spannung in ihm erzeugt, die ihn überallhin verfolgte. Nur an einigen wenigen Orten, wie zum Beispiel im Haus des Dünnen, gelang es ihm, sich von seinen Obsessionen zu befreien und die innere Lockerheit früherer Zeiten wiederzuerlangen, jener Zeiten, von denen sie auch jetzt wieder sprachen. Von damals, als sie Schüler der Oberstufe am Gymnasium von La Víbora waren und sich die Zukunft ausmalten; als der dünne Carlos noch dünn war und auf seinen beiden gesunden Beinen gehen konnte, denn damals war er noch nicht im Krieg in Angola gewesen und verwundet worden; als Andrés von einer großen Karriere als Baseballspieler träumte; als der Hasenzahn unbedingt die Geschichte umschreiben wollte, der rote Candito sein leuchtend rotes Haar im Afrolook trug und Mario Conde die Tage damit verbrachte, seine ersten Erzählungen als früh gescheiterter Schriftsteller auf einer Underwood auszuschwitzen.
»Erinnerst du dich noch, Conde?«, fragte ihn Candito, und Mario sagte, ja, er erinnere sich noch, und er erinnerte sich auch noch an jene hübsche Anekdote, die er gerade verpasst hatte.
Der Blonde brachte die vierte Runde und Cuqui den zweiten Teller mit Sandwiches, über die sich der dünne Carlos sogleich hermachte. Mario beugte sich gerade vor, um sich ein Schinkensandwich zu sichern, als Candito plötzlich aufsprang und dabei seinen Stuhl umwarf.
»Du Arschloch!«, rief jemand.
El Conde drehte sich um und sah, wie ein Mulatte sich mit den Händen das Gesicht bedeckte und vor dem großen Blonden zurückwich, der mit einer zerbrochenen Flasche in der Hand vor ihm stand. Der prähistorische Schwarze näherte sich dem Mann von hinten – »Du Arschloch, du Arschloch!« – und umklammerte seine stämmigen Gorillabeine. Dann bearbeitete er die Nieren des Störenfrieds mit einer Serie blitzschneller Haken und zwang ihn so auf die Knie. Der große Blonde hatte den beiden inzwischen den Rücken zugekehrt und hielt, eine Hand am Gürtel, die Tische in Schach. »Wenn einer aufsteht …«, drohte er, aber niemand hatte das Verlangen aufzustehen.
El Conde sah, wie Candito an ihm vorbei auf den knienden Mulatten zuging und ihn am Hemdkragen packte, während der kleine Blauschwarze das Opfer an den Haaren festhielt und ihm mit einer Scheuerbürste aufs Ohr schlug. Aus einer Augenbraue des Mannes quoll Blut.
»Hör auf!«, schrie Candito, aber der Schwarze schlug weiter mit der Bürste auf den Mann ein. »Du sollst aufhören, verdammt noch mal!« Candito ließ den Hemdkragen des Mulatten los und umklammerte nun die Hand seines Partners, der endlich von seinem Opfer abließ. El Conde beobachtete mit beinahe wissenschaftlichem Interesse den K.o. des malträtierten Mulatten, der nach rechts zu Boden sank. Sein Kopf schlug wie eine hohle Kokosnuss auf dem Zement auf. Nein, viel mehr hätte der nicht einstecken können.
Der Blonde ging zum Recorder und wechselte die Kassetten. Daniel Santos hieß der neue Star des Abends. Dann, ohne große Eile, wandte er sich dem Mulatten zu und fasste ihn unter den Achseln, während der Schwarze ihn an den Fußgelenken hochhob. Durch eine Tür hinten im Hof, die Mario bislang nicht bemerkt hatte, trugen sie ihn fort.
Candito sah die übrigen Gäste an. Einen Moment lang war nur die Stimme von Daniel Santos zu hören.
»Ist doch nichts passiert, oder?« Der Rote blickte grinsend in die Runde. »Wenn jemand noch ’n Bier will, muss ers nur sagen, okay?« Er hob den Stuhl auf, der bei seinem überstürzten Eingreifen umgekippt war.
Der Dünne wischte sich den Schweiß ab, der ihm überall am ganzen fetten Körper ausgebrochen war. »Was war los, Roter?«, fragte er nach einem endlos langen Schluck.
»Keine Panik, Jungs. Das sind die Schattenseiten des Geschäfts, wie man so sagt.«
»Der wollte auf mich los, stimmts?«, fragte Mario.
Jetzt trank Candito ausgiebig aus seiner Flasche und nahm dann, ohne hinzusehen, ein Käsesandwich. »Keine Ahnung, Conde, aber auf irgendeinen wollte er los«, antwortete er schnaubend, ohne das Kauen einzustellen.
»Und woher willst du das wissen? Der Typ hat doch kein Wort gesagt …« Carlos hatte sich noch nicht von dem Schreck erholt.
»So einen darf man auch nicht zu Wort kommen lassen, Dünner. Aber irgendwas hatte der vor.«
»Scheiße noch mal, die beiden hätten ihn fast umgebracht.«
Der Rote strich sich grinsend über die Stirn. »Das Dumme ist nur, dass sich so was nicht vermeiden lässt, Bruder. Hier herrscht das Gesetz des Dschungels. Respekt ist alles. Eins steht jedenfalls fest: Weder der von eben noch sonst jemand hier und auch keiner, der erfährt, was heute vorgefallen ist, wird das in Zukunft noch einmal wagen.«
»Und was machen die jetzt mit ihm?« Die Neugier nagte an Carlos, der nervös weitertrank.
»Die legen ihn irgendwo ab, wo er sich erholen und abkühlen kann. Dann muss er bezahlen, was er getrunken hat, und danach schicken wir ihn nach Hause. Der muss nämlich heute früh ins Bett, findest du nicht auch?«
Der Dünne schüttelte den Kopf, als kapiere er gar nichts mehr, und sah Mario an. Der hüllte sich in Schweigen und lauschte scheinbar versonnen dem Bolero, den Daniel Santos gerade sang.
»Hast du das gesehen, Kleiner?«
»Na klar hab ich das gesehen, Bär.«
»Und? Kapierst du was?«
»Nein. Ich kapier immer weniger, ehrlich … Los, Roter, bring noch ’ne Runde, mach schon.«
2
Das Schlimmste von allem war das Gefühl der Leere. Während das Schrillen des Weckers Marios Hirn durchbohrte, ihm einhämmerte: viertel vor sieben, viertel vor sieben, und die Augenlider gegen den bleiernen Schlaf und die Schwere der Biere ankämpfte, viertel vor sieben, viertel vor sieben, nahm die Leere ihren Platz in Marios Bewusstsein ein wie ein Ölfleck, der sich auf der Meeresoberfläche ausbreitet. Dieser Fleck jedoch war farblos, denn es handelte sich um die Leere, das Nichts, es war das Ende, das jeden Tag aufs Neue begann mit unerbittlicher Fähigkeit zur Erneuerung, gegen die er sich weder mit Gewalt noch mit schlagenden Argumenten wehren konnte. Viertel vor sieben, das war das einzig Fassbare inmitten der Leere.
In letzter Zeit hatte er angefangen, sich den Tod als ein Erwachen im leeren Raum vorzustellen, mühsam, aber schmerzlos, frei von Erwartungen und Überraschungen. Denn genau das war der Tod: das bodenlos tiefe Loch der Leere, eine dunkle Wattewolke, die ihn einhüllte, endgültig, bis in alle Ewigkeit. Und dann versuchte er, sich an die Zeit zu erinnern, als es weder ein Gefühl der Leere noch Gedanken an den Tod gegeben und der Morgenschleier sich wie ein Theatervorhang für eine neue Aufführung gehoben hatte, eingebildet oder überraschend, egal, aber auf jeden Fall verlockend und unumgänglich. Die unbewusste Sehnsucht danach, einen neuen Tag zu erleben. Doch es geschah das, was auch dann geschah, wenn er sich krank fühlte und sich vorzustellen versuchte, wie es war, wenn er sich gesund fühlte. Es gelang ihm nicht. Das Unwohlsein war allgegenwärtig und hinderte ihn daran, andere, angenehmere Gefühle zu empfinden.
Wenn er dann an einem so heißen Morgen wie diesem auf die Straße trat, im Mund den einsamen Kaffeegeschmack, ohne den Abschiedskuss einer Frau hinter sich oder irgendein erfreuliches Ereignis in naher Zukunft vor sich, das ihn wie ein Magnet angezogen hätte, dann fragte er sich, ob er überhaupt noch einen Grund hatte, seine Uhr aufzuziehen oder den Wecker zu stellen, wo doch die Zeit genau das war, was seine Leere am objektivsten zum Ausdruck brachte. Und weil er keinen überzeugenden Grund dafür fand – Pflichtgefühl? Verantwortungsbewusstsein? Die Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Bewegung der trägen Masse? –, fragte er sich immer wieder, was er hier eigentlich machte, auf dem Weg zur Bushaltestelle, zu der Schlange, die jeden Tag länger und brutaler wurde, eine Zigarette rauchend, die ihm die Eingeweide zerfraß, inmitten einer Menschenmenge, die ihm immer fremder war, unter der Hitze leidend, die mit jeder Minute unerträglicher wurde. Und seine Antwort lautete: Das ist mein vorgezogener Weg in die Hölle. Er fasste sich an den Gürtel und stellte fest, dass er auch heute wieder seine Dienstpistole zu Hause vergessen hatte. Er erkundigte sich, wer der Letzte in der Schlange war, und zündete sich die dritte Zigarette des Tages an. Wo ich doch sowieso sterben muss …
»Mayor Rangel will mit dir sprechen.«
Die Worte des Dienst habenden Offiziers weckten in Mario Conde eine seiner verloren geglaubten Hoffnungen. Ja, vielleicht würde er gleich einen guten Kaffee bekommen, der im Stande war, den Geschmack jenes süßen, dunkelbraunen, undefinierbaren Gesöffs zu vertreiben, das er in der trostlosen Cafeteria der Kripozentrale getrunken hatte. Als er die Schlange vor dem Aufzug sah, beschloss er, die Treppe zu nehmen. Er hatte keine Ahnung, warum ihn der Alte zu sich rief. Aber mit der Nase seiner Erinnerung roch er bereits den Duft des gerade durchgelaufenen Kaffees, der in den weißen Tassen seines Chefs serviert würde. Vor drei Monaten, nach seiner Prügelei mit Teniente Fabricio in einem öffentlichen Park, war El Conde vom Disziplinarausschuss dazu verdonnert worden, ein halbes Jahr lang beim Erkennungsdienst Karteikarten auszufüllen und Telexe zu übermitteln. Nach Ablauf dieser Zeit sollte sein Fall neu verhandelt und entschieden werden, ob er wieder als Ermittler arbeiten konnte. Seitdem vermied er es, dem Alten unter die Augen zu treten. Der Mayor betrachtete das Urteil gegen seinen Untergebenen als persönliche Niederlage. Trotz der exzentrischen Art und der lockeren Dienstauffassung war Mario sein bester Mann, und er hatte volles Vertrauen zu ihm. Wiederholt hatte er, öffentlich und privat, ihm gegenüber seinem Respekt Ausdruck verliehen und ihn freundlich, geradezu liebvoll behandelt. Deswegen hatte El Conde irgendwie das Gefühl, seinen Chef enttäuscht zu haben. Darüber hinaus hatte die interne Ermittlung, der zurzeit die gesamte Zentrale unterzogen wurde, dem Mayor so gründlich die Laune verdorben, dass es äußerst ratsam schien, ihm am besten nur aus der Entfernung zu begegnen. Falls man ihm denn unbedingt begegnen musste, dachte Mario.
Er öffnete die Glastür zum Vorzimmer seines Chefs. Hinter dem Schreibtisch, wo seit mehreren Jahren Maruchi gesessen hatte, die Sekretärin von Mayor Rangel, saß nun eine andere Frau. Ungefähr fünfzig, in Uniform, mit den Rangabzeichen eines Teniente. Die Tasse Kaffee, die El Conde bereits zum Mund führte, löste sich in Wohlgefallen auf. Mario ging zu der neuen Sekretärin, grüßte und sagte, wer er war. Der Mayor warte bereits auf ihn, ließ sie verlauten. Dann drückte sie auf eine Taste der Gegensprechanlage und erstattete Meldung: »Teniente Mario Conde.«
»Soll reinkommen«, krächzte es aus dem Apparat, und die Sekretärin stand auf, um die Tür zum Chefzimmer zu öffnen.
Mayor Antonio Rangel war hinter seinem Schreibtisch aufgestanden und streckte Mario die Hand hin. Diese für den Alten so ungewöhnliche Geste verriet dem Teniente, dass die Dinge nicht zum Besten standen. »Wie geht es dir da unten, Mario?«
»Geht so, Mayor.«
»Setz dich.«
El Conde nahm in einem der beiden Sessel vor dem Schreibtisch Platz. Jetzt konnte er nicht länger an sich halten. »Und wo ist Maruchi, Chef?«, fragte er.
Der Mayor sah ihn nicht an. Er wühlte in einer Schreibtischschublade und nahm eine Zigarre heraus. Sah nicht aus wie eine gute Havanna. Zu dunkel, die Rippen des Deckblatts zu deutlich zu sehen, zu rebellisch gegen die Flamme des Feuerzeugs, die der Alte an die Spitze hielt.
»Wie ’n Stück Holz«, brummte der Mayor, nachdem er zwei-, dreimal den Rauch ausgestoßen hatte. Er betrachtete die Bauchbinde, als könnte er es nicht fassen, und Mario wartete auf den fälligen Kommentar. »Nicht zu fassen«, sagte der Mayor dann auch tatsächlich, »sieh dir das an! ›Auslese‹, aus Holguín. Welcher Idiot behauptet, dass in Holguín Zigarren gerollt werden? Das ganze Land spielt verrückt … Maruchi ist versetzt worden. Wohin, weiß ich nicht. Und warum, auch nicht. Außerdem, frag mich nicht, ich kann dir nichts sagen, und selbst wenn ichs könnte, ich würd nicht. Kapiert?«
»Es ist unmöglich, das nicht zu kapieren, Mayor«, bestätigte Mario Conde. Adiós, Kaffee, der bei Maruchi immer drin gewesen war. »Und warum hast du keine anständige Zigarre?«
»Ich hab keine, und das geht dich nichts an … Zur Sache …« Der Mayor lehnte sich im Schreibtischsessel zurück. Er sah sehr müde aus. Als wäre auch er ins Loch der Leere gefallen, dachte El Conde. Er hatte immer die jugendliche Vitalität des Mayor bewundert, die seinen achtundfünfzig Jahren so gar nicht entsprach und durch tägliche Runden im Swimmingpool und stundenlanges Balldreschen in der Squash-Halle kultiviert und gegossen wurde. »Ich hab dich kommen lassen, weil du einen Fall übernehmen sollst.«
El Conde lächelte schwach und beschloss, seinen kleinen Vorteil zu nutzen: »Willst du mir keinen Kaffee anbieten?«
Der Mayor deutete nun seinerseits ein Lächeln an, ein kaum wahrnehmbares Hochziehen der Oberlippe über der Zigarre. »Heute ist schon der Siebte«, sagte er, »aber die monatliche Kaffeequote ist noch nicht bei mir angekommen. Pech gehabt, Conde … Also, ich hab nicht genug Leute zur Verfügung und seh mich deshalb gezwungen, die Maßnahme gegen dich vorübergehend aufzuheben. Du und Sargento Palacios, ihr werdet diesen Fall unverzüglich übernehmen. Ein toter Trassvestit im Stadtwald von Havanna.«
»Transvestit.«
»Sag ich doch.«
»Nein, du hast ›Trassvestit‹ gesagt. Es heißt aber ›Transvestit‹.«
Der Mayor schüttelte den Kopf. »Wirst du dich eigentlich nie ändern, mein Junge? Meinst du, das Leben ist ein Spiel?« Seine Stimme hatte sich verändert. Seine Stimme veränderte sich je nach Thema oder Absicht, je nach Ort oder Zeit. Jetzt war sie schroff und spröde.
»Entschuldige, Chef.«
»Nein, ich entschuldige nicht, Conde. Und sag nicht immer Chef zu mir! Weißt du eigentlich, wo mir der Kopf steht? Meinst du, es wär leicht, seine Arbeit zu tun, wenn ein ganzes Bataillon von internen Ermittlern hier in der Zentrale rumschnüffelt? Weißt du, wie viele Fragen mir Tag für Tag gestellt werden? Weißt du, dass bereits zwei unserer Beamten wegen Korruption entlassen worden sind und zwei weitere wegen Nachlässigkeit im Dienst suspendiert werden? Und kannst du dir vielleicht vorstellen, wem all diese Geschichten angelastet werden? Mir natürlich! Nein, ich entschuldige nichts, Conde … Und du, warum läufst du hier in Zivil rum? Hab ich dir nicht gesagt, dass du in Uniform erscheinen musst, solange du da unten arbeitest?«
El Conde stand auf und blickte durch das breite Fenster nach draußen. Gebäude, Bäume und ein ruhiges Meer im Hintergrund, Horizont so vieler Träume, Schicksale und Enttäuschungen. »Wer hat den Bericht mit den Daten des Falls?«, fragte er und fasste sich wieder an den Gürtel, wo manchmal seine Dienstpistole steckte.
»Es gibt noch keinen. Der Tote ist gerade erst entdeckt worden. Ich glaube, Manolo wartet in deinem Büro auf dich. Du kannst jetzt gehen. Sofort.«
Mario Conde drehte sich um und ging zur Tür. Er zögerte. Irgendwie fühlte er sich seltsam. Geschmeichelt oder benutzt, das wusste er noch nicht. Doch er nahm an, dass der Alte sich noch viel seltsamer fühlte. Soweit er wusste, war es das erste Mal, dass Mayor Rangel die Disziplinarstrafe eines Untergebenen aussetzte. »Schade, dass du meine Entschuldigung nicht annehmen willst und mir keinen Kaffee anbieten kannst. Aber ich mag dich, und deshalb werd ich versuchen, eine gute Zigarre für dich aufzutreiben«, sagte er und ging hinaus, ohne eine Antwort abzuwarten oder dem Mayor dafür zu danken, dass er ihm diesen Fall übertrug. Er hatte es schon tun wollen, doch im letzten Moment war ihm eingefallen, dass sein Chef ein Dankeschön möglicherweise als zu taktlos empfunden hätte.
Als der Polizist die Plane anhob, drückte der Fotograf noch einmal schnell auf den Auslöser, so als fehlte ihm noch das Foto aus genau diesem Blickwinkel. Laut Personalausweis hatte der Tote Alexis Arayán Rodríguez geheißen. Jetzt war er nur noch eine rot gekleidete, karnevaleske Figur mit zwei sehr weißen, sehr muskulösen Beinen, die sich von dem sonnenverbrannten Gras deutlich abhoben. Ein Frauengesicht, violett und aufgeschwemmt, vervollständigte die Leiche. Um den Hals wand sich straff die rote Seidenschärpe des Todes.
Auf ein Zeichen des Teniente hin ließ der Wachposten betont angeekelt die Plane fallen. El Conde holte ein Päckchen Zigaretten hervor, und Manuel Palacios bat ihn um eine. Mario gab sie ihm widerwillig. Angeblich hatte der Sargento das Rauchen aufgegeben, aber in Wirklichkeit kaufte er sich einfach keine Zigaretten mehr.
El Conde sah auf den Fluss. Morgens, unter dem dichten Blätterdach des Stadtwaldes von Havanna, konnte man die Illusion hegen, der Sommer hätte sich zur Erleichterung der Stadtbewoh-ner über Nacht verabschiedet. Eine sanfte Brise, die die trüben Gerüche des Flusses herantrug, bewegte die Zweige der Pappeln und Johannisbrotbäume, der Mandelbäume, deren Kronen sich wie Zirkuszelte öffneten, und der Lorbeerbäume, an denen zu langen Zöpfen geflochtene Lianen wie Tränen herabhingen. Mario erinnerte sich an die vielen Geburtstagsfeiern, die er als Junge hier im Stadtwald rund um die für diesen Zweck zu mietenden Pavillons jenseits der Brücke erlebt hatte. Und daran, wie er sich einmal wie Tarzan von Liane zu Liane geschwungen hatte und dabei mit den nagelneuen orthopädischen Schuhen, die seine Mutter ihm für diesen Tag gekauft hatte, an einem Stein entlanggeschrammt war. Auf dem schwarzen Leder seiner einzigen Schuhe des Jahres blieben zwei verräterische Streifen zurück, was ihm eine Woche ohne Baseball, ohne Fernsehen und vor allem ohne die täglichen Folgen der Radioserie Guaytabó eingebracht hatte. El Conde hatte das nie vergessen. Denn genau in der Woche war der Indio Guaytabó dem alten Apolinar Matías in der Kautschukfabrik des Türken Anatolio begegnet, und damit hatte ihre unzerstörbare Freundschaft als Kämpfer für die Gerechtigkeit und gegen das Böse begonnen. Und er, Mario Conde, hatte ausgerechnet jene denkwürdige Begegnung verpasst!
Während er so auf den Fluss blickte, dachte er daran, dass in der Stadt weiter gestohlen, veruntreut, überfallen und gemordet wurde, und das in zunehmendem Maße. Zum Glück, dachte Mario. Schrecklich, aber wahr: Dieser Tod durch Ersticken, den der Gerichtsarzt den Ermittlungsbeamten Teniente Conde und Sargento Palacios gerade zu erläutern versuchte, hatte ihm ermöglicht, seiner Leere zu entfliehen und zu spüren, dass sein Gehirn wieder funktionierte und sein Kopf mehr produzieren konnte als Kopfschmerzen bei einem seiner häufigen Kater.
»Was hältst du davon, Conde? Ja, es handelt sich um eine männliche Person. Geschminkt und gekleidet wie eine Frau. Jetzt gibt es hier bei uns sogar schon ermordete Transvestiten, fast wie in einem entwickelten Land. Wenn das so weitergeht, bauen wir schon bald Raketen und fliegen zum Mond …«
»Red keinen Scheiß und mach weiter«, knurrte der Teniente und warf die Kippe in den Fluss. Manchmal reizte es ihn, ausfällig zu werden, und dieser Gerichtsarzt forderte ihn aus irgendeinem so unerklärlichen wie zwingenden Grund dazu heraus. Vielleicht machte das sein vertrauter Umgang mit dem Tod.
»Ich rede keinen Scheiß, aber ich mach weiter«, gab der Arzt zurück.
Während El Conde seinen Ausführungen lauschte, versuchte er sich vorzustellen, was hier passiert war. Er sah Alexis Arayán Rodríguez, eine Frau, die von Natur aus keine war, an der Seite eines Mannes durch den Stadtwald von Havanna schlendern, ganz in Rot gekleidet, in einem langen, altmodischen Kleid, die Schultern mit einer roten Stola bedeckt, um die Taille eine ebenfalls rote Seidenschärpe. Vielleicht war ein leichter Wind aufgekommen, dachte der Teniente, und die geheimnisvolle Nacht hier war angenehmer und einladender als in der übrigen Stadt. Auf dem Weg, der zum Wald führte, hatte man die Abdrücke von Alexis’ Sandalen entdeckt. Die anderen Spuren stammten von dem Begleiter, einem offenbar korpulenten Mann. Wahrscheinlich hatte er Arayáns Gesicht fasziniert angeschaut: die sorgfältig nachgezogenen Augenbrauen, die zartpurpurnen Lidschatten, die getuschten Wimpern und vor allem den Mund, so leuchtend rot wie das merkwürdige Kleid, das aus einer unbestimmten, aber ganz bestimmt fernen Vergangenheit stammte. Sie werden Küsse und erregende Liebkosungen ausgetauscht haben, dachte El Conde, Alexis’ schlanke Finger mit den lackierten Nägeln werden den Mann gestreichelt haben. Dann waren sie neben dem verkrüppelten Stamm eines hundert Jahre alten, blühenden Flamboyants stehen geblieben, und dort hatte sich die Tragödie des amourösen Irrtums abgespielt.
»Wisst ihr was«, unterbrach El Conde mit Blick auf die verhüllte Leiche den Bericht des Gerichtsmediziners, »gestern war doch der 6. August, oder?«
»Ja, und weiter?«, fragte der Arzt zurück.
»Da könnt ihr mal sehen, wie nützlich es ist, wenn man am Religionsunterricht teilgenommen hat … Der 6. August ist für Katholiken das Fest der Verklärung Christi, der Transfiguration. Laut Bibel verwandelte sich Jesus Christus an dem Tag auf dem Berg Tabor vor dreien seiner Jünger. Und Gottvater, von einer Lichtwolke, dem Taborlicht, umgeben, forderte die Jünger auf, ihm auf ewig zu folgen. Ist es da ein Zufall, dass am 6. August ein toter Transvestit gefunden wird?«
Sargento Palacios verschränkte die Arme vor seiner unterernährten Hühnerbrust und sah den Teniente an. Der genoss diesen leicht schielenden Blick, in dem sich Unsicherheit widerspiegelte. El Conde wusste, dass er Manolo, dieses schmale Handtuch, mit seinen Worten überrascht hatte. Doch sein Kollege ließ sich gerne auf diese Weise von ihm überraschen.
»Und wieso kannst du dich an den Scheiß erinnern, Conde? Soviel ich weiß, hast du seit mindestens dreißig Jahren keine Kirche mehr von innen gesehen.«
»Nicht ganz, Manolo, nicht ganz. Die Geschichte von der Transfiguration hat mir nämlich immer schon imponiert. Im Religionsunterricht hab ich mir vorgestellt, wie Gott auf einer Wolke thront und alles überstrahlt, wie ein Scheinwerfer …«
»Ach, komm, Conde«, mischte sich der Arzt ein, »was ist, wenn Alexis sich jeden Tag verkleidet hat?« Er unterstrich seine Frage mit einem triumphalen Grinsen, das den Teniente noch an weitere Motive für seine Abneigung gegen ihn erinnerte.
»Dann ist Schluss mit Geheimnis und Verklärung«, gab El Conde zu. »Aber wär das nicht ein Jammer? Die Verwandlung des Alexis Arayán. Klingt gut, was? … Los, erzähl weiter.«
Er sah sie unter dem Flamboyant stehen. Der Mond schimmerte matt durch das Blätterdach, übergoss das Paar – den richtigen Mann und die falsche Frau – mit einem silbrigen Licht. Der Wind ließ rote Blüten auf sie regnen. Bestimmt küssten und liebkosten sie sich wieder, und Alexis kniete sich hin wie ein reuiger Sünder, in der offensichtlichen Absicht, die Lust des Mannes mit dem Mund zu befriedigen (Grasspuren an den Knien zeugten von dem Kniefall). Und dann kam es zu der Tragödie. Irgendwann wanderte die rote Seidenschärpe von Alexis’ Taille zu seinem Hals, der kräftige Mann schnürte der Frau, die keine war, erbarmungslos die Luft ab, bis die zartpurpurn umrahmten Augen aus den Höhlen traten und sämtliche Schließmuskeln erschlafften und ihre Schleusen öffneten.
»Und genau das kapier ich nicht, Conde. Der Mann hat vor ihm gestanden, das verraten uns die Spuren, ja? Aber offenbar hat sich der Transvestit nicht gewehrt, hat den Täter nicht gekratzt und nicht mal versucht, sich zu befreien …«
»Es hat also keinen Kampf gegeben?«
»Wenn überhaupt, dann nur mit Worten. Unter den Fingernägeln ist auf den ersten Blick nichts zu entdecken, aber mit Sicherheit lässt sich das erst nach einer genaueren Untersuchung sagen … Aber da gibt es noch ein zweites Geheimnis. Der Mörder hat angefangen, die Leiche dorthin zu schleifen, dort ins Gras, siehst du? So als wollte er sie in den Fluss werfen. Nach kaum zwei Metern hat er sie dann aber liegen lassen. Warum hat er sein Opfer nicht ins Wasser geworfen, obwohl er doch zuerst daran gedacht hat?«
El Conde betrachtete das Gras, auf das der Mediziner gedeutet hatte. Dann wanderte sein Blick zu der Plane zurück, die die Leiche von Alexis Arayán und damit das rote Kleid bedeckte. Dieser leuchtend rote Farbfleck hatte den morgendlichen Jogger aufgeschreckt, der daraufhin seine Route verlassen und die Leiche entdeckt hatte, auf der bereits die Ameisen herumkrabbelten, angelockt von dem üppigen Festschmaus.
»Aber das wirklich Erstaunliche kommt erst noch! Nach dem Mord hat der Täter dem Transvestiten nämlich den Slip heruntergezogen und seinen After untersucht. Das weiß ich deshalb, weil er seine Finger hinterher an dem roten Kleid abgewischt hat. Was halten Sie von diesem Detail, meine Herren? … Also, so weit mein vorläufiger Bericht. Nach der Obduktion und den Analysen im Labor wissen wir vielleicht mehr. Ich muss euch jetzt leider verlassen, in Alt-Havanna wartet der nächste Tote auf mich …«
»Dann viel Spaß, Todesengel«, sagte El Conde und wandte dem Gerichtsarzt den Rücken zu.
Er sah wieder auf den trüben Fluss, in dessen Wasser er so manches Mal gebadet hatte. In anderen Gewässern allerdings, dachte er mit Heraklit. In weniger schmutzigen jedenfalls, weiter unten bei der Brücke von La Chorrera, wo er und seine Freunde biajacas gefangen hatten und sogar Zierkarpfen, nachdem irgendjemand auf die Idee gekommen war, diese exotischen roten Fische in den Flüssen und Seen der Insel zu züchten. »Also los, Manolo«, sagte er zu seinem Kollegen, »stellen wir uns die Fragen, die der Todesengel aufgeworfen hat. Warum lässt sich jemand strangulieren, ohne sich zu wehren? Warum wirft der Mörder die Leiche nicht ins Wasser? Und warum, zum Teufel, tastet er den After des Opfers ab?«
Sargento Palacios verschränkte wieder seine dünnen Ärmchen vor der hageren Brust. Bei jedem Fall, den er mit El Conde zu bearbeiten hatte, passierte dasselbe. Immer musste er der Erste sein, der sich irrte. »Ich weiß es nicht, Conde«, sagte er deshalb vorsichtig.
Der Teniente sah ihn erstaunt an. »Wie, du weißt es nicht? Du weißt doch sonst immer alles.«
»Heute eben nicht … Sag mal, Conde, was ist eigentlich mit dir los? Du benimmst dich zum Kotzen, Alter …«
El Conde zündete sich eine Zigarette an. Manolo hatte Recht. Was war los mit ihm? »Keine Ahnung, Manolo, aber irgendetwas stimmt nicht mit mir. Kannst du dir vorstellen, dass ich mich gefreut hab, als man mir einen Mordfall übertragen hat und ich die Zentrale verlassen konnte? Mann, ich muss schon ziemlich im Arsch sein, wenn ich mich über einen Toten freue … Und dann noch dieser Arzt, der macht mich fertig, ehrlich.«
Manuel Palacios nickte. Er kannte den Teniente inzwischen gut genug, um dieses Bekenntnis zu schätzen zu wissen. Er beschloss, sich erkenntlich zu zeigen. »Was hältst du davon: Ein ehrenwerter Mann, verheiratet, Kinder, lernt eine Frau kennen. Im Grunde ist er kein Don Juan, aber die Frau ist hübsch, und er ist von seiner Eroberung hin und weg. Er geht mit ihr in den Stadtwald, sie küssen sich, sie befummeln sich, die Frau kniet sich hin, um ihm einen zu blasen, wie der Arzt sich ausdrückt, und dann merkt der Mann, dass er keine Frau vor sich hat, sondern das genaue Gegenteil. Oder anders: Auch der ehrenwerte Mann ist das Gegenteil, ich meine, genauso schwul wie der Tote, und er rächt sich an Arayán wegen irgendeiner alten Geschichte. Eine Abrechnung unter Schwuchteln, wie gefällt dir das? Oder der Typ ist ein Perverser, der es gerne mit Transvestiten treibt und sie hinterher umbringt. Denn in Wirklichkeit hasst er die Tunten, weil er selbst eine ist, aber nicht so richtig dazugehört, weil er groß und dick ist. Klingt doch hübsch, findest du nicht?«