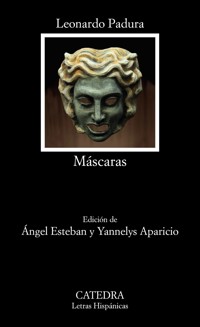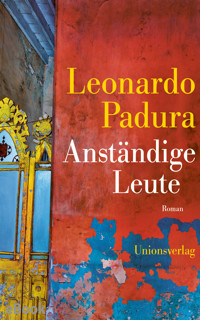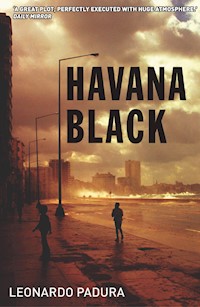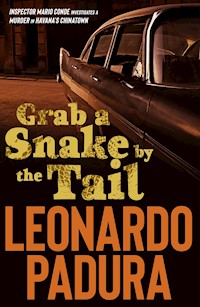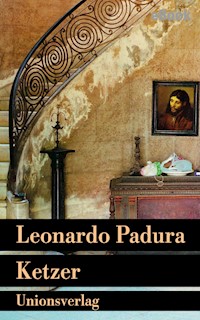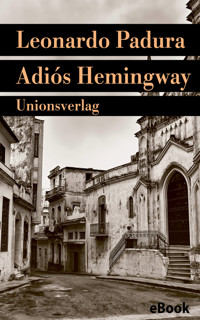12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bobby, ein alter Freund, taucht aus dem Nichts auf und bittet Mario Conde, ihm zu helfen: Die Schwarze Madonna wurde gestohlen. Sie ist nicht nur deshalb von unschätzbarem Wert, weil Bobbys Vorfahren sie aus den Pyrenäen nach Kuba gebracht haben, sondern auch, weil sie angeblich heilende Kräfte hat. Bobby verdächtigt seinen Ex-Freund, sie mitgenommen zu haben, doch Conde merkt bald, dass Bobby nicht so unschuldig ist, wie er anfangs gedacht hat. Seine Suche führt ihn zu gerissenen Kunsthändlern, in die Unterwelt Havannas und mitten hinein in eine Geschichte, in der Gegenwart und Vergangenheit ineinanderfließen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 750
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Ein alter Freund bittet Mario Conde, ihm bei der Suche nach einem gestohlenen Familienerbstück zu helfen. Die Schwarze Madonna soll heilende Kräfte haben und ist von unschätzbarem Wert. Condes Auftrag führt ihn in die Unterwelt Havannas und mitten hinein in eine Geschichte, die ihn immer tiefer in die Vergangenheit zieht.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Die Durchlässigkeit der Zeit
Roman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 5 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2018 im Verlag Tusquets Editores, Barcelona.
Deutsche Erstausgabe
Die Veröffentlichung dieses Werks wurde vom spanischen Ministerium für Kultur und Sport unterstützt.
Die Übersetzung des Mottozitats stammt aus Der Pilgerweg nach Santiago, in: Krieg der Zeit, Suhrkamp 1977. Übersetzt von Anneliese Botond.
Lektorat: Anne-Catherine Eigner
Originaltitel: La Transparencia del Tiempo
© by Leonardo Padura 2018
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit Tusquets Editores, Barcelona, Spanien.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Werner Pawlok, House of Eulalia (Ausschnitt)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31002-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 13:28h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE DURCHLÄSSIGKEIT DER ZEIT
1 – 4. September 20142 – Antoni Barral, 1989–19363 – 5. September 20144 – 6. September 2014, Vorabend des Tags der Jungfrau …5 – Antoni Barral, 19366 – 7. September 2014, Tag der Jungfrau von Regla7 – 8. September 2014, Tag der Barmherzigen Jungfrau von …8 – 9. September 20149 – Antoni Barral, 147210 – 9. September 2014 (Abend)11 – 10. September 201412 – Antoni Barral, 1314–130813 – 11. September 201414 – 12. September 201415 – Antoni Barral, 129116 – 13. September 201417 – 14. September 201418 – 14., 15. und 16. September 201419 – Antoni Barral, 8. Oktober 201420 – 9. Oktober 2014EpilogAnmerkungen des AutorsMehr über dieses Buch
Leonardo Padura: »Kuba ist von Werteverlust und moralischem Verfall geprägt.«
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Spanien
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Religion
Zum Thema Kunst
Für Lucía –wie und warum, ist ja bekannt
Er sagt es jetzt jedem, der es hören will,er komme von dorther zurück,wo er noch niemals gewesen war.
ALEJO CARPENTIER,Der Pilgerweg nach Santiago
1
4. September 2014
Das blendend helle Licht des tropischen Morgens fiel wie der Lichtkegel eines Theaterscheinwerfers durchs Fenster auf den kartonierten Jahreskalender an der Wand. Die zwölf Monatsquadrate waren auf vier Farbfelder verteilt, die ursprünglich unterschiedliche Schattierungen vom jugendfrischen Frühlingsgrün zum winterlich angestaubten Grau aufgewiesen hatten. Bei diesem Farbenspiel war offensichtlich ein fantasiebegabter Grafiker am Werk gewesen, denn auf dieser karibischen Insel gab es schlichtweg keine vier Jahreszeiten. Im Laufe der Monate hatte Fliegenschiss den Kalender mit vereinzelten Pünktchen verziert, und die verblassten Farben zeugten davon, dass er täglich dem gleißenden Sonnenlicht ausgesetzt war. Striche und Kringel zeigten, dass er rege benutzt wurde. Bizarre geometrische Figuren an den Rändern und sogar direkt neben bestimmten Daten deuteten darauf hin, dass sich da jemand Erinnerungshilfen notiert hatte, um ja nicht etwas Wichtiges zu vergessen. Lauter Spuren der vergehenden Zeit und Hinweise auf Vergesslichkeit und ein langsam verkalkendes Gedächtnis.
Die Jahreszahl am oberen Kalenderrand war mit besonders vielen kryptischen Zeichen verziert worden, und der neunte Oktober war umwuchert von Zeichen der Verwunderung, mehr noch, der Bestürzung, so wütend unterstrichen mit schwarzer Kugelschreibertinte, dass diese wie Druckerschwärze wirkte und kaum von den Buchstaben und Zahlen auf dem Kalenderblatt zu unterscheiden war. Und neben diesen Zeichen der Verwunderung die magische Zahlenfolge, die ihm jetzt zum ersten Mal auffiel: 9-9-9.
Seit Beginn dieses trägen, trüben, zähflüssigen Jahres – wie überhaupt in seinem bisherigen Leben – hatte der sonst so geschichtsbewusste und erinnerungsbesessene Mario Conde kaum darüber nachgedacht, was solche Zäsuren in der sich beschleunigenden, dahinrasenden Zeit bedeuteten. Waren das Meilensteine seines eigenen Lebens und der Menschen um ihn herum? Geburtstage, Hochzeitstage und Jubiläen von allerlei denkwürdigen Ereignissen, die für andere ein Grund zum Feiern, Trauern oder einfach Innehalten zwischen Lebensabschnitten waren, vergaß er mit peinlicher Regelmäßigkeit. Doch die alarmierende Tatsache, dass zwischen den dreihundertfünfundsechzig auf diesem billigen Kalender verzeichneten Tagen der unvorstellbare, wenn auch bedrohlich endgültige, reale Tag auf der Lauer lag, an dem er sechzig Jahre alt werden würde, versetzte ihm einen bleibenden Schock. Er wurde immer heftiger, je näher der Stichtag kam: 9-9-9. Welch eine erdrückende Menge an Jahren, und dazu der obszöne Klang des Wortes: Sech-zig, sech-zig. Da platzte etwas, aus dem zischend Luft entwich, sechch-zzig! War das nicht eine endgültige Bestätigung dessen, was sein Körper ihm seit einiger Zeit vermeldete: eingerostete Knie, Lenden und Schultern; eine verfettete Leber; ein immer trägerer Penis? Und erst sein Geist: verkümmerte oder für immer verlorene Träume, Pläne, Wünsche. Das obszöne Nahen des Alters …
Sinnend stand er vor dem an die Wand seines Zimmers geschlagenen Jahreskalender, dessen Einzelheiten vor ihm zerflossen wie eine verschwommene Landschaft. War er nun tatsächlich ein alter Mann? Er antwortete sich mit Gegenfragen: War sein Großvater Rufino mit sechzig Jahren nicht alt gewesen, als er ihn auf die Kampfplätze mitgenommen und in die Künste und Tricks des Hahnenkampfs eingeweiht hatte? Hatte man Hemingway nicht schon Jahre, bevor er sich – mit dreiundsechzig – umbrachte, »den Alten« genannt? Und war Trotzki nicht »der Alte« gewesen, als Ramón Mercader ihm in seinem zweiundsechzigsten Lebensjahr mit einem stalinistisch-proletarischen Eispickel den Schädel zertrümmerte? Doch Conde kannte seine Grenzen und wusste, dass ihn vieles von seinem pragmatischen Großvater und erst recht von Berühmtheiten wie Hemingway, Trotzki oder anderen, aus gutem oder falschem Grund prominenten alten Männern unterschied. Und darum spürte er, dass er zwar die schmerzhafte, deprimierende runde Zahl ansteuerte, aber wenig Gründe hatte, sich als »den Alten« zu bezeichnen. Von allen Ausprägungen des Greisenalters, egal ob definiert von der hochoffiziellen geriatrischen Wissenschaft oder der empirischen Weisheit der Straßenphilosophie, galt für ihn nur die eine: Bald war er ein alter Sack.
Dieser Vormittag hatte schon beim Morgengrauen stickig begonnen. Beim Anblick seines Kalenders sann er mit wachsender Beklemmung den Verbindungslinien zwischen Arithmetik, Statistik, Erinnerung und Biologie nach. Schließlich stand ihm bestürzend und kristallklar die Erkenntnis vor Augen: Selbst im besten aller Fälle (was in seinem Fall nur hieß, weiter am Leben zu bleiben, falls Leber und Lungen mitmachten) hatte er bereits drei Viertel (vielleicht mehr, niemand kann das wissen) seiner maximalen Zeit auf Erden verbraucht. Zahlen lügen nicht. Und sicher war, dass der letzte Lebensabschnitt nicht der erfreulichste sein würde. Alt sein war ein schauriger Zustand – selbst wenn man am Ende kein alter Sack wurde. Nicht nur wegen der Begleitumstände, sondern vor allem, weil die letzten Jahre unter der unerbittlichen Drohung des nahenden Todes standen. Dieser Gleichung kann niemand entrinnen. Zwei und zwei sind vier. Oder besser gesagt: Vier minus drei ist eins. Nur eins ist geblieben, Mario Conde, das eine Viertel deines Lebens!
Es lag nicht an den üblichen körperlichen Beschwerden und existenziellen Frustrationen beim Aufwachen, dass er an diesem Morgen vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten war. Es lag an diesem Warnsignal am Horizont, das unaufhaltsam näher kam. Auch wenn es vielleicht wieder in die Ferne rückte, würde es sich niemals in nichts auflösen. Er wollte leben, weiterleben, und dieses Bedürfnis paarte sich mit einem heftigen Druck auf der Blase. Also unterdrückte er den Wunsch, mit einem guten Buch in der Hand liegen zu bleiben (so viele Bücher wollte er noch lesen, aber immer weniger Zeit blieb, ihrer Herr zu werden!). Auch das ewige Verlangen, endlich selbst mit dem Schreiben zu beginnen, schob er beiseite und fasste den Entschluss, das Bett zu verlassen.
Nachdem er den reichlichen und streng riechenden Morgenurin ausgeschieden hatte, leitete er den nächsten, schon mühseligeren Prozess ein: Sich mit dem nötigen Lebensmut zu wappnen. Es sollte ja nicht so weit kommen, dass der unausweichliche Tod weit vor der Zeit, womöglich durch bloße Entkräftung, eintrat. Kurz und gut, er musste hinaus in die verdammte Welt, sich dem realen Leben, oder was ihm davon noch blieb, stellen, um dieses letzte Stündchen so lange wie möglich hinauszuzögern. Schluss jetzt mit dieser pseudophilosophischen, pseudoliterarischen Selbstbefriedigung!
Während er seinen Kaffee trank, ruhte sein Blick grimmig auf der verfluchten Zigarettenschachtel. Aufs Rauchen hatte er noch immer nicht verzichten können und wollen, und so genehmigte er sich die erste Nikotindosis des Tages. Derweilen betrachtete er seinen friedlich schlafenden Hund, den einst so stürmischen Basura II., der mit den Jahren ebenfalls träger und auch häuslicher geworden war. In letzter Zeit dehnte der ehemals ständig liebestolle Herumstreuner seinen Mittagsschlaf aus und fraß weniger. Untrügliche Alterserscheinungen, die sich auch an seiner grauen Schnauze, seinen trüben Augen und den schwärzer werdenden Zähnen offenbarten. Was für ein Elend, dachte El Conde. Während er den Hund hinter den Ohren kraulte, versuchte er ohne rechte Begeisterung, seinen Tagesablauf zu planen. Der war allerdings recht übersichtlich. Wie an jedem anderen Vormittag würde er auf der Suche nach alten Büchern durch die Stadt streifen und danach irgendwo ein leicht verdauliches Mittagessen zu sich nehmen. Oder vielleicht – falls er bei Yoyi El Palomo, seinem Geschäftspartner, Station machte – etwas wirklich Nahrhaftes essen. Danach würde er, mit oder ohne Rum, bei seinem Freund, dem dünnen Carlos, vorbeigehen, um dann bei Tamara, wo er durch zwei Tage unentschuldigter Abwesenheit geglänzt hatte, die Nacht zu verbringen. Dies alles bot wenig Überraschung, doch auch keinen Grund zur Klage: Arbeit, Freundschaft, Liebe, alles ein wenig abgenutzt, auch alt geworden, aber immer noch solide und real. Das Beschissene, gestand er sich ein, war seine Geistesverfassung, diese ewige Tristesse und Melancholie. Nicht nur aufgrund dieses bedrohlich runden Geburtstags, der so übel nach nahendem Alter klang und sicher überaus üble Konsequenzen hatte, sondern weil er vom Leben unendlich enttäuscht war. Was konnte er an der Schwelle der sechzig Jahre vorweisen? Nichts. Rein gar nichts! Was erwartete ihn, worauf konnte er hoffen? Dasselbe Nichts, aber im Quadrat. Mehr fiel ihm nicht ein als Antwort auf diese einfachen, bohrenden Fragen. Schlimm war das alles! Und was noch beunruhigender war: So viele Menschen seines Alters, Bekannte oder Fremde, wussten in diesen Zeiten auch keine bessere Antwort.
Inzwischen angekleidet, stellte er Basura II. ein paar Essensreste hin und gewährte ihm ein paar Streicheleinheiten, bei denen er gleich auch einige Zecken aus dem Fell entfernte. Dann gönnte er sich die dritte und letzte Tasse aus seiner italienischen Kaffeekanne, was seine Stimmung ein wenig aufhellte.
Da ließ ihn das Läuten des Telefons hochschrecken. Seit einiger Zeit versetzten ihn Telefonanrufe am frühen Morgen oder späten Abend in Alarmbereitschaft. So viele Leute um ihn herum waren in seinem Alter. Da konnte jeder Anruf eine Todesnachricht oder die Ankündigung eines nahenden Todes bedeuten.
»Ja?«, meldete er sich lauernd, wie immer das Schlimmste befürchtend.
»Spreche ich mit Mario Conde?«, fragte eine Stimme, langsam und zögerlich.
Mario konnte sie nicht identifizieren. Ein Unbekannter. »Ja«, antwortete er, neugierig geworden. »Was wollen Sie?«
»Du weißt nicht, wer hier spricht, oder?«
Die Neugier war wie weggeblasen. So eine Frage am Telefon brachte ihn zur Weißglut. Und an diesem Morgen, den er mit existenzialistischen Fragestellungen begonnen hatte, reizte sie ihn wie einen wilden Stier. »Zum Henker, lassen Sie diese Spielchen!«
»Entschuldige«, bat die Stimme, jetzt rasch und entschlossen. »Hier ist Bobby, Bobby Roque, der aus der Oberstufe. Erinnerst du dich?«
Conde schloss die Augen, nickte und begann zu lächeln. Tief in seinen Hirnwindungen regten sich verschüttete Erinnerungen, denen der wohlig modrige Geruch fernster Vergangenheit anhaftete. Ja, natürlich erinnerte er sich.
Roberto Roque Rosell. Ro-Ro-Ro … Der Gleichklang seiner beiden Familiennamen erhielt mit dem Vornamen Roberto den letzten Schliff. Drei R’s und drei O’s, robust, rund, rau – es passte vorzüglich zur strahlenden Zukunft, die seinem Leben zugedacht war, als mache tatsächlich, wie man so leichthin sagt, der Name den Menschen aus. Vielleicht darum weigerten sich seine Eltern, ihn mit Kosenamen wie Robertico oder Robby zu rufen. Von der Wiege an, als er noch ein dralles Baby war, nannten sie ihn Robertón, als wollten sie ihn mit diesem würdevollen Rufnamen auf eine erfolgreiche Lebensbahn bringen. Denn seine Erzeuger hatten Großes vor mit ihrem Sprössling und hofften, er würde ihnen Ehre machen.
Als Conde mit ihm in einer der Klassen der Oberstufe von La Víbora saß – zusammen mit dem dünnen Carlos, Andrés, dem Hasenzahn, dem roten Candito und natürlich auch Tamara und Rafael Morín –, war Robertón zu einem schmächtigen, immer hungrigen Jungen herangewachsen, zwei oder drei Zoll größer als seine Mitschüler, allerdings mit ein paar Pfund zu wenig, sodass seine schlottrige Erscheinung, zum Leidwesen der Eltern, keineswegs imposant war. Und jedermann nannte ihn Bobby. Nicht weil Bobby einer der vielen damals angesagten angloamerikanischen Modenamen war, auch nicht, weil Bobby Fischer sich zu der damaligen Zeit auf dem Gipfel seiner exzentrischen Berühmtheit befand. Nein, Bobby war Bobby, weil man mit dem Namen genau das verband, was an ihm auffiel: Mit seinen fünfzehn, sechzehn Jahren war der ehemals hoffnungsvolle Robertón etwas doof und eher schlaff – oder wie man es in der Sprache von Mario und seiner Clique ausdrückte: irgendwie schwul.
Obwohl sie nie wirklich Freunde waren, schufen die gemeinsamen Jahre in derselben Klasse eine gewisse Nähe zwischen Conde, Carlos, dem Hasenzahn, Andrés und dem unscheinbaren Bobby, mit dem sie in Wirklichkeit nicht viel gemein hatten. Über Baseball wollte er nicht reden, und im Studienfach Politik plapperte er nur die gängigen Parolen nach. Sein Musikgeschmack war zudem abartig, er zog Maria Callas den Beatles und sogar den Creedence Clearwater Revival vor. Allerdings brillierte er in den naturwissenschaftlichen Fächern, worauf seine Mitschüler während des hastigen Büffelns jener bockigen Materie kurz vor den Prüfungen gerne zurückgriffen. Conde und seine Freunde hatten ihn als eine Art Tutor in ihre Gruppe aufgenommen und boten ihm als Gegenleistung Schutz vor den Grausamkeiten und Spötteleien seitens der anderen Mitschüler, die nur auf eine Gelegenheit warteten, ihn fertigzumachen, sobald er irgendeine Schwäche – zum Beispiel für Maria Callas! – zeigte.
Sie analysierten ihn gemeinsam und kamen zu dem Schluss, dass Bobby noch nicht wirklich homosexuell war, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit jedoch aufgespießt werden würde. Und nicht etwa durch einen von Paris oder Pandaros abgeschossenen Pfeil wie die griechischen Helden der Ilias, über die Bobby zu sprechen pflegte, als hätte er sie persönlich gekannt. »Kommt es euch nicht etwas merkwürdig vor, dass er ständig von Achilles schwärmt, he?«, fragte der Hasenzahn, der unerschütterlich für die Trojaner und gegen die gehörnten Griechen Partei nahm. Der dünne Carlos, der damals noch dünn, aber bereits der barmherzige Samariter war, der er sein Leben lang bleiben würde, nahm sich sogar vor, Bobby vor dem fatalen Fehltritt zu bewahren. Er betrachtete es als seine Aufgabe, eine Retterin unter den Freundinnen seiner damaligen Freundin Dulcita zu suchen, doch seine Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt: Weder Dulcitas Freundinnen noch Bobby zeigten Interesse an einer körperlichen Rettungsmaßnahme. Aus jedem neuen Annäherungsversuch wurde im Handumdrehen eine Herzensfreundschaft, bei der zwei Vertraute miteinander tuschelten, kicherten und Hand in Hand über den Schulhof gingen.
Als die Freunde sich nach dem Abitur auf verschiedene Fakultäten verteilten, sah Conde Bobby weniger häufig. Manchmal begegneten sie sich in der Universitätskantine, gelegentlich trafen sie sich auf einer der politischen Pflichtveranstaltungen der Studentenvertretung, oder sie fuhren im selben Bus. Immer begrüßten sie sich herzlich, Bobby sogar beinahe freudig, aber viele Worte wechselten sie nicht. Beide spürten wohl, dass sie nun in verschiedenen Welten lebten und sich immer weniger zu sagen hatten. Einmal begegnete Conde – noch am selben Abend musste er den Freunden darüber berichten – zu seiner Überraschung Bobby in einer der Bars nahe der Universität, wo sich das Wunder ereignen konnte, am Nachmittag in Havanna Bier zu bekommen. Und Bobby war in Begleitung einer Frau, die er als seine Freundin vorstellte. Das Mädchen, so befand Conde wohl aufgrund seiner Vorurteile, war nicht wirklich eine Schönheit – sehr viel kleiner als Bobby, etwas dicklich, in Aussehen und Verhalten ziemlich burschikos. Dennoch freuten sie sich alle über Bobbys Eroberung. Nur der Hasenzahn, Experte in Sachen Dialektik der Historie, warf ein, dass dieser aktuelle Zustand keineswegs ewigen Bestand haben müsse. »Der gute alte Bobby kann doch auch bisexuell sein, nicht wahr? Wie Achilles, der Flinkfüßige!«
Bei dieser Begegnung, die legendär werden sollte, war Bobby ausgelassen und glücklich gewesen, denn er feierte seine ehrenvolle Aufnahme in die exklusive Kommunistische Jugend. Er lud Conde ein, ein paar Bier zu trinken, mit ihm, seinem roten Parteibuch (Studium! Arbeit! Gewehr!) und seiner Freundin (Yumilka? Katjuschka? Matrjoschka?), die er sehr häufig und sehr feucht küsste. Doch danach löste sich der Junge in Luft auf, wie das Phantom der Oper. Das war wohl 1978 gewesen, als Conde nach dem dritten Jahr sein Studium aufgeben musste, um nicht einen frühen Hungertod zu erleiden. Der Eintritt in die Polizeiakademie gab dem, was sein Leben hätte werden können (zeitlebens ein bohrender Gedanke), eine radikale Wendung. Von da an war Bobby aus Condes Leben verschwunden, sogar aus den nostalgischen Erinnerungen, in die er hin und wieder mit seinen Freunden eintauchte. Nur hin und wieder tauchte der Geist jenes undefinierbaren Jungen plötzlich wieder auf: Was zum Teufel ist wohl aus Bobby geworden? Ist er in den Norden gegangen wie so viele, viele Leute? Nein, nicht Bobby, nicht dieser Rotgardist. Oder vielleicht doch, wie so viele andere angebliche Orthodoxe, die aus der einen Orthodoxie in die andere gewechselt waren?
Als vor Conde ein androgynes Wesen auftauchte, mit aschblond gefärbten Haaren und einem Ring im linken Ohrläppchen, mit nachgezogenen Augenbrauen und einem strahlenden Lächeln auf dem bereits von ein paar rebellischen Falten gezeichneten Gesicht, war sein Hirn unfähig, die Verbindung zu dem zuletzt gespeicherten Bild von Bobby herzustellen: das Bierglas in der einen Hand, den anderen Arm um Yumilkas (Swetlanas?) Schultern gelegt, die Augen überschäumend vor Freude und militantem Männerstolz. Conde wusste, dass er es war, sein musste, denn am Telefon hatten sie sich um diese Zeit (»perfekt, um fünf also«) verabredet (»ja, bei mir zu Hause, wie früher, dasselbe Haus, nur älter und kaputter … wie alles, wie wir alle«).
»Hey, du, du siehst ja noch genau gleich aus!«, begann der soeben Eingetroffene, während sein Gastgeber sich noch am Türgriff festhielt und fassungslos glotzte.
»Beleidige mich nicht, Bobby«, erwiderte er, nachdem er sich von dem Schock erholt hatte. »Wenn ich schon vor vierzig Jahren eine solche Visage hatte, dann war ich schon damals ziemlich am Arsch. Aber du, du hast dich verändert.«
»Nicht wahr? Wie gefällt dir mein Look?«, fragte der andere, um dann leise hinzuzufügen: »Made in Miami, Alter! Ehrlich gesagt, ich färbe die Haare jetzt, um die grauen Strähnen zu übertönen. In meinem Alter … Vade retro!«
Conde empfand, dass der extravagante, feminine Look ungeheuer gut zu Bobby passte. Denn auch seine Persönlichkeit hatte sich radikal verändert, was die wenigen Sätze, die sie miteinander gewechselt hatten, deutlich machten. Dass Bobby sich nun als das akzeptierte, was er immer hatte sein wollen, hatte ihn von seiner großen Schüchternheit befreit. Die Person, in die er sich verwandelt hatte, strahlte eine heitere Unbeschwertheit aus. Nichts erinnerte mehr an den in sich gekehrten, niedergedrückten, fast konnte man sagen, unterdrückten Jungen. Als hätte er sämtliche Taue gekappt und wäre zu einem völlig anderen Menschen geworden: Der Segen der Freiheit.
»Siehst gut aus«, sagte Conde, immer noch perplex. »Komm rein. Du lebst also jetzt in Miami?«
»Nein, nein«, stellte der andere richtig. »Look und Färbemittel sind aus Miami. Der Rest ist hundert Prozent kubanisch. Apropos, dir würde es auch guttun, deine Haare zu färben. Hier, die grauen Härchen. Ein Dunkelbraun wäre gut!«
Bevor Conde die Tür schloss, sah er sich nach allen Seiten um. Der Gedanke, die Leute aus dem Viertel könnten sehen, wie er »so einen« ins Haus ließ, behagte ihm nicht besonders, obwohl … nach all den Jahren hatte er wohl keinen guten Ruf mehr zu verlieren.
Er führte Bobby in die Küche, bot ihm einen Stuhl an und ging zum Herd, entzündete eine Flamme und stellte die vorbereitete Kaffeekanne darauf. »Möchtest du ein Glas Wasser?«, fragte er seinen Gast, der sich mit einer müden Geste den Schweiß von der Stirn wischte.
»Hast du Mineralwasser? Oder wenigstens abgekochtes?«
»Mineralwasser? Abgekochtes Wasser?«, fragte Conde verblüfft zurück.
»Vergiss es. Ich hab mein Wasser immer dabei.« Bobby öffnete seine farbenfrohe Schultertasche, entnahm ihr eine etikettierte Flasche Wasser, stellte sie auf den Tisch und legte einen Briefumschlag daneben. »Man muss auf seine Gesundheit achten. Bazillen, Viren, der ganze Mist, der in der Luft herumfliegt. Cholera! Ebola! Chikungunya! Schon die Namen klingen schrecklich! Wie Stiche ins Kleinhirn.«
»Recht hast du«, sagte Conde. »Nächstes Jahr fang ich an, Wasser abzukochen.«
»Ach, du wieder … der ewige …«
»Ewige was?«
Bobby zögerte einen Moment, bevor er antwortete: »… Macho …«
»Scheiße, Bobby, sogar das ist vorbei. Ich hab zu hohen Blutdruck, und weil ich mein Wasser nicht abkoche, bin ich wohl bald unter der Erde.« Er ging zum Herd und stellte fest, dass der Kaffee fast durchgelaufen war.
»Für mich ohne Zucker!«, rief Bobby, als Conde die Kanne vom Herd nahm.
»Kaffee ohne Zucker?«
»Wegen der Gesundheit. In unserem Alter muss man auf sich aufpassen.«
»Hör mir bloß damit auf!« Conde reichte seinem Besucher eine Tasse und löffelte dann Zucker in seine eigene. Während sie ihren Kaffee tranken, unterzog er seinen ehemaligen Schulkameraden einer genaueren Inspektion. Es war Bobby und war es doch wieder nicht. Etwas fester war er geworden, nicht viel, aber genug, um wohlproportioniert auszusehen. Nur sein Gesicht war schmaler geworden nach so vielen Jahren, aber auch, vermutete Conde, weil sich seine Geisteshaltung verändert hatte. Und noch etwas überraschte ihn: Abgesehen von dem Ohrring, den aschblond gefärbten Haaren und den nachgezeichneten Augenbrauen, trug Bobby ein Armband mit blauen Glasperlen, Zeichen seiner Initiation in die Santería, die so pragmatische afrikanische Religion, die es geschafft hatte, allen Angriffen der christlichen Kolonialisierung, der bürgerlichen Moral der Republik und sogar, in den letzten fünfzig Jahren, der marxistisch-atheistischen Offensive zu widerstehen. Bobby, der stramme Parteisoldat, war also Santero geworden.
»Erzähl mir von deinem Leben«, forderte er Bobby auf. Er zündete sich eine Zigarette an – womit er sich vermutlich über irgendeine Gesundheitsvorschrift seines Besuchers hinwegsetzte –, stieß den Rauch aus und hörte zu.
»Es ist so viel passiert, Conde!«, begann der andere und unterstrich die Worte mit einer feinen, femininen Geste. »Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, Junge.«
»Wo es dich am meisten kratzt«, schlug Mario vor. »Mit dem Ohrring und den blonden Haaren zum Beispiel, ich weiß nicht …«
Bobby lächelte irgendwie traurig. »Aschblond, Conde. Das ist eine lange, lange Geschichte, aber ich wills kurz machen. Ich habe geheiratet, wir bekamen zwei Söhne, die inzwischen erwachsene Männer sind, richtige Männer übrigens.«
»Wie schön!« Conde kam nicht aus dem Staunen heraus. »Hast du das Mädchen von der Universität geheiratet? Yumilka?«
»Katjuschka!«, rief Bobby und fügte schnell hinzu: »Katjuschka, diese Schlampe! Du erinnerst dich an sie?«
»Was hat Katjuschka dir angetan? Hat sie dir Hörner aufgesetzt, so hässlich, wie sie war?«, fragte Conde zurück, um nicht antworten zu müssen.
Bobby sah ihn so hilflos an, dass der ehemalige Polizist in dem Mann, den er vor sich hatte, zum ersten Mal den schwächlichen Jungen von früher erkannte: ein Anflug von Verzweiflung mit ein wenig Traurigkeit, viel Zerbrechlichkeit und sehr viel Angst.
»Nein, Katjuschka hat mir keine Hörner aufgesetzt, und ich hab sie auch nicht geheiratet. Katjuschka hat mir mein Leben versaut. Oder gerettet, ich weiß es nicht. Aber das ist nicht die Geschichte, die ich dir erzählen wollte. Egal, hier mein Lebenslauf, in aller Kürze: Nach dem Studium heiratete ich Estela, Estelita, die Mutter meiner beiden Söhne. Alles ging seinen normalen Gang, bis ich bei einem meiner Geschäfte Israel kennenlernte und … da hat es bei mir gefunkt! Ich hab mich verliebt wie ein Hund … Nein, wie eine räudige Hündin!«
Vielleicht läuft Bobbys großartige Geschichte nur auf eine plötzliche Befreiung heraus, dachte Conde.
Der Besucher schlürfte den Rest Kaffee aus seiner Tasse und zeigte auf die Zigarettenschachtel.
»Schadet das nicht der Gesundheit?«, fragte Conde.
»Tut es«, sagte Bobby, »aber jetzt ist mir danach.« Er zündete sich eine Zigarette an und stieß demonstrativ genussvoll den Rauch aus. »Sag mal, Conde, hast du inzwischen was geschrieben?«
»Ja, ich hab da was«, sagte Mario, was ja auch stimmte, aber aus irgendeinem Grund, den er selbst nicht kannte, schmückte er seine Antwort ein wenig aus, als müsste er sich vor der Welt rechtfertigen. »Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Aber vergiss es, erzähl weiter.«
»Na ja, ich trennte mich von Estela und zog zu Israel. Etwa zehn Jahre waren wir zusammen, bis er nach Miami ging, weil er die Hitze nicht länger ertragen konnte.«
»In Miami soll es aber auch verdammt heiß sein. Oder stimmt das nicht?«
»Ach, das mit der Hitze ist so eine Redensart. Israel ertrug es einfach nicht mehr. Du weißt schon, die allgemeine Lage, die Sache …« Er machte eine Geste, als wollte er den gesamten Globus umfassen.
»Ach ja, die Sache.« Conde nickte. »Und dann?«
»Na ja, das Übliche. Ich hatte mehrere Beziehungen, bis ich vor etwa zwei Jahren Raydel kennenlernte. Und wieder verliebte ich mich wie eine räudige Hündin, eine verrückte und dazu noch alte!«
»Es ist schön, sich zu verlieben«, sagte Conde, der jederzeit bereit war, aufs Neue in jenen Zustand der Gnade und Wehrlosigkeit zu verfallen, auch wenn es in seinem Fall immer nur Frauen gewesen waren. Und seit vielen Jahren ein und dieselbe Frau.
»Aber gefährlich, sehr gefährlich. Deswegen bin ich hier.«
»Weil du verliebt bist?«
»Wegen der Folgen.«
»Jetzt versteh ich gar nichts mehr.«
Bobby drückte die halb aufgerauchte Zigarette im Aschenbecher aus, nachdem er einen letzten gierigen Zug getan hatte, genau in dem Augenblick, als Conde sich eine zweite aus der Schachtel nahm und anzündete. »Also, wie soll ich es dir erklären …« Bobby fuhr sich mit der Hand über seine aschblonden Haare und blinzelte mehrmals. »Es ist so furchtbar, Alter! Raydel hab ich bei meinem Patenonkel kennengelernt«, begann er und berührte das glitzernde Perlenarmband an seinem Handgelenk. Dann beugte er sich zu einer Seite hinunter, drückte die Fingerkuppen auf den Boden und führte sie schließlich an die Lippen. »Ich bin jetzt seit achtzehn Jahren Santo. Yemayá …«
»Aber warst du nicht einer von den historisch-dialektischen Materialisten?«, fragte Conde, der Bobbys Ritual interessiert verfolgt hatte und es sich nicht verkneifen konnte, ein wenig auf jemandem herumzuhacken, der früher die Parolen und Glaubenssätze des Marxismus nachgebetet hatte, um dann einer der primitiven afrokubanischen Religionen beizutreten, die laut Marx wie alle Religionen natürlich Opium waren.
»Ich hab mich hinter einer Maske verborgen, Conde, wie fast alle. Mein ganzes Leben lang musste ich verstecken, dass ich von Kopf bis Fuß schwul bin und dass ich an Gott und die Heilige Jungfrau glaube. Die ersten vierzig Jahre meines Lebens musste ich mich verstellen, mich unterdrücken und quälen, damit meine Eltern, damit ihr, meine Mitschüler, damit alle Welt in diesem machistisch-sozialistischen Land glaubte, ich sei der, der ich zu sein hatte, und man mir nicht das Leben schwer machte: ein mustergültiger Junge, männlich, militant, atheistisch und gehorsam. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mein Leben war, wirklich nicht.«
Conde enthielt sich jeden Kommentars. Er kannte sich gut mit der Heimlichtuerei und dem Druck aus, den so viele Leute hatten aushalten müssen, um in einer Gesellschaft überleben zu können, die sich vorgenommen hatte, das ethische, politische und soziale Verhalten aller zu kontrollieren und jede abweichende Äußerung gnadenlos zu unterdrücken. Und Bobby schien das perfekte Opfer gewesen zu sein.
»Also, wie gesagt, ich lernte Raydel im Hause meines Patenonkels kennen. Raydel war soeben aus Palma Soriano gekommen, aus der Gegend um Santiago de Cuba, und verkaufte Tiere an die Santeros. Du hättest ihn sehen müssen: ein Viertelmulatte mit atemberaubenden Augen, Wimpern, einem Mund …!«
»Das reicht«, unterbrach ihn Conde. »Du hast dich also verliebt. Und dann?«
»Ich habe ihn gebadet, um ihn von dem Ziegengestank zu befreien, und dabei ist es passiert. Danach hab ich den Goldschatz mit nach Hause genommen. Zwei Jahre haben wir zusammengelebt, es war wie in einem Traum. Dann hat Israel mich nach Miami eingeladen, und die Herren Imperialisten waren so verrückt, mir das Visum zu erteilen. Ich fuhr für zwei Monate hin, um Israel zu treffen und bei der Gelegenheit geschäftliche Dinge zu regeln.«
»Geschäfte?« Conde zog eine Augenbraue hoch. Sein alter Schulkamerad steckte voller Überraschungen. Jetzt also auch Geschäftsmann.
»Ja, An- und Verkauf wertvoller Dinge. Kunstgegenstände, Juwelen, teures Zeug …«
»Und als du zurückkamst, war Raydel ausgeflogen, mit allem, was er in die Finger kriegte.«
Bobbys Überraschung war echt. Er blinzelte unaufhörlich, als könnte er nicht glauben, was er gehört hatte.
»Scheiße, Bobby«, kam ihm Conde zu Hilfe, »ich bin kein Santero und kein Hellseher, aber ich war zehn Jahre Polizist, vergiss das nicht. Ich bin sicher, dass du nach mir gesucht hast und jetzt hier bist, weil dir irgendwas Schlimmes passiert ist.«
Bobby nickte, und auf seinem Gesicht spiegelte sich unendliche Traurigkeit wider. »Er hat alles mitgenommen, Conde, alles … Die Juwelen, den Fernseher, sogar die Glühbirnen und die Töpfe!«
»Scheiße!«
»Zum Glück hatte ich vor meiner Abreise vieles verkauft, um an Dollars zu kommen und in Miami ein Geschäft aufzuziehen, was mir auch gelungen ist. Aber Raydel ist mit einem Lastwagen gekommen und hat einen richtigen Umzug gemacht. Die Matratze! Den Topf, in dem ich das Wasser abgekocht habe, um die Bazillen abzutöten!«
»Und hast du ihn bei der Polizei angezeigt?«
Bobby schüttelte langsam den Kopf, als wehrte er sich gegen etwas in seinem geheimsten Innern. »Ich bin noch immer verliebt! Wenn ich ihn anzeige, geht er in den Knast und …«
Conde warf die Kippe aus dem Fenster. Er zwang sich, Bobby und seine sentimentale Schwäche nicht zu verurteilen, schließlich hatte auch er sich in Liebesdingen so manche Dummheit geleistet. Oder besser gesagt, alle möglichen Dummheiten. Allerdings mit Frauen, beruhigte er sich – ganz der Macho.
»Und wann bist du aus Miami zurückgekommen?«
»Vor … acht Tagen«, rechnete Bobby nach.
»Uff, acht Tage sind eine lange Zeit! Und was soll ich nun …?« Conde verstummte alarmiert, als er endlich begriff, worum es hier ging, und wechselte das Thema: »Verdammt, Bobby, wie hast du mich gefunden?«
»Durch Yoyi El Palomo natürlich. Ich habe ihn gebeten, dir nichts zu erzählen, ich wollte dich überraschen.«
Conde sah seinen ehemaligen Mitschüler jetzt nicht mehr wie einen Schwulen an, mit gefärbten Haaren und gezupften Augenbrauen, nicht wie einen Gläubigen und Geschäftsmann aus Havanna, der seine Fühler bis nach Miami ausstreckte, sondern wie einen Außerirdischen.
»Und woher kennst du El Palomo?«
»Geschäfte … Hör zu, Conde«, versuchte Bobby zu erklären, »ich hab zwei oder drei Mal mit Yoyi Geschäfte gemacht, wertvolle alte Bücher und einige Gemälde von kubanischen Malern. Als er hörte, was mir passiert war, und weil er wusste, dass wir beide uns von der Oberstufe kennen, dass wir mal Freunde waren, da hat er mir geraten, zu dir zu gehen. Du seist zwar kein Polizist mehr, hat er gesagt, aber hin und wieder würdest du dich überreden lassen, Leute oder Dinge zu suchen. Und weil ich dir vertraue …«
Mario konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Wie klein war doch die Welt! Da hatte Bobby also von seinem Geschäftspartner El Palomo ein paar wertvolle Bücher gekauft, die er, Conde, auf seiner Jagd quer durch Havanna aufgestöbert hatte. Und weil sein Kompagnon ihm außerdem hin und wieder Arbeit als Privatdetektiv verschaffte, saß Bobby nun vor ihm und schmeichelte sich unter Berufung auf alte Zeiten bei ihm ein.
»Verdammt, Bobby, du musst verrückt sein, wenn du alles glaubst, was El Palomo sagt.«
»Ach, mein Freund, du musst mir helfen«, unterbrach ihn Bobby und ergriff seine Hand. »Ich möchte Raydel nicht anzeigen, ich hoffe nicht mal darauf, dass er mir einige der wertvollen Stücke zurückgibt. Aber meine Jungfrau von Regla …«
»Hat der Typ sogar die Heiligen mitgehen lassen?«
»Ich habs dir doch gesagt, Conde. Alles, wirklich alles. Außer den Halsketten und dem weiten Mantel von Yemayá. Anscheinend hat er Angst gekriegt und diese Sachen nicht angerührt. Aber die Statue der Jungfrau von Regla hat er mitgenommen.«
»Und du willst allen Ernstes eine Marienstatue zurückbekommen, die du in jedem Laden kaufen kannst?«
»Das ist nicht irgendeine Marienstatue, Conde! Es ist meine, meine! Die schwarze Jungfrau ist meine Mutter!« Bobby stöhnte auf, am Boden zerstört. »Du musst wissen, diese Jungfrau von Regla gehörte meiner Großmutter, ihr Papa hat sie ihr geschenkt, als sie noch ein kleines Mädchen war. Und als ich Santo wurde und Yemayá empfing, die ja auch die Jungfrau von Regla ist, das weißt du doch, da hat sie mir die Statue geschenkt. Nein, Junge, das ist nicht irgendeine Jungfrau. Sieh mal, wie schön sie ist!«
Aus dem Umschlag, den er auf den Tisch gelegt hatte, zog Bobby mit leicht zitternden Händen zwei Farbfotos im Format 5 × 7. Auf einem war er selbst zu sehen, ein paar Jahre jünger, weiß gekleidet und mit rituellen Halsketten angetan, vor einem kleinen Wandaltar, auf dem sich die Statue einer schwarzen Muttergottes befand. Sie saß majestätisch auf einem thronartigen Stuhl, in einen weiten blauen, silbrig durchbrochenen Mantel gehüllt, eine kleine goldene Krone auf dem von einem königlich anmutenden Tuch bedeckten Kopf. Auf ihrem rechten Knie stand, von ihrem Arm umfangen und schwarz wie sie, das Jesuskind. Es lehnte sich an die mütterliche Brust, hielt in seiner Linken eine Erdkugel und hatte die Rechte erhoben. Der rechte Arm der Madonna war nach vorn gerichtet, aber die Hand sah Mario nicht. Bobbys Körper als Maßstab nehmend, schätzte er, dass die Statue etwa vierzig oder fünfzig Zentimeter hoch sein musste, etwas größer also als die serienmäßig hergestellten Statuen, die für Hausaltäre gedacht waren.
»Fehlt der Jungfrau die rechte Hand?«
»Ja, die muss wohl irgendwann abgebrochen sein. Ich kenne sie nur so, ohne die rechte Hand. Aber sag mal, mein Lieber, ist sie nicht wunderschön?«
Das zweite Foto zeigte ein Dreiviertelprofil der Madonna. Hier konnte Mario ihre Gesichtszüge besser erkennen: schwarz, aber dennoch eher mediterran als afrikanisch, mit einem grünlichen oder bläulichen Schimmer in den leicht geschlitzten Augen. Ihr aus schwarz glänzendem Holz geschnitztes Gesicht war von friedvoller, tiefer Schönheit. Der Ausdruck von Güte und zugleich ernster Strenge wurde durch ihre königliche Haltung noch unterstrichen.
»Ja, sie ist wirklich schön«, musste Conde zugeben, »und ungewöhnlich, nicht wahr?« Er rückte die Brille zurecht, die er aufgesetzt hatte, um sich die Fotos genauer anzusehen, und kniff zusätzlich die Augen zusammen. »Ich kenn mich da ja nicht so aus, aber ich glaube, ich hab noch nie eine Jungfrau von Regla auf einem Stuhl sitzen sehen. Irgendetwas ist da …«
»Genau deswegen bin ich hier, Alter«, unterbrach ihn Bobby. »Weil sie etwas hat. Diese Jungfrau ist eine Reliquie, sie begleitet meine Familie seit ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Und sie ist mächtig! Wirklich mächtig! Conde, du musst mir helfen, Raydel zu finden und ihn dazu zu bewegen, mir meine kleine Jungfrau zurückzugeben. Du bist der Einzige, zu dem ich Vertrauen habe. Du musst mir helfen, wegen der alten Zeiten, wegen unserer Freundschaft, ja?«
Als Bobby gegangen war, rief Conde unverzüglich seinen Freund Carlos an, um ihm von dieser sensationellen Begegnung zu erzählen. Bobby Roque persönlich! Bobby in voller Entfaltung! Santero und Geschäftsmann! Mit gebrochenem Herzen, von einem Adonis aus Santiago um sein Hab und Gut gebracht! Carlos nahm Conde das Versprechen ab, so bald wie möglich bei ihm vorbeizukommen, um ihm in allen Einzelheiten die wunderbare Wiederauferstehung von Roberto Roque Rosell zu schildern. Und unterwegs solle er natürlich eine Flasche Rum kaufen. Und er solle nicht vergessen, dass in einem Monat sein Geburtstag anstehe und sie … Conde verabschiedete sich und legte auf.
Um sich von seinem Schock zu erholen und Antworten auf seine Fragen zu finden, fuhr er mit einem Privattaxi zu Yoyi El Palomo und dachte unterwegs darüber nach, was er soeben erlebt hatte. Sein früherer Klassenkamerad wollte ihn engagieren. Bei Geld höre die Freundschaft auf, hatte Bobby gesagt und angeboten, sechzig Dollar pro Tag zu zahlen – das gefürchtete Wort »sechzig« klang auf einmal wohltuend und vielversprechend. Dazu tausend, wenn er die Muttergottes zu ihm zurückbringe. So groß war seine Verehrung für eine ganz gewöhnliche Statue? War sie nicht nur ein Stück Holz oder Gips, dem äußere Merkmale wie Mantel, Krone oder Farben ein besonderes Aussehen verliehen? War die Tatsache, dass es sich um eine Art Familienreliquie handelte, so wichtig für den neuen, authentischen Bobby? Und was hatte es mit der Bemerkung auf sich, sie sei mächtig? Conde, trotz seines latenten Mystizismus eine Mischung aus Agnostiker und Atheist, fühlte sich nicht imstande, Bobbys mystische, fast liebevolle Beziehung zu einer kleinen Figur zu verstehen, deren spirituelle Bedeutung nur in dem bestand, was die Gläubigen ihr zuschrieben, wobei in diesem Fall die familiäre Bedeutung hinzukam.
Yoyi erwartete ihn vor seinem Haus. Er trug eine weiße Leinenhose und ein noch weißeres Hemd, unter dem sich sein wie bei einem Täuberich gewölbter Brustkorb abzeichnete. Darauf glänzte an einer dicken goldenen Halskette baumelnd ein Medaillon aus massivem Gold – mit dem Abbild der Jungfrau Maria in der Version der Barmherzigen Jungfrau von Cobre. Am Bordstein funkelte, nagelneu lackiert, die Schnauze Richtung Stadtzentrum, sein Cabrio, ein Chevrolet Bel Air Baujahr 1957. Die Jungfrau Maria mochte wissen, auf welchen Wegen der Lack aus der Fabrik von Ferrari zu Yoyi gelangt war …
Die beiden Männer gaben sich die Hand. Conde ließ sich in einen der Schaukelstühle fallen und rückte ihn zurecht, sodass er seinem Gastgeber ins Gesicht sehen konnte.
»Dann war der Kunde also schon bei dir?«, fragte Yoyi mit seinem schönsten spöttischen Lächeln.
»Vor einer Stunde ist er gegangen.«
»Und, wie fandest du Bobby? Eine echte Type … Und als er mir erzählt hat, was ihm passiert ist, hab ich zu mir gesagt: ein Job für Conde!«
»Und warum hast du mich nicht vorgewarnt, Kollege?«
»Scheiße, man, weil Bobby gesagt hat, dass ihr Freunde wart, und weil ich weiß, dass dich alles interessiert, was mit der Oberstufe von La Víbora zu tun hat. Und, ach ja, weil ich dein Geschäftspartner und Manager bin und weiß, dass du die hundert Dollar Tagesgage gut gebrauchen kannst.«
Conde hob eine Hand, um den Redefluss zu unterbrechen. »Wie viel? Was hast du gesagt?«
Hellhörig geworden, verstummte Yoyi ahnungsvoll. Wenn ihn irgendetwas auszeichnete, dann sein Riecher für Geschäfte und Finanzen. Und dass er sich in geschäftlichen Dingen zwar knallhart, aber immer fair und transparent verhielt. Und schließlich war da noch seine Schwäche für El Conde. Obwohl fünfundzwanzig Jahre jünger als sein Kompagnon beim An- und Verkauf alter Bücher, hegte Yoyi ein unerschütterliches Gefühl der Freundschaft für den ehemaligen Polizisten. Dies nicht nur, weil der ihn einmal aus einer Prügelei rausgehauen hatte, die tödlich hätte enden können, sondern weil sie sich geschäftlich ausgezeichnet verstanden und nicht fürchten mussten, vom andern betrogen zu werden. Yoyis Schwäche für Conde zeigte sich darin, dass er ihn seit Jahren unterstützte. Da er mit unterschiedlichsten Aktivitäten – sein Spektrum war nicht nur weit gefächert, sondern schlicht unendlich – viel Geld verdiente, half er dem weniger geschickten Freund aus der Not und rettete ihn aus dem notorischen Geldmangel, indem er ihm hin und wieder ein weniger lukratives Geschäft überließ. Zog ihn aus der Scheiße, wie die beiden das zu nennen pflegten.
»Hundert, hab ich gesagt.« Yoyis Pupillen weiteten sich, als wollte er Conde noch näher unter die Lupe nehmen.
Conde schüttelte den Kopf. »Sechzig pro Tag und tausend, wenn ich die Madonna zurückbringe.«
»Dieses Schlitzohr!«, rief Yoyi. »Wir hatten hundert pro Tag ausgemacht, plus Spesen, und zweitausend für die Statue.«
Das Herz schlug Conde bis zum Hals. »Aber Yoyi, so viel! Für eine Jungfrau von Regla?«
»Was heißt hier viel, Conde? Diese Jungfrau ist ein Kunstwerk aus dem 19. Jahrhundert, das aus Andalusien nach Kuba gebracht wurde und bestimmt viel wert ist. Und Bobby stinkt vor Geld! Weißt du, wie viel er an den beiden Bildern von Portocarrero, dem von Amelia Peláez und dem von Montoto und einigen Zeichnungen von Bedia in Miami verdient hat? Abzüglich der Investition für den Ankauf und des Bestechungsgeldes, um die Bilder aus Kuba rausschmuggeln zu können, hat er siebzig Riesen in die Tasche gesteckt. Reingewinn, man! Einfach so, auf die Hand. Siebzigtausend Dollar! Du weißt wohl nicht, wer hier in Kuba seine Kunden sind und was er schon alles verkauft hat! Hast du nie was von den gefälschten Landschaften von Tomás Sánchez gehört, die in Miami aufgetaucht sind?«
Jetzt blieb Condes Herz stehen. Siebzigtausend Dollar Reingewinn in einem Rutsch und dazu gefälschte Bilder in Miami! Und sie hatten Bobby früher einmal für einen ausgemachten Blödmann gehalten …
»Überlass das mit dem Geld nur mir. Konzentriere du dich darauf, diese Schwuchtel zu suchen und herauszufinden, wo zum Teufel die verdammte Madonna geblieben ist. Du willst diese Kohle doch verdienen.«
Tief erschüttert nickte Conde mehrmals, während er auf der Suche nach der Zigarettenschachtel seine Hosentaschen abklopfte. Ihm war entfallen, dass er sie samt Feuerzeug auf die Glasplatte des Eisentischchens gelegt hatte. Als er sie schließlich entdeckte, zündete er sich eine Zigarette an, um sich durch Nikotin zu beruhigen.
»Damals haben wir immer gedacht, der Typ wär blöd. Und schwul angehaucht.«
El Palomo lachte. »Wenn er damals blöd war, ist er vollkommen geheilt, denn jetzt kauft und verkauft er Bilder wie ein Irrer und bringt sie ins Ausland, wenns sein muss. Was das andere betrifft, habt ihr ihn total unterschätzt. Er ist nämlich stockschwul, wie du ja wohl gesehen hast. Und wie er das genießt!«
Conde hatte Yoyis Ausführungen nur mit halbem Ohr zugehört, denn er war ganz in seine Kalkulationen vertieft. Hundert Dollar am Tag! Vier oder fünf Jahre war es nun her, dass der Maler Elias Kaminsky in Havanna aufgetaucht war, mit der Bitte, ihm zu helfen, die Geschichte seines Vaters, des Juden Daniel Kaminsky, zu ermitteln. Conde hatte damals für seine Nachforschungen eine Menge Dollars erhalten. Doch seitdem steckte er in einem schwarzen Tunnel, denn der An- und Verkauf von Büchern brachte immer weniger ein. Er dachte sogar daran, umzusatteln und wie einige seiner Kollegen eine andere Überlebensmöglichkeit zu finden.
»Also, mach dir um die Knete keine Sorgen. Du nimmst den Job an, oder?«
Conde war immer noch am Nachdenken. Wie, zum Henker, sollte er es anstellen, in Havanna oder weiß der Himmel, wo einen Typen zu finden, der nicht gefunden werden wollte? Nur mithilfe der Polizei, beantwortete er sich selbst seine Frage.
»Wird nicht einfach werden«, seufzte er und drückte die Zigarette aus.
»Deswegen wirst du ja bezahlt, man. Aber jetzt lad ich dich erst mal zum Essen ein. Um neun bin ich im Vedado mit einer Frau verabredet.« Yoyi zeigte auf seinen Bel Air.
»Und wie sieht heute das Tagesmenü aus?«, fragte Conde, der sich immer über die Gerichte wunderte, die sich sein Partner gönnte. Um seinen Gourmet-Gaumen zu verwöhnen, hatte der ehemalige Ingenieur Jorge Reutilio Casamayor Riquelmes, alias Yoyi El Palomo, eine weiß gekleidete Köchin samt Chefkochmütze engagiert, die die exquisitesten Speisen zubereiten konnte, auf die er Lust verspürte. Zusätzlich bügelte sie aufs Exquisiteste – weil er es sei – seine groben und feinen Leinenhemden, eine Kunst, die sie ihren Worten zufolge von ihrer Großmutter, einer philippinischen Wäscherin und Büglerin, erlernt hatte.
»Etwas Leichtes heute, habe ich Esther gesagt. Ich treffe mich ja gleich mit der Frau. Du verstehst. Nur eine Kleinigkeit, Reis mit Gemüse, Salat mit viel Grünzeug und Gazpacho. Das Richtige bei dieser Hitze.«
Conde hatte sich bei der Aufzählung nach und nach aufgerichtet, doch das Ende war so enttäuschend, dass er in ein tiefes Loch zu stürzen glaubte. Das war alles? Reis und Grünzeug? War der Gesundheitsfimmel, mit dem er neuerdings konfrontiert wurde, eine Verschwörung gegen seinen Appetit? Als Yoyi Condes Gesicht sah, musste er lachen.
»Dazu zwei Rinderfilets, Conde, aus dem Dutch Oven, mit viel grünem Paprika. Schließlich wusste ich, dass du hier auftauchen würdest! Es war wie eine Vorahnung, man, ich habs hier drin gespürt.« Yoyi legte die Fingerspitzen auf die Stelle unterhalb seiner linken Brustwarze, die am Rand seines Taubenbrustkorbs schlingerte.
»Erzähl keinen Scheiß, Yoyi, für so was bin ich zuständig«, erwiderte Conde, um sein Monopol bei Vorahnungen zu verteidigen. »Apropos, gibt es in Kuba überhaupt noch Kühe? Mit Filets?«
Panik stieg in ihm auf, er fühlte sich eingekreist, ja, attackiert, als wären sie alle darauf aus, ihn unterzukriegen. Er fand es gut, dass sich alle retten wollten, aber dass sie gleichzeitig auch ihn im Visier hatten, machte ihm Angst. Kamillentee statt Kaffee! Und auch noch ohne Zucker! Hielten sie ihn wirklich für so alt und kaputt?
Conde beobachtete Tamara, wie sie den Deckel der Teekanne festhielt, während sie die grünliche Flüssigkeit in die Teetassen mit Goldrand goss. Wie immer bewunderte er die Eleganz und Präzision ihrer harmonischen, aristokratisch anmutenden Bewegungen, die sich so sehr von seinen ungeschliffenen Manieren eines frustrierten Baseballspielers unterschieden. Warum erträgt mich diese Frau? Und geht sogar mit mir ins Bett?
Mit ihren siebenundfünfzig Jahren sah Tamara zehn Jahre jünger aus. Wie sie sich ernährte, der Sport, die Haarfärbemittel und Cremes (italienisch, teuer und effektiv, von ihrer Zwillingsschwester Aymara aus Übersee geschickt) wirkten sich bei ihr so positiv aus, wie katastrophale Ernährung, Zigaretten, Alkohol und gleißende Sonne während seiner täglichen Wanderungen auf der Suche nach alten Büchern bei ihm negativ zu Buche schlugen. Und wie um ihm unter die Nase zu reiben, was er sich während seiner häufigen Abwesenheiten entgehen ließ, hatte Tamara ihn heute Abend in einem fast durchsichtigen Negligé empfangen, ohne Büstenhalter, mit einem schwarzen Tanga, der den Spalt ihres großzügig gewölbten, knackigen Hinterns – die Jahre konnten ihm nichts anhaben – nur unzureichend bedeckte. Als Mario hereingekommen war, hatte er sie von oben bis unten und von vorn bis hinten betrachtet und sich beglückwünscht, als sich sein Hodensack leicht zusammengezogen und sein Penis sich vielversprechend geregt hatte.
Während sie ihren Kamillentee tranken – er hatte sich geweigert, auf Zucker zu verzichten –, berichtete er ihr die Sensation dieses Tages: Bobbys Auftauchen aus dem Vergessen. Tamara fand es unglaublich, dass ihr ehemaliger Mitschüler jetzt Santero und Geschäftsmann war. Seine sexuelle Präferenz überraschte sie dagegen weniger, und als Conde ihr das Foto zeigte, lächelte sie anzüglich.
»Kriegst du jetzt keine Pickel mehr, wenn du mit einem Gay zusammen bist?«, stichelte sie in Anspielung auf dieses und die zahlreichen anderen Vorurteile ihres Geliebten.
»Du weißt doch, dass ich schon lange geheilt bin. Oder so gut wie.«
Tamara nickte. Conde ließ erneut seinen Blick über sie wandern. Ja, sie war immer noch wunderschön.
»Und was willst du unternehmen, um diesen Raydel zu finden?«, fragte sie, und in diesem Moment überkam Mario das sichere Gefühl, dass seine Qualitäten als Spürnase mit schwindelerregender Geschwindigkeit den Bach runtergingen. Ganz offensichtlich lief seine Zeit ab. »Ich bin völlig von der Rolle. Hab Bobby nicht mal gefragt, ob er ein Foto von dem Kerl hat. Ich hoffe, er hat eins.«
»Und wenn er nach Santiago zurückgegangen ist?« Tamara schien sich wirklich Sorgen zu machen. Sie wusste, dass Conde, wenn er nach Santiago de Cuba fuhr, imstande war, Wochen oder gar Monate dort zu bleiben und sich in einem Dschungel aus Rumflaschen zu verirren.
»Bobby meint, der Kerl ist noch in Havanna, weil er glaubt, dass er das, was er ihm geklaut hat, hier besser verkaufen kann. Angeblich sind die Leute in Santiago völlig abgebrannt, schlimmer als hier.«
Diszipliniert trank Conde das grüne Gebräu aus und zündete sich eine Zigarette an. Angesichts der durchschimmernden Nacktheit Tamaras hatte er Mühe, einen klaren Gedanken zu fassen. Auch wenn oder vielleicht gerade weil er dabei war, in das dritte oder vierte Lebensalter einzutreten, war seine Empfänglichkeit für weibliche Reize ungebrochen und sogar noch größer als in den längst vergangenen Zeiten seiner blühenden Manneskraft. Wie magisch angezogen, drehte sich Conde jedes Mal um, wenn eine gut gebaute Frau an ihm vorbeiging (nach seinen ästhetisch-geometrischen Maßstäben gehörte zu einer guten Figur ein fester Po), schielte in jede offene Bluse oder vergaß sich beim Anblick eines schönen Frauengesichts. Sein Leben lang hatte ihn die Freude am Betrachten und, wenn möglich, am ganz konkreten Kosten der weiblichen Schönheit begleitet. Wie ein Schnüffler mit trainierter Spürnase hatten sich seine Fähigkeiten erweitert. Wenn er in einen Bus stieg, erspähten seine Augen unwillkürlich das schönste Mädchen. Wenn eine gut gewachsene Frau in Uniform seinen Weg kreuzte, spielten seine Hormone verrückt. Wenn er einen Film sah, erregten ihn die angedeuteten oder offen zur Schau gestellten weiblichen Reize. Wie hatte er für Stefania Sandrelli in Wir waren so verliebt und für Candice Bergen in Lebe das Leben geschwärmt! Wie oft hatte er mit der nackten Sônia Braga in Doña Flor und ihre zwei Ehemänner vor Augen sich selbst befriedigt! Und wie talentlos und mager waren die Schauspielerinnen von heute, großer Gott!
Obwohl er wusste, dass er mehr auf ästhetische denn körperliche Reize reagierte, konnte er seine Impulse nicht kontrollieren, lebte sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit aus. Er nährte sich vom Anblick der Schönheit, saugte sexuelle Anziehungskraft in sich auf, staunte immer aufs Neue über die unauslotbaren Mysterien im Geist und Körper der Frauen, leckte sich wie ein Vampir nach dem Blutsaugen die Lippen und fühlte sich wieder jung.
Aus diesem Grund hatte er Bobby und seinesgleichen nie verstanden und würde sie nie verstehen. Wie konnte ein Mann sich von einem behaarten, ungehobelten Manneswesen angezogen fühlen, mit diesen hässlichen Dingern, die zwischen seinen Beinen baumelten, wo es doch jenes großartige andere gab, mit zarten Ausbuchtungen, perfekten Krönungen, wohligen, unwiderstehlichen Höhlen?
Als er endlich Tamara lieben durfte, einst das schönste Mädchen der Oberstufe von La Víbora, fühlte er sich, als habe er das große Los gezogen. Er genoss diese Höhepunkte seines erotischen, sexuellen und vor allem ästhetischen Lebens mit allen fünf Sinnen. Diese Tamara, die ihn in der Oberstufe behandelt hatte wie ein bedeutungsloses Insekt, während ihm bei ihrem Anblick das Wasser im Mund zusammengelaufen war. Jahre später, als Polizist, war Conde ihr zufällig wieder begegnet, weil er den Befehl erhalten hatte, ihren am letzten Tag des Jahres 1988 verschwundenen Ehemann wiederzufinden, das opportunistische, korrupte Riesenarschloch Rafael Morín. Als er am Ende der Ermittlungen mit ihr ins Bett ging, begann eine andere Phase seines Lebens. In der er nicht glauben konnte, das zu haben, was er hatte und genießen durfte. In der er sich immer wieder fragte, wie es möglich war, dass sich diese wunderbare Frau zu einem Taugenichts wie ihm hingezogen fühlte. Schließlich waren sich die beiden so fest verbunden, dass sie es nicht für nötig erachteten, ihre Verbindung zu legalisieren. Sie lebten zufrieden in einer Art ewiger Verlobungszeit, einem Zustand gegenseitigen Respekts, der umso befriedigender war, da kein zermürbendes Zusammenleben ihn belastete. Auch jetzt noch sah Mario Conde in Nächten wie dieser seine Tamara an und fragte sich: Ist es wirklich wahr?
Laut aber fragte er: »Übrigens, wer hat dir diesen hübschen Verlobungsring geschenkt, den du da am Finger trägst?« Ein Ritual, das er über alles liebte und bei jeder sich bietenden Gelegenheit wiederholte.
Tamara tat ihm den Gefallen und gab die erwartete Antwort. »Den hat mir mein Mann geschenkt«, flüsterte sie verträumt.
»Dann bist du also verheiratet?«
»Nein, aber so gut wie«, antwortete sie gemäß Drehbuch und zeigte stolz den Ring. »Ich habe ihn zur Verlobung bekommen.«
Conde hielt es für angebracht, die Sache zu beschleunigen. »Und wo findet das Fest statt?«
Tamara lächelte. »Hier ganz in der Nähe, glaube ich.«
»Und dafür muss man sich so anziehen?« Er ließ seinen Blick und die Spitze seines Zeigefingers über ihren Körper wandern.
»Gefällt es dir?«
»Ich bin entzückt.«
»Immer noch?«
»Mehr denn je.«
»Aber du warst zwei Tage nicht hier!«
»Ich habe Sport gemacht, um Kräfte zu sammeln. In meinem Alter …«
»Und? Hast du Kräfte gesammelt?«
Conde tat so, als würde er nachdenken, bevor er antwortete. »Wollen wir den Beweis antreten?« Er stand auf, stellte sich hinter Tamara, küsste sie auf den Hals und begann, ihre Brüste zu streicheln. Im Spalt ihrer Pobacken spürte sie sein hellwaches Glied – es schien zu sagen, es wolle jetzt seine Kraft beweisen. Unbekümmert um die Last der Jahre, dank der Schönheit dieser Frau, deren Haut so frisch duftete, deren Speichel und Atem nach süßen Früchten schmeckte, jedes Mal und immer, immer wieder.
2
Antoni Barral, 1989–1936
Das Geräusch der sich schließenden Tür reißt ihn aus seinem Schlaf, der so tief, leer und lang ist, dass er schmerz- und zeitlos scheint. Er will nach der Frau rufen, sich vergewissern, dass sie bei ihm ist, will dieser abgrundtiefen, überwältigenden Einsamkeit, dieser Vorbotin noch größerer Einsamkeiten, ein Schnippchen schlagen. Doch es gelingt ihm nicht, die gedachten Worte in gesprochene zu verwandeln. Er fühlt sich verlassen, zerbrechlich, weiß, dass er so gut wie am Ende ist. Bis hierher hat er es geschafft. Mit der Langsamkeit des Besiegten öffnet er die Augen und schaut auf seine Füße. Das Beste, was er machen kann, vielleicht das Einzige. Wann immer eine Situation drohte sein Leben von Grund auf umzukrempeln, schaute er auf seine Füße, so als reagiere er auf einen Befehl von oben. Er weiß, dass andere es vorziehen, Gesicht, Augen, den Zug um den Mund zu mustern, um darin Spuren von Freude, Angst, Erwartung zu suchen. Oder auch um eine Antwort zu finden. Andere wiederum schauen auf ihre Hände. Hände, die vielleicht ruhmreiche, abscheuliche, nicht wieder gutzumachende Dinge getan haben. Manche dagegen betrachten ihr Geschlecht, weil sie wissen, dass dort der Ursprung menschlicher Entscheidungen, des Glücks oder häufig auch des schrecklichsten Unglücks liegt, schamhaft verborgen oder schamlos unverhüllt. Er dagegen hat seit seiner Jugend in den Bergen auf seine Füße geschaut, angezogen von einer seltsamen Kraft, in der sich Vertrautheit und Fremdheit, Nähe und Distanz immer neu mischten. Diese inzwischen deformierten, nutzlosen Füße offenbaren, was sein Leben gewesen ist. Mit ihnen hat er selbst gewählte oder ihm aufgetragene Wege zurückgelegt, hat sein eigenes Leben gelebt oder das ihm auferlegte. Seine Füße sind die zurückgelegten Wege. Sie trugen ihn von der Unschuld zur Schuld, von der Unwissenheit zum Wissen, vom Frieden zum Tod. Unbeschwert schlendernd, mühsam kletternd, bis zur Flucht ohne Heimkehr. Immer getrieben von Unruhe und Angst, haben diese Füße ihn getragen, und jetzt, kraftlos geworden, führen sie ihn auf den letzten Weg. Antoni Barral weiß, dass er einen unumkehrbaren Schritt tun wird, der ihn zu seiner Mutter Paula bringt, zu seinem Vater Carles, zu seinem Bruder Andreu, dem armen Irren, der sinnlos und irrtümlich zum Märtyrer dieses schrecklichen Krieges geworden ist. Ja, bis hierher hat er es mit seinen Füßen geschafft. Alles Weitere wird Schweigen sein.
Blutige Körpersäfte schwitzen aus den Geschwüren, die seinen Rücken und seinen Hintern bedecken. Er hört mit Schrecken sein eigenes Ein- und Ausatmen, ist erschöpft von einem Kampf, den er verloren weiß, der ihn endgültig niedergestreckt hat. Doch er lässt nicht locker. Vielleicht schaut er jetzt zum letzten Mal auf seine Füße mit den gekrümmten, ins Fleisch eingewachsenen Fußnägeln, auf die gespenstisch hervortretenden Gelenke, die nur noch Hornhaut und Knochen sind. Aus den vertrauten Füßen eines einst ausdauernden Wanderers und Kletterers sind unbrauchbare, leblose Extremitäten eines Todgeweihten geworden. Fremd sind sie ihm geworden, als seien es gar nicht die seinen. Alles an ihm kommt ihm fremd vor. Doch nein: SIE ist noch seine, wird nie aufhören, seine zu sein, früher wie jetzt. Und dieser Gedanke reißt ihn aus seiner Starre. Leicht hebt er den Blick und sieht SIE auf ihrem Sockel, Herrin der Zeit, aller Zeiten. Majestätisch in ihrer Machtfülle, schwarz schimmernd im Schein der Duftkerze, die die Frau vor dem Verlassen des Zimmers angezündet hat, um ihn nicht im Dunkeln zurückzulassen und mit dem Kerzenduft den säuerlichen Geruch des Todes zu übertönen. SIE ist seine, weil SIE ihn bis hierher geführt hat, ans Ende seines wechselhaften, von Schicksalsschlägen gezeichneten Lebens. SIE wird ihn auch auf die andere Seite begleiten, wenn seine Füße den letzten Schritt tun und ihn vor den Schöpfer führen, damit Er ihn richte und für die begangenen Sünden bestrafe. Auch für die größte Todsünde der Zehn Gebote, für die es keine Vergebung gibt, auch nicht unter mildernden Umständen: den Mord, den er, wie er sich jahrelang eingeredet hat, für SIE beging. Um SIE zu retten.
Seit fünfzig Jahren peinigt ihn diese Schuld, die er nie abschütteln konnte. Seit mehr als fünfzig Jahren verfolgt ihn der Blick dieses Toten, der seinen Tod nicht verstand, und der Schmerz darüber, dass er für seine Lieben nicht einmal das Grab hat ausheben können. Und wieder geht sein Blick zu seinen Füßen. Er erinnert sich, wie er im schummrigen Licht des stinkenden, feuchten Laderaums eines Handelsschiffes vor IHRE tiefschwarz glänzende Statue niederhockte, sich dann die schwärzlichen, zerfetzten Stoffschuhe mit der Hanfsohle überstreifte und sich ins Unbekannte stürzte. Auch in jenem Moment hat er innegehalten und auf seine Füße geschaut, in dem Bewusstsein, dass sie sein Schicksal bestimmt hatten und immerdar bestimmen würden. Versehrt waren sie gewesen, von Fußpilz eiternd, aber jung und stark, so nah und zu ihm gehörig, wie er sie nie zuvor gesehen hatte und später nie wieder sehen würde. Er vertraute ihnen und IHR, um der Gefahr zu entkommen, wie er so vielen Gefahren entkommen war.