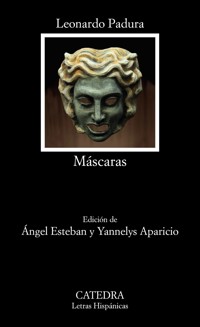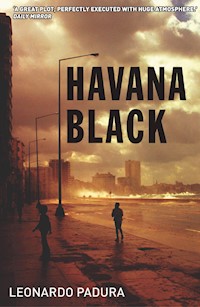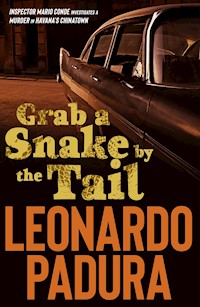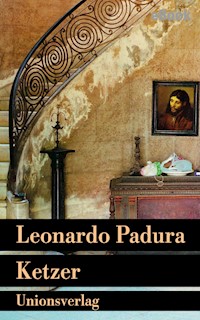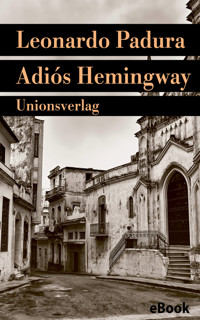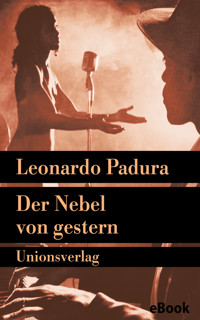9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Havanna im Herbst 1989: Fischer entdecken am Strand eine Leiche. Wie sich herausstellt, war der Tote ein hoher Funktionär der kubanischen Regierung, bis er sich vor elf Jahren in die USA absetzte. Damals zuständig für die Enteignung der Bourgeoisie, hatte er sich viele Feinde geschaffen. Warum kehrte er nach Kuba zurück? Wollte er wirklich nur seinen schwer kranken Vater besuchen? Oder gab es einen anderen Grund? Im vierten Teil des Havanna-Quartetts begegnet Teniente Mario Conde abgehalfterten Funktionären und den alten Familien, die viel, aber längst nicht alles verloren haben. Während der Hurrikan Félix unbarmherzig auf Havanna zurast, fühlt Mario Conde, dass ein wichtiger Abschnitt seines Lebens zu Ende geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Havanna im Herbst 1989: Fischer entdecken am Strand die Leiche eines hohen Funktionärs der kubanischen Regierung, der sich elf Jahre zuvor in die USA abgesetzt hatte. Warum kehrte er nach Kuba zurück? Während der Hurrikan Félix unbarmherzig auf Havanna zurast, fühlt Mario Conde, dass ein wichtiger Abschnitt seines Lebens zu Ende geht.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Das Meer der Illusionen
Kriminalroman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
Havanna-Quartett »Herbst«
E-Book-Ausgabe
Mit 2 Bonus-Dokumenten im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 6 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel Paisaje de otoño bei Tusquets Editores, Barcelona.
Originaltitel: Paisaje de otoño (1998)
© by Leonardo Padura Fuentes 1998
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Robert Polidori
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30482-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 10:13h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DAS MEER DER ILLUSIONEN
Vorbemerkung des Autors1 – Komm endlich!«, rief er in einen friedlich gelangweilten …2 – Was machst du denn hier, Manolo?«, fragte Mario …3 – Jetzt wurde alles klar. »Ein tropischer Zyklon ist …4 – Er erwachte ohne Angst, aber mit der Gewissheit …5 – Das Ende der Welt war gekommen. Ein heftiger …Mehr über dieses Buch
Leonardo Padura: Wie eine Romanfigur entsteht
Noemí Madero: Kriminalroman, Sozialroman: Das Havanna-Quartett
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Lateinamerika
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Karibik
Für Ambrosio Fornet, den besten Lektor in der Literaturgeschichte Kubas.
Für Dashiell Hammett und seinen »Malteser Falken«.
Für die Freunde, nah und fern, die Teil dieser Geschichte sind.
Und – glücklicherweise – für Dich, Lucía.
Herbst 1989
… Sie dachte nach und sagte:
»Ich ziehe Geschichten vor, die von der Untergründigkeit handeln.«
»Wovon?«, fragte ich und beugte mich vor.
»Von der Untergründigkeit. Ich interessiere mich brennend für das Untergründige.«
J. D. Salinger
Hurrikan, Hurrikan, nahen fühle ich Dich.
José María Heredia
Vorbemerkung des Autors
Als ich 1990 den Roman Ein perfektes Leben zu schreiben begann, war das die Geburtsstunde des Ermittlers Teniente Mario Conde, der Hauptfigur jenes Buches. Anderthalb Jahre nach Erscheinen des Romans flüsterte Mario Conde mir eines Nachts etwas ins Ohr, was ich, nachdem ich ein paar Tage darüber nachgedacht hatte, für eine ausgezeichnete Idee hielt: Warum schreiben wir nicht noch mehr Romane? Also beschlossen wir, drei weitere Teile hinzuzufügen, die, zusammen mit Ein perfektes Leben (das zu Beginn des Jahres 1989 spielt), das Havanna-Quartett »Vier Jahreszeiten« bilden sollten. So entstanden Handel der Gefühle (Frühling), Labyrinth der Masken (Sommer) und schließlich Das Meer der Illusionen (Herbst), der vorliegende Roman, den wir im Herbst 1997 beendeten, wenige Tage vor meinem Geburtstag, der gleichzeitig der von Mario Conde ist. Wir wurden nämlich am selben Tag geboren, allerdings nicht im selben Jahr.
Damit möchte ich zweierlei zum Ausdruck bringen: Erstens, dass ich Mario Conde (einer literarischen, keinesfalls realen Figur) das Glück verdanke, ihn ein ganzes Jahr auf seinem Lebensweg begleiten und bei seinen Grübeleien und Abenteuern beobachten zu dürfen. Und zweitens, dass seine Geschichten, wie ich stets betone, fiktiver Natur sind, auch wenn sie so manchen realen Geschichten sehr ähneln.
Zuletzt möchte ich einer Gruppe von Freunden und Lesern danken, die geduldig jede einzelne Fassung von Das Meer der Illusionen verschlungen, verdaut und analysiert haben. Ohne ihre Mühe wäre dieses Buch nicht das geworden, was es ist – ob nun gut oder schlecht. Diese stets treuen Freunde sind: Helena Núñez, Ambrosio Fornet, Alex Fleites, Arturo Arango, Lourdes Gómez, Vivian Lechuga, Beatriz Pérez, Dalia Acosta, Wilfredo Cancio, Gerardo Arreola und José Antonio Michelena. Ebenso danke ich Greco Cid, der mir die Figur des Dr. Alfonso Forcade geschenkt hat; Daniel Chavarría, der mich zu der Episode um die Galeone von Manila inspiriert hat; Steve Wilkinson, der auch die Fehler gesehen hat, die andere übersehen haben; meinen Verlegern Beatriz de Moura und Marco Tropea, die mich zwangen, »mit der Axt zu schreiben«, wie Rulfo es empfahl. Und natürlich gilt mein Dank der Person, die mehr als jede andere dieses ganze Unternehmen unterstützt und mich dabei ertragen hat: Lucía López Coll, meine Frau.
1
Komm endlich!«, rief er in einen friedlich gelangweilten Himmel, der noch mit einem trügerischen Blau aus der Herbstpalette gefärbt war. Mario Conde stand mit freiem Oberkörper und ausgebreiteten Armen auf der Dachterrasse und schrie seine Verzweiflung mit aller Kraft heraus, um seine Stimme auf Reisen zu schicken und zu beweisen, dass er überhaupt noch eine Stimme besaß, nachdem er drei Tage lang kein einziges Wort hervorgebracht hatte.
Seine von übermäßigem Zigaretten- und Alkoholgenuss geschundene Kehle nahm den Ausbruch mit Erleichterung zur Kenntnis, und sein Geist genoss den bescheidenen Akt der Befreiung, der sein Inneres so sehr in Aufruhr versetzte, dass er beinahe einen zweiten Schrei ausgestoßen hätte.
Wie der Matrose im Ausguck eines verlorenen Schiffes beobachtete El Conde den wolkenlosen und windstillen Himmel, in der absurden Hoffnung, sein erhöhter Aussichtsplatz ermögliche es ihm, am Horizont endlich die beiden bedrohlichen Markierungskreuze zu entdecken, deren Weg er seit einigen Tagen auf der Wetterkarte verfolgt hatte, während sie sich auf ihr angepeiltes Ziel zubewegten: auf die Stadt, das Viertel und eben diese Dachterrasse, von der aus er sie herbeirief.
Zunächst war es ein ferner Keil am Himmel gewesen, noch namenlos, ganz unten auf der Skala eines Tropentiefs, das von der Küste Afrikas heranzog und heiße Wolken für seinen Totentanz vor sich hertrieb. In zwei Tagen würde es in die Besorgnis erregende Kategorie eines Zyklons aufsteigen, inzwischen ein Giftpfeil über dem Atlantik, der seine Spitze auf das Karibische Meer richten und das Recht erworben haben würde, auf den Namen Félix getauft zu werden. In der vergangenen Nacht jedoch hatte das Tief, zu einem Hurrikan aufgeblasen, sich bereits über die Inselgruppe von Guadeloupe gelegt wie ein grotesker Haarwirbel, entfesselt durch die verheerende äolische Umarmung mit Windgeschwindigkeiten von zweihundert Kilometern pro Stunde, in der Absicht, Bäume zu entwurzeln und Häuser zu zerstören, jahrtausendealte Berggipfel und historische Flussläufe zu verändern, Tiere und Menschen zu töten. Wie ein Fluch aus einem heiteren Himmel, der immer noch verdächtig gelangweilt und friedlich aussah. Wie eine Frau, die es da-rauf abgesehen hat, einen Mann in den Wahnsinn zu treiben.
El Conde wusste aber, dass all diese Umwege und Täuschungsmanöver das Tief nicht von seiner Mission und von seinem Ziel abbringen würden. Seit er seinen Weg auf der Wetterkarte verfolgte, fühlte er sich ihm merkwürdig verbunden. Das Scheißtief kommt direkt auf mich zu, dachte er, während er beobachtete, wie es sich näherte und immer gewaltiger wurde. Irgendetwas in der Atmosphäre oder am Tief selbst – garniert mit Wetterleuchten, begleitet von Federwolken, Kumuluswolken, tief hängenden Regenwolken, Stratuswolken, die jedoch nicht in der Lage sind, sich in einen Hurrikan zu verwandeln – ließ ihn die Zwangsläufigkeit und die wirklichen Absichten der Regenmassen und außer Kontrolle geratenen Winde erahnen, die das kosmische Schicksal mit der deutlichen Absicht erschaffen hat, über genau diese Stadt hinwegzufegen, sie einer heiß ersehnten und notwendigen Reinigung zu unterziehen.
An jenem Abend war El Conde das tatenlose Warten leid, und er entschloss sich, den Wirbelsturm lautstark herbeizurufen. Ohne Hemd, die Hose nur halb zugeknöpft, die Batterien geladen mit Alkohol, der seine verborgensten Kräfte mobilisierte, stieg er durchs Fenster auf die Dachterrasse. Dort erwartete ihn ein angenehm warmer Herbstabend, an dem er beim besten Willen keinerlei Anzeichen für einen drohenden Zyklon entdecken konnte. Angesichts des trügerisch friedlichen Himmels vergaß er für einen Moment den Zweck seines Aufstiegs und ließ den Blick über das Viertel wandern, über all die Antennen, Taubenschläge, Wäscheleinen und Wassertanks, die ein schlichtes, ländlich anmutendes Alltagsleben widerspiegelten, von dem er sich jedoch irgendwie ausgeschlossen fühlte. Auf der einzigen Erhebung des Viertels leuchtete wie immer die rote Ziegeldachkrone des pseudoenglischen Schlosses, an dessen Bau sein Großvater Rufino El Conde vor nun beinahe einem Jahrhundert beteiligt gewesen war. Das hartnäckige Fortbestehen bestimmter Gebäude über das Leben ihrer Erbauer hinaus, die Tatsache, dass sie allen, auch den heftigsten Wirbelstürmen standhielten, den Hurrikanen oder Zyklonen oder Taifunen oder Tornados, war für ihn der einzig wirkliche Daseinsgrund. Denn was würde von ihm selbst übrig bleiben, wenn er sich in diesem Moment in die Lüfte erheben würde, so wie jene Taube, die er sich einmal ausgedacht hatte? Ewiges Vergessen, lautete die Antwort, völlige Leere wie die all der namenlosen Menschen, die über die gewundene schwarze Calzada gingen, beladen mit Plastiktüten und Hoffnungen oder mit leeren Händen und Köpfen, nichts ahnend von der Nähe der verheerenden, aber notwendigen Hurrikane, gleichgültig selbst gegenüber der Leere des Todes, ohne den Willen zur Erinnerung und ohne Zukunftsperspektiven; all jener Menschen, die von seinem verzweifelten Schrei, den er dem fernen Horizont entgegenschleuderte, aufgeschreckt wurden: »Komm jetzt endlich, verdammt noch mal!«
So als schnitte er sich ins eigene Fleisch, empfand Mario den Schmerz des Korkens, der von der unerbittlichen Metallspirale durchbohrt wurde. Er versenkte den Korkenzieher bis zum Anschlag, präzise wie ein Chirurg und bemüht, alles richtig zu machen. Dann hielt er den Atem an und zog das Gerät vorsichtig wieder heraus. Der Korken glitt aus dem Flaschenhals wie ein Fisch am todbringenden Angelhaken aus dem Wasser. Alkoholgeruch drang ihm provozierend in die Nase. Er goss eine kräftige Dosis Rum in ein Glas und leerte es auf einen Zug. Wie ein Kosak, der sich von winterlichem Wolfsgeheul verfolgt fühlt.
Melancholisch betrachtete er die Flasche. Sie war die letzte einer eilig angelegten Reserve. Drei Tage zuvor hatte der Ermittler Teniente Mario Conde das Gebäude der Kripozentrale verlassen, nachdem er sein Entlassungsgesuch unterschrieben und beschlossen hatte, sich zu Hause einzuschließen und an Rum, Zigaretten, Kummer und Groll zugrunde zu gehen. Er hatte sich immer vorgestellt, dass er, sollte er sich eines Tages einmal seinen Traum erfüllen und den Polizeidienst quittieren, eine Riesenerleichterung verspüren und anfangen würde zu singen, zu tanzen und, natürlich, zu trinken. Ohne Reue, ohne Blick zurück im Zorn, einfach nur, weil er endlich einen immer wieder aufgeschobenen Akt der Befreiung vollbracht hatte. In dieser Phase seines Lebens musste er sich eingestehen, dass er nicht genau wusste, warum er Ja gesagt hatte und zur Polizei gegangen war. Und genauso wenig konnte er sagen, warum er so lange gezögert hatte, aus jener Welt auszubrechen, in der er trotz aller Bemühungen, sich anzupassen, trotz all der Dinge, die auf ihn abgefärbt hatten, immer ein Fremder geblieben war. Vielleicht hatte er an dem Argument, er sei Polizist geworden, weil er nicht wolle, dass die Schweinehunde straflos davonkommen, so großes Gefallen gefunden, dass er es am Ende selbst glaubte. Möglicherweise hielt ihn auch seine Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die sein ganzes verpfuschtes Leben bestimmt hatte, in einer durch zweifelhafte Erfolge gekrönten Routine gefangen. Der Routine, Mörder zu fassen, Vergewaltiger, Diebe oder Betrüger, die ohnehin wieder rückfällig wurden. Die Hauptschuld daran, dass er seinen Willen zur Flucht so lange unterdrückt hatte, trug jedoch zweifellos Mayor Antonio Rangel, sein Chef in den letzten acht Jahren. Seine von vermeintlichen Spannungen und wirklichem Respekt geprägte Beziehung zum Alten hatte immer wieder eine aufschiebende Wirkung gehabt. Nie hätte er, das wusste er genau, den Mut aufgebracht, mit dem Entlassungsgesuch in Händen in das Büro im fünften Stock zu gehen. Deswegen hatte er auf Rangels Pensionierung gehofft. Der Alte war inzwischen achtundfünfzig und konnte sich in zwei Jahren zur Ruhe setzen.
Am letzten Freitag jedoch waren sämtliche realen und fiktiven Abwehrmechanismen mit einem Schlage zusammengebrochen. Die Nachricht von der Entlassung des Mayors hatte sich wie ein Lauffeuer über die Korridore der Kripozentrale verbreitet. Als El Conde davon hörte, kroch ihm das brennende Gefühl von Angst und Ohnmacht den Rücken hinauf ins Hirn. Die häufig diskutierte, aber nie für möglich gehaltene Entlassung des Alten würde nicht das letzte Kapitel in der Geschichte von Verdächtigungen, Verhören und Disziplinarstrafen sein, denen die Ermittlungsbeamten der Zentrale vonseiten »interner Ermittler«, die im Hause herumspionierten, unterworfen waren. Eine Verletzung der Naturgesetze! In den langen Monaten der Inquisition hatte man Köpfe rollen sehen, die als unantastbar galten. Angst übernahm die Hauptrolle in einem Drama in drei Akten, das zur Farce geriet und offenbar bis zum bitteren Ende gespielt werden sollte. Einem Ende mit unvorhersehbaren Konsequenzen, das sogar ungeschriebene Gesetze außer Kraft setzen und heilige Kühe in den Abgrund reißen konnte.
Mario Conde überlegte es sich nicht zweimal und beschloss, seine Kündigung einzureichen. Er wollte gar nicht hören, was in der Gerüchteküche an möglichen Gründen für die Suspendierung des Alten aufgekocht wurde. Er schrieb das Gesuch, bat um seine Entlassung »aus persönlichen Gründen«, wartete geduldig auf den Fahrstuhl, der ihn in den fünften Stock brachte, unterschrieb das Papier und überreichte es dem Offizier, der im Vorzimmer des Büros saß, das einmal das seines Freundes Antonio Rangel gewesen war und nie mehr sein würde.
Aber anstelle von Erleichterung verspürte El Conde ein unerwartetes Gefühl schmerzlicher Trauer. Nein, das war natürlich nicht der triumphale und souveräne Abgang, den er sich immer erträumt hatte. Es glich mehr dem Davongleiten einer Schlange, das Mayor Rangel ihm gewiss nie verziehen hätte. Anstatt zu singen und zu tanzen, nahm sich der ehemalige Teniente deswegen vor, trinkend und rauchend alles zu vergessen. Auf dem Heimweg investierte er seine gesamten Ersparnisse in sieben Flaschen Rum und zwölf Päckchen Zigaretten.
»Na, steigt bei dir ’ne Party?«, fragte ihn komplizenhaft grinsend der Chino in dem staatlichen Laden, der Bodega.
Mario sah zu ihm auf. »Nein, mehr ’ne Trauerfeier«, antwortete er und ging hinaus.
Noch während er sich auszog, entjungferte er die erste Flasche und trank einen Schluck. In diesem Augenblick stellte er fest, dass der angekündigte Tod von Rufino, seinem Kampffisch, Wirklichkeit geworden war. Mit ausgebreiteten Flossen, wie eine verwelkte Blume, die jeden Moment ihre Blütenblätter verliert, trieb Rufino auf der Oberfläche des tintenähnlichen, ungesund aussehenden Wassers.
»Scheiße, Rufino, du kannst doch jetzt nicht einfach abnibbeln und mich im Stich lassen«, sagte er zu dem starren Fischkörper, »dabei wollte ich doch gerade heute das Wasser wechseln …« Er trank seinen Rum aus und schüttete die Brühe samt Kadaver in das alles schluckende Klo.
Mit dem zweiten Glas in der Hand und ohne zu ahnen, dass er in den nächsten drei Tagen kein Wort sprechen würde, zog El Conde die Telefonschnur aus dem Stecker, hob die Zeitung, die unter der Eingangstür hindurchgeschoben worden war, vom Boden auf und legte sie neben das Klo, um das mit Druckerschwärze voll geschmierte Papier zu gegebener Zeit seiner wahren Bestimmung zuzuführen. Und da sah er ihn, versteckt, ganz unten auf der zweiten Seite, einen noch namenlosen Spalt am Himmel westlich der Kapverden, der ihm einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Der Scheißhurrikan kommt direkt auf uns zu, dachte er sofort, und er sehnte ihn mit aller Kraft herbei, so als wäre es möglich, jene verheerende, reinigende Ausgeburt der Hölle mit geistigen Kräften herbeizurufen. Er goss sich ein drittes Glas Rum ein, um in aller Ruhe auf den Hurrikan zu warten.
Er erwachte mit der Gewissheit, dass der Hurrikan die Insel erreicht hatte. Das Donnern klang gefährlich nah, und er konnte sich nicht erklären, wie sich der Himmel noch vor ein paar Stunden so friedlich hatte präsentieren können. Inzwischen hatte tiefe Dunkelheit den milden Herbstabend abgelöst. Davon überzeugt, Donnergrollen zu hören, wunderte Mario sich noch, warum es nicht von Regen und Sturm begleitet wurde, als er eine Stimme rufen hörte: »Mario, ich bins! Mach auf, ich weiß, dass du da bist!«
Blitze durchzuckten den Alkoholdunst, der sein Hirn vernebelte, und Alarmglocken ließen ihn hellwach werden. Ohne seine nackten, durch den Schreck geschrumpften Körperteile zu bedecken, rannte er zur Haustür und öffnete.
»Was machst du denn hier, Bär?«, fragte er, wobei ihm eine böse Vorahnung die Brust zuschnürte. »Ist was mit Josefina?«
Die Lachsalve, die Mario traf, machte ihm seinen nicht wieder gutzumachenden Fehler bewusst, und die Stimme des dünnen Carlos wies ihn auf die Ungeheuerlichkeit seines Lapsus hin.
»Leck mich am Arsch, du, was hast du für ’n Kleinen!«, rief der dünne Carlos und brach wieder in schallendes Gelächter aus, in das jetzt auch Andrés und der Hasenzahn einfielen. Sie steckten ihre Köpfe durch die offene Tür, um sich von der Richtigkeit der Feststellung zu überzeugen.
»Größer als der von deinem Alten«, war das Einzige, was Mario entgegnen konnte, bevor er den Rückzug antrat und den Freunden das unanständig bleiche Hinterteil zudrehte.
El Conde musste zwei Duralginas schlucken, um die drohenden Kopfschmerzen zu verjagen, die er mehr dem Schrecken als dem Rum zuzuschreiben geneigt war. Das unverhoffte Auftauchen des dünnen Carlos in seinem Rollstuhl hatte ihn befürchten lassen, dass der alten Josefina etwas zugestoßen sein könnte. Schon seit einer Ewigkeit hatte ihn sein bester Freund nicht mehr besucht, und deswegen hatte Mario sogleich an ein Unglück denken müssen. Die krankhafte Idee, die ihn am Abend beschlichen hatte, als er ohne Flügel ins Leere zu stürzen drohte, kam für ihn als Lösung seiner Probleme nun nicht mehr infrage. Sich einfach so aus dem Staub machen und die Freunde im Stich lassen? Carlos alleine in seinem Rollstuhl zurücklassen und Josefina durch den zugefügten Schmerz zugrunde richten? Das Wasser, das er sich ins Gesicht schüttete, wusch die letzten dreckigen Reste von Schlaf und Zweifel ab. Nein, das konnte er nicht tun. Jedenfalls nicht im Moment.
»Ich hab schon mit dem Schlimmsten gerechnet«, sagte er, als er, Zigarette im Mund, schließlich wieder ins Zimmer trat. Carlos, Andrés und der Hasenzahn hatten sich der sterblichen Überreste der letzten Flasche Rum angenommen.
»Und was meinst du, womit wir gerechnet haben?«, entgegnete der Dünne und trank einen Schluck. »Drei Tage ohne die geringste Scheißahnung, wo du steckst, dein Telefon tot und von dir kein Wort … Das geht zu weit, Conde, ehrlich, du, das geht zu weit!«
»Jetzt mach mal halblang, Alter, ich bin doch kein kleiner Junge mehr«, verteidigte sich der Teniente.
Wie immer versuchte Andrés vermittelnd einzugreifen: »Keine Panik, Jungs, ist ja nichts passiert.« Und zu Mario gewandt: »Josefina und Carlos haben sich wirklich Sorgen gemacht, Conde. Deswegen musste ich ihn hierher schieben, er wollte mich nicht alleine zu dir lassen.«
Mario betrachtete seinen ältesten und besten Freund: eine unförmige Masse, die über die Armlehnen des Rollstuhls quoll, gemästet wie ein Schwein vor dem Schlachtfest. Nichts war übrig geblieben von dem hageren Jungen, der der dünne Carlos einmal gewesen war. Eine hinterhältige Kugel in Angola hatte ihn für immer zum Krüppel gemacht und sein Leben zerstört. Und trotz alledem war das Gute in ihm unverletzt geblieben, unbesiegbar. Wenn El Conde ihn so vor sich sah, wurde er in seiner Überzeugung bestärkt, dass es nicht gerecht zuging auf dieser Welt. Warum musste ausgerechnet jemandem wie dem dünnen Carlos so etwas passieren? Warum musste jemand wie er in einen fernen, schmut-zigen Krieg ziehen, um dort das Wertvollste seines Lebens zu verlieren? Wenn so etwas möglich ist, kann Gott nicht existieren, dachte Mario. Er fühlte sich beschissen, wie eine Seele im Fegefeuer, und verging fast vor Rührung, als der Dünne zu ihm sagte:
»Du hättest ruhig anrufen können.«
»Ja, stimmt, ich hätte anrufen müssen. Um dir zu sagen, dass ich den Dienst quittiert habe.«
»Gott sei Dank, mein Junge, ich hab mir schon solche Sorgen gemacht«, seufzte Josefina erleichtert und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. »Aber wie siehst du überhaupt aus? Und diese Fahne! Wie viel hast du geschluckt? Und dünn bist du, da kann man ja richtig Angst kriegen …«
»Und so einen Kleinen hat er«, ergänzte Carlos lachend, wobei er mit Daumen und Zeigefinger Marios geschrumpfte Männlichkeit andeutete.
»Conde, Conde«, sagte der Hasenzahn mit sorgenvollem Gesicht. »Hör mal, du bist doch so was Ähnliches wie ’n Schriftsteller, ja? Ich hab da ’ne Frage: Was ist der Unterschied zwischen Leid tun und wehtun?«
El Conde sah den Hasenzahn an, der seine Riesenhauer kaum noch hinter der Oberlippe verstecken konnte. Wie immer war es unmöglich, festzustellen, ob sich hinter der Grimasse ein Lachen oder einfach nur Hasenzähne verbargen.
»Keine Ahnung … das eine schreibt man zusammen, das andere auseinander.«
»Falsch! Die Größe des Schwanzes«, rief der Hasenzahn. Er lachte laut und lange, das Gebiss jetzt endgültig im Freien. Carlos und Andrés stimmten in sein Gelächter ein.
»Hör nicht hin, Condesito«, kam Josefina dem ehemaligen Teniente zu Hilfe und nahm seine Hände. »Guck mal, ich hab mir schon gedacht, dass die drei da, die behaupten, deine Freunde zu sein, dich mitbringen würden. Und ich hab mir außerdem gedacht, dass du Hunger hast. Da braucht man dich ja nur anzusehen. Und deswegen hab ich hin und her überlegt, was ich euch kochen könnte, aber mir ist nichts Gescheites eingefallen. Man kommt so schlecht an die nötigen Sachen ran, weißt du … Aber dann, paff, hatte ich einen Geistesblitz, und ich hab was ganz Einfaches gezaubert: Reis mit Hähnchen im eigenen Saft. Was sagst du dazu?«
»Mit wie vielen Hähnchen, Jose?«, erkundigte sich El Conde.
»Dreieinhalb.«
»Und mit Paprika?«
»Ja, als Beilage und fürs Auge. Und mit Bier angemacht.«
»Dreieinhalb Hähnchen also … Meinst du, das reicht für uns?«, fragte Mario, während er bereits den Rollstuhl des Dünnen ins Esszimmer schob. Darin hatte er jahrelange Übung.
Nachdem sie drei große Teller von dem durch Fett und Hähnchen geschmacksverfremdeten Reis verschlungen hatten, fiel das abschließende Urteil der Tischgenossen einstimmig aus: »Dem Reis fehlen eindeutig die grünen Erbsen«, sagten sie; »obwohl er gut schmeckt«, sagten sie außerdem.
Zum Nachtischgespräch mit Rum zogen sie sich in Carlos’ Zimmer zurück. Josefina setzte sich vor den Fernseher und döste ein.
»Wirf ’ne Kassette ein, Mario«, forderte der Dünne seinen Freund auf. Mario grinste und stellte die rhetorische Frage: »Wie immer?«
Der Dünne grinste zurück. »Wie immer.«
»Gut, also, was möchtest du hören?«
»Die Beatles?«
»Chicago?«
»Fórmula V?«
»Los Pasos?«
»Creedence?«
»Creedence!«, riefen beide im Chor. Diese Szene hatten sie in den unzähligen Jahren ihrer Freundschaft tausendmal geprobt und tausendmal gespielt und es dabei zur Perfektion gebracht. »Aber erzähl mir nicht wieder, dass John Fogerty wie ein Schwarzer singt! Ich hab dir schon tausendmal gesagt, er singt wie ein Gott, klar?« Und die beiden nickten sich zu. Jawohl, darauf konnten sie sich einigen, der Junge singt wie ein Gott. Was er, begleitet von den Creedence Clearwater Revival, wieder einmal bewies, als Mario die Play-Taste drückte und die unverwechselbare Version von Proud Mary erklang. Wie oft hatte Mario diese Szene schon erlebt?
Auf dem Boden sitzend, ein Glas Rum neben sich und die brennende Zigarette im Aschenbecher, kam El Conde der Aufforderung seiner Freunde nach und berichtete über die neusten Entwicklungen in der Kripozentrale und über seinen unwiderruflichen Entschluss, aus dem Polizeidienst auszuscheiden.
»Ist mir doch scheißegal, ob die Verbrecher bestraft werden oder nicht. Gibt sowieso immer mehr davon. Bataillone von Arschlöchern.«
»Regimenter, Armeen«, vergrößerte Andrés die logistische und zahlenmäßige Stärke jener Invasoren, die resistenter waren und sich schneller vermehrten als Kakerlaken.
»Du bist verrückt, Conde«, urteilte Carlos.
»Und was willst du jetzt machen?«, fragte der Hasenzahn, ein durch und durch wissenschaftlich denkender Mensch, der immer nach Gründen, Ursachen und Wirkungen suchte, auch bei den unwichtigsten und privatesten Dingen.
»Darüber zerbrech ich mir vorläufig nicht den Kopf. Erst mal will ich weg von denen …«
»Hör mal, Kleiner«, meldete sich Carlos zu Wort und klemmte sein Glas zwischen die Beine, »mach, was du willst, egal was dabei rauskommt, für mich ist es okay. Schließlich bin ich dein Freund, oder? Aber wenn du tatsächlich gehst, dann geh mit Pauken und Trompeten und halt dich nicht an ’ner Rumflasche fest. Stell dich mitten in die Eingangshalle und schrei: Ich geh, weil ich die Schnauze gestrichen voll hab! Aber schleich dich nicht davon, als wärst du denen was schuldig. Bist niemandem was schuldig, stimmts?«
»Also, ich freu mich für dich, Conde«, sagte Andrés und sah auf seine Hände, mit denen er dreimal in der Woche Bäuche und Brustkörbe öffnete, um das zu reparieren, was noch zu reparieren war, um zu schneiden und das Kranke und Unbrauchbare zu entfernen. »Ich freu mich, dass wenigstens einer von uns auf alles scheißt und den Mut hat, die Dinge auf sich zukommen zu lassen.«
»Einen Zyklon zum Beispiel«, murmelte Mario und trank einen Schluck. Doch der Freund fuhr fort, als hätte er seine Bemerkung nicht gehört: »Weil unsere Generation sich nämlich rumkommandieren lässt, und das ist unsere Sünde und unser Verbrechen! Zuerst haben uns unsere Eltern dazu getrieben, gute Menschen und gute Schüler zu werden. Dann hat man uns in der Schule und auf der Uni rumkommandiert, wieder um uns zu guten, zu sehr guten Menschen zu machen. Und später hat man uns arbeiten geschickt, denn gut waren wir ja inzwischen, und man konnte uns hinschicken, wo man wollte. Aber keinem ist jemals in den Sinn gekommen, uns zu fragen, was wir eigentlich wollten. Man hat uns in die Schule geschickt, in die wir gehen mussten, dann auf die Uni zu dem Studium, das wir absolvieren mussten, und später zu dem Arbeitsplatz, an dem wir arbeiten mussten, alles, ohne uns zu fragen. Und man kommandiert uns weiter rum, ohne uns auch nur ein verdammtes Mal in unserem verdammten Leben zu fragen, ob wir das auch wollen … Immer bestimmen andere für uns, vom Kindergarten bis zum Grab auf dem Friedhof, auf den man uns einmal bringen wird. Alles nimmt man uns ab, ohne uns nach unserer Meinung zu fragen, nicht einmal danach, an welcher Krankheit wir sterben wollen. Deswegen sind wir die armen Würstchen, die wir sind, deswegen haben wir keine Träume mehr, und wenn wir Glück haben, taugen wir für das, was uns vorgeschrieben wird …«
»Also wirklich, Andrés, so ist das nun auch wieder nicht«, versuchte der dünne Carlos zu beschwichtigen, während er sich Rum nachgoss.
»Ach, so ist das nicht, Carlos? Du bist nicht nach Angola in den Krieg gegangen, weil sie dich dahin geschickt haben? Du bist nicht beschissen dran in deinem Scheißrollstuhl, weil du ein guter Junge warst und getan hast, was man von dir verlangt hat? Ist es dir irgendwann mal in den Sinn gekommen, dich zu weigern? Man hat uns gesagt, wir müssen aus historischen Gründen gehorchen, und dir ist nicht mal im Traum eingefallen, Nein zu sagen, Carlos, weil man uns nämlich beigebracht hat, Ja zu sagen, immer nur Ja, Ja, Ja … Und der da …«, er zeigte auf den Hasenzahn, dem das Wunder gelungen war, seine Hauer zu verbergen und einmal richtig ernst auszusehen angesichts der zu erwartenden Abkanzlung, »was hat der denn aus seinem Leben gemacht, außer mit der Geschichte rumzuspielen und alle sechs Monate die Frau zu wechseln? Wo sind denn die verdammten Geschichtsbücher, die er schreiben wollte? Wo ist denn das auf der Strecke geblieben, was er immer werden wollte und nie geworden ist? Hör mir doch auf, Carlos, und lass mir wenigstens die Überzeugung, dass mein Leben im Arsch ist!«
Der dünne Carlos, der schon lange nicht mehr dünn war, sah Andrés an. Die Freundschaft der vier war mehr als zwanzig gut abgehangene Jahre alt, und es gab nur sehr wenige Geheimnisse zwischen ihnen. In den letzten Monaten aber war irgendetwas mit Andrés passiert. Der ehemalige Star der Baseball-Mannschaft von La Víbora, den alle Schüler bewundert und mit Beifall überschüttet hatten, er, der seine Jungfräulichkeit durch ein so hübsches und so zauberhaftes und so verrücktes Mädchen verloren hatte, durch das alle anderen liebend gerne sogar ihr Leben verloren hätten, er, der später ein tüchtiger Arzt geworden war, zu dem alle hinliefen, er, der Einzige von ihnen, der eine beneidenswert vorbildliche Ehe führte, mit zwei Kindern, eigenem Haus und Auto, dieser Andrés entpuppte sich nun als frustrierter, verbitterter Mensch, der andere mit seinem Groll anstecken und vergiften konnte. Denn Andrés war nicht glücklich, nicht einmal zufrieden mit seinem Leben, und alle seine Freunde sollten es wissen. Irgendetwas mit seinen geheimsten Plänen war schief gelaufen, sein Lebensweg hatte – wie der aller anderen – ohne sein Zutun, ohne dass er damit einverstanden gewesen war, eine unerwünschte, wenn auch vorgezeichnete Richtung genommen.
»Okay, okay, du hast Recht, und ich hab meine Ruhe«, murmelte Carlos resigniert, trank einen kräftigen Schluck und fügte dann doch noch hinzu: »Aber so kann man doch nicht leben …«
»Warum nicht, Dünner?«, meldete sich El Conde zu Wort und blies den Zigarettenrauch in die Luft. Er erinnerte sich an seine alkoholvernebelten Selbstmordgedanken der letzten Nacht.
»Weil man dann zu dem Schluss kommt, dass alles Scheiße ist.«
»Und, ist nicht alles Scheiße?«
»Nein, Conde, und das weißt du ganz genau«, antwortete Carlos und schaute von seinem Rollstuhl aus an die Zimmerdecke. »Nicht alles … oder?«
Mit von Zigaretten- und Alkoholdunst vernebeltem und von Andrés’ Generationsgejammer dröhnendem Kopf fiel er aufs Bett. Er zog sich im Liegen aus und warf die Kleidungsstücke achtlos auf den Boden. Morgen früh würden ihn Kopfschmerzen quälen, das ahnte er. Die gerechte Strafe für seine nächtlichen Exzesse. Im Augenblick jedoch arbeitete sein Hirn ausgezeichnet, produzierte Gedanken, Erinnerungen und Vorstellungen von erregender Konkretheit. Mit übermenschlicher Kraftanstrengung stand er auf und ging ins Bad, wo die Duralginas auf ihn warteten, die den drohenden Kater in die Flucht schlagen würden. Zwei müssen reichen, überlegte er und schluckte sie mit viel Wasser. Dann stellte er sich vors Klo und ließ einen bernsteinfarbenen, schwachen Urinstrahl in die Schüssel plätschern und bepinkelte den schon fleckigen Rand. Dabei fiel sein Blick auf sein Glied. Schon immer hatte er den Verdacht gehabt, dass es zu kurz war, und nun, nachdem er sich seinen Freunden nackt gezeigt hatte, war es ihm bestätigt worden. Doch er zuckte innerlich mit den Schultern zum Zeichen dafür, dass er dem keine Bedeutung beimaß. Bisher war dieser im Moment schlaffe Fleischzipfel stets ein verlässlicher Freund bei seinen erotischen Schlachten gewesen, ob in Zwei- oder Einsamkeit. Immer wenn die Situation es verlangte, war er wacker zur Stelle und zur Attacke bereit. Lass die Arschlöcher ruhig reden, sagte er zu ihm und sah ihm direkt in die Augen, du tust keiner Frau Leid und keiner weh, weil du nämlich ein guter Freund bist, stimmts? Und er schüttelte ihm dankbar die Hand.
Der Gedanke, dass er am nächsten Morgen nicht zur Arbeit gehen musste, weckte seine Lebensgeister. Die teerverklebte Lunge atmete befreit auf, und er beschloss, die Zeit nicht in seinem einsamen Bett zu vergeuden. Auf der Stelle wirst du dein Leben ändern, Mario Conde, befahl er sich. Als Erstes wirst du die Nachtstunden nutzen. Unabhängigkeit war eins der Privilegien seiner neuen Situation. Rasch ging er in die Küche und stellte die gusseiserne Kanne aufs Feuer. Mit dem vorgezogenen Morgenkaffee würde er seinen Organismus täuschen, ihm die nötige Vitalität verleihen, um das zu tun, was er vorhatte: sich hinzusetzen und zu schreiben. Aber worüber willst du denn schreiben, verdammt noch mal?, fragte er sich. Na ja, über das, was Andrés gesagt hat, lautete die Antwort. Er würde eine Geschichte über Täuschung und Enttäuschung schreiben, über die Ernüchterung und das Gefühl, nutzlos zu sein. Und über den Schmerz, der einen plagt, wenn man entdeckt, dass man sich – ob aus eigener Schuld oder nicht – alle Wege verbaut hat. Dies war die wichtigste Erfahrung seiner Generation, eine Erfahrung, die in den letzten Jahren immer mehr Nahrung gefunden hatte und groß und stark geworden war. Er fand, dass sie es wert war, niedergeschrieben zu werden, als einziges Gegengift gegen das unerträgliche Vergessen und als möglicher Weg, endlich das verworrene Knäuel ihrer Irrtümer zu entwirren. Wann, wie, warum und wo hatte alles angefangen, den Bach runterzugehen? Wie viel Schuld hatte jeder Einzelne von ihnen (falls sie überhaupt eine Schuld traf)? Wie viel Schuld hatte er selbst? Er trank seinen verfrühten Morgenkaffee, ganz langsam, bereits vor seiner Underwood sitzend, in die ein weißes Blatt Papier eingespannt war, und schon jetzt wusste er, dass es schwierig werden würde, jene Erfahrungen und Gewissheiten, die in seinen Eingeweiden wie Würmer rumorten, in eine untergründige und anrührende Geschichte zu verwandeln. Eine einfache, leise Geschichte wie die des Mannes, der einem Kind von den Gewohnheiten des Bananenfisches erzählt und sich danach eine Kugel in den Kopf jagt, weil er nichts Besseres mit seinem Leben anzufangen weiß. El Conde starrte auf das jungfräulich weiße Blatt und begriff, dass sein bloßer Wunsch, zu schreiben, nicht ausreichte, um den ewigen Kampf gegen die 8½ mal 13 Zoll, auf denen die Chronik eines vergeudeten Lebens Platz finden sollte, zu gewinnen. Was er brauchte, war einer von Josefinas Geistesblitzen, der ihn dazu inspirieren würde, das poetische Wunder zu vollbringen und mit einer kühnen Mischung aus vergessenen und verlorenen Komponenten etwas Neues zu schaffen. Und ihm kam der Zyklon wieder in den Sinn, der bisher nur auf der Wetterkarte zu sehen war. Genau so etwas war nötig, etwas Verheerendes und alles mit sich Reißendes, etwas Reinigendes und Gerechtigkeit Schaffendes, damit so jemand wie er die Möglichkeit wiedererlangen würde, er selbst zu sein, ich selbst, du selbst, Mario Conde, und ein wenig Schönheit oder Schmerz oder Aufrichtigkeit zu schaffen und auf diesem stummen, leeren Blatt Papier festzuhalten, das ihn herausfordernd ansah. Und er fing an zu tippen, und es floss aus ihm heraus wie eine Ejakulation, die er nicht mehr zurückzuhalten vermochte: »Er fiel aufs Gesicht, als hätte man ihn zu Boden gestoßen, und noch bevor er den Schmerz spürte, nahm er den jahrtausendealten Gestank nach verfaultem Fisch wahr, den die graue, fremde Erde verströmte.«
2
Was machst du denn hier, Manolo?«, fragte Mario Conde überrascht, als er die dürre Gestalt des Sargento Manuel Palacios vor der Tür stehen sah.
Das Gesicht seines langjährigen Kollegen drückte Verwunderung aus, das schielende Auge verschwand fast hinter der Nasenscheidewand. El Conde begriff sogleich, dass die Ursache dafür in seinem eigenen Gesicht zu suchen war.
»Bist du krank, Conde?«
»Krank? Red keinen Scheiß, ’n Dreck bin ich. Hab die ganze Nacht durch geschrieben«, antwortete er, und verspürte ästhetisches Wohlgefallen bei dieser Erklärung. Er stellte sich die tiefen Ringe unter seinen Augen vor, die vom Schlafmangel geröteten Lider, und er war stolz auf den poetischen Grund für sein ramponiertes Aussehen. Doch so ganz entsprach das nicht der Wahrheit. Nur wenige Seiten voller Erinnerungsnarben waren die einzige Ausbeute quälender Nachtarbeit.
»Dann hats dich also wieder mal gepackt«, stellte der Sargento fest. Und mit drohendem Zeigefinger fügte er hinzu: »Du bist wirklich nicht zu retten, du.«
»Und darf man wissen, was du hier willst?«, beharrte Mario.
»Dich abholen«, antwortete Manolo lächelnd.
»Ich bin seit drei Tagen nicht mehr bei der Polizei.«
»Das glaubst du! Unser neuer Chef will mit dir über dein Entlassungsgesuch reden.«
»Sag ihm, ich kann heute nicht. Ich befinde mich in der kreativen Phase, erklär ihm das.«
Wieder lächelte Manolo. Jetzt war es ein breites Grinsen. »Keine Entschuldigungen, keine Ausreden, hat er gesagt.«
»Und was will er mit mir machen, wenn ich nicht mitkomme? Mich entlassen?«
»Oder dich einbuchten, wegen Befehlsverweigerung und ungebührlichen Verhaltens gegenüber einem Vorgesetzten. Das hat er mir auch noch gesagt«, vervollständigte Manolo seinen offiziellen Auftrag. Dann schlug er wieder einen persönlicheren Ton an: »Willst du den Kram im Ernst hinschmeißen, Conde?«
»Ja, Manolo, im Ernst. Aber komm erst mal rein, ich mach uns ’n Kaffee.«
Sie setzten sich in die Küche, um das Durchlaufen des Wassers abzuwarten, während Manolo seinen Kollegen über die letzten Ereignisse in der Kripozentrale informierte. Von den sechzehn Ermittlern waren nur noch elf übrig geblieben. Es ging zu wie in einem Wespennest. Die Personalakten der Überlebenden wurden durchforstet und immer wieder durchforstet, von neuerlichen Befragungen war die Rede. Eine erbarmungslose Treibjagd auf Leben und Tod, so als handle es sich um die dringend notwendige Ausrottung einer längst überflüssigen Spezies.
»Und was redet man so über Mayor Rangel?«
»Dass er nichts gemacht hat. Und genau das wirft man ihm vor. Soweit ich weiß, hat er sich seitdem nicht mehr blicken lassen, aber ich hab gehört, dass er in allen Ehren in den Ruhestand versetzt wird.«
»Auf diese Art von Ehre scheißt er«, bemerkte Mario.
Heute Morgen habe der neue Chef alle Mitarbeiter zu sich zitiert, erzählte Manolo weiter, und sie aufgefordert, ihrer Arbeit nachzugehen, bis sich die Situation wieder normalisieren würde. Trotz der Ereignisse in der Zentrale gehe das Leben draußen seinen üblichen Gang, wie sonst auch, eher noch schlimmer, und wie sonst auch würden alle möglichen Verbrechen begangen.
»Nichts mehr wird so sein wie früher«, seufzte El Conde und goss den fertigen Kaffee in zwei große Tassen. »Jedenfalls nicht für mich.«
»Ach, komm doch erst mal mit, Conde, und red mit ihm. Danach kannst du ja immer noch machen, was du für richtig hältst. Schmeiß nicht einfach alles in den Müll, was du zehn Jahre lang gemacht hast. Warst du etwa nicht stolz, wenn die Leute gesagt haben, du seist der beste Ermittler der Zentrale? Los, Conde, zeig ihnen, wer du bist!«
»Und was hab ich davon, Manolo?«
Der Sargento sah seinen Freund an und versuchte zu lächeln. Sie kannten sich in- und auswendig, und El Conde wusste genau, welche Ängste Manolo in den Monaten der internen Ermittlungen, der Säuberungsaktionen und Entlassungen ausgestanden hatte. Sie alle waren während dieser Hasenjagd mehrmals verhört worden, und am Ende hatte man diejenigen über die Klinge springen lassen, von denen man es am wenigsten erwartet hatte. Kollegen seit zwanzig Jahren hauten sich gegenseitig in die Pfanne; altgediente, über jeden Verdacht erhabene Polizisten wurden als Gewohnheitsverbrecher entlarvt; brisante Fälle waren unter unvorstellbaren Mengen von Geldscheinen begraben, Vergünstigungen gegen unterschiedlichste Gegenleistungen gewährt worden, angefangen bei einem einfachen Händedruck von jemandem, der im geeigneten Moment den entsprechenden Gefallen zu tun versprach, über Universitätsdiplome ohne jede Teilnahme an Seminaren bis hin zu Sex mit Minderjährigen. Und die Lunte brannte weiter, immer weiter, und verbrannte alles, was ihr in die Quere kam.
Manolo sah also seinen Freund Mario Conde an, trank einen Schluck Kaffee und gab ihm die beste aller Antworten: »Dass man dich gehen lässt und nicht rausschmeißt, das hast du davon. Dass du aus der ganzen Scheiße sauber hervorgehst. Dass man Respekt vor dir hat. Und außerdem würden sie merken, glaub ich, dass der Mayor sich nicht in dir getäuscht hat … und auch nicht in mir.«
El Conde sah Mayor Rangel vor sich, einsam im Hof seines Hauses sitzend, den Sonnenuntergang betrachtend, an den nackten Füßen Badelatschen, im Mund eine dicke Havanna und im Kopf die Frage, wie er die erzwungene Freizeit am besten totschlagen könnte. Das Bild tat Mario in der Seele weh. Nach einem so arbeitsreichen Leben so traurig zu enden, das verdiente der Mayor einfach nicht.
»Na schön, ich komm mit«, brummte El Conde schließlich. »Aber sag mal, wo steckt eigentlich Félix?«
»Félix? Welcher Félix, Conde?«
»Na ja, Félix, der Zyklon, Alter.«
»Ach so … Was weiß ich …« Kopfschüttelnd trank Manolo seinen Kaffee aus.
»Du bist mir ja ein schöner Polizist. Weißt nicht mal, wo sich der Scheißkerl heute rumtreibt … Ein Versager bist du, Manolo!«
Er musste so um die fünfundvierzig sein, mehr oder weniger. Mehr wegen der grau melierten Haare, weniger wegen des faltenlosen, glatt, ja porentief rein rasierten Gesichtes mit dem olivbraunen Teint des weißen Mulatten oder mulattigen Weißen. Seine Uniform war maßgeschneidert, nicht von der Stange. Die Jacke schmiegte sich dem Brustkorb an, fiel locker über den flachen Bauch und den Bund der leichten Leinenhose, die sich im Ort und in der Zeit geirrt zu haben schien. Und dann der Duft! Ein zartes, aber eindeutig männlich herbes Parfüm, das seine so elegant uniformierte Gestalt auf einer Entfernung von fünfzehn Zentimetern mit einem zusätzlichen Nimbus von Reinlichkeit umgab. Der Anblick dieses Mannes warf die Meinung, die El Conde sich vorab von ihm gebildet hatte, vollkommen über den Haufen. Er hatte keinen gepflegten, wohlduftenden Menschen erwartet, sondern ein Ungeheuer, einen Despoten, der ihm seine Freiheit verweigern wollte. Und nun sah er einen freundlichen, sanftmütigen Mann vor sich. Mario war darauf gefasst gewesen, einen übel gelaunten Beamten anzutreffen, und nun saß ihm da dieser Mensch gegenüber, der ihn mit einem Lächeln entwaffnete. Und mit einer Frage: »Rauchen Sie, Teniente? … Ach, das freut mich, dann kann ich ja auch rauchen.« Er bot Mario eine H. Upmann an und nahm sich dann ebenfalls eine aus der Schachtel.
»Danke, Coronel.«
»Molina. Mein Name ist Alberto Molina … Setzen Sie sich doch bitte, ich glaube, wir haben so einiges zu besprechen. Vorher wollen wir uns aber noch Kaffee bringen lassen.«
Sie scheinen nicht gut geschlafen zu haben, Teniente, stimmts? Also, ich auch nicht, muss ich Ihnen sagen. Hab mich die halbe Nacht im Bett hin und her gewälzt, bis meine Frau wütend wurde, weil sie wegen mir nicht schlafen konnte, und mich ins Wohnzimmer verbannt hat. Ich hab eine Decke auf den Boden gelegt und über das nachgedacht, was in der Zentrale gerade passiert. Und darüber, in was für eine schwierige Lage ich dadurch gebracht worden bin. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich damit fertig werde. Ich befürchte fast, nein … Glauben Sie mir, es ist alles andere als angenehm, die Nachfolge eines Mannes wie Mayor Rangel antreten zu müssen, eines Mannes, der sich wie kein Zweiter in diesem Land mit Ermittlungen und Prozessen auskennt, mit allem, was mit Ihrer Arbeit zusammenhängt. Ich nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Wissen Sie, woher ich komme? Na ja, vom militärischen Abschirmdienst, Abteilung Analyse. Das hat nichts mit dem zu tun, was Sie hier machen. Und soll ich Ihnen noch was verraten? Ich habe jahrelang davon geträumt, Spion zu werden. Ein richtiger Spion, nicht so einer wie die in den Romanen von John Le Carré, die real wirken, aber eben nur Literatur sind. Spion zu sein, schien mir das Höchste, und davon habe ich zwanzig Jahre lang geträumt, während ich in einem Büro saß und die Informationen auswertete, die die richtigen Spione lieferten. Mit anderen Worten, ich war ein Büromensch, wie eine Figur aus Le Carrés Romanen … Aber wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, lernt man als Erstes, dass man Befehlen gehorchen muss, Teniente. Wenn man einen Befehl kriegt, bleibt einem nichts anderes übrig, als die Schnauze zu halten und zu gehorchen. Deswegen sitze ich jetzt hier und nicht in Tel Aviv oder in New York. Und deswegen wollte ich mit Ihnen sprechen. Denn Sie stehen bestimmt nicht von ungefähr in dem Ruf, ein guter Ermittler zu sein, auch wenn man sich so einiges über Sie erzählt … Aber nein, solche Dinge interessieren mich nicht, glauben Sie mir. Ich bin nicht hergekommen, um andere zu be- oder verurteilen, sondern um zu versuchen, den Laden am Laufen zu halten, so wie Mayor Rangel es getan hat … Um Leute zu beurteilen, sind die anderen da, die, die da draußen rumlaufen. Und lassen Sie mich Ihnen auch sagen, ich persönlich finde es höchst bedauerlich, dass einige Ihrer Kollegen getan haben, was sie getan haben, wodurch diese verdammte Ermittlung provoziert wurde, die Rangel schließlich den Posten gekostet hat. Aber auch wenn ich das bedaure, so möchte ich doch betonen, dass ich dieses Vorgehen für nötig halte. Denn ein korrupter Polizist ist schlimmer als der schlimmste Verbrecher. Ich glaube, darin sind wir uns einig, oder? In letzter Zeit sind wirklich einige sehr merkwürdige Dinge passiert … Und mitten in diesem ganzen Theater seine Kündigung einzureichen, gibt zu denken, Teniente, das wissen Sie so gut wie ich. Aber, wie gesagt, ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu verdächtigen. Deshalb möchte ich Ihre Gründe für diesen Schritt verstehen. Die Zentrale ist nicht mehr das, was sie, wie ich annehme, einmal war: ein Ort zur Verbrechensbekämpfung. Und genau deshalb habe ich Sie zu mir gerufen. Im Augenblick sind alle Ermittler, alte wie neue, mit irgendeiner Arbeit beschäftigt. Deswegen brauche ich Sie, Teniente. Es mag Ihnen unorthodox erscheinen, was ich Ihnen jetzt sagen werde, aber ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen: Sie lösen einen Fall für mich, und ich unterschreibe Ihr Gesuch … Nein, nein, glauben Sie mir, ich will Sie nicht damit erpressen! Sagen wir, ich möchte Sie dazu verpflichten, mir zu helfen. Denn ich brauche Ihre Hilfe, und Sie wissen ja, dass Sie monatelang auf Ihre Entlassung warten können, wenn ich das Papier auf meinem Schreibtisch nicht unterschreibe … Habe ich schon erwähnt, dass ich letzte Nacht schlecht geschlafen habe? Dann lassen Sie mich Ihnen jetzt sagen, dass ich überhaupt nicht geschlafen habe, und zwar wegen Ihnen. Ich wusste nicht, wie ich Ihnen das vorschlagen sollte, was sich wie ein Erpressungsversuch anhört, und wie ich Sie im Guten dazu überreden könnte, diesen speziellen Fall zu übernehmen. Und ich kam zu dem Schluss, dass es am besten ist, vollkommen offen mit Ihnen zu sein … Lassen Sie mich Ihnen den anstehenden Fall zuerst erklären, und dann sagen Sie Ja oder Nein. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Aber auch wenn Sie mich jetzt so reden hören, so ruhig und höflich, so lasse ich mich dennoch nicht leicht von etwas abbringen, wenn ich es für richtig halte. Ich kann auch unhöflich werden, das versichere ich Ihnen … Also, es geht um Folgendes: Samstagnacht wurde die Leiche eines Mannes gefunden, eines Kubaners mit nordamerikanischer Staatsangehörigkeit, der hier seine Familie besucht hat. Das bringt Probleme mit sich, nicht wahr? Der Mann ist am Donnerstagnachmittag alleine mit dem Auto seines Schwagers weggefahren, um eine Spritztour durch Havanna zu machen, wie er selbst gesagt hat. Seither ist er nicht wieder aufgetaucht. Bis Samstagnacht um elf Uhr Angler seine Leiche an der Playa del Chivo entdeckten, an der Ausfahrt des Tunnels, der zur Bucht führt. Sie wissen, wo das ist, ja? Laut Gerichtsarzt war der Mann bereits tot, bevor man ihn ins Meer geworfen hat. Davon zeugt unter anderem eine Kopfwunde, verursacht von einem stumpfen Gegenstand. Er erlitt einen Schädelbruch und Gehirnblutungen, was zum Tod geführt hat. Der Schlag muss, so nimmt der Arzt aufgrund der Wunde an, mit so etwas wie einem Baseballschläger geführt worden sein, aber einem von früher, aus Holz … Bis dahin ist der Fall schon reichlich mysteriös und außerdem politisch brisant. Aber da gibt es noch ein Detail, das das Ganze noch brisanter macht. Dem Opfer wurden nämlich der Penis und die Hoden abgeschnitten, anscheinend mit einem handelsüblichen, nicht sehr scharfen Messer … Was halten Sie davon? Fängt die Geschichte an, Sie zu interessieren? Natürlich handelt es sich dabei wohl um einen Racheakt, doch das muss bewiesen und der Täter gefasst werden, und das möglichst bevor der Fall in Miami Staub aufwirbelt und die kubanische Regierung beschuldigt wird, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Der Tote mit der Kopfwunde und den abgeschnittenen Geschlechtsteilen hat nämlich einen Namen und eine Geschichte. Er heißt Miguel Forcade Mier und war in den Sechzigerjahren stellvertretender Leiter der Behörde für Enteignungen in der Provinz Havanna. Und er war Vizedirektor im Ministerium für Wirtschaftsplanung und Außenhandel, als er sich 1978 auf dem Rückflug aus der Sowjetunion während einer Zwischenlandung in Madrid abgesetzt hat … Sagen Sie, Teniente, interessiert Sie der Fall wirklich nicht?
In den zehn Jahren, die Mario Conde bei der Polizei war, hatte er ein paar Grundregeln gelernt, die ihm das Überleben ermöglichten. Und die erste davon war das Gesetz der Treue. Nur durch den Korpsgeist, der die anderen Mitglieder der Polizeisippe schützte, konnte er sicher sein, dass die anderen auch ihn schützten und seiner Kraft und seinem Mut einen realen Wert verliehen. Obwohl er nie das Gefühl entwickelt hatte, ein richtiger Polizist zu sein und zu ihnen zu gehören, obwohl er es vorzog, ohne Pistole und ohne Uniform aufzutreten, und sogar den bloßen Gedanken hasste, eventuell Gewalt anwenden zu müssen, während er davon träumte, all das bald aufzugeben und ein normales Leben zu beginnen – was, zum Henker, ist ein normales Leben?, fragte er sich, und dann stellte er sich ein Holzhaus am Meer vor, in dem er sein Leben mit Erinnern und Schreiben verbringen würde –, trotz alledem beachtete er dieses ungeschriebene Gesetz der Treue, vielleicht manchmal auch bis hart an die Grenze, so wie es Mayor Rangel stets getan hatte, um zu guter Letzt von eben jenen gemeinen Schuften verraten zu werden, die er bis zum Schluss verteidigt hatte, was ihm schließlich selbst zum Verhängnis geworden war. Und nun wurde die Polizei- und Straßenethik Mario Condes auf eine dramatische Bewährungsprobe gestellt: Entweder er blieb bei dem Entschluss, der Zentrale den Rücken zu kehren, weil man Mayor Rangel in denselben gefallen war, oder aber er übernahm den zum Himmel stinkenden Fall, an dem er bereits Gefallen gefunden hatte. Auf diese Weise würde er die Freiheit erlangen, die ihn nach der möglichen Aufklärung des Verbrechens erwartete, und ganz nebenbei könnte er beweisen, dass der Mayor ihn zu Recht allen anderen vorgezogen hatte. Während El Conde über die Alternative nachdachte, vor die ihn der neue Chef, dieser wohlduftende und elegant uniformierte Herr, gestellt hatte, zündete er sich eine weitere Zigarette an und sah auf den weißen Aktenordner, der auf seinen Knien lag. Zwischen diesen Pappdeckeln waren die bekannten Fakten des Lebens und die bisher enthüllten Hintergründe des Todes des abtrünnigen Miguel Forcade Mier enthalten. Er blickte zum Fenster des Büros hinüber und stellte fest, dass der Himmel trotz der Bedrohung durch Félix immer noch blau und heiter war. El Conde suchte nach einem Ausweg aus seinem Dilemma.
»Coronel«, begann er, »da wir uns um ein Gentlemen’s Agreement bemühen, möchte ich Ihnen zwei oder drei Fragen stellen und Sie um etwas bitten, bevor ich mich entscheide.«
Sein glatt rasierter und hervorragend gekleideter neuer Chef lächelte. »Sie irren, Teniente, es handelt sich nicht um ein Gentlemen’s Agreement, denn ich bin Ihr Chef. Aber schießen Sie los. Wie lautet Ihre erste Frage?«
»Wieso wurde ein Mann wie Miguel Forcade überhaupt ins Land gelassen? Nach dem, was Sie mir erzählt haben, hat er früher sehr hohe Posten bekleidet und sich während einer staatlichen Mission abgesetzt, nicht wahr? Soweit ich weiß, kommt es nicht gerade häufig vor, dass so einer versucht, ins Land zurückzukehren, und noch seltener, dass er ein Visum erhält. Ich weiß von Leuten, die man wegen weit weniger nicht mehr nach Kuba einreisen lässt … Als er ins Ausland gegangen ist, hat er da keine Dokumente oder Geld oder sonst was mitgenommen, was gegen das Gesetz gewesen wäre?«
Coronel Molina zündete sich eine weitere seiner H. Upmanns an, bevor er antwortete: »Nein, nichts, was gegen das Gesetz verstoßen hätte. Aber die Sache ist so: Man hat ihn reingelassen, um ihn zu beobachten und herauszubekommen, was er vorhatte. Das Visum hat er über das Internationale Rote Kreuz erhalten, sein Vater ist nämlich sehr krank. Man kam zu dem Schluss, dass es besser sei, ihn einreisen zu lassen.«
»Eine solche Antwort hab ich erwartet. Kommen wir deshalb gleich zur nächsten Frage: Hat er sich der Beschattung entzogen?«
»Unglücklicherweise – für uns und vor allem für ihn selbst – konnte er die Leute, die auf ihn angesetzt waren, abschütteln. Sind Ihre Fragen damit zufrieden stellend beantwortet?«
El Conde nickte, hob aber die Hand wie ein skeptischer Schüler. »Ich möchte Ihnen jetzt noch eine dritte Frage stellen: Hat man irgendwann herausgefunden oder hat man eine Vermutung, warum Forcade in Madrid geblieben ist? Solche Typen bleiben normalerweise nicht aus mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen im Ausland, nicht wahr?«
»Vermutungen hat es viele gegeben, wie immer in solchen Fällen. Ende 78 zum Beispiel wurde im Ministerium für Wirtschaftsplanung und Außenhandel ein Fall von Veruntreuung aufgedeckt, aber es konnte nie endgültig geklärt werden, ob Forcade in die Sache verwickelt war. Dann dachte man, er könnte während seiner Zeit bei der Enteignungsbehörde etwas für sich abgezweigt haben. Doch es ist nicht bekannt geworden, dass er irgendetwas von Wert verkauft hätte. Schließlich wurde vermutet, er habe irgendwelche Informationen besessen und zum Kauf angeboten. Aber bewiesen wurde auch hier nichts. Außerdem hat sich Forcade nie politisch geäußert, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, er schien eine reine Weste zu haben. Und deswegen hat er wohl gewagt, nach Kuba zurückzukommen … Aber jetzt verraten Sie mir doch, worum Sie mich bitten wollen. Mal sehen, ob ich Ihre Bitte erfüllen kann.«
El Conde legte den Ordner auf den Schreibtisch und sah dem Coronel offen ins Gesicht. »Ich glaube nicht, dass Sie damit ein Problem haben werden«, sagte er. »Ich möchte mit Mayor Rangel sprechen, bevor ich meine Entscheidung treffe. Und wenn ich den Fall übernehme, möchte ich ihn um Rat fragen dürfen, falls das nötig sein wird.«
Der Coronel drückte sorgfältig seine Zigarette im Zinkaschenbecher aus und sah Mario Conde an. »Sie sind ein bewundernswerter Mann, Teniente. Eigentlich habe ich geglaubt, dass es solche Treuebeweise nicht mehr gibt. Natürlich können Sie mit Ihrem Freund Mayor Rangel sprechen, wann und worüber Sie wollen. Und richten Sie ihm aus, dass ich das Vorgefallene sehr bedaure, und er möge entschuldigen, dass ich ihm das nicht persönlich sage. Aber vielleicht würde mich das in Schwierigkeiten bringen. So wie die Dinge zurzeit liegen … Gut, ich erwarte Ihre Antwort in zwei Stunden, Teniente«, schloss er und baute sich zu einem korrekten militärischen Gruß auf.
Erstaunt über die soldatische Geste erhob sich El Conde und fuhr sich mit der Hand an die Stirn, um ebenfalls zu grüßen. Doch es glich eher einem Abschiedsgruß oder dem Versuch, das Gespenst der Unsicherheit zu verscheuchen.
Ana Luisa blickte erstaunt auf, als sie die Tür öffnete und Teniente Conde vor sich stehen sah.
»Was machst du denn hier, mein Junge?«
Mario Conde freute sich über die gelungene Überraschung und brachte sogleich seinen Spruch an: »Ich möchte um die Hand einer deiner Töchter anhalten«, sagte er. »Welcher von beiden, ist mir egal. Auch der Gedanke an den zukünftigen Schwiegervater kann mich nicht schrecken.«
Die Frau musste über den uralten Scherz lachen. Sie trat zur Seite, um den Gast eintreten zu lassen, und tätschelte ihm freundschaftlich die Schulter. »So wie du heute aussiehst, glaub ich nicht, dass sich eine von ihnen in dich verlieben wird.«
»Ich muss ja ein schreckliches Bild abgeben, du bist schon die Dritte, die mir das sagt«, seufzte Mario entmutigt. »Und wo ist der Hausherr?«
»In der Bibliothek. Geh nur durch, ich bring euch sofort Tee.«
»Sag mal, Ana Luisa, hat ihn jemand besucht?«
Die Frau sah ihn an, und er bemerkte eine alarmierende Traurigkeit in ihren Augen.
»Nein, Conde, von denen, die sich bis vor kurzem noch seine Freunde genannt haben, hat sich keiner hier blicken lassen. Na ja, du weißt ja, wie das ist. Wenn du in Ungnade fällst … Aber wenigstens du …« Sie brach den Satz ab und machte, dass sie in die Küche kam.
El Conde durchquerte das Esszimmer, blieb vor der Schiebetür zur Bibliothek stehen und klopfte zweimal behutsam mit dem Fingerknöchel an.
»Komm schon rein, Mario«, hörte man eine Stimme auf der anderen Seite.
Mario schob einen Türflügel zur Seite. Mayor Rangel saß hinter seinem Schreibtisch. Es war fast so wie in der Zentrale. Doch jetzt fragte sich El Conde mehr denn je, wie der Alte wissen konnte, dass er es war, der zu ihm wollte. Die Tür war aus massivem Holz, nicht aus Milchglas wie die im Büro, und das kurze Gespräch mit Ana Luisa hatte in einer für die fast sechzigjährigen Ohren des Mayor zu großen Entfernung stattgefunden.
»Sag mir eins, Alter: Woher weißt du immer, dass ich es bin? Kannst du mich vielleicht riechen oder was? Ich benutze kein Parfüm, schließlich bin ich ein richtiger Mann …«
»Parfüm? Wieso Parfüm? Ich hab dich durch den Garten kommen sehen.« Der Mayor zeigte auf das Fenster. »Hat Ana Luisa dir Kaffee versprochen?«
»Nein, sie hat was von Tee gesagt.«
»Verdammt und zugenäht!«, fluchte der Mayor, als hätte er sich den Daumen geklemmt. »Weißt du, was diese Frau sich neuerdings ausgedacht hat, Mario? Dass ich gesünder leben soll! Ich würde zu viel rauchen, sagt sie, und zu viel Kaffee trinken. Jetzt will sie mir nur noch Tee geben! Tee in allen möglichen Variationen, aus Orangenblättern, Sternanis, Cañasanta, was weiß ich. Sie behauptet nämlich auch noch, dass richtiger Tee zu Verstopfung und innerer Unruhe führt … Innere Unruhe, ausgerechnet ich …«
»Hast du wenigstens Zigarren?«
Antonio Rangel entfaltete sein breitestes Grinsen. Ein leichtes Hochziehen der Oberlippe, das kaum einen Schimmer seiner Zähne sehen ließ.