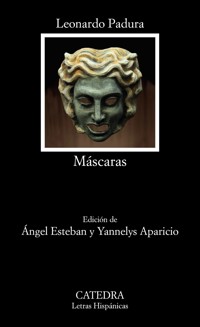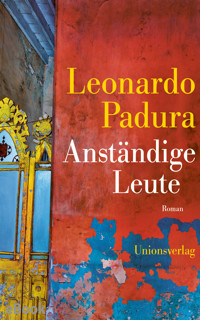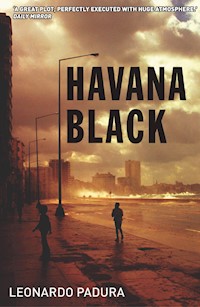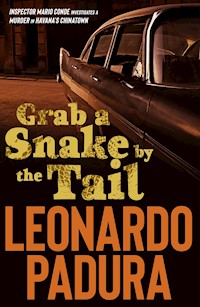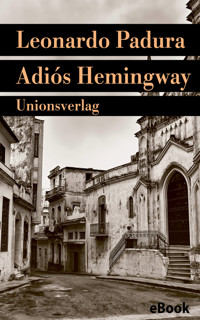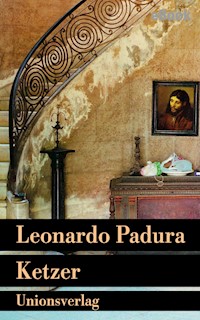
7,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Havanna, 27. Mai 1939: Die MS St. Louis fährt im Hafen ein. An Bord: 937 jüdische Flüchtlinge aus Deutschland. Daniel Kaminsky wartet an Land auf Eltern und Schwester. Doch die Einreise wird allen verweigert, das Schiff fährt zurück nach Europa. Amsterdam, 1648: Elias, ein Schüler Rembrandts, wird vom mächtigen Rabbinerrat aufgrund seiner Malerleidenschaft aus der Stadt verstoßen. Der Meister selbst gibt ihm sein Porträt mit auf den Weg ins Exil. London, 2007: Sensation auf dem Kunstmarkt. Ein bislang unbekanntes Christusporträt von Rembrandt taucht bei einer Auktion auf. Wer ist der Eigentümer? Mario Conde macht sich auf die Suche nach den Geheimnissen des Christusbildes und der Familie Kaminsky. Der Fall führt ihn durch die Jahrhunderte. Die Spur zieht sich um die halbe Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1062
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
London, 2007: Sensation auf dem Kunstmarkt. Ein bislang unbekanntes Christusporträt von Rembrandt taucht bei einer Auktion auf. Wer ist der Eigentümer? Mario Conde macht sich auf die Suche nach den Geheimnissen des Christusbildes. Der Fall führt ihn durch die Jahrhunderte. Die Spur zieht sich um die halbe Welt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Ketzer
Ein Mario-Conde-Roman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 5 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Herejes im Verlag Tusquets Editores, Barcelona.
Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde mit Mitteln der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V.
Die Nachbemerkung »Wie Ketzer entstand« übersetzte Karin Betz.
Originaltitel: Herejes (2013)
© by Leonardo Padura Fuentes 2013
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Robert Polidori
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30827-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 13:01h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KETZER
VorbemerkungDas Buch Daniel1 — Havanna, 19392 — Havanna, 20073 — Krakau 1648–Havanna 19394 — Havanna, 20075 — Havanna, 1940–19536 — Havanna, 20077 — Havanna, 1953–19578 — Havanna, 1958–20079 — Havanna, 195810 — Havanna, 200711 — Miami, 1958–198912 — Havanna, 2007Das Buch Elias1 — Neues Jerusalem, im Jahre 5403 der Schöpfung,1643 allgemeiner Zeitrechnung2 — Neues Jerusalem, im Jahre 5405 der Schöpfung,1645 allgemeiner Zeitrechnung3 — Neues Jerusalem,im Jahre 5407 der Schöpfung,1647 allgemeiner ZeitrechnungDas Buch Judith1 — Havanna, Juni 20082 – Kaum hatte El Conde einen Fuß in die …3 – In der Zeit, als Mario Conde Baseballspieler gewesen …4 – Natürlich bin ich es … Was gibts denn?«5 – Der Platz, der viele Jahre zuvor von irgendeinem …6 – Als Conde unter dem warmen Blechdach der Bar …7 – Conde malte sich aus, wie Basura II über …8 – Was möchtest du hören?«9 – Er stand am Fenster, zündete sich eine Zigarette …10 — Havanna, Juli 200811 – Sie hatten gefrühstückt. Tamara hatte mit Butter bestrichene …12 — Havanna, August 2008GenesisHavanna, April 2009DanksagungWorterklärungenLeonardo Padura — Wie Ketzer entstandMehr über dieses Buch
Leonardo Padura: »Diese Geschichte hat mich gefunden«
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Niederlande
Zum Thema Amsterdam
Zum Thema Malerei
Zum Thema 2. Weltkrieg
Zum Thema Karibik
Zum Thema Kunst
Wieder einmal für Lucía,
das Stammesoberhaupt
Es gibt Künstler, die sich nur in Freiheitsicher fühlen, aber auch solche, die nurin Sicherheit frei atmen können.
Arnold Hauser
Alles ist in den Händen Gottes,mit Ausnahme der Gottesfurcht.
Talmud
Wer immer über diese vier Fragen nachdenkt,hätte besser daran getan, nicht auf die Welt zukommen: Was gibt es oben? Was gibt es unten?Was war vorher? Was wird danach sein?
Rabbinische Weisheit
Vorbemerkung
Viele der in diesem Buch geschilderten Episoden sind das Ergebnis erschöpfender Nachforschungen. Sie beruhen darüber hinaus auf historischen Dokumenten aus erster Hand, so zum Beispiel auf Jawen Mezulah von Nathan Hannover, einem eindrucksvollen, lebendigen Zeugnis des entsetzlichen Blutbads, das zwischen 1648 und 1653 unter den polnischen Juden angerichtet wurde. Dieses Dokument ist von so erschütternder Intensität, dass ich beschloss, es mit den notwendigen Kürzungen und Abänderungen in den Roman aufzunehmen und mit fiktiven Personen auszustatten. Als ich den Text in der französischen Übersetzung (Le Fond de l’Abîme) las, wurde mir klar, dass ich dieses Grauen nicht besser würde beschreiben und mir noch weniger den Grad des Sadismus und der Perversion würde vorstellen können, als es der Chronist real erlebt und wenig später niedergeschrieben hatte.
Doch da es sich um einen Roman handelt, unterwarf ich einige der historischen Ereignisse den Erfordernissen einer dramatischen Entwicklung im Interesse ihrer Verwendung für den, ich wiederhole es, Roman. Die Passage, in der dies vielleicht am deutlichsten wird, betrifft die Ereignisse in den 1640er Jahren. In ihr werden die damaligen Vorfälle zusammengefasst und mit einigen der vorangegangenen Dekade vermischt, wie zum Beispiel der Verurteilung von Baruch de Spinoza, der Wallfahrt des angeblichen Messias Schabbtai Zvi oder der Reise von Menasse ben Israel nach London, mit der er 1655 Cromwell und das englische Parlament dazu bewegen konnte, die Anwesenheit der Juden, die kurz darauf in England Zuflucht suchen würden, stillschweigend zu dulden.
In den darauf folgenden Passagen wird die historische Chronologie gewahrt, allerdings mit kleineren Änderungen in der Biografie einiger realer Personen. Denn Realität, Geschichte, Wirklichkeit und Roman unterliegen einer unterschiedlichen Dynamik.
HÄRETIKER (Ketzer). Aus dem Griechischen hairetikós, adj., abgeleitet vom Substantiv haíresis, »Trennung, Auswahl«, und vom Verb haireísthai, »trennen, auswählen, hervorheben«, ursprünglich zur Abgrenzung von Personen, die anderen Denkschulen angehören, d. h., die bestimmten »Denkmustern« anhängen. Der Begriff taucht zum ersten Mal im Zusammenhang mit den Christen auf, die sich von der Frühkirche abspalten, und zwar im Traktat Adversus haereses (Ende des 2. Jh. n. Chr.) von Irenäus von Lyon, geschrieben insbesondere gegen die gnostischen Lehren. Wahrscheinlich abgeleitet aus der indogermanischen Wurzel *ser, in der Bedeutung von »ergreifen, aufnehmen«. Im Hethitischen findet sich das Wort »šaru« und im Gälischen »herw«, beides in der Bedeutung von »Halbstiefel«.
Laut Wörterbuch der Königlichen Akademie für die Spanische Sprache: HEREJE (HÄRETIKER) (abg. von eretge). 1. allg.: Person, die eins oder mehrere der von einer Religion errichteten Dogmen nicht anerkennt. // 2. Person, die der von einer Institution, Organisation oder Akademie etc. vertretenen Meinung nicht zustimmt oder von deren offizieller Linie abweicht. // Kuba: estar hereje (eine Situation betreffend): sehr schwierig, insbesondere in politischer oder ökonomischer Hinsicht.
Das Buch Daniel
1
Havanna, 1939
Mehrere Jahre sollte Daniel Kaminsky brauchen, um sich an den pulsierenden Lärm einer Stadt zu gewöhnen, die in allgegenwärtiges Stimmengewirr eingehüllt war. Sehr bald hatte er herausgefunden, dass hier alles unter lautem Geschrei besprochen und beschlossen wurde, alles schrillte durch die Atmosphäre und die Feuchtigkeit: Die Autos machten sich mittels explosionsartiger Geräusche und Motorengeknatter bemerkbar oder verschafften sich durch anhaltendes Hupen Gehör, die Hunde bellten mit oder ohne Anlass, und die Hähne krähten sogar um Mitternacht, während die Straßenhändler mit einer Trillerpfeife, einer Glocke, einer Trompete, mit Pfiffen, einer Knarre, einer Flöte, melodiösem Singsang oder einfach nur mit Gebrüll auf sich aufmerksam machten. Er war in einer Stadt gestrandet, in der zu allem Überfluss jeden Abend um Punkt neun ein gewaltiger Kanonenschuss widerhallte, ohne dass der Krieg erklärt worden oder Stadttore zu schließen gewesen wären, und in der immer, wirklich immer, in fetten wie in mageren Zeiten, irgendjemand Musik hörte und auch noch dazu sang.
In seiner ersten Zeit in Havanna versuchte der Junge oftmals, sofern es ihm sein an Erinnerungen armes Gedächtnis erlaubte, die träge Stille des Judenviertels von Krakau heraufzubeschwören, wo er geboren worden war und seine ersten Lebensjahre verbracht hatte. Aus der reinen Intuition des Entwurzelten heraus sehnte er sich nach jener magentafarbenen, kalten Stadt seiner Vergangenheit wie nach einem Holzbrett, an das er sich nach dem Schiffbruch, in den sich sein Leben verwandelt hatte, hätte klammern können. Doch sobald seine tatsächlich erlebten oder nur erfundenen Erinnerungen den festen Boden der Realität berührten, versuchte er, ihr zu entfliehen, denn im stillen, düsteren Krakau seiner Kindheit konnte lautes Geschrei nur zweierlei bedeuten: entweder war Markttag, oder es drohte irgendeine Gefahr. Während seiner letzten Jahre in Polen drohte häufiger Gefahr, als dass Obst und Gemüse verkauft wurde, und die Angst war eine ständige Begleiterin.
Wie nicht anders zu erwarten, deutete Daniel Kaminsky in der Stadt der schrillen Töne das Aufbrausen jenes explosiven Lärms als Alarmzeichen. Es ließ ihn hochschrecken, bis er mit den Jahren begriff, dass den gefährlichsten Situationen in dieser neuen Welt Stille voranzugehen pflegte. Als er schließlich mit dem Lärm zu leben lernte, ohne ihn zu hören, und zu atmen, ohne sich dessen bei jedem Atemzug bewusst zu sein, entdeckte der junge Daniel, dass er die Stille inzwischen nicht mehr als Wohltat schätzte. Doch er war stolz darauf, sich mit dem Getöse Havannas versöhnt zu haben und sich dieser turbulenten Stadt zugehörig zu fühlen, in die ihn ein historischer oder göttlicher Fluch geworfen hatte. Bis zum Ende seines Lebens würde er uneins sein, welches der beiden Adjektive das zutreffende war.
An jenem Tag, an dem für Daniel Kaminsky der schlimmste Albtraum seines Lebens begann und sich zugleich die ersten Hoffnungsschimmer seines privilegierten Schicksals zeigten, lagen ein intensiver Meergeruch und eine ungewöhnliche, fast hörbare Stille über dem frühmorgendlichen Havanna. Sein Onkel Joseph hatte ihn viel zeitiger geweckt als sonst, wenn er ihn in die hebräische Schule des Jüdischen Zentrums schickte, wo der Junge seine schulische und religiöse Ausbildung erhielt. Dazu den Spanischunterricht – unumgänglich, wenn er sich in der verwirrenden, bunten Welt zurechtfinden wollte, in der er für wusste der Himmel wie lange Zeit leben würde. Doch nachdem der Onkel ihm den Sabbat-Segen erteilt und ihm ein frohes Schawuotfest gewünscht hatte, wurde es offensichtlich, dass der Tag ein ganz besonderer war: Entgegen seiner Gewohnheit drückte der Onkel dem Jungen einen Kuss auf die Stirn.
Onkel Joseph, ebenfalls ein Kaminsky und natürlich auch Pole, damals schon von allen »Pepe Cartera« genannt – wegen des Geschicks, mit dem er Taschen, Geldbörsen und Aktenmappen (»Carteras«) sowie andere Lederartikel anfertigte –, hatte die Gebote des jüdischen Glaubens stets gewissenhaft befolgt und würde dies bis zu seinem Tod tun. Deswegen erinnerte er den Jungen, bevor er ihm erlaubte, mit dem Frühstück zu beginnen, daran, dass sie es nicht bei den rituellen Waschungen und den üblichen Gebeten eines ganz besonderen Morgens belassen dürften. Die Gnade des Allerhöchsten, gesegnet sei Er, habe es nämlich gewollt, dass das Schawuotfest, die Feier zur Erinnerung an die Überreichung der Zehn Gebote an Moses und die feierliche Annahme der Thora durch die Gründer der Nation, dass also das Schawuotfest auf einen Sabbat falle. Nein, an diesem Morgen müssten sie noch viele weitere Bitten an ihren Gott richten, damit sie mit Seiner Hilfe auf bestmögliche Art das Problem lösen konnten, das sich derzeit zuspitze. Selbst wenn die Bedrohung sie womöglich gar nicht erreiche, fügte der Onkel mit verschmitztem Lächeln hinzu.
Nach fast einer Stunde des Betens, während der Daniel glaubte, vor Hunger und Müdigkeit ohnmächtig zu werden, bedeutete Joseph Kaminsky ihm endlich, er dürfe sich nun von dem reichhaltigen Frühstück bedienen. Es bestand aus Ziegenmilch (die Italienerin Maria Perupatto, eine römische Christin und als solche von Onkel Joseph als »Sabbat-Goi« ausgewählt, hatte sie über den glühenden Kohlen ihres Öfchens erwärmt), ungesäuertem Brot, Obstkonfitüre und sogar einer ordentlichen Portion honigtriefender Baklava. Ein Festessen, bei dem sich das Kind fragte, woher der Onkel das Geld für einen solchen Luxus nahm. Denn außer den Lärmqualen und der schrecklichen Woche, die auf diesen Morgen folgen sollte, würde Daniel Kaminsky für den Rest seines langen Erdenlebens von jenen Jahren den unersättlichen und ungesättigten Hunger in Erinnerung behalten, der ihn stets verfolgte wie ein treuer Hund.
Nach dem ungewöhnlich üppigen Frühstück nutzte der Junge den ausgedehnten Aufenthalt seines an Verstopfung leidenden Onkels auf der Gemeinschaftstoilette der Mietskaserne, um auf das Flachdach des Gebäudes zu steigen. In diesen frühen Stunden vor Sonnenaufgang war der Fliesenboden noch kühl. Obwohl es ihm verboten war, wagte er sich an den Rand des Daches vor, um auf die Straßen Compostela und Acosta im Herzen der wachsenden jüdischen Gemeinde Havannas hinunterzublicken. Das Regierungsgebäude, ein altes katholisches Kloster aus der Kolonialzeit, in dem es sonst vor Menschen wimmelte, war noch verriegelt und verrammelt und lag da wie tot. Unter der Arkade über der Calle Acosta, dem sogenannten »Bogen von Bethlehem«, ging niemand hindurch. Das Kino Ideal, die deutsche Bäckerei, die polnische Eisenwarenhandlung, das Restaurant Moishe Pipik, das für den Appetit des stets hungrigen Kindes die größte Verlockung auf dem Erdball darstellte, hatten ihre Rollläden noch unten und die Lichter in den Schaufenstern noch nicht angezündet. Auch wenn in dieser Gegend viele Juden wohnten und die meisten Geschäfte Juden gehörten, von denen einige ihre Läden samstags geschlossen hielten, war die herrschende Stille nicht nur auf die frühe Stunde zurückzuführen oder darauf, dass Sabbat war, dazu Schawuot, ein Tag der Synagoge also, sondern auch auf die Tatsache, dass in diesem Augenblick, während die Kubaner noch tief und fest schliefen, die Mehrheit der Aschkenasen und Sepharden ihre besten Kleider aus dem Schrank holten und sich, wie die Kaminskys, zum Ausgehen fertig machten.
Die Stille der frühmorgendlichen Stunde, der Kuss des Onkels, das unerwartete Frühstück und der glückliche Umstand, dass Schawuot auf einen Sabbat fiel, hatten Daniels kindliche Erwartung an den beginnenden, außergewöhnlichen Tag nur noch gesteigert. Denn der eigentliche Grund für das zeitige Wecken war ein anderer: Im Lauf des Morgens sollte der Überseedampfer MS St. Louis im Hafen von Havanna anlegen. An Bord des Schiffes, das zwei Wochen zuvor in Hamburg ausgelaufen war, befanden sich neunhundertsiebenunddreißig Juden, die von der nationalsozialistischen Regierung Deutschlands die Erlaubnis erhalten hatten, das Land zu verlassen. Und unter den Passagieren der St. Louis befanden sich der Arzt Jesaja Kaminsky, seine Frau Esther Kellerstein und Judith, ihre kleine Tochter, das heißt, der Vater, die Mutter und die Schwester des kleinen Daniel Kaminsky.
2
Havanna, 2007
Als er die Augen öffnete und bevor er in seinem von billigem Rum noch umnebelten Hirn Ordnung schaffen und sich bewusst werden konnte, dass er die Nacht bei Tamara verbracht hatte und dass, wie sollte es auch anders sein?, Tamara die Frau war, die nun an seiner Seite schlief, durchdrang Mario Conde, wie ein plötzlicher Stich ins Herz, das heimtückische Gefühl des Scheiterns, das ihn nun schon so lange begleitete. Warum aufstehen? Was kannst du mit deinem Tag anstellen?, fragte ihn das hartnäckige Gefühl wie so oft. El Conde wusste darauf keine Antwort und verließ mit dieser bedrückenden Gewissheit das Bett. Er gab sich dabei größte Mühe, den friedlichen Schlaf der Frau nicht zu stören, aus deren halb geöffnetem Mund ein silbriger Speichelfaden rann und ein beinahe musikalisches, leicht pfeifendes Schnarchen drang.
Nachdem er am Küchentisch frisch aufgebrühten Kaffee getrunken und sich die erste Zigarette des Tages angezündet hatte, was ihn wieder in den labilen Zustand eines verstandesbegabten Wesens versetzte, sah er auf den Innenhof hinaus, wo sich langsam das erste Licht eines weiteren heißen Septembertags ausbreitete. Die Aussichten waren jedoch so trüb, dass er auf der Stelle beschloss, ihnen auf die einzige ihm bekannte Weise und in der einzigen Form, die ihm möglich war, zu begegnen: von vorn und mit offenem Visier.
Eineinhalb Stunden später lief derselbe Mario Conde aus allen Poren schwitzend durch die Straßen des Cerro und schrie wie ein mittelalterlicher Straßenhändler aus vollem Hals sein verzweifeltes Anliegen heraus: »Kaufe alte Bücher! Los, komm schon, verkauf mir deine alten Bücher!« Seit El Conde vor fast zwanzig Jahren den Polizeidienst quittiert hatte, um sich dem sehr heiklen, aber damals noch einträglichen An- und Verkauf alter Bücher zu widmen, hatte er alle möglichen Betriebsmodelle ausprobiert. Angefangen bei der primitiven Methode, sein Kaufinteresse lauthals auf der Straße herumzuposaunen (was seinen Stolz anfangs aufs Tiefste verletzt hatte), über das Aufsuchen ausgewählter Bibliotheken nach Hinweis irgendeines Informanten oder früheren Kunden bis hin zum Klopfen an die Türen von Häusern im Vedado oder in Miramar, bei denen gewisse Merkmale (ungepflegter Garten, Fenster mit einer zerbrochenen Scheibe) darauf schließen ließen, dass möglicherweise Bücher vorhanden und, vor allem, die Bewohner dazu gezwungen waren, sie zu verkaufen. Als er dann einige Zeit später das Glück hatte, Yoyi El Palomo kennenzulernen, den jungen Mann mit dem untrüglichen Riecher fürs Geschäft, und fortan ausschließlich nach besonders exquisiten Büchern suchte, für die Yoyi immer genau die richtigen Käufer auftrieb, begann für El Conde eine Phase wirtschaftlichen Aufschwungs. Sie dauerte mehrere Jahre an und gestattete es ihm, sich beinahe hemmungslos seinen Lieblingsbeschäftigungen im Leben zu widmen: gute Bücher zu lesen und mit seinen ältesten und engsten Freunden zu essen, zu trinken, Musik zu hören und zu philosophieren (besser gesagt: dummes Zeug zu quatschen).
Doch dieser Quell sprudelte nicht ewig. Seit er vor drei, vier Jahren über die märchenhafte, von den Geschwistern Dionisio und Amalia Ferrero fünfzig Jahre lang eifersüchtig gehütete Bibliothek der Familie Montes de Oca gestolpert war, war er nie wieder auf eine vergleichbare Goldader gestoßen. Seitdem war größerer Aufwand erforderlich, um die Wünsche der anspruchsvollen Käufer zu befriedigen. Das Feld war praktisch abgeerntet und rissig geworden wie Böden in der Trockenzeit, und für El Conde brachen Zeiten an, in denen es häufiger Tiefs als Hochs gab und die ihn zwangen, immer öfter auf die erbärmliche, schweißtreibende Methode des Straßenkaufs zurückzugreifen.
Weitere eineinhalb Stunden später, als er einen Teil des Cerro durchquert hatte und sein Geschrei, allerdings ohne greifbares Ergebnis, sogar bis ins benachbarte Palatino gedrungen war, zwangen ihn Gleichmut, Trägheit und die brutale Septemberhitze dazu, das Geschäft ruhen zu lassen und in einen Bus zu steigen, der aus dem Nichts auftauchte, wunderbarerweise vor ihm hielt und ihn in die Nähe des Hauses seines Geschäftspartners brachte.
Yoyi El Palomo war im Gegensatz zu Mario Conde ein Unternehmer mit Weitblick und hatte seine Aktivitäten umgestellt. Seltene, kostbare Bücher seien nur ein Hobby, behauptete er, sein wahres Interesse gelte lukrativeren Dingen, nämlich dem An- und Verkauf von Häusern, Autos, Schmuck und anderen wertvollen Dingen. Der junge Ingenieur, der nie einen Schraubenzieher in die Hand genommen, geschweige denn eine Baustelle betreten hatte, hatte Mario immer wieder mit seiner Hellsichtigkeit in Erstaunen versetzt und schon vor geraumer Zeit erkannt, dass das Land, in dem sie lebten, weit entfernt war von dem Paradies, das in den Zeitungen und in den offiziellen Reden beschrieben wurde. Und so hatte er beschlossen, Profit aus der Misere zu schlagen, so wie es die Fähigsten immer zu tun wissen. Mit Geschick und Intelligenz griff er an mehreren Fronten an, stets am Rande der Legalität, aber nie zu weit über die rote Linie hinaus. Seine Geschäfte brachten ihm genug ein, um wie ein Fürst zu leben: Markenkleidung, Goldschmuck, teure Restaurants. Stets in Begleitung schöner Frauen und in seinem Chevrolet Cabriolet »Bel Air«, Baujahr 1957, den Kenner als das vollkommenste, robusteste, eleganteste und komfortabelste Auto betrachten, das je eine nordamerikanische Fabrik verlassen hat – und für das Yoyi, jedenfalls für kubanische Verhältnisse, ein Vermögen hingeblättert hatte. Yoyi war in jeder Hinsicht ein Musterexemplar des von der Realität überholten Neuen Menschen: desinteressiert an Politik, den vielfältigen Genüssen des Lebens zugewandt und mit einer nutzorientierten Moral ausgestattet.
»Verdammt, man, du siehst ja richtig scheiße aus«, begrüßte er seinen schweißgebadeten Geschäftspartner, dessen Gesicht er semantisch und eschatologisch damit präzise beschrieben hatte.
»Danke«, erwiderte Conde nur und ließ sich auf das weiche Sofa fallen, von dem aus Yoyi, frisch geduscht nach einem zweistündigen privaten Fitnesstraining, sich gerade ein Baseballspiel der obersten US-Liga auf seinem 52-Zoll-Flachbildschirm anschaute.
Wie so häufig lud Yoyi ihn zum Mittagessen ein. Die Frau, die den jungen Mann bekochte, hatte Kabeljau auf baskische Art zubereitet, dazu Reis mit schwarzen Bohnen, in trockenem Wein, Zucker, Zimt und Butter gebackene Kochbananen und einen Gemüsesalat. El Conde schlang alles mit Heißhunger hinunter, begleitet von einer Flasche Pesquera reserva. Yoyi hatte sie aus dem Freezer geholt, in dem er seine Weine bei der für das feucht-tropische Klima erforderlichen Temperatur aufbewahrte.
Während sie den Kaffee auf der Terrasse tranken, plagte El Conde wieder jenes nagende Gefühl des Scheiterns und der Frustration.
»Es läuft nicht mehr, Yoyi. Die Leute haben nicht mal mehr alte Zeitungen.«
»Irgendwas geht immer, man, du darfst nur nicht aufgeben«, sagte der andere und streichelte wie gewöhnlich den riesigen Muttergottes-Anhänger an der dicken Goldkette über seinem kräftig gewölbten Brustkorb, dem er seinen Spitznamen »El Palomo«, der Täuberich, verdankte.
»Was heißt hier, nicht aufgeben? Was zum Henker soll ich denn tun?«
»Ein dicker Auftrag liegt in der Luft, das sagt mir mein Riecher«, erwiderte Yoyi und schnupperte tatsächlich in die heiße Septemberluft. »Du wirst in Pesos ersaufen.«
Conde wusste, worauf Yoyis Vorahnungen hinausliefen, und er schämte sich bei dem Gedanken, dass er hierherkam, um seinen Partner anzustacheln. Doch von seinem alten Stolz war nur noch wenig übrig, und stand ihm das Wasser bis zum Hals, kreuzte er hier auf und jammerte Yoyi etwas vor. Mit seinen vierundfünfzig Jahren gehörte er zu dem, was er und seine Freunde vor einigen Jahren als die »verborgene Generation« bezeichnet hatten: älter gewordene, gescheiterte Männer, die sich in ihre Schlupfwinkel verkrochen und zur enttäuschtesten, kaputtesten Generation innerhalb des im Entstehen begriffenen neuen Landes entwickelt (oder besser gesagt: zurückentwickelt) hatten. Zu kraftlos und zu alt, um sich zu Kunsthändlern oder Leitern ausländischer Unternehmen oder wenigstens zu Klempnern oder Konditoren umschulen zu lassen, blieb ihnen nur noch der Kampf ums nackte Überleben. Während einige von den Dollarüberweisungen ihrer Kinder aus irgendeinem Teil der Welt lebten, versuchten andere, sich irgendwie durchzuschlagen, um nicht im absoluten Elend zu versinken oder im Gefängnis zu landen. Sie gaben Privatstunden, vermieteten ihr klappriges Auto (mit und ohne Chauffeur), arbeiteten auf eigene Rechnung als Tierärzte oder Masseure, taten, was immer sich ergab. Doch es war nicht einfach, sich über Wasser zu halten, und verursachte jene Erschöpfung, das Gefühl ständiger Unsicherheit und endgültigen Scheiterns, das auch den ehemaligen Polizisten häufig quälte und dazu trieb, auf der Suche nach alten Büchern, mit denen er ein paar Pesos zum Überleben verdienen konnte, durch die Straßen zu laufen.
Nachdem sie Kaffee getrunken, ein paar Zigaretten geraucht und über dies und das geplaudert hatten, gähnte Yoyi herzhaft und sagte zu Conde, nun sei es Zeit für eine Siesta, bei dieser Hitze die einzige anständige Tätigkeit für einen Habanero, der etwas auf sich halte.
»Keine Sorge, ich geh schon …«
»Du gehst nirgendwohin, man«, sagte Yoyi, wobei er sein Lieblingswort noch mehr in die Länge zog. »Schnapp dir die Campingliege aus der Garage und stell sie im Schlafzimmer auf. Hab die Klimaanlage schon vor ner Weile anwerfen lassen. Die Siesta ist heilig. Nachher bring ich dich nach Hause, ich muss sowieso noch weg.«
Da Conde nichts Besseres zu tun hatte, kam er der Aufforderung nach. Obwohl er rund zwanzig Jahre älter war als El Palomo, hatte er grundsätzlich Vertrauen in dessen Lebensweisheit. Und nach dem Kabeljau und der Flasche Pesquera drängte sich eine Siesta, das Beste, was die Spanier ihnen hinterlassen hatten, in der Tat auf. Man ergab sich quasi nur dem Befehl des tropischen Fatalismus.
Drei Stunden später nahmen die beiden Männer in dem glänzenden Chevrolet Cabrio, den Yoyi voller Stolz durch die holprigen Straßen Havannas lenkte, Kurs auf El Condes Stadtviertel. Kurz bevor sie das Haus des ehemaligen Polizisten erreichten, bat der seinen Partner, anzuhalten.
»Lass mich an der Ecke raus«, sagte er, »ich hab da was zu erledigen.«
Yoyi El Palomo grinste und hielt an der Bordsteinkante.
»In der Bar der Verzweifelten?«, fragte er, da er die Bedürfnisse und Charakterschwächen El Condes kannte.
»Mehr oder weniger.«
»Hast du Geld?«
»Mehr oder weniger. Aus dem Fonds für den Bücherkauf«, wiederholte El Conde gebetsmühlenartig und streckte dem Jüngeren die Hand zum Abschied hin, die dieser kraftvoll drückte. »Danke für das Essen, die Siesta und das Bringen.«
»Hier, man, nimm das, für alle Fälle.«
El Palomo zog ein Geldbündel aus der Tasche, zählte ein paar Scheine ab und reichte sie Mario. »Kleiner Vorschuss auf das Geschäft, das in der Luft liegt.«
Conde sah Yoyi an und nahm das Geld, ohne langes Nachdenken. Der Jüngere half ihm nicht zum ersten Mal aus, und seitdem er von dem angeblich bevorstehenden Geschäft gesprochen hatte, wusste Conde, dass ihn beim Abschied eine kleine Finanzspritze erwarten würde. Und obwohl ihre Freundschaft zunächst aus einer rein geschäftlichen Beziehung hervorgegangen war, in die jeder seine speziellen Fähigkeiten einbrachte, wusste El Conde auch, dass Yoyi ihn wirklich mochte. Aus diesem Grund fühlte er sich bei der Scheinchenübergabe nicht noch mehr in seinem Stolz verletzt, als er es ohnehin schon war.
»Weißt du was, Yoyi? Du bist das netteste Arschloch in Kuba.«
Yoyi grinste und streichelte das riesige Goldmedaillon auf seinem vorgewölbten Brustkorb. »Erzähl das bloß nicht weiter. Wenn die Leute rauskriegen, dass ich auch nett sein kann, schadet das meinem Ruf … Wir sehen uns«, fügte er hinzu und startete den Motor des Bel Air. Der Wagen glitt dahin, als wäre er Herr über die Straßen Havannas. Oder der Welt.
Mario Conde betrachtete das trostlose Panorama, das sich vor ihm ausbreitete, und spürte deutlich, wie der Anblick seinen ohnehin schon jämmerlichen Gemütszustand noch verschlimmerte. Diese Straßenecke war der Nabel seines Viertels gewesen, und jetzt glich sie einem Eiterpickel. In einem selbstquälerischen Nostalgieanfall erinnerte er sich an seine Kindheit, als sein Großvater Rufino ihn in die Kunst des Trainings von Kampfhähnen einweihte und ihn auf das Überleben in einer Welt vorbereitete, die einem Hahnenkampfplatz sehr ähnlich war. An genau dem Punkt, wo er sich jetzt befand, konnte man damals das ständige Chaos der berühmt-berüchtigten Omnibus-Endhaltestelle des Viertels beobachten, an der sein Vater jahrelang gearbeitet hatte. Doch nachdem die Linie stillgelegt worden war, war die verwaiste Anlage immer mehr verfallen wie ein zum Sterben verurteilter Autofriedhof. Und Conchitas Kneipe, Porfirios Stand, an dem Zuckerrohrsaft gepresst wurde, die Imbissbuden von Pancho Mentira und El Albino, Nenitas Kramladen, die Friseurläden von Wildo und Chilo, die Cafeteria, Miguels Geflügelhandlung, die Bodega von Nardo und Manolo, Izquierdos Café, der chinesische Laden, das Möbelgeschäft, die Eisenwarenhandlung, die beiden Kfz-Werkstätten mit ihrem Reifenservice und der Waschanlage, der Billardsalon, die Bäckerei La Ceiba mit ihrem Duft nach Brot und Leben … all das war ebenfalls verschwunden, wie von einem Tsunami oder noch etwas Schlimmerem hinweggefegt, und überlebte nur noch in der hartnäckigen Erinnerung von Typen wie El Conde. Jetzt fungierte eine der Kfz-Werkstätten zwischen Straßen voller Schlaglöchern und kaputten Bürgersteigen als Cafeteria, die ihr Zeug gegen CUCs, die irreale kubanische Zwitterwährung, verkaufte. In der anderen Werkstatt gab es nichts mehr. Und das Lokal, in dem sich früher einmal die Bodega von Nardo und Manolo befunden hatte und das mehrmals renoviert worden war, um das Original wieder auferstehen zu lassen – leider vergeblich –, bestand nun aus einer Theke in der Tür. Durch stabile Eisenstäbe vor den Attacken möglicher Korsaren und Piraten geschützt, diente sie als Verteilerstelle von Alkohol und Nikotin und wurde von El Conde »Die Bar der Verzweifelten« getauft. Hier, und nicht in der Cafeteria, die nur CUCs annahm, tranken die wahren Trinker des Viertels zu jeder Tages- und Nachtzeit ihren billigen Rum ohne wohltuende Eiswürfel, im Stehen oder auf dem dreckigen Boden hockend, wo ihnen die unzähligen Straßenköter den Platz streitig machten.
Conde wich den schmutzigen Wasserpfützen aus, überquerte die Straße und näherte sich der mit dem Gefängnisgitter gesicherten Bar neuen Typs. Sein Alkoholdurst war weniger schlimm als sonst, musste aber nichtsdestoweniger gestillt werden. Und Gandinga, der Mann hinter dem Tresen, »Gandhi« für die Stammgäste, stand bereit, um ihm dabei behilflich zu sein.
Zwei große Glas Rum und gute zwei Stunden später stand El Conde, frisch geduscht und parfümiert mit Kölnischwasser, einem Geschenk von Tamaras Zwillingsschwester Aymara, wieder auf der Straße. Neben die Bodenklappe der Terrassentür hatte er den Fressnapf für Basura II hingestellt, der trotz seiner inzwischen zehn Jahre nach wie vor dem Straßenköterdasein frönte – eine Vorliebe, die er von seinem ruhmreichen und inzwischen verstorbenen Vater, Basura I, geerbt hatte. Conde dagegen hatte nichts gegessen: Wie an fast jedem Abend hatte Josefina, die Mutter seines Freundes Carlos, ihn zum Essen eingeladen, und in solchen Fällen war es besser, so viel Platz wie möglich im Magen frei zu halten. Bewaffnet mit zwei Flaschen Rum, die er dank Yoyis Großzügigkeit in der Bar der Verzweifelten hatte kaufen können, stieg er in den Bus. Und trotz der Hitze, des Chaos, der stampfenden Reggaeton-Musik, die seinen Ohren und seiner Stimmung Gewalt antat, der herrschenden Enge und der allgemeinen Erschöpfung fühlte er sich bei der Aussicht auf einen angenehmen Abend wieder einigermaßen wohl.
Ein Abend mit seinen alten Freunden beim dünnen Carlos, der längst nicht mehr dünn war, war für Mario Conde die schönste Art, den Tag zu beschließen. Am zweitschönsten fand er es, den Abend (und die Nacht) mit Tamara zu verbringen, sich gemeinsam einen seiner Lieblingsfilme anzusehen – etwa Chinatown, Cinema Paradiso, Der Malteser Falke oder das immer wieder tiefschürfende und ergreifende Werk Wir waren so verliebt von Ettore Scola mit der hinreißenden Stefania Sandrelli – und den Tag mit einer Runde Sex abzuschließen, der mit der Zeit weniger wild und langsamer geworden war (von beiden Seiten), aber immer noch äußerst befriedigend. Diese kleinen Freuden waren die besten Hinterlassenschaften eines Lebens, das mit den Jahren und den zahlreichen Fußtritten fast alles verloren hatte, das nicht mit dem bloßen Überleben verbunden war. Verloren hatte er sogar seinen Traum, irgendwann einen Roman zu schreiben, eine so lakonische wie ergreifende Geschichte wie die von diesem verdammten Salinger, der wohl bald sterben würde, ohne auch nur eine einzige weitere erbärmliche Erzählung veröffentlicht zu haben.
Nur in jenen Bereichen, die El Conde und seine Freunde hartnäckig von der Realität ferngehalten und zum Schutz vor den Barbaren vehement abgeschirmt hatten, existierten liebenswerte, unveränderliche Welten, auf die keiner von ihnen verzichten wollte oder konnte, auch wenn sie selbst sich physisch und mental verändert hatten. Welten, mit denen sie sich identifizierten und in denen sie sich vorkamen wie Wachsfiguren, fast sicher vor den Katastrophen und Pervertierungen um sie herum.
Der dünne Carlos, der Hasenzahn und der rote Candito unterhielten sich bereits vor dem Haus. Seit ein paar Monaten saß Carlos in einem neuen, batteriebetriebenen Rollstuhl, einem Wunderding, das ihm die stets hilfsbereite treue Dulcita aus dem Norden mitgebracht hatte. Dulcita, die verlässliche Exverlobte des Dünnen, noch verlässlicher, seit sie ein Jahr zuvor Witwe geworden war, kam jetzt doppelt so häufig von Miami nach Kuba geflogen und blieb – aus offensichtlichem, wenn auch nicht öffentlich eingestandenem Grund – jedes Mal länger auf der Insel.
»Weißt du, wie spät es ist, Alter?«, begrüßte ihn der Dünne und setzte seinen elektrisch betriebenen Stuhl in Gang, um Mario die Plastiktüte zu entreißen, in der er zu Recht den für den bevorstehenden Abend benötigten Brennstoff vermutete.
»Red keinen Scheiß, Dünner, es ist erst halb neun … Was läuft, Roter? Wie gehts, Hasenzahn?«, fragte El Conde und drückte den beiden Freunden die Hand.
»Beschissen, aber glücklich«, antwortete der Hasenzahn.
»Genauso wie dem da …«, sagte Candito und wies mit dem Kinn auf den anderen. »Aber ich will mich nicht beklagen. Wenn ich merke, dass ich losjammern will, bete ich ein wenig.«
Conde lachte. Seit Candito die bewegten Zeiten in den verschiedensten Berufen – Betreiber einer Flüsterkneipe, Schuhfabrikant mit geklautem Material, Verwalter eines illegalen Benzinlagers – hinter sich gelassen und sich dem Protestantismus zugewandt hatte – welcher der zahlreichen Spielarten, wusste Conde nicht –, versuchte der Mulatte mit dem inzwischen weiß gewordenen Haar seine Probleme mit Gottes Hilfe zu lösen.
»Irgendwann werde ich dich bitten, mich zu taufen, Roter«, sagte Mario. »Das Problem ist nur, ich bin dermaßen im Arsch, dass ich danach den ganzen Tag lang beten müsste.«
Carlos kam in seinem Rollstuhl zurück vor die Tür gefahren, auf den Knien seiner schlaffen Beine ein Tablett mit vier klirrenden Wassergläsern, drei randvoll mit Rum und eins mit Limonade. Beim Verteilen der Getränke – die Limonade war natürlich für Candito – sagte er: »Das Essen ist so gut wie fertig.«
»Und was serviert uns Josefina heute?«, wollte der Hasenzahn wissen.
»Sieht schlecht aus, sagt sie, und außerdem wär sie nicht inspiriert.«
»Dann macht euch auf was gefasst!«, rief El Conde, der ahnte, was auf sie zukam.
»Weils so heiß ist«, sagte Carlos, »gibts als Vorspeise einen Kichererbseneintopf mit Chorizo, Morcilla, ein paar Brocken Schweinefleisch und Kartoffeln. Als Hauptgericht gegrillten Fisch, einen Pargo, aber nicht besonders groß, nur etwa zehn Pfund schwer. Und natürlich Reis, aber mit Gemüse, wegen der Verdauung, sagt sie. Und der Salat ist auch schon fertig: Avocados, grüne Bohnen, Radieschen und Tomaten.«
»Und zum Nachtisch?« El Conde sabberte wie ein tollwütiger Hund.
»Das Übliche: Guavenscheiben mit weißem Käse. Wie gesagt, sie war nicht inspiriert.«
»Scheiße noch mal, Dünner, ist die Frau eine Zauberin?«, rief Candito, der sich offenbar darüber wunderte, dass sein Glaube an das Unbegreifliche noch übertroffen wurde.
»Wusstest du das nicht?«, rief Conde und kippte das halbe Glas Rum hinunter. »Das kannst du mir nicht erzählen, Roter, mir nicht!«
»Mario Conde?«
Als ihm der Hüne mit dem Pferdeschwanz diese Frage stellte, begann er nachzudenken: Seit Jahren hatte er keinem Ehemann mehr Hörner aufgesetzt, seine Büchergeschäfte waren so sauber, wie Geschäfte nur sein konnten, Geld schuldete er nur Yoyi … und den Polizistenberuf hatte er schon vor so langer Zeit an den Nagel gehängt, dass ihn unmöglich jemand mit einer Vendetta bedrohen konnte. Zog er dazu den eher erwartungsvollen denn aggressiven Ton und den freundlichen Gesichtsausdruck des Mannes vor sich in Betracht, wuchs seine Sicherheit, dass der Unbekannte wohl nicht die Absicht hatte, ihn umzubringen oder zu verprügeln.
»Ja, bitte?«
Der Mann hatte sich aus einem der beiden wackligen Schaukelstühle mit der abgeblätterten Farbe erhoben, die El Conde vor seinem Haus stehen und trotz ihres beklagenswerten Zustands aneinander- und dann an eine Säule des Portals gekettet hatte, um jeden Versuch zu erschweren, sie von der Stelle zu bewegen. Im lediglich von der Straßenbeleuchtung durchbrochenen Dämmerlicht – die letzte Glühbirne der Lampe im Hauseingang hatte Conde eines Nachts, zu besoffen, um sich über Glühbirnen Gedanken zu machen, bei irgendwem anders eingeschraubt und dort vergessen – konnte er sich ein erstes Bild von dem Besucher machen. Der Mann war etwa ein Meter neunzig groß, etwas über vierzig Jahre alt und einige Kilos schwerer, als sein Körperbau es vorsah. Das vorn eher spärliche Haar trug er zum Ausgleich im Nacken lang und zu einem Pferdeschwanz gebunden, der wiederum ein Gleichgewicht zu seiner enormen Nase herstellte. Als Conde vor ihm stand und die blassrosa Hautfarbe sowie die sportlich elegante Qualität seiner Kleidung bemerkte, folgerte er, es müsse sich um jemand handeln, der übers Meer gekommen war. Über irgendeines der sieben Meere.
»Elias Kaminsky, sehr erfreut«, sagte der Fremde lächelnd und reichte El Conde die Hand.
Der warme weiche Händedruck dieser Riesenpranke überzeugte den Expolizisten davon, dass der Mann nichts Böses im Schilde führte, und er warf seinen Gehirncomputer an, um zu ergründen, warum dieser Ausländer kurz vor Mitternacht im dunklen Hauseingang auf ihn gewartet hatte. Hatte Yoyi recht, und hier stand jemand, der auf der Jagd nach seltenen Büchern war? Sah ganz danach aus, schloss El Conde und setzte ein an jedwedem Geschäft desinteressiertes Gesicht auf, wie es ihm El Palomo mit seiner merkantilen Weisheit geraten hatte.
»Wie war noch der Name?« Conde bemühte sein Gehirn, das dank des Nahrungsschocks, den die alte Josefina ihnen verpasst hatte, vom Alkohol nicht übermäßig vernebelt war.
»Elias … Elias Kaminsky. Entschuldigen Sie, dass ich Sie um diese Uhrzeit so überfalle … Hören Sie …« Der Mann, der ein ziemlich neutrales Spanisch ohne bestimmten Akzent sprach, lächelte verlegen und beschloss dann offenbar, gleich seinen besten Trumpf auszuspielen: »Ich bin ein Freund Ihres Freundes Andrés, des Arztes, der in Miami lebt …«
Bei diesen Worten wichen auch die letzten Reste der Anspannung wie durch einen Zauberspruch von Mario. Dieser Mann musste auf der Suche nach alten Büchern sein, und sein Freund Andrés hatte ihn zu ihm geschickt. Wusste Yoyi davon und hatte er deshalb so getan, als hätte er eine Vorahnung?
»Ja, natürlich, klar, er hat so was erzählt«, log El Conde, der seit zwei oder drei Monaten nichts mehr von Andrés gehört hatte.
»Umso besser. Also, Ihr Freund lässt Sie grüßen und …« Der Fremde griff in die Brusttasche seines lässigen Hemdes (von Guess, stellte Conde fest). »Er hat mir einen Brief für Sie mitgegeben.«
Conde nahm den Umschlag. Seit Jahren hatte er keinen Brief mehr von Andrés erhalten, und er war neugierig auf den Inhalt. Irgendein besonderer Grund musste den Freund veranlasst haben, sich hinzusetzen und ihm einen Brief zu schreiben, denn seit der Arzt in Miami lebte, hatte er, sozusagen als vorbeugende Maßnahme gegen das hinterlistige Heimweh, beschlossen, nur noch eine lose Verbindung zu seiner schmerzlichen und der Gegenwart deshalb abträglichen Vergangenheit zu pflegen. Nur zwei Mal im Jahr brach er das Schweigen und badete in Melancholie: an Carlos’ Geburtstag und am 31. Dezember. Er rief den Dünnen abends an, weil er wusste, dass dann seine Freunde bei ihm waren, Rum tranken und ihre Verluste bilanzierten. Verloren hatten sie auch ihn, Andrés, der vor nunmehr zwanzig Jahren, wie es in dem bekannten Bolero hieß, ohne Lebewohl fortgegangen war, um nicht zurückzukommen. Nur dass er Lebewohl gesagt hatte …
»Ihr Freund arbeitet in der Seniorenresidenz, in der meine Eltern ihre letzten Jahre verbracht haben«, fuhr der Mann fort, als er sah, dass Conde den Umschlag faltete und in die Tasche steckte. »Er hatte eine besondere Beziehung zu ihnen. Meine Mutter, die vor ein paar Monaten starb …«
»Tut mir leid.«
»Danke. Meine Mutter war Kubanerin und mein Vater Pole, hatte aber zwanzig Jahre in Kuba gelebt, bevor sie 1958 emigriert sind.« Irgendeine liebevolle Erinnerung ließ Elias Kaminsky lächeln. »Obwohl er nur zwanzig Jahre in Kuba verbracht hat, sagte er immer: er sei Jude aufgrund seiner Herkunft, Deutsch-Pole von Geburt und durch seine Eltern, rechtmäßiger Bürger der USA und von all dem abgesehen Kubaner. In Wirklichkeit war er nämlich vor allem Kubaner. Von der Partei der Schwarze-Bohnen-und-Yucca-mit-Knoblauch-Esser, sagte er immer …«
»Also ein Kollege von mir … Wollen wir uns nicht setzen?« Conde zeigte auf die beiden Schaukelstühle. Er holte einen Schlüssel hervor, schloss die Kette auf, die sie wie ein zum Zusammenleben verdammtes Ehepaar miteinander verband, und schob sie in eine günstigere Position zum Plaudern. Neugierig darauf, warum dieser Mann ihn aufgesucht hatte, war ein weiterer Teil seiner bereits wochenlang andauernden Niedergeschlagenheit wie weggefegt.
»Danke«, sagte Elias Kaminsky und setzte sich, »aber ich werde Sie nicht lange belästigen, um diese Uhrzeit …«
»Warum sind Sie denn nun zu mir gekommen?«, fragte El Conde unvermittelt.
Kaminsky zog eine Schachtel Camel hervor und bot Conde eine Zigarette an, doch der lehnte höflich ab. Nur im Falle einer nuklearen Katastrophe oder bei Todesgefahr würde er diese parfümierte, süßliche Scheiße rauchen. Nebst seiner Mitgliedschaft in der Partei der Schwarze-Bohnen-Esser war er ein Nikotinpatriot, was er umgehend bewies, indem er sich eine seiner zerstörerischen Criollos anzündete, schwarz, ohne Filter.
»Ich nehme an, dass Andrés es Ihnen in seinem Brief erklärt. Ich bin Maler, geboren in Miami, lebe inzwischen aber in New York. Meine Eltern haben die Kälte dort nicht ertragen, deshalb sind sie in Florida geblieben. Sie hatten eine kleine Wohnung in der Seniorenresidenz, und dort lernten sie Andrés kennen. Ich selbst bin zum ersten Mal in Kuba und … na ja, es ist eine lange Geschichte. Darf ich Sie morgen zum Frühstück in mein Hotel einladen? Dann können wir in Ruhe darüber reden. Andrés sagt, Sie seien der richtige Mann, um mir zu helfen, etwas über meine Eltern herauszufinden. Ach ja, ich bezahle Sie selbstverständlich für Ihre Mühe.«
Während Elias Kaminsky sprach, spürte El Conde, wie seine kurz zuvor ausgeschalteten Alarmlichter nach und nach wieder aufblinkten. Wenn Andrés diesen Mann, der offensichtlich keine seltenen Bücher suchte, zu ihm schickte, musste es einen gewichtigen Grund dafür geben. Doch bevor er einen Kaffee mit dem Unbekannten trank und erst recht, bevor er ihm sagte, dass er weder Zeit noch Lust habe, sich mit seiner Geschichte abzugeben, musste er ein paar Dinge wissen. Andererseits … Der Mann hatte von Bezahlen gesprochen, oder? Und wie viel? Der finanzielle Engpass, in dem er sich schon seit Monaten befand, ließ das Angebot verlockend erscheinen. Auf jeden Fall war es, wie immer, am besten, mit dem Anfang zu beginnen.
»Gestatten Sie, dass ich erst einmal den Brief lese?«
»Selbstverständlich. An Ihrer Stelle wäre ich auch sehr neugierig.«
Conde grinste. Er öffnete die Haustür, und das Erste, was er sah, war Basura II, der auf dem Sofa lag, auf dem einzigen freien Platz, der von Bücherstapeln nicht belegt war. Der Hund knurrte im Schlaf und bewegte nicht mal den Schwanz, als Conde Licht machte und den Umschlag aufriss.
Miami, den 2. September 2007
Verdammter,es ist noch lange hin bis zum Silvesteranruf, aber das hier kann nicht warten. Von Dulcita, die vor ein paar Tagen aus Kuba zurückgekommen ist, weiß ich, dass es Euch allen gut geht, nur dicker geworden seid ihr und habt weniger Haare. Der Überbringer des Briefes ist NICHT mein Freund. Seine Eltern waren es BEINAHE, zwei supernette alte Leute, vor allem er, der kubanische Pole. Der Sohn ist Maler, verkauft anscheinend ziemlich gut und hat was (ein paar $) von seinen Eltern geerbt. ICH GLAUBE, er ist ein prima Kerl. Nicht wie Du oder ich, aber irgendwie schon.
Das, worum er Dich bitten wird, ist einigermaßen kompliziert, ich glaube, nicht mal Du kannst ihm helfen. Aber versuch es, bitte, denn auch ich bin in die Sache verwickelt. Außerdem wirds Dir Spaß machen, wirst schon sehen.
Übrigens hab ich ihm gesagt, dass Du hundert Dollar pro Tag nimmst, plus Spesen. Hab ich aus einem Roman von Chandler, den Du mir vor zwei verdammten Jahren geliehen hast. Da gab es einen Typen, der hat geredet wie die Figuren von Hemingway, erinnerst Du Dich?
Seid ALLE herzlich umarmt. Ich weiß, dass der Hasenzahn nächste Woche Geburtstag hat. Richte ihm meine Glückwünsche aus. Hab Elias ein Geschenk für ihn mitgegeben, außerdem ein paar Medikamente für Jose.
Mit Liebe und Untergründigkeit,auf IMMER, Dein Bruder
Andrés
PS: Ach ja, sag Elias, er soll Dir unbedingt die Geschichte mit dem Foto von Orestes Miñoso erzählen!
El Conde bekam feuchte Augen, er konnte nichts dagegen tun. So müde und frustriert, wie ich bin, dazu die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit, da jucken einem die Augen, log er sich vor. Im Brief, in dem so gut wie nichts stand, sagte Andrés alles zwischen den Zeilen und durch die Großbuchstaben. Die Tatsache, dass er sich an den Geburtstag vom Hasen erinnerte, und das ein paar Tage vor dem Datum, verriet es: Wenn er nicht schrieb, dann weil er weder konnte noch wollte, um sich nicht herunterziehen zu lassen. Auch in der Entfernung war Andrés ihnen nah und würde es immer bleiben. Die Clique, der er seit vielen Jahren angehörte, war unzertrennlich, IN SAECULA SAECULORUM, in Großbuchstaben.
Conde legte den Brief auf den kaputten russischen Fernseher, den auf den Müll zu werfen er sich nicht entschließen konnte. Zusätzlich zu den schlimmsten und täglich neuen Frustrationen und Enttäuschungen überrollte ihn die Sehnsucht, und er vermutete, dass sich diese unerwartete Unterhaltung wohl am besten mit Alkohol ertragen ließe. Aus der Flasche billigen Rums, die er noch in Reserve hatte, goss er reichlich bemessene Rationen in zwei Wassergläser. Erst jetzt wurde er sich seiner Situation bewusst: Wollte der Typ ihm tatsächlich hundert Dollar pro Tag zahlen, nur damit er ihm half, etwas herauszufinden? Mario wurde schwindelig. In seiner aus den Fugen geratenen, ärmlichen Welt waren hundert Dollar ein Vermögen. Und wenn er ihm fünf Tage half? Das Schwindelgefühl wurde stärker, und um es in den Griff zu bekommen, trank er einen ersten Schluck direkt aus der Flasche. Mit den beiden Gläsern in der Hand und Finanzplänen im verwirrten Kopf ging er wieder vor die Tür.
»Trauen Sie sich?«, fragte er Elias Kaminsky und hielt ihm ein Glas hin. Der andere nahm es mit einem gemurmelten »Danke« entgegen. »Es ist billiger Rum … der, den ich normalerweise trinke.«
»Gar nicht schlecht«, sagte der Ausländer, nach einem vorsichtigen Nippen. »Kommt der aus Haiti?«, fragte er dann mit Kennermiene und zündete sich eine weitere Camel an.
Conde nahm einen kräftigen Schluck und tat, als koste er den billigen Fusel auf der Zunge.
»Ja, wahrscheinlich Haiti. Also gut, wenn Sie wollen, reden wir morgen in Ihrem Hotel weiter, und Sie erzählen mir ein paar Einzelheiten.« Conde bemühte sich, seine Neugier zu verbergen. »Aber sagen Sie mir, wobei genau kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Wie gesagt, es ist eine lange Geschichte. Sie hat viel mit dem Leben meines Vaters Daniel Kaminsky zu tun. Sagen wir, ich suche ein Bild, einen Rembrandt, soviel ich weiß.«
El Conde musste lachen. Einen Rembrandt? In Kuba? Vor Jahren, als er noch bei der Polizei gewesen war, hatte ihn ein Matisse in eine schmerzliche Geschichte von Liebe und Hass getrieben. Und dieser Matisse war auch noch falsch gewesen, falscher als der Treueschwur einer Hure … oder eines Polizisten. Doch die Erwähnung eines Bildes des holländischen Meisters entfachte Marios Neugier. Sie wurde immer stärker, vielleicht weil dieser fürchterliche Rum, möglicherweise tatsächlich aus Haiti, seine Wirkung tat, aber vor allem, weil ein dicker Batzen Geld winkte.
»Einen Rembrandt also … Was ist das für eine Geschichte, und was hat sie mit Ihrem Vater zu tun?«, hakte er nach und fügte zwei Argumente hinzu, die den Fremden zum Weiterreden bewegen sollten: »Um diese Uhrzeit ist es gar nicht mehr so heiß, und in der Flasche ist auch noch was drin.«
Elias Kaminsky trank aus und hielt Conde das leere Glas hin. »Setzen Sie den Rum auf die Spesen.«
»Erst mal sorge ich für eine neue Glühbirne. Besser, wenn man sich ins Gesicht sehen kann, meinen Sie nicht?«
Während er eine Birne suchte und einen Stuhl, auf den er sich stellen konnte, die Birne einschraubte und es endlich Licht ward, dachte El Conde nach. Er war wirklich nicht zu retten. Warum, zum Henker, ermunterte er den Mann, ihm die Geschichte seines Vaters zu erzählen, obwohl er ihm aller Voraussicht nach nicht helfen konnte, auch nur irgendwas zu finden? Nur weil er ihm Geld angeboten hatte? So weit ist es mit dir gekommen, Mario Conde?, überlegte er und ersparte sich für den Moment lieber die Antwort.
Als Mario wieder in seinem Schaukelstuhl saß, zog Elias Kaminsky ein Foto aus der Geheimtasche seines Freizeithemds und reichte es ihm.
»Der Schlüssel zu allem könnte dieses Foto sein.«
Es handelte sich um die abfotografierte Kopie einer alten Aufnahme. Das Sepiabraun des Originals war einem Grauton gewichen, und man konnte die gezackten Ränder des ursprünglichen Fotos erkennen. Auf dem Bild war eine Frau zwischen zwanzig und dreißig in dunklem Kleid zu sehen. Sie saß auf einem Brokatsessel mit hoher Rückenlehne. Neben ihr stand ein etwa fünfjähriger Junge, eine Hand in ihren Schoß gelegt und den Blick starr aufs Objektiv gerichtet. Aufgrund der Kleidung und der Frisuren der beiden nahm El Conde an, dass die Aufnahme aus den dreißiger Jahren stammte. Nach ausgiebiger Betrachtung der beiden Personen konzentrierte er sich auf ein kleines Bild, das hinter ihnen an der Wand hing, über einem Tischchen mit Blumenvase. Das Bild war, gemessen am Kopf der Frau, vielleicht vierzig mal fünfundzwanzig Zentimeter groß. Conde hielt das Foto ins Licht, um das Gesicht auf dem gerahmten Gemälde genauer zu studieren: das Porträt eines Mannes mit strähnigem, in der Mitte gescheiteltem Haar, das ihm bis auf die Schultern reichte, und dünnem, ungepflegtem Bart. Etwas Undefinierbares ging von diesem Bildnis aus, vor allem von dem melancholischen, etwas verlorenen Blick. Conde fragte sich, ob es sich um das Bild eines gewöhnlichen Mannes handelte oder um eine Christusdarstellung, wie er sie in einem Kunstband mit Rembrandt-Reproduktionen gesehen haben musste. Ein Christus von Rembrandt in einem jüdischen Haus?
»Ist das das Bild von Rembrandt?«, fragte er, ohne den Blick vom Foto zu heben.
»Die Frau ist meine Großmutter, der Junge mein Vater. Das Foto wurde in ihrem Haus in Krakau aufgenommen … und das Bild wurde als ein echter Rembrandt beglaubigt. Mit Lupe sieht man es besser.«
Er holte eine Lupe aus der Hemdtasche, und Conde betrachtete nun durch sie das Gemälde.
»Und was hat dieser Rembrandt mit Kuba zu tun?«
»Das Gemälde hat sich irgendwann mal in Kuba befunden. Später wurde es ins Ausland gebracht, und vor vier Monaten tauchte es in einem Auktionshaus in London auf. Es sollte zum Einstiegspreis von einer Million zweihunderttausend Dollar angeboten werden. Zu einigen seiner Werke hat Rembrandt nämlich Vorstudien gemacht, und dies scheint eine solche gewesen zu sein. Eine der vielen Vorstudien für seine großen Christusdarstellungen während der Arbeit an Pilger von Emmaus, der Version von 1648. Kennen Sie sich da ein bisschen aus?«
Conde leerte sein Glas und betrachtete das Foto erneut durch die Lupe. Wie viele Probleme in Rembrandts Leben – ein ziemlich beschissenes, wie er gelesen hatte – hätten sich mit dieser Million Dollar lösen können?, fragte er sich unwillkürlich.
»Nur wenig«, gestand er. »Ich habe Reproduktionen des Bildes gesehen. Aber wenn ich mich recht erinnere, schaut Christus auf den Pilgern nach oben, gen Himmel, oder?«
»Stimmt. Jedenfalls ist dieser Christuskopf wohl 1648 in den Besitz der Familie meines Vaters gelangt. Meine Großeltern haben das Bild auf ihrer Flucht vor den Nazis 1939 nach Kuba gebracht. Es war so etwas wie ihre Lebensversicherung. Das Bild blieb in Kuba. Sie nicht. Irgendjemand hat es sich unter den Nagel gerissen. Vor ein paar Monaten hat dann jemand anderer versucht, das Gemälde zu verkaufen. Vielleicht glaubte er, der Moment sei gekommen. Über eine Adresse in Los Angeles hat er Kontakt zu einem Auktionshaus aufgenommen. Er besitzt ein Echtheitszertifikat, das 1928 in Berlin ausgestellt wurde, und eine notariell beglaubigte Bescheinigung über den Erwerb von 1940, hier in Havanna. Zu dem Zeitpunkt waren meine Großeltern und meine Tante bereits in einem Konzentrationslager in Holland. Aber mithilfe dieses Fotos, das mein Vater sein ganzes Leben lang aufbewahrt hat, konnte ich die Auktion stoppen. Die Öffentlichkeit ist inzwischen für das Thema Kunstraub an Juden vor und während des Krieges höchst sensibilisiert. Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass es mir nicht um den materiellen Wert des Bildes geht, obwohl der nicht gerade gering ist. Nein, was ich herausfinden will, und deshalb bin ich hier und rede mit Ihnen, ist: Was ist mit diesem Gemälde geschehen, das so etwas wie eine Familienreliquie war, und was ist mit der Person geschehen, die hier in Kuba in seinen Besitz gelangt ist? Wo hat sich das Bild in der Zwischenzeit befunden? Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch herausfinden lässt, aber ich will es versuchen. Und dafür brauche ich Ihre Hilfe.«
Conde sah von dem Foto auf und musterte den Fremden. Hatte er sich verhört, oder interessierte sich der Mann tatsächlich nicht für den Millionenwert dieses Bildes? Er versuchte sich in diese offenbar außergewöhnliche Geschichte hineinzudenken, die ihm da serviert wurde, hatte im Moment jedoch nicht den geringsten Anhaltspunkt. Er wusste nur, dass er mehr wissen musste.
»Was hat Ihnen Ihr Vater darüber erzählt, wie das Bild nach Kuba gekommen ist?«
»Nicht viel. Er wusste nur, dass seine Eltern es auf der St. Louis mitgebracht hatten.«
»Auf dem berühmten Schiff, das mit den vielen Juden an Bord nach Havanna gekommen ist?«
»Genau. Über das Bild selbst hat mir mein Vater dagegen viel erzählt. Über die Person, die es hier in Kuba besaß, allerdings so gut wie nichts.«
Conde lächelte in sich hinein. Ließen ihn die Müdigkeit, der Rum und seine Niedergeschlagenheit endgültig verblöden, oder war das inzwischen sein Normalzustand?
»Ehrlich gesagt, ich versteh das nicht so ganz … Besser gesagt, ich versteh überhaupt nichts«, gestand er und gab dem Besucher die Lupe zurück.
»Ich möchte, dass Sie mir helfen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, damit ich sie verstehe. Schauen Sie, im Moment bin ich ziemlich erledigt, und ich möchte Ihnen die ganze Geschichte gern mit klarem Kopf erzählen. Aber um Sie dazu zu bewegen, sie sich bei unserem morgigen Treffen anzuhören, möchte ich Ihnen etwas gestehen. Meine Eltern sind 1958 aus Kuba fortgegangen. Nicht 59 und auch nicht 1960, als fast alle Juden und Leute mit Geld das Land verließen, um dem zu entkommen, was sie ihrer Einschätzung nach bei einer kommunistischen Regierung erwartete. Ich glaube, dass die überstürzte Abreise meiner Eltern im Jahr 1958 etwas mit diesem Rembrandt zu tun hatte. Und seitdem das Bild bei der Londoner Auktion aufgetaucht ist, bin ich sogar davon überzeugt, dass die Beziehung meines Vaters zum Bild und seine Abreise aus Kuba in einem ziemlich komplizierten Zusammenhang stehen.«
»Warum kompliziert?«, fragte Conde, jetzt endgültig sicher, allmählich stumpfsinnig zu werden.
»Weil … wenn tatsächlich passiert ist, was ich vermute, hat mein Vater möglicherweise etwas sehr Schlimmes getan.«
Conde war kurz davor zu explodieren. Entweder war dieser Elias Kaminsky der lausigste Erzähler aller Zeiten oder ein diplomierter Volltrottel, trotz seines Gemäldes, seiner hundert Dollar pro Tag und seiner gehobenen Freizeitkluft.
»Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was geschehen ist und was Ihnen nun wirklich so zu schaffen macht?«
Der Hüne nahm sein Glas in die Hand und trank aus. Dann sah er Conde an und sagte: »Es ist nicht leicht zu sagen, dass man glaubt, der eigene Vater, den man immer als Vater geachtet hat … dass der eigene Vater einem anderen Menschen die Kehle durchgeschnitten hat.«
3
Krakau 1648–Havanna 1939
Zwei Jahre vor jenem dramatisch schweigsamen Morgen, an dem Daniel Kaminsky und sein Onkel Joseph zum Hafen von Havanna gingen, um die St. Louis anlegen zu sehen, hatte sich die ohnehin angespannte Situation der Juden in Europa immer weiter zugespitzt, und neues und noch größeres Unheil blieb zu befürchten. So hatten Daniels Eltern also entschieden, sich am besten direkt ins Auge des Hurrikans zu begeben und die Kraft seiner Winde auszunutzen, um sich in Sicherheit zu bringen. Da Esther Kellerstein in Deutschland geboren worden war und ihre Eltern noch dort wohnten, hatte Jesaja Kaminsky nach Bestechung mehrerer Beamter die Erlaubnis bekommen, mit seiner Frau und ihren Kindern Daniel und Judith Krakau in Richtung Leipzig zu verlassen. Dort hoffte der Arzt, zusammen mit den anderen Mitgliedern des Kellerstein-Klans – einer der angesehensten Familien der Stadt, Fabrikanten von Holz- und Saiteninstrumenten, die unzähligen deutschen Sinfonien seit Bachs und Händels Zeiten Klang und Seele verliehen hatten –, eine Lösung für ihre Probleme zu finden.
Nachdem sie sich mithilfe der Kontakte und des Geldes der Kellersteins in Leipzig eingerichtet hatten, besorgte Jesaja auf höchst komplizierten Wegen die Ausreiseerlaubnis und ein Touristenvisum für seinen Sohn Daniel, der gerade sein achtes Lebensjahr vollendet hatte. Das erste Ziel des Jungen würde die ferne Insel Kuba sein, wo er auf die Ausweitung seines Visums auf die Vereinigten Staaten warten sollte. Seine Eltern und seine Schwester würden, so hofften sie, bald nachkommen, wenn möglich auf direktem Weg nach Nordamerika. Dass die Wahl auf Havanna als ersten Anlaufpunkt fiel, lag an den erschwerten Einreisebedingungen in die Vereinigten Staaten und an dem günstigen Umstand, dass Jesajas älterer Bruder Joseph seit einigen Jahren dort lebte. Inzwischen zu dem umtriebigen Kubaner Pepe Cartera geworden, konnte Joseph den Behörden gegenüber die finanzielle Verantwortung für den Jungen übernehmen.
Für die anderen drei Familienmitglieder, die in Leipzig festsaßen, gestalteten sich die Dinge komplizierter. Zum einen durch die Einschränkungen der deutschen Behörden, die ihre jüdischen Bürger nicht ausreisen ließen (es sei denn, sie hatten Vermögen und überschrieben es bis auf den letzten Pfennig dem Staat). Zum anderen durch die wachsende Schwierigkeit, ein Visum zu erhalten, insbesondere für die Vereinigten Staaten, die Jesaja Kaminsky als idealen Ort für einen Mann seines Berufes, seines Bildungsstandes und seiner Bestrebungen ansah. Und schließlich durch die unerschütterliche Zuversicht der Kellersteins, die glaubten, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Position genug Ansehen und Respekt zu genießen, um zumindest ihr Geschäft zu einem vorteilhaften Preis verkaufen und irgendwo anders auf der Welt ein wenn auch bescheideneres Unternehmen gründen zu können. Am Ende waren es wohl diese Träume, Illusionen und Ansprüche, zusammen mit dem, was Daniel Kaminsky später als Unterwürfigkeit bezeichnen sollte, und einer lähmenden Unfähigkeit, die Vorgänge im Land zu begreifen, die sie wertvolle Monate kosteten. Monate, die sie gebraucht hätten, um die Vorbereitungen für einen der Fluchtwege zu treffen, die andere Leipziger Juden bereits gewählt hatten; Leute, die – weniger romantisch und verwurzelt als die Kellersteins – zu der Überzeugung gelangt waren, dass nicht nur ihr Geschäft, ihr Haus und ihre Freundschaften auf dem Spiel standen, sondern auch und vor allem ihr Leben, nur weil sie Juden waren in einem an aggressivem Nationalismus erkrankten Land.
Das tiefe Vertrauen in den Anstand und die Zivilisiertheit der Deutschen, mit denen sie seit Generationen erfolgreich zusammengelebt hatten, rettete die Kellersteins nicht vor dem Ruin und dem Tod. Hatten die deutschen Juden zu jener Zeit bereits all ihre Bürgerrechte verloren und waren zu Parias geworden, so wurde inzwischen die bloße Zugehörigkeit zu ihrer Religion und Rasse zu einem Verbrechen. In der schwarzen Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, der sogenannten »Kristallnacht«, sechs Monate, nachdem Daniel nach Kuba abgereist war, verloren die Kellersteins praktisch ihren gesamten Besitz.