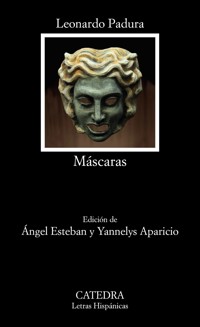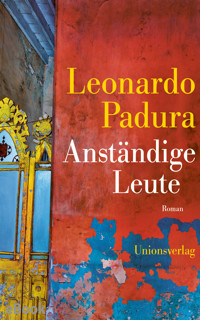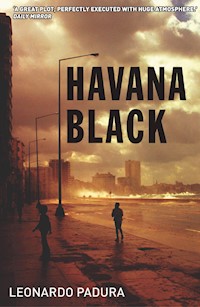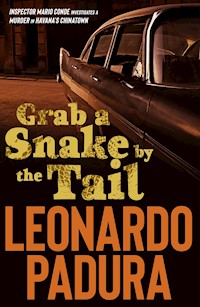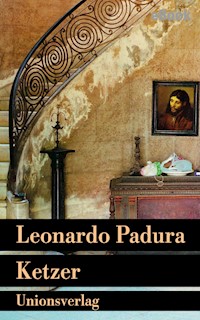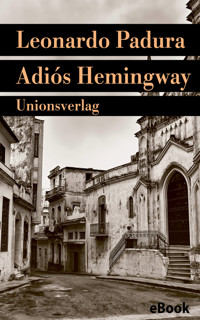9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dreh- und Angelpunkt der Geschichten ist Paduras Havanna. Alles, was wir aus seinen Romanen kennen, ist da: der Bolero, die Hitze, die Bars, in denen am Weihnachtsabend der Rum ausgeht, die zu kleinen Wohnungen mit Wasserflecken an den Decken, der Applaus aus dem Baseballstadion, die Düfte aus all den zur Straße hin offenen Küchen. Padura macht aus Alltagsszenen dieser turbulenten Stadt kurze, dichte Erzählungen, die oft die Tragik eines ganzen Menschenlebens erfassen. Diese Geschichten sind der erste Carta blanca on the rocks für alle, die Padura noch nicht kennen. Seine Leser entdecken viele neue Facetten eines vertrauten Kosmos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Padura macht aus Alltagsszenen der Stadt Havanna kurze, dichte Erzählungen, die oft die Tragik eines ganzen Menschenlebens erfassen. Diese Geschichten sind der erste Carta blanca on the rocks für alle, die Padura noch nicht kennen. Seine Leser entdecken viele neue Facetten eines vertrauten Kosmos.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Neun Nächte mit Violeta
Erzählungen
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 4 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Aquello estaba deseando ocurrir im Verlag Tusquets Editores, Barcelona.
Originaltitel: Aquello estaba deseando ocurrir (2015)
© by Leonardo Padura, 2015
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Paul Piebinga/iStockphoto.com
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30944-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 09:41h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
NEUN NÄCHTE MIT VIOLETA
Die Puerta de Alcalá1 – Das Unglück kann man auch herbeireden, hatte er …2 – Es waren noch drei Monate bis zum Examen …Neun Nächte mit VioletaAdelaida und der DichterSonatine für Rafaela – Wie die Zeit vergeht1 – Wie viele Jahre, Lucrecia?«2 – Elías schaut in den Kleiderschrank und überlegt: ›Was …3 – Den besten Freund, den ich in Angola hatte … – Die Grenzen der LiebeMittwochMittwochMittwochDonnerstagDonnerstagFreitagFreitagSamstagSonntagSonntagSonntagMontagMontagDer glückliche Tod der Alborada AlmanzaSchicksal: Mailand–Venedig (via Verona)1 – In dem Moment, als er den Blick hob …2 – Als Miguel wieder zu Vergleichen in der Lage …Die WandBeim Betrachten der Sonne – Der baumelnde Tod des Raimundo ManzaneroNachrichtStellungnahmenDokumenteStraßenklatsch und TreppenhausgerüchteEin weiteres DokumentSubjektive Analyse eines Selbstmords durch Erhängen und Entwurf eines Briefes, der nie geschrieben wurdeWeiße Weihnacht – Der JägerMehr über dieses Buch
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Angola
Zum Thema Lateinamerika
Wie immer für Lucía, die dieses Buch hat wachsen sehen. Und auch für die Freunde, die es, Geschichte für Geschichte, erlitten haben.
Taktvoll ist es, zu schweigen wie ein Stein.
Eliseo Diego
Die Puerta de Alcalá
Es beliebte zu geschehen.
Marc Aurel
(Inschrift auf der Zimmertür von Seymour und Buddy Glass, in: J. D. Salinger, Franny und Zooey)
1
Das Unglück kann man auch herbeireden, hatte er immer sagen hören. Und das Jornal de Angola berichtete wieder einmal von einer bevorstehenden Invasion der Südafrikaner. Diese Nachricht wurde wöchentlich verbreitet, zusammen mit Gewissheiten und angeblich unwiderlegbaren Tatsachen, logistischen Angaben und Regierungserklärungen. Doch obwohl die Buren in den letzten dreiundzwanzig Monaten die Grenze zu Namibia mit bedrohlichen Flugzeugen und schlagkräftigen Panzern wiederholt überschritten hatten, fand die angekündigte Invasion nicht statt. Dennoch fröstelte es ihn immer, wenn er diese Nachricht las. Es war eine dunkle, deutlich spürbare Angst, die vom Magen ausging, seine Beine zu Pudding werden ließ und ihn veranlasste, wen auch immer anzuflehen, das drohend Bevorstehende möge bis nach Februar warten. Dann nämlich würde er bereits weit weg sein von alldem, und sein zweijähriger Einsatz in Angola wäre unwiderruflich Vergangenheit.
Allerdings konnte diese Angst unmittelbare Auswirkungen haben. Kaum hatte er die Überschrift und ein paar Zeilen des ersten Absatzes gelesen, musste er sein Bett verlassen und, mit der Zeitung unter dem Arm, so rasch wie möglich das Bad aufsuchen und sich, schon auf dem Weg dorthin, die Hose aufknöpfen. Nach all den Monaten wusste er um Ursache und Wirkung jenes unkontrollierbaren Gefühls, das er in Angola kennengelernt hatte und bei aller Zwiespältigkeit in der beruhigenden Gewissheit, dass seine Angst nicht unbedingt Feigheit war, inzwischen genoss. Wenn er also auf der Kloschüssel saß, begann er, die erste Seite, die seine Ängste heraufbeschworen hatte, sorgfältig abzutrennen, um sich auf die eschatologischste und symbolischste Art, die er kannte, an ihr zu rächen: Er würde sich den Hintern mit der Nachricht abwischen. Während er auf das Ende des unfreiwilligen Reflexes wartete, drehte er die Zeitungsseite um und entdeckte eine kurze Notiz, deren Überschrift von knapp zwanzig Anschlägen lautete: DER GANZE VELÁZQUEZ. Darunter wurde berichtet, dass vom 23. Januar bis zum 30. März im Prado die, wie es hieß, »Ausstellung des Jahrhunderts« stattfinden werde, in der zum ersten und einzigen Mal seit ihrem Entstehen neunundsiebzig Meisterwerke des Künstlers aus Sevilla zu sehen sein würden, zusammengetragen aus allen Teilen der Welt, um in den Bestand des bedeutenden spanischen Museums aufgenommen zu werden.
Während er damit beschäftigt war, sich mit der Sportseite den Hintern gründlich abzuwischen, widmete er sich einer weiteren seiner Lieblingsobsessionen: ›Die Welt ist ein großer Scheißhaufen‹, dachte er, ›und ich scheiße auf Angola und die Leute in Madrid, die sich darauf freuen, diese einmalige Ausstellung von Diego Velázquez anzusehen.‹ Seit er vor nunmehr fast zwei Jahren von Kuba nach Angola geflogen war, hatte er keinen Augenblick aufgehört, so zu denken. Er dachte es, wenn er zwei Mal wöchentlich seiner Frau diese endlosen und herzzerreißenden Briefe schrieb, in die er all seine Verzweiflung legte. Er dachte es an den Tagen, an denen er vom Fenster seines Zimmers aus das Leben in dem Lager beobachtete, das mehrere Familien in einer 1976 von den Portugiesen aufgegebenen Lagerhalle errichtet hatten, und sah, wie die Männer in der Hocke auf irgendwelchen Kräutern kauend ihrerseits die ausgemergelten Frauen beobachteten, die Yuccawurzeln und Fisch für ihren Maisbrei, den Funche, auf einem Holzfeuer kochten, während sie rotznasigen, apathischen Säuglingen, die vielleicht nie erfahren würden, dass das Wort »Glück« überhaupt existierte, die Brust gaben. Und er dachte es, wenn er durch die Straßen von Luanda ging, wobei er den Müllsammlern an jeder Ecke auswich und das Gesicht abwandte, wenn er den unzähligen Versehrten eines realen und endlosen Krieges begegnete und sich fragte, warum, zum Teufel, es Menschen gab, die dazu verdammt waren, so zu leben, während er, ausgerechnet er, ohne Erwartungen, aber auch ohne Hunger durch diese kaputte, fremde Stadt schlich, die sich ihm nicht erschloss, sich nicht verstehen ließ, und deren endgültiges Schicksal sich vorzustellen ihm ebenso wenig gelang.
Seitdem war jeder beginnende Tag ein Kreuz auf einem der drei Kalender, die über seinem Bett hingen und von denen der letzte abrupt endete: Er bestand lediglich aus dem Monat Januar 1990, und jetzt waren es nur noch acht Ziffern, die durchkreuzt werden mussten.
»Was hast du dir denn reingepfiffen, als du das geschrieben hast, Kollege? Rum, Marihuana und was noch? Das ist doch nicht normal, bei Gott, wirklich nicht …« Der Chefredakteur der Zeitung schien so überzeugt von seiner Vermutung, dass er zusätzlich noch den Kopf schüttelte und lachte. Er fand fast alles zum Lachen. Aber diesmal hat er nicht ganz unrecht, dachte Mauricio und redete weiter auf ihn ein: »Schau mal, Alcides, ich bin doch nicht blöd, das weißt du. Es gibt eine Menge Leute, die nach Berlin oder Madrid fliegen, und wenn du ein bisschen nachhilfst, kann auch ich nach Madrid fliegen.«
»Und wie soll ich das begründen? Dass du dir in Spanien ein paar Bilder ansehen willst? Hör mal, Mauricio, wenn ich das sage, dann ist mein Einsatz hier zu Ende. Sie erklären mich für unzurechnungsfähig und schicken mich nach Hause, wenn nicht Schlimmeres.«
Draußen, vor dem offenen Fenster, erhob sich plötzlich ein starker Wind, und der Chefredakteur musste seine Arme schützend auf die Papiere legen, damit sie nicht vom Schreibtisch geweht wurden. Es sah ganz so aus, als würde es in Luanda zum zweiten Mal in diesem Sommer regnen, und Mauricio hoffte, dass es ein verheerender Platzregen werden würde.
»Warum? Weil sie glauben werden, dass ich in Spanien bleiben will, ja? Das ist doch bescheuert, Alcides. Da hast du dir zwei Jahre lang in Angola den Arsch aufgerissen, bist von dem Scheißchloroquin halb blind geworden und hast dir den Magen vom Büchsenfleisch verkorkst, und dann kommt irgend so ein Arschloch und unterstellt dir, dass du dich absetzen willst. Find ich ja ganz reizend …«
Der Chefredakteur ordnete die Papiere auf dem Schreibtisch und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte aufgehört zu lachen und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, so als wollte er mit dieser Geste die Müdigkeit und die Falten der letzten Monate vertreiben. In Kuba hatte er es nur zum stellvertretenden Leiter einer Regionalzeitung gebracht, aber er war auch ein vertrauenswürdiger Kader, und darum hatten sie ihn nach Angola geschickt, um die Zeitung für die freiwilligen kubanischen Kämpfer zu leiten, eine Arbeit, die er mit der größten Zuverlässigkeit erledigte. Auf jeden Fall aber war er ein umgänglicher und auch intelligenter Mann.
»Schau mal, Mauricio, ich glaube, ich kenne dich sehr gut«, sagte er schließlich, jetzt ohne zu lachen, »und ich glaube, dass man die Menschen hier in Afrika noch besser kennenlernt. Aber du musst nicht meinen, dass die anderen so denken wie ich. Du hast einen Haufen Scheiße in deiner Akte, und das weiß hier jeder, sogar der Bekloppte, der nackt über den Kinaxixi-Platz spaziert. Und du wärst nicht der Erste, der in Spanien bleibt, das weißt du. Außerdem ist da noch das Problem mit dem Flugticket …«
»Du meinst also, man wird mir wieder mit dem alten Scheiß kommen, ja? Verdammt komisch nur, dass es bei den anderen keine Probleme gibt. Zumindest bei denen, die dann geblieben sind …«
Der Chefredakteur lachte wieder, beinahe wider Willen, und warf die Zigarettenkippe von seinem Schreibtischstuhl aus durchs offene Fenster. »Erpress mich nicht, du Klugscheißer … Eine Ausstellung von Velázquez also … Na gut, mal sehen, was ich machen kann. Aber vergiss nicht, wenn du Scheiße baust, reißt man mir die Eier ab.«
»Wär nicht der schlechteste Grund«, erwiderte Mauricio. Manchmal ist das Leben eben doch nicht nur Scheiße, dachte er.
Für Velázquez zumindest war das Leben nicht Scheiße gewesen. So etwas Ähnliches versuchte Emma Micheletti, in dem Büchlein über den Maler zu zeigen, das Mauricio in einer der drei Buchhandlungen von Luanda gefunden hatte, als er während der ersten drei Monate seines Angola-Einsatzes noch in Museen und Buchhandlungen gegangen war. Das Bändchen Velázquez stand, verstaubt und fleckig, in einem der hinteren Regale, zusammen mit anderen Büchern, die man hier nicht erwartet hätte – Der Staat von Platon, auf Deutsch, die Gesammelten Werke von Erasmus, auf Italienisch, und einige Broschüren über Fußball, auf Portugiesisch –, und obwohl man es ihm als neu verkaufte, hatte es bereits eine Besitzerin gehabt: María Fernanda hatte es nicht nur mit Namen und Datum (9. 7. 1974) versehen, sondern auch einige Passagen und einzelne Sätze unterstrichen, die ihr aus verschiedenen Gründen – oder aus einem bestimmten – wichtig erschienen waren. Vielleicht wegen seiner Unfähigkeit, sich für mehr als das Anekdotische zu interessieren, oder auch wegen seines völligen Unvermögens, zwei gerade Striche hintereinander hinzukriegen, hatte sich Mauricio nie groß für Malerei interessiert. Doch seit er die Markierungen von María Fernanda bemerkt hatte, war der Band Nr. 26 der Serie »Die Juwelen der Bildenden Kunst«, veröffentlicht 1973 im Verlag Ediciones Toray in Barcelona, zu einer wunderbaren Entdeckungsreise für ihn geworden. Die Tatsache, dass dieses Buch hier in Luanda zum Kauf angeboten wurde, war das erste Rätsel, und die Person jener María Fernanda war das zweite, noch verlockendere Geheimnis. Anfangs sagte er sich, sie müsse zu den Portugiesen gehört haben, die 1975 oder 1976 aus Angola geflohen waren und ihre Geschäfte, Häuser und sogar Hunde und Bücher zurückgelassen hatten. Als er aber ihren Spuren und Obsessionen gefolgt war und sie dadurch besser kennengelernt hatte, kam er zu der Überzeugung, diese María Fernanda müsse eine leidenschaftlich Liebende gewesen sein, der man die Liebe immer vorenthalten hatte.
Zwei Markierungen in dem Buch brachten ihn auf diesen poetischen Gedanken. Ganz oben auf Seite 5 hatte die ursprüngliche Besitzerin eine Stelle blau unterstrichen und mit zwei senkrechten Strichen am Rand versehen: »Im Jahre 1624 lässt er sich mit seiner Familie in der Calle de la Concepción in Madrid nieder. Die Beziehung zum König wird erst mit dem Tod des Malers enden, und auch wenn sie bisweilen seine Freiheit einschränkte, so bot sie ihm andererseits die Möglichkeit, ein ruhiges Leben zu führen, frei von finanziellen Sorgen, wobei der Souverän ihn nicht übermäßig mit Verpflichtungen oder Einschränkungen belastete.«
Drei Seiten weiter, zu Beginn des mit »Das Werk« überschriebenen Kapitels, hatte die vermutlich unglücklich Liebende den gesamten ersten Absatz unterstrichen, diesmal mit roter Tinte, und ganz am Ende mit einem verzweifelten Ausrufungszeichen versehen. »Velázquez’ Leben«, schrieb Emma Micheletti zu María Fernandas Freude oder zu ihrem Kummer, »war rundherum glücklich. Bei genauer Betrachtung zeigen sich Parallelen zu dem von Rubens, der sich, wie wir gesehen haben, mit ihm anfreundete. Beide im Juni zur Welt gekommen, scheinen sie aufgrund ihrer Geburt in diesem strahlenden Sommermonat für ein behagliches und glückliches Leben sowie für eine frühe Anerkennung als ruhmreicher Künstler prädestiniert. Beide standen in den Diensten verständnisvoller und großzügiger Herrscher, denen sie in unverbrüchlicher Treue und Liebe verbunden waren. Beide starben im noch rüstigen Alter von etwas über sechzig Jahren, als sie ihre künstlerischen Ziele erreicht hatten, als sie ihren Stil und ihre Technik bereits perfektioniert hatten und ihnen in Wahrheit nur noch wenig hätten hinzufügen können. Verschieden waren sie vielleicht in ihrem Charakter, in ihrer expressiven und emotionalen Kraft. Rubens war sehr temperamentvoll, geradeheraus und extrovertiert; Velázquez war besonnen und nachdenklich, ein aufmerksamer Beobachter.«
Nur ein sensibler und liebender Geist mit einer gewissen Neigung zum Selbstmord macht sich so viele Gedanken über Glück und Sicherheit, sagte sich Mauricio. Doch endgültig bestärkt wurde er in seiner Überzeugung durch die bemerkenswerteste Spur, die María Fernanda in jenem Buch, das sie so sehr geliebt haben musste, hinterlassen hatte. Es waren zwei kaum wahrnehmbare Punkte unter den Abbildungen dreiundsechzig und vierundsechzig im Werkverzeichnis. Mauricio entdeckte die Punkte, weil diese Bilder auch seine Aufmerksamkeit erregt hatten. Sie waren weniger berühmt als Die Trunkenbolde, Las Meninas, Venus vor dem Spiegel oder Josephs Rock, jedoch einzigartig und faszinierend durch Thema und Gestaltung. Die Bildunterschrift lautete: »63: Blick auf die Gärten der Villa Medicis, Öl auf Leinwand, 48 x 42 cm, Madrid, Prado. Auch bekannt unter dem Titel Abend. Fertiggestellt vermutlich 1650, zusammen mit seinem Zwillingsbild Mittag (64). Die beiden Gemälde bilden eine große Ausnahme in der Produktion des Meisters. 1666 waren sie bereits Teil der Bestände des Alcázar, seit 1819 sind sie im Besitz des Prado.«
Seitdem träumte Mauricio von María Fernanda und davon, den Prado zu besuchen, um sich jenes wunderbare Diptychon anzusehen, auf dem Velázquez die geschlossenen Räume, die Könige, Päpste, Fürsten und Hofnarren hinter sich ließ und unbeirrbar, wenn auch zwei Jahrhunderte vor der Zeit, Corot und auch van Gogh, Renoir, Monet und den gesamten Impressionismus des 19. Jahrhunderts vorwegnahm. Vor allem auf dem Bild Abend: Jene Bäume, die Mauricio zu Zypressen erklärte, obwohl er noch nie im Leben eine Zypresse gesehen hatte, und die sich über die Bögen einer Galerie im Renaissancestil erheben; das diffuse, trübe, aber dennoch kraftvolle Licht, das die Konturen der beiden ins Gespräch vertieften Personen im Vordergrund verschwimmen lässt, und auch die des Mannes mit dem weiten Mantel im Hintergrund, der, mit dem Rücken zum Betrachter, die Landschaft mit den sich in der Ferne verlierenden Pinien und Weiden genießt. Dieser wundervolle Abend im Garten der Medicis vermittelt Lebenslust und zeugt von der unbändigen Freude, die der Künstler empfunden haben musste, als er, ein sanftmütiger Mann, seinen Pinsel frei und ohne Verpflichtungen gegenüber mehr oder weniger verständnisvollen und großzügigen Königen über die Leinwand gleiten ließ.
Für Mauricio stand es außer Zweifel: Diego Rodríguez de Silva y Velázquez war, wenigstens an einem Tag seines Lebens, glücklich gewesen, und María Fernanda war eine ätherische, bezaubernde Frau, die von diesem Buch auf ihrem Weg durch die Welt begleitet worden war, einem Buch, das sie mit Neid erfüllte, weil sie nicht einmal einen Tag lang glücklich gewesen war. María Fernanda hatte begriffen, dass das Glück für all jene, die keine Könige sind, ein höchst flüchtiges Privileg ist, und vielleicht hatte sie sich auf der Suche nach ihrem eigenen Königreich in der Einsamkeit im afrikanischen Dschungel verirrt.
»Los, geh Rum kaufen, du bist mir was schuldig«, sagte Alcides zu ihm, natürlich lachend.
Doch Mauricio sah ihn ernst an, ungläubig und hoffnungsvoll. »Erzähl keinen Scheiß, Alcides.«
»Am Dritten fliegst du nach Madrid. Du kommst um vier Uhr nachmittags an und fliegst am nächsten Morgen um zehn nach Havanna. Da bleibt dir genug Zeit, oder?«
Mauricio ging in sein Zimmer und suchte die siebentausend Kwanzas für die Flasche Rum zusammen, die der Chefredakteur von ihm einforderte. Dann stieg er hinunter in den vierten Stock zu Ortelio, dem Magazinverwalter. Der hielt immer – »für mich und meine Freunde«, wie sein Slogan lautete – eine Flasche dreijährigen Havana Club und andere mehr oder weniger begehrte Kleinigkeiten bereit, zum Beispiel eine Stange Zigaretten.
Auf dem Balkon der Wohnung entkorkten sie die Literflasche, und Mauricio konnte es sich nicht verkneifen, einen Toast auszusprechen: »Auf Velázquez!«
»Auf mich, verdammt noch mal«, sagte Alcides und stieß mit seinem Untergebenen an, »ohne mich könntest du Velázquez nämlich vergessen.«
Sie tranken. Sie tranken mehrere Gläser und sprachen über die Hitze, über die Zeit, die Alcides noch hier verbringen musste, und über das, was Mauricio tun würde, sobald er in Havanna wäre: zehn Mal hintereinander seine Frau vögeln, eine Woche am Strand liegen, eine Pizza auf der Rampa essen und sich nie mehr wieder einen runterholen, weil sein Rohr inzwischen wie ein Fahrradlenker aussah und seine Finger schon Schwielen hatten. Vor allem aber wollte er spätabends durch die Straßen spazieren, ohne dass es ihm irgendjemand verbot oder irgendein unsichtbarer Feind ihm in der Dunkelheit auflauerte.
»Und wie geht es für dich in der Zeitung weiter?«
Mauricio leerte sein fünftes Glas, bevor er antwortete: »Keine Ahnung, ich hoffe, nach den zwei Jahren hier wird man mir die Daumenschrauben lockern und mich wieder über Kultur schreiben lassen.«
Alcides warf seine Kippe auf die Straße. »Die haben dich kurzgehalten, was?«
»Kann man wohl sagen. Zuerst musste ich die Berichte der Korrespondenten aus der Provinz redigieren, und dann haben sie mich hierhergeschickt, zur Bewährung.«
»Die haben mich ganz schön angespitzt wegen dir. Haben gesagt, ich soll dich überwachen und alles.«
»Und das sagst du mir erst jetzt, du Arsch?«
Alcides zündete sich die nächste Zigarette an und trank noch einen Schluck. »Was sollte ich machen? Mich mit dir anlegen, ohne zu wissen, wer zum Teufel du warst? Red keinen Blödsinn, Mauricio.«
Lächelnd beobachtete Mauricio, wie die Sonne hinter dem Hotel Trópico verschwand. »Aber ich freue mich, dass ich dich hier besser kennengelernt habe. Du bist der beste Journalist, mit dem ich je zusammengearbeitet habe.«
»Danke für die Blumen, Chef.«
»Hoffentlich kriegst du alles auf die Reihe und bleibst nicht in Spanien. Nicht wegen mir, sondern wegen denen, die dir das eingebrockt haben. Gib ihnen nicht im Nachhinein recht.«
»Mir scheint, mein Leben wird eine einzige Bewährungsprobe sein, wie bei der Challenger.«
»Gieß mir noch einen ein. Sieht aus, als würde es wieder regnen.«
»Stell dir vor, ich werde die Ausstellung des Jahrhunderts sehen, Alter! Endlich werde ich mir den Blick auf die Gärten der Villa Medicis anschauen können …«
Wieder lachte Alcides und trank den nächsten Schluck Rum.
»Am Ende wirst du noch verrückt … oder schwul. Da geh ich jede Wette ein.« Jetzt lachte er nicht mehr. Er sah Mauricio in die Augen und sagte: »Glaubst du, dass wir uns in Kuba wiedersehen werden?«
Der Rum und die Bewilligung seiner Reise nach Madrid hatten Mauricio leicht euphorisch werden lassen, und er war drauf und dran, einen Scherz zu machen, doch er verkniff ihn sich.
»Glaubst du, dass wir noch Freunde sein werden, wenn wir von hier weg sind?«, fragte er.
»Fände ich gut«, seufzte Alcides. Er sah traurig aus. Alkohol legte immer seine melancholische Ader frei. »Ich werde dich nämlich vermissen, glaube ich. Nachdem ich dein Gesicht rund fünfzehn Monate lang jeden Tag gesehen habe …«
»Wär schön, wenn wir Freunde bleiben könnten. Fehlte noch, dass man nach so einem Scheißkrieg auch noch das Wichtigste verliert, oder?«
»Irgendwann werde ich dich besuchen, mit ’ner Flasche Rum. Ehrlich, das würde mir gefallen.«
Mauricio sah auf die Straße, auf der es unter den immer niedriger hängenden Wolken langsam dunkel wurde. Er bedauerte, dass er diesem Mann in den ersten Monaten so sehr misstraut hatte. In Kuba wäre Alcides vielleicht nie sein Freund geworden, möglicherweise hätten sie nie ein Wort miteinander gewechselt; aber hier, inmitten von so viel Melancholie, Angst und Einsamkeit, war alles anders, unauslöschlich. Ja, er würde sich freuen, ihn wiederzusehen, mit den drei Kugelschreibern in der Brusttasche seiner leinenen Sommerjacke, der Guayabera, dem nervigen Lachen und den Macken eines überkorrekten, äußerst verantwortungsbewussten Mannes.
»Hoffentlich klappt das mit dem Rum«, sagte er schließlich.
»Ich hätte sogar Lust, dich zu umarmen«, sagte der andere.
»Du wirst am Ende auch noch verrückt oder schwul«, erwiderte Mauricio und versuchte, das ewige Lachen seines Chefs zu imitieren.
Er konnte es immer noch nicht glauben. Die Verkettung von Zufällen, die ihn am 3. Februar 1990 nach Madrid geführt hatten, war zu kompliziert, um möglich zu sein, und ganz und gar nicht real. Wie gerne hätte er María Fernanda alles erzählt, dachte er, angefangen mit seinen Problemen bei der Zeitung bis hin zu der Entdeckung des Buches, das ihr einmal gehört hatte. Er hätte sie gebeten, mit ihm in den Prado zu gehen, um sich zusammen die neunundsiebzig Gemälde des Sevillaners anzusehen und schließlich zu der Überzeugung zu gelangen, dass sie, die frühere Besitzerin des Buches, ihn ihr Leben lang gesucht hatte, ohne zu ahnen, dass er in einem staubigen, streitsüchtigen Viertel von Havanna wohnte, nach dem sich zu sehnen er sich bis vor zwei Jahren niemals hätte vorstellen können … Als Mauricio noch sehr jung war und Biografien berühmter Männer las, hatte er mit Begeisterung die verschlungenen Wege zu ergründen versucht, die das Leben der Menschen ausmachen: eine zufällige Begegnung, eine überraschende Entscheidung, eine unerwartete Handlung. Warum geschah in seinem eigenen Leben nichts dergleichen? Er selbst betrachtete sich als Irrtum, und sein Leben erschien ihm wie eine Abfolge von Enttäuschungen und Fehlern, die dazu geführt hatten, dass all seine Ambitionen, all seine Träume verloren gegangen waren. Wenn er doch kein Liebhaber der Malerei war und sich noch nie in seinem Leben eine Reproduktion von Velázquez angesehen hatte, warum nur war er dann auf jenes Buch gestoßen und nicht der Frau über den Weg gelaufen, die es in ihren schlaflosen Nächten markiert hatte? In letzter Zeit hatte er damit begonnen, sich María Fernandas Aussehen vorzustellen. Anfangs war sie nur Geist, Stimme und Geheimnis gewesen, doch jetzt erschien sie ihm als eine blasse, stille Frau mit großen, sehr feuchten Augen, die ihm in einem Spiegel entgegenlächelte. So fand er sie auf der Abbildung siebenundsechzig des Buches, nackt vor einem Spiegel liegend. Doch sie würde ihm nie entgegensehen. Deswegen musste er sich für den Augenblick mit der Venus von Velázquez zufriedengeben.
»Entschuldigen Sie, bis wann ist der Prado geöffnet?«
Der Zollbeamte betrachtete das Foto in Mauricios Pass und hob dann den Blick. »Tja, also, Señor …«, antwortete er achselzuckend und sah ihn verwirrt und ratlos an.
»Egal«, sagte Mauricio und nahm seine Ausweispapiere wieder an sich. Auf dem Weg zur Gepäckausgabe musste er die Augen zusammenkneifen: Die blitzblanke Sauberkeit des Flughafens blendete ihn. Zwei Jahre, in denen er durch Straßen gegangen war, die nur vom Wind und den in Luanda sehr seltenen Regenschauern gereinigt wurden, in denen er mit drei weiteren Männern zusammengewohnt hatte, die abwechselnd nicht gefegt hatten, diese zwei Jahre also hatten genügt, dass ein Fliesenboden ohne Staub und Zigarettenkippen ihn regelrecht begeisterte.
Er sah auf seine Armbanduhr und seufzte: vier Uhr fünfundzwanzig. Niemand hier sah aus, als wüsste er, wann das Museum schloss. Er hatte darauf gehofft, dass es bis neun geöffnet war, und sich ausgerechnet, dass er um fünf den Flughafen verlassen, ins Hotel gehen, seinen Koffer abstellen und spätestens um sechs im Prado sein würde: Zeit genug, um sich an Velázquez zu berauschen.
Er ging auf die Toilette, und während er urinierte, sah er wieder auf seine Uhr. ›Ich bin tatsächlich in Madrid‹, dachte er um halb fünf, und als er die Toilette verließ, sah er, dass er Glück hatte: Sein Koffer lief über das Gepäckband. Er wischte sich den Schweiß von den Händen und verbot sich, erneut auf die Uhr zu schauen.
Der Bus brachte ihn zur Puerta del Sol. Der Mann, der auf der Fahrt vom Hotel Diana neben ihm saß, erklärte ihm, wie er gehen musste: »Eine der Straßen, die auf die Puerta del Sol führen, ist die Calle de Alcalá. Du gehst die ganze Alcalá runter, bis zum Ende, und bei der Banco de España bist du schon auf dem Paseo del Prado. Beim Cibeles-Brunnen biegst du rechts ab, und da ist schon das Museum«, sagte er, und dann kam das Wichtigste: »Es ist bis neun geöffnet.«
Mauricio überquerte den Platz, wobei er sämtlichen Versuchungen widerstand: den Cafés, den Geschäften, den zu Straßenhändlern gewordenen Afrikanern, die den Passanten Sonnenbrillen, Ringe und anderen billigen Plunder, alles Schmuggelware natürlich, andrehen wollten. Plötzlich erlitt er einen unerwarteten Anfall von Heimweh. Seit sein Busnachbar den Paseo del Prado erwähnt hatte, waren ihm die zwei Bronzelöwen vom Paseo del Prado in Havanna nicht mehr aus dem Kopf gegangen und hatten in ihm wieder einmal den unbändigen Wunsch geweckt, endlich zu Hause zu sein, bei seiner Frau, den Hunden und den Büchern, die er so sehr zum Leben brauchte.
Die Kälte in Madrid war erträglich. Eine digitale Anzeige an einer Ampel zeigte Temperatur und Uhrzeit an: 13 Grad, 17:39. Mauricio wäre am liebsten gelaufen. Die Leute gingen schnell, redeten ununterbrochen und rauchten wie zum Tode Verurteilte. Sie betraten die Bars, und wenn sie wieder herauskamen, knöpften sie ihre Pelz- oder Wollmäntel zu. Sie schauten sich die Auslagen der Geschäfte an und überlegten, ob die Preise der Waren für den Winterschlussverkauf tatsächlich heruntergesetzt worden waren. Sie hasteten auf die Metroeingänge zu, ungestüm, bereit, jedes menschliche Hindernis aus dem Weg zu räumen. Mauricio gefiel der Gedanke, dass keiner dieser Menschen die geringste Vorstellung davon haben konnte, wer er war und was er in Madrid machte. Er hatte Lust zu laufen und fühlte sich so euphorisch, wie er es seit Langem nicht mehr gewesen war. Seine Hände schwitzten nicht mehr, und er wollte nur kurz anhalten, um einen Kaffee zu trinken, doch diesen Luxus gestattete er sich nicht. Sein gesamtes Vermögen belief sich auf sechzehn Dollar, und Kaffee hatte er in Angola genug getrunken.
Der Paseo del Prado überraschte ihn: Dort lag er, direkt vor ihm, unverwechselbar, wenn auch ohne Bronzelöwen. Mauricio gesellte sich zu denen, die auf den Farbwechsel der Lichtstrahlen warteten. Ohne sich die Zeit zu nehmen, den berühmten Cibeles-Brunnen zu bewundern, überquerte er die Straße und bog nach rechts auf den Mittelstreifen der Avenida ein, der von nackten, düsteren Bäumen, vielleicht Zypressen, gesäumt war. Er war weniger als 200 Meter vom Museum entfernt, und jetzt erst glaubte er es, ja, es stimmte, und einen Moment lang dachte er an Alcides, der in seiner Erinnerung lachte. Und dann fing Mauricio an zu laufen, hin zu der friedvollen Abenddämmerung in den Gärten der Villa Medicis.
Als der Museumswärter ihm erklärte, dass die Ausstellung montags geschlossen sei und dienstags um neun öffne, und dass es ihm leidtue, dass er eigens aus Angola gekommen sei – das liege doch gleich neben dem Kongo, oder? – und am nächsten Morgen wieder abreise, aber er könne da nichts machen, die Ausstellung sei geschlossen, verriegelt und verrammelt, Señor, da war Mauricio sich wieder sicher, dass das Leben Scheiße war, selbst wenn man an einem 3. Februar vor dem Prado stand, nur durch eine Mauer getrennt von neunundsiebzig Meisterwerken des liebenswürdigen Diego Velázquez. Vor allem an einem Montag.
An einem Montag war seine Mutter gestorben, erinnerte er sich. An einem Montag hatte die UNITA den Konvoi angegriffen, in dem sich auch sein Freund Marquitos befand, der Fotograf, der bei dem Scharmützel als Einziger getötet worden war. An einem Montag hatte man ihn in die Zeitungsdirektion kommen lassen, um ihm die Leviten zu lesen und sein Leben zu versauen. An einem Montag hatte er aber auch geheiratet. Nicht einmal im Pech bin ich zuverlässig, dachte er.
Der Cibeles-Brunnen ergoss seinen Wasserstrahl über die Marmorkarosse, und Mauricio musste lächeln angesichts der kleinen Geschenke, die die Europäer sich gegenseitig machten: Ein Schild wies darauf hin, dass die roten, gelben und purpurnen Tulpen, die um das Monument herum gepflanzt waren, ein Geschenk der Stadt Amsterdam an die Stadt Madrid war. An der Ecke des Paseo del Prado – ohne Löwen – blieb Mauricio stehen. Er fühlte sich leer und ausgelaugt und dachte daran, ins Hotel zurückzugehen, sich die Decke über den Kopf zu ziehen und zu schlafen, um alles zu vergessen. Doch ein Straßenschild und ein Lied ließen ihn seine Meinung und die Richtung ändern: PUERTA DE ALCALÁ, stand dort, und der Pfeil darunter zeigte nach rechts. Mauricio begann, jene Melodie zu summen, die ihm zwei Jahre zuvor so verhasst gewesen war, als nämlich sein Bruder das Lied von Ana Belén auf Kassette aufgenommen hatte und seine Mitbewohner dazu verdammt gewesen waren, in voller Lautstärke bis zu zehn Mal am Tag hören zu müssen: »Mírala, mírala, mírala / la Puerta de Alcalá …« (Sieh mal da, sieh mal da, sieh mal da / die Puerta de Alcalá). Verdammt noch mal, er würde sie sich ansehen!
Als Mauricio die Puerta de Alcalá vor sich sah, stellte er fest, dass es genug holländische Tulpen gab, um auch noch diesen monumentalen Triumphbogen am Eingang zur Madrider Altstadt zu schmücken, den Carlos III. zu Ehren seiner selbst, des gebildeten und ruhmreichen Königs, beim Architekten Sabatini in Auftrag gegeben hatte. Unter den fünf triumphalen Bögen, die jetzt durch Tulpenbeete von den Passanten getrennt waren, waren einstmals die besten Kampfstiere gerannt, dazu bestimmt, im Sand der Arena zu sterben; Könige hatten sie durchschritten und ganze Armeen sowie Wasserverkäufer und Bettler. Vielleicht hatte sich auch seine unergründliche María Fernanda manchmal dieses strenge Monument angesehen, nachdem sie sich im Prado an den Lichteffekten und den zarten Farben von Velázquez erbaut und im Museumsshop jenes Büchlein gekauft hatte, das durch Zufall in die Hände eines unbekannten, gemaßregelten kubanischen Journalisten gelangt war, dem vorgeworfen wurde, ideologisch nicht ausreichend gefestigt zu sein, um den Massen Orientierung zu geben, wie es in seiner Personalakte hieß … Was mochte in ihrem Kopf vorgegangen sein, als sie es gesehen hatte? Mauricio wollte sich vorstellen, was María Fernanda gedacht hatte, doch dann kehrte er wieder zu sich und seinen Problemen zurück. Würde er in seinem Leben noch einmal die Gelegenheit bekommen, in Madrid zu sein und endlich den Prado zu betreten? Was sollte er nun mit den verdammten sechzehn Dollar anfangen: sich zu betrinken versuchen und seinen persönlichen Triumph Bacchus widmen? Oder einen Madrider Eintopf essen, oder seiner Frau den Büstenhalter kaufen, wie sie ihm aufgetragen hatte? Was würde geschehen, wenn er in die Zeitung zurückkehrte, endlich geläutert und von Schuld gereinigt durch seinen selbstlosen Einsatz in Angola, der von Alcides als arbeitsethisch, ideologisch, militärisch und politisch ausgesprochen positiv bewertet und von der Parteispitze und der Einsatzleitung anerkannt wurde? In Gedanken und in den Anblick der Puerta de Alcalá versunken, vergaß Mauricio das Lied und Velázquez, und gerade als er sich für den Madrider Eintopf entschieden hatte, sah er am anderen Ende der Calle de Alcalá, genau auf der Linie unter dem mittleren Bogen der Puerta hindurch, den Mann im eleganten grauen Anzug, der die Figuren auf dem Monument betrachtete. In diesem Augenblick senkte der Mann den Blick, und seine Augen folgten derselben Linie wie Mauricios Augen, nur in umgekehrter Richtung, unter dem Bogen hindurch, über die Tulpen hinweg, den Straßenverkehr ignorierend, und sahen Mauricio. Das darf doch nicht wahr sein, dachten Mauricio und der Mann im grauen Anzug gleichzeitig, jeder auf seiner Seite der Puerta de Alcalá.
2
Es waren noch drei Monate bis zum Examen – Mauricio in Philologie und Frankie in Architektur –, als Charo, Frankies Freundin, Mauricio anrief und ihm sagte: »Frankie ist über den Hafen von Mariel abgehauen. Er ist in das Büro gegangen, das sie im Cuatro Ruedas eingerichtet haben, und hat gesagt, er sei schwul, und da haben sie ihm die Ausreise gestattet. Er hat dir seine Bücher vermacht.«
Es waren zwei Bände Geschichte der modernen Architektur von Leonardo Benevolo, die Mauricio schon immer hatte haben wollen und die er dann nie las, als sie ihm gehörten.
Sie hatten sich zu Beginn des zehnten Schuljahres in der Oberstufe von La Víbora kennengelernt und waren bis zum Abitur in dieselbe Klasse gegangen. Während des fünfjährigen Studiums hatten sie sich etwas aus den Augen verloren, waren nur hin und wieder zusammen ins Baseballstadion gegangen, wenn die Industriales eine gute Serie hinlegten, oder hatten sich samstags getroffen, um sich Platten von Chicago und Creedence Clearwater Revival anzuhören und Rum zu trinken. Aber Mauricio hatte Frankie immer als seinen Freund betrachtet. Außerdem hatten sie noch andere gemeinsame Vorlieben – für Marilyn Monroe (ausnahmsweise) und Mulattinnen (vorzugsweise), für die Romane von Raymond Chandler und die Bar des Hotels Colina und ihr Wandgemälde mit den saufenden Hunden, für Bluejeans und Sandalen ohne Socken – und empfanden Mitleid für Straßenhunde und eine gewisse unbestimmte Abneigung gegen Schwule. Und weil Frankie gläubiger Katholik war und Mauricio ungläubiger Atheist, sprachen sie nie über Religion. Lieber träumten sie gemeinsam davon, was sie in Zukunft einmal sein würden: natürlich ein großer Architekt und ein berühmter Schriftsteller.
Sehr viel später, als Mauricio der jüngste und gefragteste Mitarbeiter der Zeitungsredaktion war und man ihm besondere Aufgaben übertrug, schrieb er eine preisgekrönte Reportage über die chinesischen Immigranten in Kuba. Durch diese Arbeit bekam er zum ersten Mal eine konkrete Vorstellung vom Drama der Entwurzelung. Und er dachte an seinen alten Freund, mit dem er die Schulbank gedrückt und seine Vorlieben geteilt hatte, und erinnerte sich an ein Gespräch, das sie geführt hatten, als sie eines Abends durchs Chinesenviertel gegangen waren.
»Tun sie dir nicht leid? Mir zerreißt es das Herz, wenn ich diese Chinesen sehe. Die Einsamkeit frisst sie auf, und ihnen ist nichts geblieben, wohin sie gehen können«, hatte Frankie gesagt, als er einen uralten, schmutzigen, ausgemergelten Chinesen gesehen hatte, der sich den Eiter aus den Augen wischte und das Ergebnis auf der Fingerspitze mit fast geschlossenen Lidern eingehend betrachtete.
Als Charo ihn dann anrief und ihm sagte, was Frankie getan hatte – er sei schwul, hatte er gesagt –, weigerte sich Mauricio zunächst, es zu glauben. Nie hätte er die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass der Freund aus Kuba fortgehen könnte. Obwohl sie, vollauf mit ihrer Examensarbeit beschäftigt, in den letzten zwei Monaten miteinander nur telefoniert hatten, konnte Mauricio nicht glauben, dass jemand in so kurzer Zeit eine so unumstößliche, endgültige Entscheidung treffen könne. Vergeblich suchte er nach einer Nachricht zwischen den Seiten der Architekturbücher, und Charo schwor, dass auch sie nichts wisse. Er sprach mit Frankies Eltern, erreichte jedoch nur, dass sie zu weinen begannen. Frankie hatte es ganz allein entschieden, in aller Stille, wie jemand, der seine Flucht vorbereitet. Wie ist es möglich, dass zwei Menschen, die sich so ähnlich sind, so unterschiedliche Dinge tun?, fragte sich Mauricio, fand aber keine befriedigende Antwort darauf, und er bekam auch nie einen Brief mit einer plausiblen Erklärung. Etwas war zu Ende gegangen.
Sie hatten die Rotunde, die die Puerta de Alcalá umschließt, umkreist und gingen nun lächelnd aufeinander zu. Frankie sah gesund und zufrieden aus. Sein schlichter grauer Anzug saß ausgezeichnet, und der Wollpullover, den er unter dem Jackett trug, war bestimmt warm. Mauricio kam sich irgendwie minderwertig vor, doch er war konsequent geblieben. Seine verblichene Bluejeans war wie ein Zeichen seiner Treue gegenüber einer lieb gewordenen Gewohnheit, und sein wattiertes, synthetisches Jackett sowjetischer Machart dämpfte die Umarmung des Mannes, der aus der Vergangenheit und der Erinnerung gekommen war. Sie sahen sich eine Weile wortlos an, bis Frankie das Schweigen brach und gleich den Ton vorgab: »Scheiße, Mauricio, du hast ja schon graue Haare!«
»Ja, vom Wichsen und vom Chloroquin … Hab zwei Jahre Angola hinter mir.« Er lachte.
So manches Mal hatte er sich dieses Wiedersehen ausgemalt: Frankie, der für ein paar Tage nach Havanna gekommen war, um seine Eltern zu besuchen, und ihn anrief. Schwierig dagegen war es, sich eine Unterhaltung vorzustellen. Würde Frankie sich rechtfertigen? Würde er als strahlender Sieger kommen und ihm Geld anbieten, damit er sich irgendetwas kaufen konnte? Würde er so heruntergekommen und kaputt sein wie ein Chinese auf der Calle Zanja? Aber Frankie war nie mehr nach Havanna zurückgekehrt.
»Und was machst du dann hier, wenn du in Angola warst?«
»Da kommst du nicht drauf … Und du, was machst du hier?«
»Ich war auf einem Architektenkongress. Morgen früh reise ich wieder ab.«
»Gehts dir gut?«
»Ich glaube, ja. Und du? Wie geht es dir?«
»Im Arsch, aber zufrieden«, sagte Mauricio mit den Worten von Frankies Vater, der auf eine solche Frage diese Antwort zu geben pflegte.
»Ich kann es noch gar nicht fassen! Das hätte ich nie im Leben gedacht! … Und wie läufts bei deinen Leuten?«
Frankie war sichtlich gerührt und wollte alles genau wissen. Das mit der Velázquez-Ausstellung tat ihm leid. Scheiße, und ich hab sie mir gestern angeschaut, Alter, sagte er, während sie ohne ein bestimmtes Ziel weitergingen, fort von der Puerta de Alcalá.
»Sag mal, Mauricio, was hast du jetzt vor?«, fragte Frankie, als sie an der Plaza de Cibeles angelangt waren.
»Auf morgen warten und dann nix wie weg«, antwortete Mauricio.
»Gut, ich lade dich auf einen Kaffee ein. Gleich um die Ecke ist das Café Gijón, da verkehren die Schriftsteller. Apropos, hast du inzwischen ein Buch geschrieben?«
»Du hast ja ein tolles Gedächtnis!«
»Kannst du laut sagen. Los, gehen wir, da drüben ist es, gleich gegenüber.«
»Sag mal, kriegst du keine Probleme, wenn du hier mit mir sitzt?«, fragte Frankie.
Mauricio genoss die gemütliche Atmosphäre des alten Madrider Cafés, das für literarische Treffen, die Tertulias, wie geschaffen war, und sah Frankie an. »Kann schon sein, aber mach dir keine Sorgen. Ich bin Internationalist, und du bist einer, der abgehauen ist. Aber ehrlich, ich freue mich, dich zu sehen. Vor zehn Jahren hast du mich mit einer Frage im Regen stehen lassen.«
»Zwei Kaffee und zwei JB«, bestellte Frankie. »Willst du Eis? … Also, beide ohne Eis, bitte, in Kognakgläsern.«
»Du bist so anders.«
»Und du bist noch genauso. Mehr im Arsch als zufrieden … Ich freue mich auch, dich zu sehen, Mauricio. Ich hab dir mindestens zehn Briefe geschrieben, vor allem am Anfang, aber ich hab mich nicht getraut, sie abzuschicken.«
»Und was hast du mir geschrieben?«
»Alles. Ich glaube, ich hab dir alles geschrieben. Dass ich dich zum Verrecken liebe, mehr als meine Schwestern, und dass ich nichts lieber täte, als mit dir ins Stadion zu gehen. Im Ernst, man«, fügte er lächelnd hinzu, »ich geh überhaupt nicht mehr zum Baseball, Alter.«
Der Kellner brachte die Getränke und stellte sie auf den Marmortisch. Frankie holte eine Schachtel »Kaiser« und ein vergoldetes Feuerzeug heraus. Er zündete sich eine Zigarette an und trank einen Schluck Kaffee.