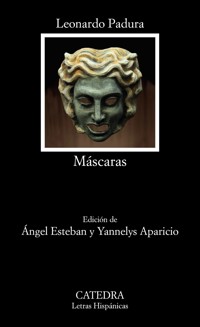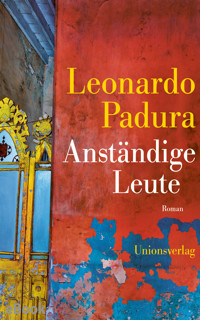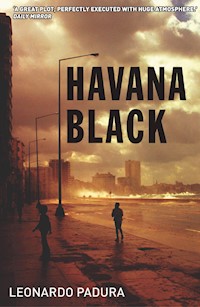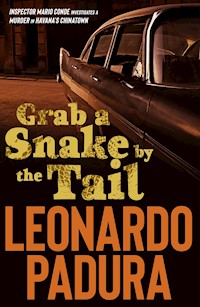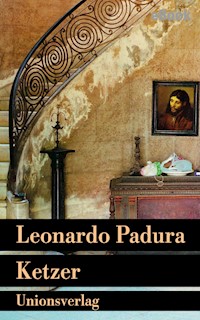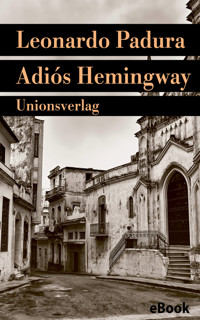
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vierzig Jahre nach Hemingways Tod wird auf seiner Finca bei Havanna eine Leiche gefunden, getötet mit zwei Kugeln aus einer Maschinenpistole seiner legendären Waffensammlung. War Hemingway ein Mörder? Die kubanische Polizei ist beunruhigt und will um jeden Preis die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit vermeiden. Doch auf Kuba gibt es nur einen, der diesem Fall gewachsen ist: Ex-Polizist Mario Conde. Im Zuge seiner Recherchen durchlebt Conde das Drama von Hemingways letzten Tagen in Kuba. Er befragt ehemalige Angestellte und alte Weggefährten und findet schließlich ganz unerwartet die Lösung für Hemingways letztes Geheimnis, nicht zuletzt dank Ava Gardners schwarzem Spitzenhöschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Vierzig Jahre nach Hemingways Tod wird auf seiner Finca bei Havanna eine Leiche gefunden, getötet mit zwei Kugeln aus einer Maschinenpistole seiner legendären Waffensammlung. War Hemingway ein Mörder? Ex-Polizist Mario Conde findet ganz unerwartet die Lösung für dessen letztes Geheimnis.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Adiós Hemingway
Mario Conde ermittelt in Havanna
Kriminalroman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 5 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel Adiós Hemingway bei Tusquets Editores, Barcelona.
Das Motto im Vorwort folgt der Ausgabe: Ernest Hemingway, Gesammelte Werke, Stories I, Rowohlt Verlag, Reinbek 1977, deutsch von Annemarie Horschitz-Horst.
Originaltitel: Adiós Hemingway (2006)
© by Leonardo Padura Fuentes 2006
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Wolfgang Kunz, Bilderberg
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30481-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 12:24h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ADIÓS HEMINGWAY
VorbemerkungEr spuckte, stieß den restlichen Rauch aus …Noch einen?«, fragte ManoloWenn Miss Mary an jenem Mittwochabend zu Hause …Den ganzen Nachmittag schon regnete es. Die Fenster …Er sah die Flasche Chianti an, wie man …Nach einer Weile begriff er, dass es sich …Es musste sich wohl um eine der letzten …Er schulterte die Thompson, bezwang die Steifheit seiner …Er sah sie, als sie bereits am Beckenrand …Black Dog und die beiden anderen Hunde liefen …Ja, das war ich, natürlich erinnere ich mich …El Conde wusste nur zu gut, was nun …Er beschloss, über die asphaltierte Autozufahrt zum Haus …El Conde kannte das Gesicht. Er hatte es …Tag, Ruperto.«Die Massai pflegen zu sagen: Ein Mann allein …Warum wolltest du nicht mit in die Zentrale?«Das Meer bildete eine unergründliche, feindselige Fläche …Mehr über dieses Buch
Leonardo Padura: Ein maßgeschneiderter Hemingway
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Lateinamerika
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Karibik
Dieser Roman ist, wie die vorangegangenen und wohl auch alle, die noch folgen werden, Lucía gewidmet, mit Liebe und Untergründigkeit.
Die Toten hatten nicht immer heißes Wetter:
Sehr oft war es der Regen, der sie reinwusch,
wenn sie in ihm lagen, und der die Erde, nachdem
man sie darin begraben hatte, aufweichte
und der dann manchmal anhielt, bis die Erde
zu Schlamm wurde und sie herauswusch und
man sie von neuem begraben musste.
Ernest Hemingway, »Eine Naturgeschichte der Toten«
Vorbemerkung
Im Herbst 1989, während ein Hurrikan Havanna verwüstete, löste der Teniente Mario Conde seinen letzten Fall als Ermittler der Kripozentrale. Danach reichte er seinen Abschied ein und beschloss, Schriftsteller zu werden. Das war an seinem sechsunddreißigsten Geburtstag. Von jenem letzten Abenteuer als Polizist erzählt der Roman Das Meer der Illusionen. Er schließt den Zyklus des »Havanna-Quartetts« ab, zu dem auch Ein perfektes Leben, Handel der Gefühle und Labyrinth der Masken gehören.
Ich war entschlossen, Mario Conde für eine Zeit lang sich selbst zu überlassen, und begann einen Roman zu schreiben, in dem der Teniente nicht auftauchte. Mitten in dieser Arbeit baten mich meine brasilianischen Verleger, eine Erzählung für ihre Serie Literatur oder Tod zu schreiben, bei der jeweils ein Schriftsteller im Mittelpunkt stand. Ich brauchte nicht lange, um mich für das Projekt zu begeistern. Und sogleich kam mir jener Schriftsteller in den Sinn, mit dem mich über Jahre hinweg eine heftige Hassliebe verbunden hatte: Ernest Hemingway. Ich suchte einen Weg, meine persönlichen Probleme mit dem Autor von Fiesta zu verarbeiten, doch mir fiel dabei nichts Besseres ein, als meine Obsessionen auf Mario Conde zu übertragen – so wie ich es schon oft getan hatte – und ihn wieder zur Hauptfigur zu machen.
Das Resultat der Beziehung zwischen dem Schriftsteller und Mario Conde ist der Roman Adiós Hemingway. Ja, dies ist ein Roman, und er muss als solcher gelesen werden. Viele der hier erzählten Begebenheiten gehören, auch wenn sie im Einklang mit den Tatsachen stehen, ins Reich der Fiktion und sind derart mit Erdachtem verwoben, dass ich heute nicht mehr zu sagen vermag, wo die Wahrheit endet und die Dichtung beginnt. Dennoch wurden einige der Personen umgetauft, um auf mögliche Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen; andere dagegen haben ihren Namen behalten.
Zuletzt möchte ich mich bei all denen bedanken, die mich unterstützt haben. Zunächst bei Francisco Echevarría, Danilo Arrate, María Caridad Valdés Fernández und Belkis Cedeño, allesamt Mitglieder der Vereinigung kubanischer Hemingwayaner und Sachverständige des Museums Finca Vigía. Und natürlich auch bei meinen unentbehrlichen Lesern Alex Fleites, José Antonio Michelena, Vivian Lechuga, Stephen Clark, Elizardo Martínez sowie dem wirklichen, realen John Kirk.
Leonardo PaduraMantilla, Winter 2001
Er spuckte, stieß den restlichen Rauch aus, der sich in seiner Lunge angesammelt hatte, und schnippte die winzige Zigarettenkippe ins Wasser. Das Brennen, das er auf der Haut spürte, hatte ihn in die Wirklichkeit zurückgeholt. Und jetzt, wieder von dieser Welt, kam er ins Grübeln. Wie kam es, dass er hier am Meer stand, bereit, eine Reise in die Vergangenheit anzutreten, deren Ausgang ungewiss war? Ihm wurde schlagartig klar: Auf viele der Fragen, die er sich von nun an stellen würde, gab es keine Antwort. Doch es beruhigte ihn der Gedanke, dass das auch für die zahllosen anderen Fragen galt, die er auf dem weiten, langen Weg seines Lebens mit sich herumgeschleppt hatte, bis er schließlich zur Überzeugung gelangt war, es sei besser, sich mit der brutalen Wahrheit abzufinden: Er musste es akzeptieren, mit mehr Fragezeichen als Gewissheiten zu leben. Vielleicht bin ich deshalb kein Polizist mehr, dachte er und schob sich die nächste Zigarette zwischen die Lippen.
Die angenehm sanfte Brise, die von der kleinen Bucht herüberwehte, wirkte in der Sommerhitze wie eine Wohltat. Doch Mario Conde stand an diesem kurzen, von uralten Kasuarinen beschatteten Abschnitt der Uferpromenade aus Motiven, die nichts mit Sonne und Hitze zu tun hatten. Er saß auf der Kaimauer, ließ die Beine über der Uferstraße baumeln und genoss das Gefühl, der Tyrannei der Zeit entronnen zu sein. Er hätte den Rest seines Lebens an diesem Ort verbringen, aufs friedliche Meer hinausschauen, sich den Erinnerungen hingeben, nachdenken und – wenn ihm irgendeine gute Idee kommen würde – sogar mit dem Schreiben beginnen können. Denn das Meer mit seinen Gerüchen und Geräuschen war sein persönliches Paradies, lieferte die ideale Szenerie für seinen Geist, seine Seele und seine unauslöschlichen Erinnerungen. Wie in der Fantasie eines zähen Schiffbrüchigen überdauerte in ihm schon seit Jahren die verführerische Vorstellung, eines Tages in einem Holzhaus am Meer zu leben, morgens mit Schreiben und nachmittags mit nichts als Angeln und Schwimmen seine Zeit zu verbringen. Auch wenn die herzlose Realität seit etlichen Jahren diesen Traum Lügen strafte, hielt El Conde unbeirrbar an dieser Fantasie fest. Anfangs hatte ihm das Traumbild so lebhaft, gestochen scharf, beinahe fotografisch genau vor Augen gestanden, doch inzwischen konnte er davon nur noch flimmernde Lichtreflexe erkennen, als wäre es ein Bild, das der Palette eines mittelmäßigen Impressionisten entsprungen war.
Deshalb ließ er schließlich davon ab, sich über die tieferen Gründe seines Tuns und Lassens am heutigen Nachmittag den Kopf zu zerbrechen. Er wusste nur, dass Körper und Geist danach verlangten, dass er wieder an die kleine Bucht von Cojímar zurückkehrte, die sich in seine Erinnerung eingegraben hatte, als wäre sie eine unverzichtbare Kulisse. Eigentlich hatte alles genauso angefangen, genau hier, mit dem Blick aufs Meer, unter diesen Kasuarinen, inmitten genau dieser ewigen Gerüche, an jenem Tag im Jahre 1960, als er Ernest Hemingway begegnet war. Das präzise Datum war ihm, wie so viele andere schöne Dinge des Lebens, entfallen. Er konnte nicht einmal mehr mit Gewissheit sagen, ob er damals noch fünf oder bereits sechs Jahre alt gewesen war. Es war die Zeit, als ihn sein Großvater Rufino El Conde immer an die interessantesten Orte mitnahm, zu den Hahnenkampfplätzen und in die Hafenkneipen, zu den Dominotischen und in die Baseballstadien, an seine Lieblingsorte also, wo der kleine Mario Conde vieles von dem lernte, was ein Mann lernen muss. An jenem Nachmittag, der bald unvergesslich werden sollte, waren sie in Guanabacoa gewesen, um sich Hahnenkämpfe anzuschauen und zu wetten. Wie fast immer hatte sein Großvater gewonnen und beschlossen, zur Krönung des Tages mit seinem Enkel nach Cojímar zu fahren, damit der Junge das Dorf und das (wie er behauptete) beste Eis von ganz Kuba kennen lernte, das der Chinese Casimiro Chon in alten Holzkübeln herstellte, immer aus frischem Obst.
Noch heute glaubte sich El Conde an den cremig-klebrigen Geschmack des Mamey-Eises zu erinnern und an seine Begeisterung über eine prachtvolle Fischerjacht mit schwarzem Rumpf und braunen Planken und zwei riesigen, in den Himmel ragenden Angelruten, die das Schiff wie ein schwimmendes Insekt aussehen ließen. Wenn Mario sich recht erinnerte, hatte er beobachtet, wie die Jacht sich gemächlich der Küste näherte, wobei sie den in der Bucht ankernden altersschwachen Fischerbooten geschickt auswich, um schließlich am Landeplatz festzumachen. Im nächsten Augenblick sprang ein sonnenverbrannter Mann mit nacktem Oberkörper von Bord auf den geteerten Landungssteg. Er fing das Tau auf, das ihm ein zweiter Mann, der eine schmutzig weiße Kapitänsmütze trug, von Deck aus zuwarf. Der Rotgesichtige zog die Jacht näher an den Steg heran und schlang das Tau mit einem perfekten Knoten um einen Poller. Vielleicht wollte Großvater Rufino seinen Enkel auf irgendetwas aufmerksam machen, doch dessen Augen hingen bereits gebannt an dem anderen Mann, dem mit der Kapitänsmütze, der außerdem eine runde Brille mit grünen Gläsern trug und einen dichten weißen Bart hatte. Der Junge sah ihm zu, wie nun auch er an Land sprang und mit dem sonnenverbrannten, rotgesichtigen Mann sprach. Sein Leben lang sollte El Conde der festen Überzeugung bleiben, dass er gesehen hatte, wie die beiden Männer sich die Hand gaben und eine Weile, die in der Erinnerung nicht genau zu bestimmen war, so dastanden und miteinander redeten, vielleicht eine Minute oder auch eine Stunde, aber ganz bestimmt Hand in Hand. Dann umarmte der bärtige alte Mann den anderen und ging über den Steg davon, ohne sich noch einmal umzublicken. Er hatte etwas von einem Weihnachtsmann, dieser bärtige und ein wenig schmuddelige Alte mit den großen Händen und Füßen, der sich jetzt mit festem Schritt, jedoch irgendwie traurig entfernte. Vielleicht aber beruhte dieser Eindruck auch nur auf etwas Magischem, Unergründlichem, vielleicht war es gar ein Fingerzeig auf eine in ihm wohnende Sehnsucht, auf eine Zukunft, die sich der Junge nicht einmal vorzustellen vermochte.
Als der Mann mit dem weißen Bart die Steinstufen zur Uferpromenade hinaufging, sah Mario, wie er die Mütze abnahm und sie sich unter den Arm klemmte. Er zog einen kleinen Plastikkamm aus der Brusttasche und fing an, sich die Haare nach hinten zu kämmen, immer und immer wieder, als wäre es mit einem einzigen Mal nicht getan. Der Mann ging so nahe an ihnen vorbei, dass sein Geruch den Jungen streifte, eine Mischung aus Schweiß und Meer, Motorenöl und Fisch. Ein penetranter, ordinärer Körpergeruch.
»Das sieht gar nicht gut aus«, sagte der Großvater, und Mario wusste nicht und würde nie erfahren, ob sich die Bemerkung auf den Mann mit dem Bart oder aufs Wetter bezog. Denn an diesem Punkt seiner Erinnerung vermischten sich Erinnertes und später Gehörtes, der vorübergehende Mann und das ferne Grollen eines Donners.
Und deshalb pflegte El Conde die Rekonstruktion seiner einzigen Begegnung mit Ernest Hemingway hier abzubrechen.
»Das ist Cheminguey, der amerikanische Schriftsteller«, klärte der Großvater seinen Enkel auf, als der Mann außer Hörweite war. »Der hat auch Spaß an Hahnenkämpfen, weißt du …«
El Conde meinte sich zu erinnern, dass er diesen Satz gehört und gleichzeitig beobachtet hatte, wie der Schriftsteller in einen chromblitzenden schwarzen Chrysler stieg, der auf der anderen Straßenseite stand. Und durch das Autofenster winkte er, ohne die Brille mit den grünen Gläsern abzusetzen, genau in Marios Richtung, wie zum Abschied. Aber vielleicht zielte die Geste auch am Jungen vorbei, weiter bis zum Landungssteg mit der Jacht und dem sonnenverbrannten Mann, den er eben umarmt hatte, oder bis zu dem alten spanischen Wehrturm, dem Torreón, der dem Lauf der Jahrhunderte trotzte, oder vielleicht sogar bis zum fernen Golfstrom … Der Junge aber hatte den Gruß aufgeschnappt, und bevor der Wagen sich in Bewegung setzte, winkte er zurück und rief: »Adiós Cheminguey!«, und zur Antwort erhielt er das Lächeln des Mannes.
Etliche Jahre später, als Mario Conde das schmerzhafte Bedürfnis zu schreiben verspürte und nach literarischen Idolen Ausschau zu halten begann, erfuhr er, dass dies Hemingways letzte Fahrt über ein Stück Meer gewesen war, das er geliebt hatte wie kaum einen Ort auf der Welt. Da begriff er: Der amerikanische Schriftsteller hatte sich damals gewiss nicht von ihm, einem winzigen Insekt auf der Uferpromenade von Cojímar, verabschiedet, sondern in jenem Augenblick weit wichtigeren Dingen seines Lebens Lebewohl gesagt.
Noch einen?«, fragte Manolo.
»Klar«, antwortete El Conde.
»Doppelt oder normal?«
»Wofür hältst du mich?«
»Hey, Pfeife, zwei doppelte Rum«, rief Teniente Palacios mit hochgerecktem Arm dem Mann hinter der Theke zu, der sich sogleich daranmachte, die Gläser zu füllen, ohne seine Pfeife aus dem Mund zu nehmen.
Das ›Torreón‹ war keine saubere und schon gar keine gut beleuchtete Bar. Doch hier gab es Rum, Stille und nur wenige Betrunkene. Vom Tisch aus konnte El Conde aufs Meer schauen und auf die verwitterten Steine des Wehrturms aus der Kolonialzeit, dem die Bar ihren bombastischen Namen verdankte.
Der Mann, Pfeife im Mund, kam gemächlich an ihren Tisch, stellte die randvollen Gläser vor sie hin, klemmte sich die leeren zwischen die Finger mit den schmutzigen Nägeln und sah Manolo drohend an.
»’ne Pfeife ist höchstens deine Mutter«, sagte er langsam. »Und so was soll ’n Bulle sein …«
»Komm, reg dich ab, Mann«, versuchte Manolo ihn zu beruhigen, »war doch nur ’n Scherz, Pfeife.«
Der Barmann setzte sein unfreundlichstes Gesicht auf und schlurfte von dannen. Schon Mario hatte er böse angeblitzt, als dieser ihn gefragt hatte, ob er einen »Papa Hemingway« haben könne, jenen Daiquirí, den der Schriftsteller immer getrunken hatte: einen doppelten Rum, Limonensaft, ein paar Spritzer Maraschino, viel zerstoßenes Eis und kein bisschen Zucker. »Als ich das letzte Mal Eis zu Gesicht gekriegt hab, da war ich noch Pinguin«, hatte der Barmann entgegnet.
»Und woher wusstest du, dass ich hier bin?«, fragte El Conde seinen ehemaligen Kollegen, nachdem er einen kräftigen Schluck getrunken hatte.
»Dafür bin ich schließlich Polizist, oder?«
»Klau nicht meine Sprüche, du!«
»Du brauchst sie ja nicht mehr, Conde … wo du doch jetzt kein Polizist mehr bist.« Der Ermittler Manuel Palacios grinste. »Egal. Also, ich kenn dich doch, und da hab ich mir gedacht, dass du hier rumhockst. Ich weiß nicht, wie oft du mir die Geschichte erzählt hast von dem Tag, an dem du Hemingway begegnet bist. Hat er dir nun tatsächlich zugewinkt, oder ist das frei erfunden?«
»Das musst du selbst rauskriegen, dafür bist du schließlich Polizist …«
»Mies drauf?«
»Weiß nicht … Eigentlich hab ich gar keine Lust, mich da reinzuhängen … aber dann wieder doch.«
»Pass auf, Conde, häng dich so lange rein, wie du willst, und wenn du nicht mehr willst, dann hörst du auf, ja? Hat sowieso nicht viel Sinn, nach vierzig Jahren …«
»Ich weiß wirklich nicht, warum zum Teufel ich Ja gesagt hab … Wenn ich erst mal anfange, kann ich nicht mehr aufhören, selbst wenn ich will.«
Nach dieser Selbstkritik trank El Conde das Glas mit einem zweiten Schluck leer. Acht Jahre ohne Kripozentrale sind eine lange Zeit. Er hätte nie gedacht, dass er so einfach wieder in ihren Schoß zurückkehren könnte. Neuerdings verbrachte er die freien Stunden, in denen er nicht schrieb oder zumindest zu schreiben versuchte, damit, in der Stadt herumzulaufen und alte Bücher zu suchen, mit denen er das Antiquariat seines Freundes versorgte. Auch wenn dabei nicht viel zu verdienen war – er war mit fünfzig Prozent am Gewinn beteiligt –, hatte Mario seinen Spaß dabei. Seine neue Tätigkeit hatte viele Vorteile. Er erfuhr persönliche und familiäre Geschichten, die manchmal hinter der Entscheidung steckten, sich von einer in drei oder vier Generationen zusammengetragenen Bibliothek zu trennen, und die Zeitspanne zwischen Kauf und Verkauf konnte er dazu nutzen, all das interessante Zeug zu lesen, das durch seine Hände ging.
Der wesentliche Nachteil seines Händlerdaseins war allerdings, dass ihn der Anblick alter, wertvoller Bücher, die durch Gleichgültigkeit oder Unwissenheit gelitten hatten und häufig nicht mehr zu retten waren, wie eine offene Wunde schmerzte. Oder wenn er sich entschloss, besonders faszinierende Exemplare in sein eigenes Regal zu stellen, anstatt sie in den Laden seines Freundes zu bringen. Eine gefährliche Nebenwirkung der unheilbaren Krankheit namens Bibliomanie.
An diesem Morgen jedoch hatte ihn sein ehemaliger Kollege Manuel Palacios angerufen und ihm die Geschichte der Leiche, die auf der Finca Vigía gefunden worden war, auf dem Silbertablett serviert. Als die Frage kam, ob er den Fall übernehmen wolle, da war es ihm gewesen, als hätte er den Ruf der Wildnis vernommen. Mit einem gequälten Blick auf das weiße leere Blatt, das in seine prähistorische Underwood eingespannt war, hatte er Ja gesagt, kaum dass er die ersten Einzelheiten des Falles erfahren hatte.
Das Sommergewitter hatte Marios Viertel kräftig durchgeschüttelt. Solche Attacken von Wasser, Wind, Blitz und Donner pflegen sich, im Gegensatz zu den Hurrikanen im Herbst, nicht anzukündigen. Irgendwann am Nachmittag vollführen sie irgendwo auf der Insel ihren rasenden Totentanz, zerstören Bananenplantagen, verstopfen Abwasser-kanäle, aber richten nur selten größere Schäden an. Das Unwetter hatte seine Wut an der Finca Vigía ausgelassen, dem ehemaligen Wohnsitz von Ernest Hemingway und heutigen Museum in der Nähe von Havanna. Einige Dachziegel waren davongeflogen, der Strom war ausgefallen und ein Teil des Gartenzauns weggerissen worden. Vor allem jedoch hatte der Sturm einen uralten, todkranken Mangobaum gefällt, der sicherlich schon vor 1905, dem Jahr des Hausbaus, gepflanzt worden war. Und zusammen mit den Baumwurzeln waren die Knochen eines, wie die Spezialisten der Kripozentrale feststellten, etwa sechzigjährigen weißen Mannes mit beginnender Arthrose und einem alten, schlecht verheilten Bruch der Kniescheibe zum Vorschein gekommen, getötet zwischen 1957 und 1960 von zwei Kugeln, höchstwahrscheinlich aus einem Gewehr. Eine Kugel hatte das Brustbein sowie die Wirbelsäule zerschmettert. Die zweite war offenbar in den Bauch gedrungen und auf der Rückseite wieder ausgetreten, denn sie hatte eine hintere Rippe gebrochen.
Zwei Schüsse aus einer schweren Waffe, vermutlich aus nächster Nähe abgegeben, hatten den Tod jenes Mannes herbeigeführt, der jetzt nur noch ein Haufen angenagter Knochen in einem Plastiksack war.
»Weißt du, warum du Ja gesagt hast?«, fragte Manolo seinen früheren Kollegen mit einem amüsierten Grinsen, wobei das rechte Auge auf die Nasenscheidewand schielte. »Ein Arschloch ist und bleibt ein Arschloch, auch wenn er in die Kirche rennt und sogar zur Beichte geht. Und ein kaputter Typ, der einmal Polizist war, ist und bleibt Polizist. Darum, Conde.«
»Und warum erzählst du mir nicht was Interessantes, anstatt so ’n Stuss zu reden?«, gab Mario zurück. »Mit dem, was ich bis jetzt gehört hab, kann ich nicht mal …«
»Weil es im Moment nichts zu erzählen gibt … Und auch nicht geben wird, glaub ich. Das ist vierzig Jahre her, Conde.«
»Sag mir die Wahrheit, Manolo: Für wen ist der Fall von Interesse?«
»Willst du wirklich die Wahrheit wissen? Die reine Wahrheit? Zurzeit nur für dich, den Toten und Hemingway, und für sonst niemand. Also, mir ist die Sache völlig klar. Hemingway war ein äußerst reizbarer Mensch. Irgendwann ist ihm irgendjemand zu sehr auf den Zeiger gegangen, und da hat er ihm zwei Schüsse verpasst. Dann hat er die Leiche vergraben, und keiner hat danach gefragt. Später hat sich Hemingway eine Kugel in den Kopf geschossen, und damit hatte sich die Sache. Ich hab dich angerufen, weil ich wusste, dass dich die Geschichte interessieren würde. Ich will ’ne Weile warten, bevor ich den Fall zu den Akten lege. Sobald er nämlich in den Akten liegt, besteht die Gefahr, dass was davon durchsickert, und dann geht die Story von der Leiche auf Hemingways Grundstück um die ganze Welt, da kannst du einen drauf lassen …«
»Und natürlich wird man annehmen, dass Hemingway der Mörder ist. Aber wenn er nicht der Mörder ist?«
»Genau das sollst du rauskriegen, wenn du kannst … Schau mal, Conde, ich steck bis hier in Arbeit.« Der Teniente hob die Hand bis zu den Augenbrauen. »Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Diebstahl, Betrug, Raubüberfälle, Prostitution, Pornografie …«
»Schade, dass ich kein Bulle mehr bin. Ich liebe Pornografie.«
»Red keinen Scheiß, Conde! Pornografie mit Kindern!«
»Dieses Land ist verrückt geworden.«
»Der Satz stammt nicht von dir … Meinst du, ich hätte da noch Zeit, mich mit Hemingways Leben zu beschäftigen, um herauszufinden, ob er den Mann umgebracht hat oder nicht? Einer, der sich vor tausend Jahren selbst umgebracht hat?«
El Conde schaute lächelnd aufs Meer hinaus. »Weißt du was, Manolo? Ich würde liebend gerne feststellen, dass Hemingway der Täter war. Der Kerl geht mir nämlich schon seit Jahren mächtig auf den Sack. Andererseits könnte ich es nicht haben, dass man ihm einen Mord anhängt, den er nicht begangen hat. Deswegen werd ich mich darum kümmern … Hat man die Stelle, an der die Leiche gefunden wurde, schon gründlich untersucht?«
»Nein, Crespo und El Greco gehen morgen hin. So was kann kein x-beliebiger Totengräber machen …«
»Und du, was hast du vor?«
»Ich werd mich um meinen eigenen Kram kümmern. In einer Woche, wenn du mir erzählst, was du weißt, werd ich den Fall abschließen und ihn so schnell wie möglich vergessen. Sollen doch andere in die Scheiße greifen …«
El Conde schaute wieder aufs Meer. Er wusste, dass der Teniente Recht hatte. Trotzdem fühlte er eine seltsame Unruhe in sich. War ich vielleicht zu lange Polizist?, dachte er. Aber danach bin ich nur noch Schriftsteller, dachte er weiter. Er durfte seine großen Pläne nicht aus den Augen verlieren.
»Komm mal mit, ich will dir was zeigen«, sagte er zu seinem Freund und stand auf. Ohne auf Manolo zu warten, überquerte er die Straße und ging zu einem Rondell mit einer Art offenem Pavillon, unter dessen Bogen das Podest mit der Bronzebüste stand. Die letzten schwachen Sonnenstrahlen fielen schräg auf das mit Grünspan bedeckte, beinahe lächelnde Gesicht des dort verewigten Schriftstellers.
»Als ich mit dem Schreiben anfing, hab ich versucht, es so zu machen wie er«, sagte El Conde, den Blick auf die Skulptur gerichtet. »Er war sehr wichtig für mich.«
Von all den Huldigungen, Erinnerungen und Ausbeutungen, die der Name und die Person Hemingways in Kuba erfahren hatten, schien ihm nur diese Büste hier sinnvoll und aufrichtig zu sein, denn sie war schlicht wie die Sätze, die dem Schriftsteller in seiner letzten Zeit als Journalist beim Kansas City Star gelungen waren. Übertrieben und wenig literarisch dagegen fand er es, dass ein von ihm selbst ins Leben gerufenes Turnier im Schwertfisch-Angeln ihn überlebt hatte und nun auf ewig mit seinem Namen verbunden war. Falsch und geschmacklos – buchstäblich schlecht schmeckend – fand er auch jenen »Papa Doble«, den er einmal in der Bar ›Floridita‹ seinem armen, chronisch leeren Geldbeutel zugemutet hatte, um dann ein trübes Gesöff vorgesetzt zu bekommen, dem Hemingway – das sollte wohl die persönliche Note sein – das rettende Löffelchen Zucker verweigert hatte, das eine zusammengepanschte Plörre zu einem guten Cocktail veredeln kann. Mehr als trübe allerdings empfand er die geradezu beleidigende Idee, ein Luxushotel namens ›Marina Hemingway‹ an einem der Strände von Havanna hinzuklotzen, damit sich die Reichen und Schönen dieser Welt (aber ja kein zerlumpter Kubaner) an Jachten und Stränden erfreuen konnten, an guten Getränken und feinem Essen, an zu allem bereiten Huren und einer karibischen Sonne, die die Haut so reizvoll tönt. Selbst die Finca Vigía, das Hemingway-Museum, das er seit so vielen Jahren nicht mehr besucht hatte, kam ihm vor wie eine zu Lebzeiten kalkulierte Inszenierung für die Zeit nach dem Tod … Nur der verwitterte, öde kleine Platz in Cojímar mit der Bronzebüste sagte wirklich etwas aus. Es war nach seinem Tod weltweit die erste Ehrung gewesen, und keiner seiner Biografen erwähnte sie. Doch es war die einzige aufrichtige Huldigung, denn das Denkmal hatten die Fischer von Cojímar aus ihrer eigenen Tasche bezahlt. In ganz Havanna hatten sie die Bronze für die Skulptur zusammengesucht, und der Bildhauer hatte auf ein Honorar verzichtet. Jene Fischer, denen Hemingway in schlechten Zeiten den Fang aus günstigeren Gewässern überließ, denen er während der Verfilmung von Der alte Mann und das Meer Arbeit gab (und sie ordentlich bezahlte), mit denen zusammen er Bier und Rum trank (auf seine Rechnung) und denen er schweigend lauschte, wenn sie von riesigen Fischen erzählten, die sie in den warmen Gewässern des großen blauen Stromes gefangen hatten – jene Fischer empfanden, was niemand sonst auf der Welt empfinden konnte. Ihnen war ein Freund gestorben, ein Kamerad, und das war Hemingway weder für die Schriftsteller- noch für die Journalistenkollegen gewesen, nicht für die Toreros oder die Großwildjäger in Afrika, ja nicht einmal für die Spanienkämpfer oder für die französischen Widerstandskämpfer, an deren Spitze er nach Paris marschiert war, um die glückliche, feuchtfröhliche Befreiung des ›Ritz‹ von der Nazi-Herrschaft zu feiern. Vor diesem Bronzeklumpen verflog die spektakuläre Verlogenheit des Lebens von Ernest Hemingway, überwunden durch eine der wenigen Wahrheiten hinter seinem Mythos. El Conde bewunderte diesen Beweis der Freundschaft, nicht wegen des Schriftstellers, der ihn nicht mehr erlebt hatte, sondern wegen der Männer, die ihn erbracht hatten, wegen ihres aufrichtigen Gefühls, das eigentlich gar nicht mehr in diese Welt passte.
»Und weißt du, was das Schlimmste ist?«, fügte er hinzu. »Ich glaube, er ist es immer noch.«
Wenn Miss Mary an jenem Mittwochabend zu Hause gewesen wäre, hätten sie Gäste gehabt wie jeden Mittwoch, und er hätte nicht so viel Wein trinken können. Es wären bestimmt nicht sehr viele zum Abendessen geladen gewesen, denn in letzter Zeit zog er ein ruhiges Leben und das Gespräch mit ein paar Freunden den Alkoholexzessen vergangener Tage vor. Insbesondere seit seine Leber Alarm geschlagen hatte. Sauferei und Völlerei standen ganz oben auf der unaufhaltsam länger werdenden Schreckensliste von Verboten. Lediglich die Mittwochabendessen auf der Finca wurden beibehalten wie ein Ritual. Unter all ihren Bekannten bevorzugte Hemingway als Gesellschaft den Arzt Dr. Ferrer Machuca, seinen alten Freund aus dem spanischen Bürgerkrieg, sowie die betörende Valerie, jene so junge und sanfte rothaarige Irin, die er, um sich nicht zu verlieben, zu seiner Sekretärin gemacht hatte, überzeugt davon, dass Arbeit und Liebe miteinander unvereinbar seien.
Seine Frau war überraschend in die Vereinigten Staaten gereist, um den Kauf eines Grundstücks in Ketchum voranzutreiben, und er war alleine auf der Finca zurückgeblieben. Wenigstens für ein paar Tage wollte er das Alleinsein genießen, jenes Gefühl, das so leicht bitter werden kann, wenn es sich mit dem Alter verbindet. Aber noch spürte er nichts dergleichen, jeden Morgen stand er mit der Sonne auf und arbeitete hart und konzentriert an seiner Schreibmaschine, stehend, wie in den besten Zeiten. Sein Tagespensum betrug mehr als dreihundert Wörter, obwohl es ihm immer schwieriger erschien, der Wahrheit in der spiegelglatten Geschichte, der er den Titel Der Garten Eden gegeben hatte, auf die Spur zu kommen. Diese Erzählung hatte er zehn Jahre zuvor als Kurzgeschichte begonnen, und jetzt drohte sie ins Unermessliche auszuufern. Er hatte sie sich nur deshalb wieder vorgenommen, weil er es nicht schaffte, die Überarbeitung von Tod am Nachmittag fortzuführen, auch wenn er das niemals zugegeben hätte. Für die geplante Neuausgabe musste er diesen Roman über Kunst und Philosophie des Stierkampfs grundlegend überarbeiten, aber er hatte das Gefühl gehabt, sein Gehirn arbeite zu langsam. An früher vertraute Einzelheiten konnte er sich oft nur mit Mühe erinnern, und manchmal musste er sogar grundlegende Dinge über den Stierkampf nachschlagen, um sie sich wieder vor Augen zu führen.
An jenem Mittwochmorgen des 2. Oktober 1958 hatte er es auf dreihundertsiebzig Wörter gebracht, und mittags war er geschwommen, allerdings ohne die Bahnen zu zählen, um sich nicht zu schämen wegen der lächerlichen Leistung im Vergleich zu der täglichen Meile, die er bis vor drei oder vier Jahren noch geschafft hatte. Nach dem Mittagessen hatte er sich vom Chauffeur nach Cojímar fahren lassen, um mit seinem alten Freund Ruperto zu sprechen, dem Kapitän der Pilar, und ihm von seiner Absicht zu erzählen, am darauf folgenden Wochenende in den Golf hinauszufahren. Außerdem wollte er seinem erschöpften Hirn eine Ruhepause gönnen. Gegen Abend dann fuhr er direkt nach Hause zurück, ohne seinem Verlangen nachzugeben und an der Theke des ›Floridita‹ Halt zu machen, wo er sich nie mit einem einzigen Glas begnügen konnte.