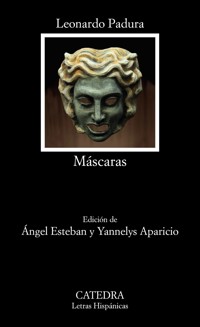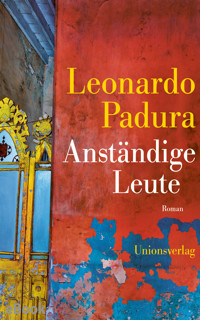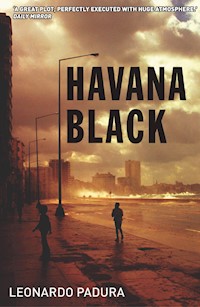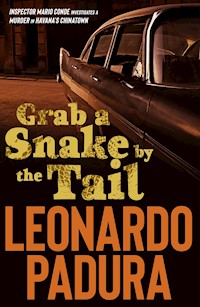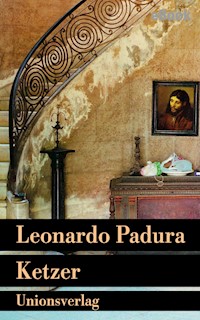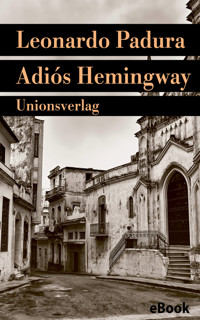12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während in Berlin die Mauer fällt, kommt in Havanna das Leben zum Stillstand. Das Einzige, was alle im Übermaß besitzen, ist Zeit. Verbunden durch den Durst nach Leben findet sich eine verschworene Gemeinschaft zusammen, der »Clan«. In ihrer Mitte die kämpferische Elisa, Clara, ruhig und liebevoll, und Irving, mit seiner Fähigkeit zu uneingeschränkter Hingabe. Ein altes Haus, durchzogen von vielfarbigem Licht und dem Duft nach Kaffee und Rum, wird zum Zufluchtsort. Hier kommen sie alle zusammen, feiern, streiten, trinken, lesen, begehren. Doch der Clan zerbricht, zerstreut sich in alle Himmelsrichtungen. Erst Jahrzehnte später und Hunderte Kilometer entfernt, mit dem Fund eines vergilbten Fotos, beginnen sich die unter der Zeit begrabenen Geheimnisse der einst so engen Freunde zu lüften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
In Havanna findet sich eine verschworene Gemeinschaft zusammen, der »Clan«. In einem alten, stets nach Rum und Kaffee duftenden Haus kommen sie zusammen, trotzen allen Widrigkeiten, feiern, streiten, lesen, begehren. Als einer der Ihren stirbt, zerbricht der Clan. Erst Jahrzehnte später beginnen sich die Geheimnisse von damals zu lüften.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Peter Kultzen (*1962) studierte Romanistik und Germanistik in München, Salamanca, Madrid und Berlin. Er lebt als freier Lektor und Übersetzer spanisch- und portugiesischsprachiger Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Peter Kultzen.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Wie Staub im Wind
Roman
Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 4 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2020 bei Tusquets Editores, Barcelona.
Die Übersetzung dieses Werkes wurde unterstützt von Acción Cultural Española, AC/E.
Motto S. 9: Aus José Samarago, Das Evangelium nach Jesus Christus. Aus dem Spanischen von Andreas Klotsch. Rowohlt, Reinbek 1993.
Motto S. 11: Aus Paul Auster, Die New-York-Trilogie, Stadt aus Glas. Aus dem Englischen von Joachim A. Frank. Rowohlt, Reinbek 2012.
Alle übrigen Motti wurden von Peter Kultzen ins Deutsche übertragen.
Originaltitel: Como Polvo en el Viento
© Leonardo Padura 2020
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit Tusquets Editores, Barcelona, Spanien
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Daniel Korzeniewski (Alamy Stock Photo)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31110-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 13:54h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
WIE STAUB IM WIND
Adela, Marcos und die ZärtlichkeitGeburtstagIst es heiß in Havanna?Niemands TochterQuintus HoratiusSanta Clara, die Schutzheilige der FreundschaftDie Frau, die mit den Pferden sprachDie Flüsse des LebensMagnetentrümmerDer endgültige SiegAnmerkung und DankMehr über dieses Buch
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Peter Kultzen
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Spanien
Zum Thema USA
Für meine Lucía, Kind der Diaspora
Für den lieben Elizardo Martínez, der im Exilbis zum letzten Atemzug ein aristokratischerJunge aus El Vedado blieb
Du wirst den Krieg verlieren, unabwendbar,aber alle Schlachten gewinnen.
JOSÉ SARAMAGO,Das Evangelium nach Jesus Christus
Endlich war der Erwartete da,
die Türen des Hauses wurden geöffnet,
erneut die Lichter entzündet. (…)
Wir haben das Haus aufs Neue bezogen.
Wir kannten uns seit eh und je.
Alle hatten sich eingefunden.
JOSÉ LEZAMA LIMA,El Esperado
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Dust in the wind
Everything is dust in the wind
The wind …
KANSAS,Dust in the Wind
Adela, Marcos und die Zärtlichkeit
Nichts ist wirklich,außer dem Zufall.
PAUL AUSTER,Mond über Manhattan
Adela Fitzberg hörte die Fanfare, die zu erkennen gab, dass jemand aus der Familie anrief, und erblickte das Wort Mutter auf dem Display ihres iPhone. Ohne lange zu überlegen – sie wusste aus Erfahrung, dass es besser war, darauf zu verzichten –, wischte sie über den grünen Knopf. »Loreta?«, fragte sie, als könnte jemand anders als ihre Mutter am Apparat sein.
Drei Stunden zuvor hatte sie zum Frühstück ihren angeblich »original griechischen« Joghurt mit Haferflocken und Obst in sich hineingelöffelt – lustlos wie jeden Morgen, aber vielleicht stimmte ja wirklich, dass er wenig Kalorien hatte –, dazu den belebenden Duft des Kaffees eingesogen, dessen Zubereitung normalerweise Marcos übernahm, und war dann der Versuchung erlegen, mit ihrem Handy herumzuspielen. Als sie das Verzeichnis der eingegangenen Anrufe durchsah, stellte sie fest, dass Mutter es in den vergangenen sechzehn Monaten kein einziges Mal bei ihr versucht hatte. Während dieser gesamten Zeit hatte stets sie die Mutter angerufen, hatte nach innerem Ringen schließlich Loretas Nummer gewählt, im Schnitt zwei Mal pro Monat.
Und nun kam ihr Anruf! War etwas geschehen? War das Telepathie? Wohl eher ein Zufall. Sie würde schon sehen, was dahintersteckte. Falls sie es überlebte.
»Na, Cosi, wie gehts?«
Der dunklen Stimme war regelmäßiger Alkohol im Verbund mit viel Nikotin anzuhören – da konnte ihre Mutter noch so oft schwören, dass sie von Zigaretten die Finger ließ. Und auch dass sie in Adelas Gegenwart niemals etwas Stärkeres als eine Bloody Mary oder einige Gläschen Rotwein getrunken hatte, bewies nicht das Gegenteil. Dass sie sie »Cosi« nannte, verhieß ebenfalls nichts Gutes. So hatte sie sie als kleines Kind angesprochen. »Adela« sagte sie nur, wenn sie verärgert, und »Adela Fitzberg«, also den kompletten Namen, wenn sie hochgradig empört war. Klarer Fall: Dass Loreta nach so vielen Monaten von sich aus anrief, diente nur dem Zweck, ihr den Tag zu versauen.
»Alles gut hier … Soeben bei der Arbeit angekommen …«
Ihrerseits zu fragen, wie es ging, oder gar, ob etwas passiert sei, wagte Adela nicht. Und zu sagen, dass ihr der Anruf gerade nicht so gut passte, erst recht nicht. Sie war im Verkehrschaos stecken geblieben und schon wieder zu spät gekommen. Aber das würde Loreta nur einmal mehr zum Anlass nehmen, um über den verfluchten Autowahn unserer Zeit und den Schaden für unser aller Lungen, insbesondere die ihrer Tochter, herzuziehen.
»Schön für dich. Mir gehts miserabel …«
»Bist du krank? Was ist passiert? Wie spät ist es denn bei euch?«
»Jetzt? Sechs Uhr achtzehn. Aber es ist noch dunkel. Stockdunkel und ziemlich kalt … Nein, ich bin nicht krank. Jedenfalls nicht körperlich … Ich rufe bloß an, weil ich deine Mutter bin und dich lieb habe, Cosi. Und weil ich mit dir reden muss. Glaubst du, das ginge?«
»Natürlich. Was hast du denn, Loreta?«
Adela schloss die Augen und hörte, wie ihre Mutter den altbekannten dramatischen Stoßseufzer von sich gab. Dass sie sie »Loreta« und nicht »Mama« genannt hatte, war wahrscheinlich eine unbewusste Rache für das hartnäckige Beharren auf dem Kindernamen »Cosi«. »Mama« sagte Adela tatsächlich nur, wenn sie von der Lust befallen wurde, ihre Mutter umzubringen.
»Wie läufts mit deinem Freund?«
Diesmal war es Adela, die seufzte. »Hast du nicht schon längst klargestellt, dass du darüber nichts wissen willst? Nein, deswegen rufst du nicht an, gibs zu.«
Noch ein langer Seufzer. Ob der ernst zu nehmen war? Bei ihrem letzten Telefonat hatte die Mutter ihr ins Ohr geschrien, sie könne ihretwegen gerne noch tiefer in der Scheiße versacken, und geschworen, sie werde nie mehr über das Liebesleben ihrer Tochter ein Wort verlieren und wolle auch nie wieder etwas darüber hören. Und Adela wusste, dass ihre Mutter zu den Leuten gehörte, die ein Versprechen halten.
»Ringos Zeit ist abgelaufen«, verkündete die übernächtigte Stimme schließlich.
»Was sagst du da, Mama?«
Schlagartig schob sich das Bild eines Pferdes mit glänzend braunem Fell vor das ihrer Mutter. Von dem weißen Stern auf der Stirn hatte das Tier seinen Namen: Ringo Starr. Als Loreta ihre Arbeit auf dem großen Gestüt »The Sea Breeze Farm« in der Nähe von Tacoma im Nordwesten der USA angetreten hatte, hatte sie sich sofort und unwiderruflich in diesen wunderschönen Cleveland-Bay-Zuchthengst mit den blassen und stets ein wenig verweint wirkenden Augen verliebt, die an einen gleichermaßen melancholischen wie scharfsinnigen Menschen denken ließen. Auch Ringo erkannte diese Seelenverwandtschaft und erwiderte sie.
Zehn, zwölf Jahre war das jetzt her – und Loreta bestand seither darauf, sich persönlich um den Hengst zu kümmern, was sie auch so gründlich und gewissenhaft tat, wie sie es bisher mit nichts und niemandem sonst getan hatte. Auch Adela war schon auf Ringos breitem Rücken durch die Wälder rings um das abgelegene Gestüt geritten, auf dem ihre Mutter sich vor der Welt zurückgezogen hatte, und hatte seinen energischen Schritt und die ungewöhnliche Gelassenheit genossen. Immerhin waren seine Artgenossen als Kutschpferde des englischen Königshauses im Einsatz.
»Zwing mich nicht, es zu wiederholen, Cosi.«
»Aber was ist mit ihm? Als wir das letzte Mal telefoniert haben … Na ja, das ist natürlich schon eine Weile her«, sagte Adela. Jetzt tat es ihr leid, dass sie angenommen hatte, ihre Mutter rufe wieder einmal aus einer bloßen Laune heraus an.
»Er hat Koliken. Rick und ich, wir versuchen schon seit Tagen alles Mögliche. Auch der beste Tierarzt aus der Gegend war hier und hat ihn sich angesehen. Vor zwei Tagen gab es dann eine endgültige Diagnose. Sein Bauch ist punktiert worden. Für eine Operation ist er zu alt, andererseits ist er immer noch sehr stark, und wir wollen nicht, dass er … Mir war es sowieso klar, aber der Tierarzt hat noch einmal bestätigt, dass es bloß eine Lösung gibt.«
»O Gott. Hat er schlimme Schmerzen?«
»Schon seit Tagen. Ich habe ihn stark sediert.«
Adela schluckte. »Kann man gar nichts mehr machen?«
»Nein. Wunder gibt es nicht.«
»Wie alt ist er jetzt?«
»So alt wie du, sechsundzwanzig. Er sieht nicht so aus, aber er ist tatsächlich ein Greis …«
Adela zögerte, bevor sie fortfuhr. »Dann hilf ihm, Loreta.«
Als Antwort war ein erneutes Seufzen zu hören. »Ja, das werde ich tun. Aber ich weiß nicht, ob ich es selbst machen oder Rick überlassen soll. Oder dem Tierarzt.«
»Mach du das. Aber liebevoll.«
»Das wird hart …«
»Natürlich. Du bist schließlich wie eine Mutter für ihn«, sagte Adela.
»Das ist ja gerade das Schlimme. Du hast keine Vorstellung davon, was es heißt, Mutter zu sein. Was man als Mutter alles durchmachen muss.«
»Du hast viel mit mir durchgemacht, stimmts?«, erwiderte Adela unwillkürlich. Und hatte das Gefühl, schon wieder in die Falle gegangen zu sein, wie immer. Umso überraschter war sie, als Loreta nun nicht zu dem üblichen Schwall von Vorwürfen ansetzte.
»Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte bloß wissen, dass es dir gut geht. Und ich wollte dir sagen, dass ich dich sehr, sehr lieb habe, und … Cosi, ich kann jetzt nicht weitersprechen. Ich glaube, ich …«
»Tut mir leid«, sagte Adela, der erst jetzt bewusst wurde, wie unangebracht ihre Äußerung gewesen war und wie sehr ihre Mutter jetzt litt. Dass sie zum Schluss einfach aufgelegt hatte, zeigte, dass sie am Boden zerstört und nicht in der Lage war, sich auf die üblichen Wortgefechte einzulassen.
Eine Weile saß Adela reglos mit ihrem iPhone in der Hand da und stellte sich vor, wie Loreta mit einer Furcht einflößenden Metallspritze auf Ringo zutrat, um ihn mit einem Stich in den braunen Hals in ewigen Schlaf zu versetzen. Die Augen des Tieres blickten sie aus der Erinnerung sanft und gleichzeitig misstrauisch an. Adela ließ das Telefon in die oberste Schreibtischschublade fallen und schloss sie mit einem leisen Knall. Sie stand auf und ging zum Ausgang der Universitätsbibliothek, wo sie in der Sonderabteilung eine Stelle als Spezialistin für kubanische Literatur ergattert hatte. Als sie am Tisch ihrer Kollegin Yohandra vorbeikam, erklärte sie, sie müsse ein bisschen an die frische Luft, außerdem brauche sie einen Kaffee.
»Ist irgendwas?«, fragte Yohandra.
»Ja, das heißt, nein, nichts«, murmelte Adela, die keine Lust hatte, Erklärungen abzugeben. Stattdessen fragte sie: »Schenkst du mir eine Zigarette?«
Yohandra sah sie erstaunt an und zog eine Zigarette aus ihrer Packung. »Ist es so schlimm?«, fragte sie und reichte ihr die Zigarette und ein Feuerzeug.
Adela bedankte sich leise, versuchte zu lächeln und nickte anschließend bloß zustimmend, als die Kollegin auf den Bildschirm ihres Computers deutete und sagte, Präsident Obama habe offenbar wirklich vor, nach Kuba zu fahren, der sei ja echt ein Wahnsinnstyp …
Adela ging hinaus in den Bibliotheksgarten, wo ihr die feuchte Wärme Miamis entgegenschlug. Im Norden standen Wolken am Himmel, höchstwahrscheinlich würde es am Abend einen heftigen Regenguss geben, was die Rückfahrt zur reinsten Tortur machen würde.
Dem Duft nach frisch gekochtem kubanischem Kaffee folgend, steuerte sie den Imbiss im Erdgeschoss der geisteswissenschaftlichen Fakultät an. Mit einem vollen Plastikbecher in der Hand ging sie wieder hinaus in den Garten und suchte sich eine möglichst abgeschiedene und schattige Bank, um in Ruhe den Kaffee trinken und möglichst ungesehen die erste Zigarette seit Monaten rauchen zu können. Scheiß drauf, genau das Richtige für einen so bekackten Tag wie heute, sagte sie sich und genoss die Wirkung des Nikotins, das sich in ihr ausbreitete. Gleich darauf befiel sie die Gewissheit, dass ihre schlechte Stimmung nicht bloß dem bevorstehenden Tod des alten Ringo geschuldet war. Loreta hatte ihr nicht nur mit einer schlechten Nachricht den Tag versauen wollen, sie musste noch einen anderen Grund für ihren Anruf gehabt haben.
Als Adela auf dem »Palmetto«, der zehnspurigen Autobahn, die sie an jedem Arbeitstag mindestens zwei frustrierende Stunden ihrer Lebenszeit im Stau von Abertausenden Autos kostete, nach Hause fuhr, brach das erwartete Unwetter los. Das unangenehme Gefühl, das die Vorstellung von der Nadel, die sich unaufhaltsam in Ringos Hals bohrte, in Adela ausgelöst hatte, steigerte sich noch einmal gewaltig, als sie plötzlich den unverkennbaren Druck im Unterleib spürte, der anzeigte, dass sie dabei war, ihre Tage zu bekommen. Abrupt schaltete sie den CD-Player aus, in dem gerade Musik der Gruppe Habana Abierta lief, die Marcos so gut gefiel. Sich mitten in diesem nervtötenden Stau auch noch anhören zu müssen, dass jedermann happy zu sein habe, überstieg ihre Leidensfähigkeit. Sie war noch drei Ausfahrten von ihrem Ziel entfernt, stop and go, und hätte vor Wut und Hilflosigkeit am liebsten zu heulen angefangen.
Fast eineinhalb Jahre war es jetzt her, dass sie sich darauf eingelassen hatte, mit Marcos nach Hialeah zu ziehen. Der Entschluss hatte hitzige Diskussionen mit ihrer Mutter ausgelöst, die nicht einen Funken Verständnis für diese Entscheidung ihrer Tochter zeigte. Dass Adela nicht in New York, sondern in Miami studieren wollte – ausgerechnet in Miami –, ließ sie noch als typisch jugendlichen Unsinn durchgehen. Dass sie dann aber ein paar Jahre später mit einem Bachelor der Florida International University in der Tasche eine schäbige Stelle bei der Universitätsbibliothek antrat und gleichzeitig einen Masterstudiengang in einem so nutzlosen Dritte-Welt-Fach wie »Lateinamerikastudien« begann, qualifizierte ihre Erzeugerin als skandalöse Zeit- und Talentvergeudung. Dass sie sich zum krönenden Abschluss auch noch in einen kubanischen Bootsflüchtling verliebte und nur wenige Monate später mit ihm in ein schmuddeliges Appartement im noch viel schmuddeligeren Hialeah zog, war für die Mutter der endgültige Beweis ihrer unheilbaren Geistesverirrung, für die sie, wie sie nun endlos klagte, noch teuer würde bezahlen müssen.
Als Loreta bei einer dieser endlosen Strafpredigten erschöpft Atem holen musste, schrie Adela, sie ziehe um, weil ihre Arbeit und überhaupt ihre Zukunft nun einmal im Süden Floridas lägen, außerdem sei sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben sicher, dass sie wirklich verliebt sei. Woraufhin Loreta lachend fragte, was das denn heißen solle, verliebt sein, und ob ihre Entscheidung in Wirklichkeit nicht einfach nur mit der Schwanzgröße ihres kubanischen Liebhabers zu tun habe. »Als ob es nicht mehr als genug lange Schwänze auf dieser Welt gibt, Adela Fitzberg«, versetzte sie. Dann legte sie schlagartig auf, nur um zwanzig Sekunden später erneut anzurufen und ihre Tochter zu fragen, ob sie sonst noch jemanden kenne, der bereit sei, freiwillig seine Wohnung in Coconut Grove aufzugeben und nach Hialeah zu ziehen. »Nach Hialeah, das gibts ja nicht«, kreischte sie und legte wieder auf.
Nach diesem Anruf meldete sie sich nicht wieder, und auch Adela blieb starrsinnig. So vergingen Wochen ohne irgendeinen Austausch zwischen den beiden.
Kennengelernt hatten sich Adela und Marcos in The Hunter, einer Diskothek in der Nähe von Adelas Wohnung in Coconut Grove, wo sie manchmal freitagabends mit Yohandra und noch ein paar allein lebenden Freundinnen tanzen ging. Das entspannte kubanische Ambiente dort gefiel ihr auf Anhieb, und auch die H.-Upmann-Zigaretten, die Yohandra sich aus Kuba schicken ließ, rauchte sie gern, wie sie sich auch bereitwillig mit der Kollegin aus der Bibliothek auf die Tanzfläche begab, wenn der DJ die passende Musik von der Insel auflegte, über die die dort versammelten Exilanten pausenlos herzogen, ohne dass sie sich jemals endgültig von ihr hätten lossagen wollen (oder können). Wenn Adelas Kräfte nachließen, setzte sie sich eine Weile und genoss es, von ihrem Tisch aus der Freundin beim Tanzen zuzusehen, die sämtliche Stile samt den dazugehörigen Schritten perfekt beherrschte. Dazu bewegte sie sich mit einer Sinnlichkeit und Natürlichkeit, die für Adela unerreichbar blieben, sosehr sie sich auch bemühte.
Sie fühlte sich dermaßen wohl in diesen in Yohandas Gesellschaft durchtanzten Nächten, dass sie sich irgendwann verunsichert zu fragen begann, ob hier nicht doch eine versteckte lesbische Neigung im Spiel sein könnte. Als sie dann zur Feier des sechzigsten Geburtstages ihres Vaters nach New York fuhr – wie in den Jahren zuvor war Loreta nicht mit von der Partie –, nutzte sie die Gelegenheit, mit der einzigen Person, an die sie sich in einer so heiklen Angelegenheit wenden konnte, darüber zu reden. Wie immer aßen sie in dem Restaurant Blue Smoke in der East 27th Street, und als Adela ihrem Vater anschließend ihre Sorgen vortrug, lächelte Bruno Fitzberg nur, ganz der Psychoanalytiker, als der er schon in seinen Jahren in Argentinien gearbeitet hatte. Ihr einziges Problem sei, dass sie noch so jung sei und den Richtigen bislang nicht gefunden habe, den Mann, der, anders als ihre bisherigen wenig erfahrenen Liebhaber, imstande wäre, ihr als Frau wirkliche Erfüllung zu geben.
»Lass dir Zeit«, sagte er. »Irgendwann wird er schon auftauchen.«
»Das hört sich ziemlich nach der guten alten Geschichte vom Märchenprinzen an, Papa«, erwiderte Adela.
Bruno Fitzberg nahm ihre Hände und sah ihr über den Tisch hinweg in die Augen. »Genau den hast du verdient, mein Mädchen. Du weißt selbst, wie schön und anziehend du bist. Der Richtige wird kommen. Einer, mit dem alles ganz anders ist. Was du aber erst merken wirst, wenn du es erlebst. Andererseits: Und wenn du doch lesbisch wärst? Was wäre denn dabei? Deine Freundin ist wunderschön. Und wirklich attraktiv. Allerdings steht sie nicht auf Frauen, mach dir da nichts vor. Die ist scharf auf Kerle.«
»Woher weißt du das so genau?«, fragte Adela. Wie immer, wenn sie mit Bruno sprach, war sie in den argentinischen Akzent gefallen.
»Man hat so seine Erfahrungen«, erwiderte er mit einem kleinen Lächeln.
»Soll das heißen, dass du bei deinem Besuch in Miami …?«
»No comment.«
Ihr Vater sollte recht behalten: Nur wenige Monate später lernte Adela in ihrer Lieblingsdiskothek Marcos kennen.
Zunächst sah es nach einem langweiligen Abend aus, da Yohandra mit einer fiebrigen Halsentzündung zu Hause geblieben war. Adela hatte letztlich nur deshalb dem Drängen der übrigen Freundinnen nachgegeben und war mitgekommen, weil sie auch unabhängig von Yohandra und ihren kubanischen Zigaretten imstande sein wollte, sich zu amüsieren. Allerdings schien es, als sei ihre Mühe vergebens. Obwohl sie mit dem Auto unterwegs war, bestellte sie ein zweites und dann auch noch ein drittes Glas Wein, während sie, die meiste Zeit allein, mit aufgestützten Ellbogen am Tisch saß und mit sich, ihrer langweiligen Art und ihrem ereignislosen Dasein haderte. Sie sah den Kubanern zu, die in bester Feierlaune die Tanzfläche in Besitz genommen hatten. Und da sprang schließlich der Funke über.
Der Typ, den sie hier noch nie gesehen hatte, sah aus wie die Karikatur eines Schauspielers aus einem Hollywood-Film der Fünfzigerjahre. Er trug eine weit geschnittene Hose und ein langärmeliges Hemd, beides aus weißem Leinen. Das Hemd war ziemlich weit aufgeknöpft, und vor der unbehaarten, vielleicht auch rasierten Brust baumelte an einer goldenen Kette ein blitzendes Medaillon der Barmherzigen Jungfrau von Cobre. Auf seinem Kopf saß ein offensichtlich falscher Panamahut – vielleicht hatte er ihn, samt Kette und Medaillon, auf dem Flohmarkt von Miami erstanden –, den er, sooft er es für nötig hielt, als Teil seiner extravaganten Selbstinszenierung einsetzte: Er nahm ihn ab und schwenkte ihn wie ein Stierkämpfer seine Capa, warf ihn in die Luft und fing ihn nach einer eleganten, offenkundig gut eingeübten Drehung wieder auf. Das pechschwarze gewellte Haar glitzerte von Pomade und Schweiß. Die nackten Füße, die in dünnsohligen braunen Slippern steckten, führten mit millimetergenauer Präzision, doch fast ohne sich vom Boden zu heben, die Tanzschritte aus, während die Arme umso ausladendere Bewegungen vollzogen und die Schultern im Rhythmus des wummernden Bassrhythmus zuckten.
Gebannt von seiner Aufmachung und dem ungezwungenen Auftreten, sagte sich Adela, dass die Betreiber der Diskothek wahrscheinlich einen Profi engagiert hatten, der für Stimmung sorgen sollte, was ihm, wie zu sehen war, auch bestens gelang. Als die Musik dann auf ihren Höhepunkt zusteuerte und Trommeln und Timbales die Führung übernahmen, hörten die übrigen Paare auf zu tanzen und bildeten einen Kreis um den jungen Mann und seine Partnerin, eine Schwarze mit dichten Locken in einem äußerst knappen, grün glänzenden Kleid. Verführerisch die Hüften schwingend und sich, breit lächelnd, anzügliche Blicke zuwerfend, präsentierten die beiden schweißnassen Tänzer ein Schauspiel von explosiver Sinnlichkeit.
Am Ende applaudierten die Zuschauer begeistert, während der junge Mann aus voller Brust rief: »I love you, Miami!« Was wegen seines starken spanischen Akzents jedoch nicht ohne Weiteres zu verstehen war.
Als Adela sich anschließend ihr drittes Glas Wein vornahm, wurde der Stuhl neben ihr plötzlich ein Stück zurückgezogen, und im nächsten Augenblick ließ sich der ganz in Weiß gekleidete junge Mann darauf nieder.
»Was ist denn mit dir los, Mädchen? Hat dich dein Freund abserviert, oder kannst du nicht tanzen?«
Er roch nach Rasierwasser und Schweiß. Männergeruch, dachte Adela, als der Tänzer es sich unaufgefordert neben ihr bequem machte und einen langen Schluck aus dem Glas Heineken trank, das er in der einen Hand hielt. Mit der anderen nahm er den Panamahut ab, legte ihn auf den Tisch, wischte sich mit einem roten Taschentuch die Stirn trocken und präsentierte lächelnd eine Reihe makellos weißer Zähne.
»Weder noch«, war das Einzige, was Adela darauf einfiel.
»Ich würde dir nämlich, wenn du erlaubst, gerne bei der Lösung beider Probleme behilflich sein.« Sein Lächeln wurde noch breiter, während er eine Braue in die Höhe zog, als wollte er Adela genauer in den Blick nehmen.
»Seit wann bist du hier?«, fragte Adela, die sich über die Ungeniertheit des jungen Mannes wunderte.
»Seit zwei Monaten.« Er senkte die Stimme. »Merkt man es mir sehr an?«
»Und wie! Du benimmst dich wie der letzte Hinterwäldler.«
»Hast du Angst vor mir?«, konterte er lächelnd.
»Nein, eher schon Mitleid.«
»Du machst mich fertig, Mädchen. Mitleid? Oje, wenn ich so weitermache, schicken die mich noch zurück.«
Jetzt musste Adela doch lächeln. »Sorry. Du tanzt wirklich gut«, sagte sie versöhnlich.
»Und du? Jetzt mal im Ernst, kannst du wirklich nicht tanzen?«
»Wer hat das gesagt?«
»Egal. Beweis mir das Gegenteil.« Er fuhr sich noch einmal mit dem roten Tuch übers Gesicht, griff nach seinem Hut, stand auf – war er auf einmal größer geworden? – und hielt Adela die rechte Hand hin.
Adela betrachtete ihn nachdenklich – immerzu dachte sie nach, das hatte ihr Vater schon gesagt, als sie noch ein Kind war, aber nie hatte er dazugesagt, ob er das gut oder schlecht fand. In jedem Fall hatte sie es hier mit einer dermaßen überholten Form von Anmache zu tun, dass es fast schon komisch war. Vielleicht gerade deshalb beschloss sie, nicht länger nachzudenken, und ließ sich stattdessen auf das Spiel ein. Was hatte sie schon zu verlieren? Sie ergriff also seine Hand, stand auf, sprach aber noch eine Warnung aus, bevor sie ihm folgte: »Wenn du irgendwelchen Quatsch machst, gehe ich sofort.«
»Kein Quatsch«, versprach er.
»Hast du den Hut vom Flohmarkt?«
Er legte lächelnd den Finger an die Nase und visierte Adela an. »Woher kommst du? Du bist nicht von hier, stimmts?«
»Na ja, Amerikanerin bin ich schon. US-Amerikanerin, aus New York. Warum?«
»Ihr Gringos glaubt, überall ist Disneyland. Nein, Mädchen, der Hut ist aus Ecuador, echter und besser geht nicht. Den hat mir ein Kumpel mitgebracht, der vor zwei Wochen hier angekommen ist. Heute habe ich ihn zum ersten Mal auf, irgendwas hat mir nämlich am Morgen gesagt, dass ich, keine Ahnung …«
»Eine Vorahnung, meinst du«, fiel ihm Adela ins Wort.
»Oder Changó hat mir einen Tipp gegeben. Auf jeden Fall wusste ich, dass heute etwas Gutes passieren würde …«
»Glaubst du an Santería?«
»Ich glaube eigentlich an alles. Kann nicht schaden«, sagte er und hielt ihr das rote Taschentuch und das Medaillon entgegen.
Dann schleifte er sie fast an der Linken hinter sich her auf die Tanzfläche, wo er ihr die Rechte an die Hüfte legte, sie zu sich herzog und gleich darauf wieder zurückstieß, als wäre er unsicher. »Moment. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit Mädchen tanzen, deren Namen ich nicht kenne. What’s your name, baby?«
Wieder empfand Adela eine Mischung aus Mitleid und Rührung. Ein totaler Hinterwäldler, hundertprozentig. »Adela Fitzberg.«
Er streckte ihr die Hand entgegen. »Freut mich, Adela Fitz, oder wie auch immer. Mein Name ist Marcos Martínez Chaple, auf Kuba haben mich alle immer Marcos der Schlaufuchs genannt, manchmal auch Magier Mandrake. Du bist also in New York geboren. Aber woher kommst du? Sind deine Eltern richtige Amis? Oder bist du Halbargentinierin? Oder Kubanerin, und willst es bloß nicht sagen?«
»Von allem etwas.«
»Aha, der reinste Molotowcocktail. Los, jetzt wird getanzt!«
Gleich bei den ersten Schritten zeigte sich, dass Adela eigentlich nicht richtig tanzen konnte. Sie zog sich aus der Affäre, indem sie sich einfach von ihm führen ließ. Was sich im Nachhinein als genau die richtige Entscheidung erweisen sollte. Sie staunte selbst über ihre Fügsamkeit gegenüber diesem Fremden, an dem sie ja durchaus allerlei auszusetzen hatte. Doch dann wurde sie tiefer und tiefer in die schrankenlose und schwindelerregende Welt dieses Marcos Martínez Chaple, genannt Marcos der Schlaufuchs, hineingezogen. Was damit geendet hatte, dass sie nur wenige Monate später nach Hialeah übersiedelte, in die selbst ernannte »Stadt des Fortschritts«.
Jetzt war sie endlich auf der West 49th Street dieses Gettos angekommen und fuhr die sogenannte Palm Spring Mile entlang, immer noch im Schneckentempo, mitten in einem endlosen, ohrenbetäubenden Hupkonzert, durch riesige Pfützen, die der Regen hinterlassen hatte, vorbei an mehr Reklameschildern, als irgendein Mensch aufnehmen konnte, für tausend Produkte, die zweifellos ebenso geschmacksfrei wie gesundheitsgefährdend waren.
Zwei Mal hatten sie sich getroffen, bevor sie zum ersten Mal zusammen ins Bett gingen – was sie komplett durchrüttelte und alles bisher Erlebte übertraf. Dieser 18. August 2014 würde ihr für immer unvergesslich bleiben. Ihr Vater würde hochzufrieden feststellen, dass er mit seiner Vorhersage recht gehabt hatte.
Schon bei den ersten beiden Treffen entdeckte Adela, dass die Masken, hinter denen Marcos sich versteckte, nur ein Schutzschild waren. Dass sein überdrehtes Gehabe ein durchaus authentisches Wesen verbarg. Dass hinter den bald mehr, bald weniger originellen Sprüchen dieses gerade erst hier eingetroffenen jungen Mannes aus Havanna eine Person steckte, in der sich grenzenlose Unschuld mit unvergleichlicher Gewitztheit verband, in einer Mischung, die es so nur in jener Stadt gab. Mitleid oder vielmehr zärtliche Rührung überschwemmten sie. So kam es, dass Adela sich schließlich in diesen Marcos Martínez Chaple verliebte.
Im September 2007 war die Stimmung im Land euphorisch. Die Wirtschaft florierte, man hielt den endgültigen Sieg über den Terrorismus und einen grundlegenden Wandel für greifbar nahe. Während sich in New York nach dem heißen Sommer bereits die ersten melancholischen Vorboten des Herbstes zeigten, ließ in Miami die Sonne immer noch das Pflaster schmelzen, und das Meer präsentierte sich in seiner glasklar schillernden Pracht. Adela beschloss, die schönen Dinge des Lebens zu genießen und sich die Laune nicht durch das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter verderben zu lassen, das damals wieder einmal einen Tiefpunkt erreicht hatte. Sie hatte eine Entscheidung getroffen: Sie würde nach Kräften die Wahlkampagne des vielversprechenden, charismatischen Senators Barack Obama unterstützen und sich auch künftig für die Friedensbewegung und die Besserstellung der Einwanderer einsetzen. Und sie würde in den Süden ziehen, um an der Florida International University zu studieren.
Im April war Adela siebzehn geworden. Ihr ganzes bisheriges Leben hatte sie in Hamilton Heights, West Harlem, gewohnt, in einer Wohnung, die ihr Vater Bruno Fitzberg seit fast zwanzig Jahren gemietet hatte. Dort war Anfang 1989, nur wenige Monate nach ihrer Ausreise aus Kuba, auch ihre Mutter Loreta untergeschlüpft. Ursprünglich hatte Loreta damals bloß an einem mehrtägigen Kongress über Tiermedizin in Boston teilnehmen wollen. Als der zu Ende war, beschloss sie jedoch, nicht auf die Insel zurückzukehren, obwohl sie genau wusste, dass es in den USA leichter war, eine Ausbildung zum Astronauten zu machen, als den Doktortitel einer kubanischen Universität, in ihrem Fall in Tiermedizin, anerkennen zu lassen.
Die fulminante Liebesgeschichte zwischen der Frau, die sich aus Kuba abgesetzt hatte, und dem argentinischen Psychoanalytiker, begann mit einer beiläufigen Unterhaltung in der Impressionismusabteilung des Metropolitan Museum, setzte sich in einem Café und anschließend einem Restaurant fort und erfuhr eine erste Krönung, als Loreta Aguirre Bodes und Bruno Fitzberg noch am selben Abend in ebenjener Wohnung in Hamilton Heights miteinander ins Bett gingen. Loreta hatte Adela immer wieder erzählt, dass sie damals vollkommen auf sich allein gestellt war, was vielleicht auch ihre grenzenlose Sorglosigkeit erklärte, die dazu geführt hatte, dass sie fast augenblicklich schwanger und bald darauf Bruno Fitzbergs Ehefrau geworden war. Wenige Monate später, im April 1990, war dann Adela Fitzberg zur Welt gekommen.
Als Loreta und Bruno sich 2005 trennten, vereinbarten sie, dass Adela bis zu ihrem Schulabschluss und dem Ende ihrer gleichzeitigen künstlerischen Ausbildung in der Wohnung in Hamilton Heights bleiben sollte. Anschließend, hofften die Eltern, würde es ihr ein privates Stipendium oder ein staatlicher Kredit ermöglichen, ein Studium an der Columbia University aufzunehmen. Die freien Sommermonate sollte sie mit ihrer Mutter verbringen, entweder gemeinsam durchs Land reisend oder in deren Wohnung in Union City, wohin sie mit ihren Büchern, Räuchergefäßen, ihrem Karma und ihren Neurosen nach der Trennung gezogen war.
Später beschäftigte sich Adela vertieft mit ihren kubanischen Wurzeln, von denen Loreta sich so radikal losgesagt hatte. Vielleicht war das auch nur ein Versuch, sich von der Mutter abzusetzen, jedenfalls fühlte die junge Adela, die eigentlich nichts anderes sein konnte als eine waschechte New Yorkerin – falls es so etwas gibt –, sich von allem, was mit Kuba zu tun hatte, heftig angezogen. Warum nicht vom Heimatland ihres Vaters oder auch der Kultur der Dominikaner, die gerade ihre Wohngegend in Besitz nahmen? Jahre später würde sie sich diese Frage stellen.
Adela war wie eine Pflanze ohne Wurzeln großgezogen worden. Ihr Vater, ein argentinischer Jude, hatte als junger Mann wegen politischer Aktivitäten fliehen müssen und hasste so unausgesprochen wie verbissen alles, was mit seinem Herkunftsland zu tun hatte – bis auf die Fußballnationalmannschaft, das Rindfleisch, die Romane von Osvaldo Soriano und Ricardo Piglia und das Bandoneon von Astor Piazzolla. Kaum weniger verachtete er die »Tyrannei« der jüdischen Kultur seiner Eltern, die ihm von der unguten – ja »faschistoiden«, wie er sie zuweilen nannte – Politik der Zionisten manipuliert schien. Adelas Mutter wiederum hatte wohl noch entschiedener die Verbindungen zu ihrem Geburtsland gekappt, das sie als ein Sammelbecken unwürdiger Nichtsnutze betrachtete, Leute, die grundlos stolz waren und zugleich aus vielerlei Gründen frustriert. Ebenso heftig kritisierte sie den britischen Lebensstil, unter dem sie als Tochter kubanischer Diplomaten in London gelitten hatte, inmitten von Leuten, die beim Reden so grotesk den Mund verzogen, »dass er aussah wie ein Hühnerarsch«, und auf diese Weise die Sprache malträtierten, die sie selbst geschaffen hatten. Und New York? Na ja, das war nicht übel, aber so umwerfend auch wieder nicht. Das Wetter, Dreck und Drogen überall, und diese ständige Großtuerei …
Obwohl Adelas Mutter also gegen fast alles revoltierte, selbst ihre familiäre Herkunft, drängte sie ihre Tochter dazu, sich anzupassen. Sie sprach vorzugsweise Englisch mit ihr, mit dem britischen Akzent, den sie nie ganz abgelegt hatte oder nie hatte ablegen wollen, und ließ sie nordamerikanische Schriftsteller lesen. Sie vermittelte ihr das Gefühl, der angelsächsischen Kultur anzugehören – allerdings befreit von den religiösen und moralischen Traditionen, die sie als heuchlerisch bezeichnete. Darüber hinaus versuchte sie, ihr andere – edlere, wie sie erklärte – Formen der Weisheit wie etwa den Buddhismus nahezubringen. Sie hatten nun einmal das Glück, in New York zu leben, und mussten das Beste daraus machen, obgleich einem hier, wo es alles gab, nichts geschenkt wurde, wie sie zu sagen pflegte. Über Kuba dagegen weigerte sie sich, auch nur zu reden.
Zum Glück sprach Adela dank der Hartnäckigkeit ihres Vaters ein korrektes Spanisch, wenn auch manchmal mit einem leichten Buenos-Aires-Akzent. Weil sie sich mit dem Schreiben anfangs ein wenig schwergetan hatte, wählte sie an der Schule absichtlich Spanisch als ein Hauptfach. Zusätzlich stürzte sie sich, und sei es nur aus Widerspruchsgeist, auf eigene Faust auf Romane und Geschichtsbücher, die von der Insel ihrer Vorfahren mütterlicherseits handelten, über die sie bis auf die unabänderlich harschen und abschätzigen Urteile ihrer Mutter kaum etwas wusste. Sobald sie alt genug war, ging sie zu Konzerten, bei denen Musiker und Tänzer aus allen Ländern Lateinamerikas zusammenkamen, unter denen sich jedes Mal auch der eine oder andere Kubaner einfand. Ihre engste Freundin war ein gleichaltriges Mädchen mit Namen Anisley, die mit elf aus Kuba nach New York gekommen war und die Adela kubanischer als die berühmte Guantanamera vorkam, die viel besungene Bäuerin aus Guantánamo.
Anisleys Vater war Baseball- und Softball-Trainer, die Mutter Kinderärztin. Sie konnte in den USA aber nur als Krankenschwester arbeiten. Die beiden lehrten Adela kubanische Lebensart. Hinzu kam ein Intensivkurs mit einem Vetter von Anisley, mit dem Adela ein paar Wochen herumknutschte, bevor sie pflichtgemäß, wenn auch mit sechzehn Jahren relativ spät, gemeinsam die Unschuld verloren, Adela allerdings mehr aus Neugier denn aus Leidenschaft. An den Wochenenden, die sie glücklich bei der Familie ihrer Freundin in Queens verbrachte, wurde sie in die feinsten Verästelungen von Haltungen, Denkweisen und Redewendungen eingeführt und mit der komplexen Struktur einer Gesellschaft vertraut gemacht, die – so ihre Gastgeber – sie ins Exil getrieben hatte.
Im Gegensatz zu den Rundumschlägen ihrer Mutter und der verstockten Weigerung der Politiker in Miami oder New Jersey, dem neuen Kuba auch nur einen Funken Verständnis entgegenzubringen, zeigte Anisleys Familie, dass man die Sache auch differenziert angehen konnte. Sosehr sie das neue System ablehnten, waren sie insgeheim doch dankbar für die Möglichkeiten, die sich ihnen zunächst innerhalb und, später dann, erst recht außerhalb ihres Landes geboten hatten. Denn Kubaner genossen aus politischen Gründen Vorteile, die den meisten anderen lateinamerikanischen Emigranten in den USA verwehrt blieben, diesem Land der Wunder, in dem sie nun lebten und kämpften …
Mit größter Selbstverständlichkeit zelebrierten diese Leute ihre Zugehörigkeit zu ihrer Gemeinschaft. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit bekräftigten sie es, etwa durch die Art, wie sie schwarze Bohnen zubereiteten oder das Lied von den ebenso schwarzen Tränen sangen, das durch das Trío Matamoros berühmt geworden war. Oder indem sie keine Gelegenheit ausließen, sich bei einem der vielen New Yorker Filmfestivals neue Produktionen aus Kuba anzusehen. Oder durch die Lektüre zeitgenössischer kubanischer Schriftsteller. Oder auch, indem sie sich gemeinsam halb totlachten bei den Radiosendungen des Komikers Guillermo Álvarez Guedes, in dessen schelmischen Geschichten die Kubaner stets durch ihren Einfallsreichtum wie auch ihre unflätige Ausdrucksweise hervorstachen. Außerhalb der eigenen vier Wände lebte Anisleys Familie, genau wie viele ihrer ebenfalls kubanischen Freunde, das offene und multikulturelle Leben New Yorks, zu Hause jedoch oder wenn sie zu Festen zusammenkamen, suchten diese Leute ihre eigenen Wurzeln zu behalten, ganz so, als befänden sie sich immer noch auf ihrer längst verlorenen Insel. Warum blieb die Welt, von der ihre Mutter berichtete, dagegen so ungreifbar, nebulös und verschwommen? Das fragte sich die junge Adela immer wieder.
In der Gesellschaft dieser Kubaner, die so glühend ihre Eigenheiten bewahren wollten, lernte Adela auch deren Religion besser verstehen. Sie kam ohne Gott aus, hatte dafür jedoch einen Apostel, der nicht nur José hieß wie der biblische Urvater, sondern auch ein dichtender Prophet oder prophetischer Dichter war. Adela konnte gar nicht anders, sie bewunderte Anisley und die Ihren, die unbedingt bleiben wollten, wie sie seit jeher gewesen waren. Dabei war sie sich aber auch sicher: Sie konnte es ihnen nicht einfach nachtun, dafür fehlte ihr schlichtweg etwas – oder aber sie hatte zu viel anderes in sich.
Als sich schließlich die Frage stellte, an welcher Universität sie sich einschreiben solle, teilte Adela ihrer Mutter, ohne zu zögern, mit, dass sie einen Bachelorstudiengang an der Florida International University belegen wollte. Dort hatte man ihr aufgrund ihrer hervorragenden Noten ein Stipendium angeboten, das ein Drittel der Studiengebühren abdeckte.
Für die Mutter war das natürlich eine Kriegserklärung. Der Vater erklärte sich alsogleich für neutral, sicherte jedoch zu, Adela finanziell zu unterstützen. Die Mutter versuchte verzweifelt, die Tochter von diesem Irrweg abzubringen, und überredete sie, ein paar Tage mit ihr auf dem wunderschönen Gestüt bei Tacoma zu verbringen, wo sie inzwischen lebte und arbeitete. Dort kam es nach einer viertägigen Waffenruhe, als Adela bereits zu hoffen wagte, für diesmal unversehrt davonzukommen, doch noch zu einem sehr unschönen Streit, in dessen Folge Adela von ihrer Mutter eine ziemliche Weile nicht mehr Cosi genannt, sondern als »Adela Fitzberg« tituliert wurde. Doch die junge Frau bewies eine Charakterstärke, die niemand ihr zugetraut hätte. Sie überstand den Hurrikan Stärke fünf, den Loreta Fitzberg – oder kam hier die alte Loreta Aguirre Bodes wieder zum Vorschein? – entfesselte, indem sie ihre Tochter mit Argumenten überschüttete, die Adela überzeugen sollten, dass sie sich in diesem politischen und kulturellen Misthaufen mit Namen Miami unweigerlich selbst in einen Haufen Mist verwandeln würde.
Im September 2007, zwei Monate nach diesem bitteren Streit, stieg Adela in der Southwest 35th Street im Stadtteil Westchester von Miami vor dem Haus von Miguel und Nilda Vasallo aus dem Taxi. Hier würde sie wohnen, bis sie ihr Zimmer im Studentenheim beziehen konnte. Die beiden Sechzigjährigen warteten schon am Eingang des Haupthauses und boten ihr zur Begrüßung einen selbst gemachten Guavensaft, einen ebenfalls selbst gemachten köstlich süßen Flan und einen – bereits gesüßten – frisch gebrühten kubanischen Kaffee an. Sie machten Adela klar, dass sie nicht nur eine wunderschöne Unterkunft bezog, sondern dass diese Unterkunft sich in einem wunderschönen Viertel einer wunderschönen Stadt in einem wunderschönen Bundesstaat befand. Sie überreichten ihr die Schlüssel der Gästewohnung, ohne zu unterlassen, auf sehr kubanische Art und Weise mehrfach zu wiederholen, dass ihr Haus – das Haus von Miguel und Nilda Vasallo – ab sofort auch Adelas Haus war.
Adela parkte ihren Toyota Prius an der Ecke West 53rd Terrace und West 10th Avenue. Dort hatten sie und Marcos vor einigen Monaten ziemlich günstig ein Haus angemietet, dessen Besitzer, die letzten in der Gegend verbliebenen weißen US-Amerikaner, in ein »ruhigeres« Viertel fortgezogen waren. Das ein wenig heruntergekommene Anwesen sah inzwischen dank Marcos’ Anstrengungen wieder recht akzeptabel aus. Der Vorgarten, um den Marcos sich ebenfalls kümmerte – was die Miete noch ein wenig günstiger machte –, blitzte im wiedererstarkten Sonnenschein, der keine zehn Minuten nach dem Regen der feuchten Erde schon wieder wabernde Dämpfe entlockte. Hialeah mit seinen Einfamilienhäusern, Giebeldächern und meist gut gepflegten Gärten war eine Oase inmitten des buntscheckigen kubanischen Gettos, das in fünfzig Jahren hartnäckiger Ausdehnung entstanden war.
Der Marcos’ Auto vorbehaltene Platz in der Auffahrt war leer, ihr Freund war also noch nicht zu Hause. Worüber sie ausnahmsweise Erleichterung empfand, sie wollte erst einmal eine Weile allein sein, ungestört einen Kaffee trinken und danach die Zigarette rauchen, die sie sich in weiser Voraussicht von Yohandra erschnorrt hatte, als sie die Bibliothek verließ. Bevor sie ins Haus ging, richtete sie das Schild mit dem Foto von Hillary Clinton wieder auf, das der Sturm, vielleicht aber auch ein fanatischer Anhänger der Republikaner umgeworfen hatte. Adela war sich darüber im Klaren, dass das Plakat für manche Leute ein Ärgernis darstellte, doch im Land der Meinungsfreiheit wollte sie sich diese keinesfalls nehmen lassen, auch wenn sie mit ihrer Hoffnung auf einen Sieg der Demokraten bei den Wahlen im November in dieser Gegend wohl ziemlich allein dastand. Marcos, der daran gewöhnt war, dass bei solchen Fragen andere für ihn entschieden, hatte verkündet, ihm sei egal, wer ins Weiße Haus einziehe, Hauptsache, er mische sich möglichst wenig in sein Leben ein.
Im Haus stellte sie sofort die Klimaanlage an und ging ins Bad, wo sie feststellte, dass ihr Slip, wie erwartet, Blutflecken aufwies. Sie steckte ihre gesamte Kleidung in einen Beutel, wusch sich gründlich – es war ihr schon immer unangenehm gewesen, ihre Tage zu haben – und führte einen extra starken Tampon ein. Auf diese Weise in ihrem weiblichen Selbstgefühl etwas reduziert, stellte sie sich vor den an der Badezimmertür befestigten Spiegel und musterte ihren nackten Körper, die breiten Hüften, den dunklen, dicht behaarten und zugleich sorgfältig zurechtgestutzten Schamhügel, die kleinen straffen Brüste mit den zimtfarbenen Warzen, den glatten Bauch, die festen Oberschenkel und, sich ein wenig umwendend, die prallen Pobacken. Marcos sagte, er finde sie schön, ließ sie nackt durchs Haus laufen, und behauptete, gewiss gebe es in ihrem Blut »einen Anteil schwarzer Blutkörperchen«, von irgendeiner dunkelhäutigen Großmutter, der sie, neben anderen attraktiven Eigenschaften, auch die vollen Lippen und den knackigen Hintern verdanke. Als wollte sie diese Theorie überprüfen, fuhr Adela sich mit der Hand über die vorspringenden Rundungen, die ihr seit dem Einsetzen der Pubertät so viele begehrliche Blicke beschert hatten.
Nur mit knappen Shorts und einem dünnen T-Shirt bekleidet, machte sie sich anschließend einen Espresso und setzte sich damit auf die Terrasse, deren Dach Marcos ebenfalls vor Kurzem repariert hatte. Sie durchwühlte die Schale voller Muscheln und Schneckenhäuser, bis sie das vor Monaten dort deponierte Feuerzeug fand, und zündete sich die Zigarette an. Auf einmal wurde ihr bewusst, wie verspannt ihre Schultern waren, und auch das dumpf drückende Gefühl im Unterleib, das sie mindestens während der nächsten vierundzwanzig Stunden begleiten würde, verstärkte sich. Da sprang sie, von einem plötzlichen Drang getrieben, auf, ging noch einmal ins Wohnzimmer und entnahm dem Kästchen mit der Notreserve einen schlanken Joint, den sie, wieder auf der Terrasse, entzündete, kaum dass sie die Zigarette zu Ende geraucht hatte.
Die Spannung, die sich während der eineinhalbstündigen Autofahrt aufgebaut hatte, ließ nach, sie genoss die friedliche Ruhe, die sich in ihr ausbreitete. Die Last der schlechten Gefühle, die das morgendliche Telefonat noch gesteigert hatte, fiel von ihr ab. Hatte die Mutter wirklich angerufen, weil sie über das kranke Pferd sprechen wollte? Oder war da noch etwas anderes, vielleicht noch Unangenehmeres? So wie sie ihre Mutter zu kennen glaubte, wäre das durchaus denkbar.
Gedankenverloren zog Adela am Joint, bis die Hitze der Glut an ihren Fingern sie aus dem Dämmer riss. Sie brachte den Stummel im Rest ihres Kaffees zum Erlöschen und sah sich nach einer Stelle um, wo sie ihn verschwinden lassen konnte, obgleich ihr klar war, dass der Geruch sie verraten und sie sich Marcos’ Vorwürfe würde anhören müssen, weil sie sich nicht an ihre Absprache gehalten hatte, diese Glimmstängel nur zu besonderen Anlässen zu rauchen, um sich gemeinsam zu vergnügen.
Sie schämte sich für ihre Schwäche. Und hatte auf einmal das seltsame Gefühl, sich von außen zu sehen – eine junge Frau, die Marihuana rauchte, aber nicht, weil sie es brauchte, sondern weil sie allein sein wollte, obwohl sie wusste, dass sie sich in guter Gesellschaft befand. Die mit Überzeugung ihre Zukunft plante, jedoch in einer zäh sich hinziehenden Gegenwart feststeckte. Sie und ihr Gegenstück, sie und ihre Doppelgängerin. Was, zum Teufel, war los mit ihr? Was beunruhigte sie? Und vor allem, wovor hatte sie Angst? Vor dem Gnadenschuss für ein krankes Pferd? Oder ging es um die Tatsache, einen so komplizierten Menschen zur Mutter zu haben? Oder fürchtete sie, einen Fehlentscheid für ihre berufliche, akademische und wirtschaftliche Zukunft gefällt zu haben? Sie wusste es nicht. Nein, dachte sie schließlich, sie würde sich keine Fragen mehr stellen und keine Erklärungen für die wachsende Unruhe suchen, die sie seit dem Morgen erfasst hatte.
Da nahm sie einen starken Geruch nach Erde und Schweiß wahr. Und hörte gleich darauf eine Stimme: »Du hast geraucht, alte Kifferin!«
Der erste große Traum, der in Marcos Martínez Chaples Leben unerfüllt blieb, war es, ein berühmter Baseballspieler zu werden. Ein sehnlicher Wunsch, den er mit dermaßen vielen Kubanern teilte, dass man von Scheitern hier eigentlich nicht sprechen konnte – viel zu groß war die Zahl derjenigen, die die gleiche Niederlage hinnehmen mussten, und viel zu gering die derjenigen, deren Traum sich erfüllte. Im Lauf der Jahre sollten noch andere Abstürze und Misserfolge dazukommen. Verglichen mit dem, was andere Menschen um ihn herum durchmachen mussten, die auf den verschiedensten Gebieten schwer gebeutelt wurden, kamen sie ihm aber geradezu vernachlässigenswert vor. Von der Enttäuschung abgesehen, verdankte Marcos dem Baseball jedoch viele seiner schönsten Erinnerungen sowie einen antrainierten Kampfgeist, der ihn zeitlebens begleiten und ihm so manche Tür öffnen sollte.
Er war in den Jahren der verheerenden Wirtschaftskrise herangewachsen, die um 1990 eingesetzt hatte, und hatte die wachsenden Nöte durch den Abstieg des Landes am eigenen Leib erfahren – die ständigen Stromausfälle, dass es manchmal an einem ganzen Tag nicht mehr als ein Stück säuerliches trockenes Brot zu essen gab, oder einfach dieses ständige Gefühl von Überhitzung und Erschöpfung. Vor allem jedoch litt er unter der schier unüberwindlichen Schwierigkeit, Bälle für seinen heiß geliebten Sport aufzutreiben.
Eine seiner Lieblingserinnerungen aus jener dunklen Zeit war der Tag, an dem er, Marcos Martínez Chaple, eine Partie zwischen der Mannschaft aus seinem Viertel und dem so mächtigen, um nicht zu sagen, übermächtigen Gegner aus Boyeros entschied. Die beiden Teams waren schon x-mal gegeneinander angetreten, und fast immer hatte die Neun aus Boyeros gewonnen. Doch diesmal standen die Sterne günstig, und kurz bevor der Gegner einen erneuten Sieg einfuhr, betrat Marcos die Batter’s Box. Zwei Rundowns und zwei Outs sprachen zu diesem Zeitpunkt bereits gegen seine Mannschaft, er war folglich, wie man so sagt, ihre letzte Hoffnung. Woher er in diesem Augenblick die Kraft, Koordinationsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit nahm, konnte Marcos sich später nie erklären, er führte jedenfalls einen Swing gegen den mit voller Wucht auf ihn zufliegenden Ball aus und traf ihn so perfekt mit seinem Schläger, dass die mit Leder umhüllte Kugel im Gegenschlag bis weit über die Büsche hinausflog, die das Spielfeld begrenzten. Sieg für sein Team! Es war wie im Himmel.
Noch zwanzig Jahre später war Marcos imstande, wenn er die Augen schloss und sich konzentrierte, diese gnadenerfüllte Mikrosekunde zu durchleben. Wieder hörte er dann den Aufprall des Balles, spürte die Vibration, die sich durch das Holz des Schlägers auf seine Arme übertrug, und sah, wie die Kugel davonflog, immer höher stieg und schließlich in der Ferne verschwand. Ein Zustand vollkommener Glückseligkeit, überbordenden Jubels und durch nichts getrübter Zufriedenheit mit sich und der Welt. Für einen Augenblick überschritt er die Schwelle zum Land seiner Träume, das sich schon bald wieder in Luft auflösen sollte.
Auf einem ungenutzten Stück Land an der Ausfahrt aus Fontanar, ganz in der Nähe des Elternhauses, hatte er die ersten Schritte zur Erfüllung seines großen Baseballtraums unternommen. Hier trafen sich schon seit Jahren die Jungen aus den angrenzenden Vierteln zum Spielen. Bis eines Tages – Marcos absolvierte damals bereits den Vorbereitungskurs für den Übertritt in die Universität – jemand auf die Idee kam, ausgerechnet diese Fläche umzupflügen, um irgendwelche aus Argentinien importierte Knollen anzupflanzen, die angeblich reich an Proteinen waren und Millionen Stück Rindvieh ernähren sollten, die wiederum die Insel mit Fleisch und Milch »überschwemmen« würden (wie man sich damals in Bezug auf nahezu alles ausdrückte). Wie so oft gab es am Ende weder ein Baseballfeld noch irgendwelche Knollen und erst recht keine Viehschwemme. Im Gegenteil, wie Onkel Horacio, ein Freund seiner Eltern, es formulierte, gehörten Kühe inzwischen auf Kuba zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten, was zumindest gut für den Cholesterinspiegel der Nation war.
Die begabtesten Baseballeleven landeten mit etwas Glück bei einem der Trainer, die auf dem Gelände gleich beim psychiatrischen Krankenhaus von Havanna arbeiteten. Hier stand ein richtiges Stadion, wo Turniere abgehalten wurden und Mannschaften unterschiedlicher Alters- und Qualitätsstufen einander abwechselten. Marcos sollte nie vergessen, wie bei einem der Trainings, an denen er dort teilnehmen durfte, auf einmal ein ernst dreinblickender kräftiger Mulatte mit kahl geschorenem Schädel auftauchte. Sie erkannten den Mann sofort, hatten sie doch seit Jahren im Fernsehen seine Auftritte inner- und außerhalb Kubas bewundert, bald im Trikot der Industriales, bald im Nationaltrikot, aber stets mit der Rückennummer 26. Mit vor Staunen offen stehenden Mündern verfolgten sie, wie kein Geringerer als Orlando Hernández, der inzwischen in Ungnade gefallene »Duque«, zu dem gerade anwesenden Trainer trat, der Jahre früher sein Lehrer gewesen war, und sich leise mit ihm unterhielt. Später erfuhren sie: Der einstige Olympiasieger und bis zu seinem erzwungenen Abschied erfolgreichste kubanische Baseballspieler aller Zeiten – er hatte wegen angeblicher Fluchtpläne aufhören müssen, oder auch, wie andere sagten, weil man ihm unterstellte, gewusst zu haben, dass sein Bruder sich während eines Mexikoaufenthaltes absetzen würde – bat um die Erlaubnis, mit ein paar Freunden auf dem Gelände spielen zu dürfen, wenn alle anderen fertig seien. Woraufhin sein ehemaliger Lehrer, aus Angst vor möglichen Folgen, erwiderte, dass er darüber erst mit seinen Vorgesetzten sprechen müsse.
Mit sechzehn musste Marcos sich eingestehen, dass er trotz seiner hoch aufgeschossenen und drahtigen Gestalt nicht einmal genug Talent hatte, um bei der Jugendmannschaft seines Viertels mitzuspielen. Doch das tat seiner Liebe zum Baseball keinerlei Abbruch. Seine Begeisterung nahm allerdings eine andere Form an, bei der es auch nach seiner Ankunft in den USA bleiben sollte – er lebte sie als Zuschauer oder Helfer am Spielfeldrand aus.
Nach dem ersten halben Jahr in Hialeah hatte sich seine wirtschaftliche Lage so weit gefestigt, dass er sich die Zeit nehmen konnte, montags, mittwochs, freitags und samstags jeweils zwei Stunden am späten Nachmittag in einem Fitnessstudio gleich bei der Westland Mall zu trainieren, umsonst, da dort ein ehemaliger Baseballkollege aus Fontanar arbeitete, der ihm eine kostenlose Gästekarte beschafft hatte. Dienstags und donnerstags wiederum war er, zur selben Uhrzeit, und manchmal auch noch am Sonntagvormittag, als Hilfstrainer der Baseballmannschaft der Tigres de Hialeah im Einsatz. Der eigentliche Trainer und die Seele des Teams war kein Geringerer als Agustín Casamayor, einst First Baseman der Industriales, der, auch wenn seine Karriere damals schon ihren Zenit überschritten hatte, ebenfalls zu Marcos’ Kindheitsidolen gezählt hatte.
Das Trainingsgelände lag zwischen wenig ansehnlichen Wohnblocks an der West 76th Street. Casamayor hatte sein Projekt für zehn- bis vierzehnjährige Jungen nicht nur ins Leben gerufen, um ihnen auf korrekte beziehungsweise »wissenschaftliche« Weise – wie er es nannte – die Grundregeln dieses Sports und seiner Philosophie beizubringen, vor allem wollte er dazu beitragen, dass sie nicht, weniger vornehmen Versuchungen ausgesetzt, so viel Zeit auf der Straße zubrachten.
Die meisten dieser etwa zwei Dutzend Jungs aus kürzlich eingewanderten Familien konnten sich einen regulären Sportverein nicht leisten. Ihre kubanischen Väter und Mütter arbeiteten oftmals bis in den Abend hinein, während die Kinder sich die Zeit zu Hause vor dem Computer oder aber auf Streifzügen durchs Viertel vertrieben, wo sie nur zu leicht auf Abwege gerieten. Mit der Unterstützung mehrerer bei US-Vereinen tätiger kubanischer Spieler und einiger bessergestellter Eltern hatte Casamayor die nötige Ausrüstung besorgt und sogar von einer der wenigen Textilfabriken, die es vor Ort noch gab, Trikots anfertigen lassen. Als Marcos dazustieß, spielte das Team bereits in einer der unteren Kreisligen, nicht übermäßig erfolgreich, aber dennoch mit großer Leidenschaft und vom Trainer befeuertem Stolz darauf, die ärmste Gegend der »Stadt des Fortschritts« zu vertreten, die schon bessere Zeiten gesehen hatte.
Während Marcos sich als ehrenamtlicher Jugendtrainer betätigte, lebte nicht nur seine alte Baseballleidenschaft wieder auf, er konnte auf diese Weise auch hervorragend von all den Belastungen entspannen, die das Ein- und Überleben in einer Welt mit sich brachte, die ihm ständiges Zähnezusammenbeißen und Wachsamsein abverlangte. Sobald er die Baseballhose anzog, in seine Spikes schlüpfte – die besten, die er je besessen hatte –, das weiße, fast immer übel riechende und verdreckte Oberteil mit den orangefarbenen Ärmeln überstreifte, die Mütze aufsetzte und das rötliche Gras des Spielfelds betrat, hatte er das Gefühl, in eine andere Welt einzutauchen. Hier war das Leben wohltuend einfach, man musste nur so gut wie möglich tun, was es auf einem Baseballfeld zu tun gibt, also laufen, werfen, schlagen, fangen und, vor allem, denken wie ein richtiger Baseballspieler. Und seine Schüler hatten ja auch seinen einstigen Traum: große Spieler zu werden, Stadien zu füllen und sich dafür feiern zu lassen, dass sie mit vollendeter Meisterschaft fortführten, was so viele Kubaner schon seit mehr als hundert Jahren betrieben. Und vielleicht würde es dem einen oder anderen ja sogar gelingen, diesen Traum zu verwirklichen und ein Baseballkönig zu werden wie der Duque, mehrfacher kubanischer Meister, Gewinner einer Goldmedaille bei der Olympiade und, nach seiner Flucht von der Insel, triumphaler Sieger in den großen US-amerikanischen Baseballligen.
Nach einem der ersten Trainings lud Casamayor Marcos auf ein Bier zu sich nach Hause ein. Am Sonntag davor waren seine Söhne zu Besuch gewesen, ein paar Flaschen hatten ihren Ansturm jedoch ungeöffnet überlebt.
»Weißt du, dass meine Jungs keine Lust haben, Baseball zu spielen?«, gestand der Trainer, als er Marcos eine Flasche Corona hinhielt. Sie saßen auf dem winzigen Balkon von Casamayors Wohnung. Von dort aus sah man einen auf der anderen Straßenseite liegenden ebenso klotzigen Wohnblock, der allerdings in noch schlechterem Zustand war. Auf den Balkons waren Wäscheleinen aufgespannt, die Wände bröckelten, und die Grünanlagen wirkten völlig vernachlässigt. Insgesamt war das Gebäude so hässlich und heruntergekommen wie die Häuser, die Marcos’ Architektengroßeltern in Fontanar entworfen hatten.
»Manchmal gehen die Kinder eben eigene Wege«, war das Einzige, was Marcos dazu einfiel.
»Das Problem ist, dass sie auch sonst zu kaum etwas Lust haben. Trotzdem wollen sie tausend Dinge besitzen, und zwar sofort. Sie haben keine Ahnung vom Leben. Sie haben die Regeln nicht kapiert. Selbst der, der Ingenieur ist, so wie du. Sie haben ihm hier sein Diplom nicht anerkannt, und da er sich gut mit Computern und diesem Zeug auskennt, kopiert er jetzt Kreditkarten, um sich damit Sachen zu beschaffen und sie anschließend privat weiterzuverkaufen.«
Marcos sagte lieber nichts und nickte bloß. Er hatte Casamayors Sohn schon mehrfach geklautes Benzin abgekauft.
»Und bei dir läufts gut?«, fragte Casamayor.
»Ich kann mich nicht beklagen. Schließlich bin ich erst seit Kurzem hier.«
»Hast du vor, dir wieder ein Diplom zu besorgen?«
»Vorläufig geht das nicht, ich müsste noch mal ganz von vorn anfangen. So viel Zeit und Geld habe ich nicht. Die Universitäten hier sind Mist. Das funktioniert bei den Amis nicht wie auf Kuba. Hier kostet dich ein Abschluss ein Schweinegeld.«
Casamayor nickte, trank einen Schluck und starrte zu dem anderen Wohnblock hinüber. »Zum Kotzen, noch einer, der Ingenieur ist, aber nie als Ingenieur arbeiten wird. Wie viele Ärzte und Ingenieure deines Alters sind wohl schon aus Kuba weggegangen?«
»Ich schätze mal, die Hälfte von denen, die mit mir studiert haben. Mein Bruder ist weg, bevor er den Abschluss gemacht hat. Er hat in Frankreich zu Ende studiert, der Schuft.«
Casamayor schwieg nachdenklich und sagte schließlich: »Warum bist du aus Kuba weg, wenn ich fragen darf? Heutzutage machen sich ja alle davon, irgendeinen Grund hat jeder, aber du?«
»Ich musste einfach … Na ja, ich wollte ein eigenes Haus und ein Auto, und all das kannst du dort bekanntlich vergessen.«
»Ja, das kann ich verstehen. Ich bin gegangen, als meine Kinder weg sind. Sie wollten auch ein Haus und ein Auto. Unbedingt, ein Haus und ein Auto. Aber du bist anders, das merke ich.«
»Nein, Casamayor, ich bin nicht anders. Ich bin auch nur ein Kubaner, der in Hialeah gelandet ist und …«
»Warum trainierst du mit den Jungs? In der Zeit könntest du Geld verdienen oder studieren.«
Das Gespräch schlug eine Richtung ein, die Marcos nicht gefiel. Immer wenn jemand so viele Fragen stellte, spürte er einen Druck im Bauch. Ob er das von seinem Vater geerbt hatte? Der war berühmt für seinen Verfolgungswahn. Oder hatte er sich bei Irving angesteckt, dem besten Freund seiner Mutter, der ständig Angst hatte? Der behauptete sogar, er werde vom Geheimdienst überwacht. Aber er, Marcos, war ja völlig harmlos, sagte er sich. Alles lag offen zutage, er konnte eigentlich mit jedem darüber sprechen.
»Ich brauche Geld, wie jeder. Und ich hab auch gern Geld, das geht allen so. Aber immer nur ranklotzen, von früh bis spät, das ist nichts für mich. Ich möchte auch was mit anderen machen, oder für andere, das ist das Beste, was meine Mutter mir beigebracht hat. Die Ärmste, sie ist die letzte Romantikerin der Welt. Dabei bin ich eigentlich nicht wie sie, ganz und gar nicht. Ehrlich gesagt, komme ich vor allem meinetwegen zum Training, nicht nur wegen dir oder den Jungs, verstehst du? Einmal habe ich einen Film gesehen, da hat ein Mann zu seinem Sohn gesagt: Ein Baseball, der steht eigentlich für die ganze Welt. Und als ich das gehört habe … Na ja, wenn du das nicht kapierst, ist es auch egal, ich kapiers vielleicht selbst nicht. Auf dem Platz fühl ich mich jedenfalls gut, da ist mir der Rest scheißegal … Und jetzt gib mir noch ein Bier und mach mich nicht verrückt mit diesen Fragen. Reden wir lieber über Baseball, einverstanden? Ich hab dir, glaube ich, noch nie von dem Homerun erzählt, mit dem ich mal ein Spiel entschieden habe. Ich war damals zehn, und ich spüre bis heute, wie ich damals drauflosgedroschen habe, das schwöre ich dir!«
Zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Im Norden, Süden, Westen und Osten. Über die Floridastraße, die Niagarafälle, die mexikanische Grenze, oder via Moskau und dann über die Beringstraße und durch das verschneite Alaska … In den letzten Jahren, die er in Havanna zubrachte, verwandelte Marcos, der Schlaufuchs, sich in eine wandelnde Enzyklopädie sämtlicher Methoden und Tricks, mit deren Hilfe ein Kubaner in die USA gelangen und den Status erlangen konnte, der es nach einem Jahr und einem Tag ermöglichte, die unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. So viele seiner Freunde hatten es schließlich auf die eine oder andere Weise versucht und oftmals auch geschafft.