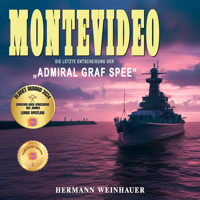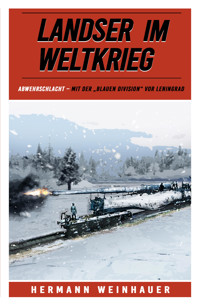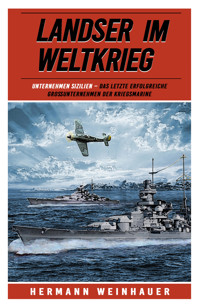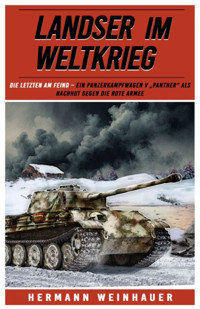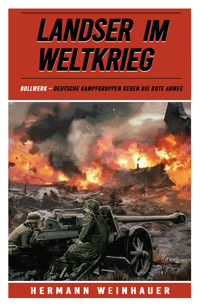2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Militär
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band „Stuka” beschreibt in nervenaufreibender Form die dramatischen Einsätze deutscher Sturzkampfbomber 1940.
Der junge Leutnant Hans Dampf ist durch zahlreiche Einsätze über Polen und nun auch gegen Frankreich kampfgewohnt. Doch die, nun folgenden Einsätze verlangen ihm und seinen Kameraden das Letzte ab. Im Himmel über Frankreich lauern die alliierten Jagdmaschinen und auch am Boden stellt die feindliche Flak eine tödliche Bedrohung dar.Wird es den jungen Flugzeugbesatzungen gelingen, den Feind letztendlich zu schlagen und den Feldzug siegreich zu beenden, oder werden die Stukas der geballten Abwehr des Gegners unterliegen?
Über die Reihe „Landser im Weltkrieg“ „Landser im Weltkrieg“ erzählt fiktionale Geschichten vor historischem Hintergrund realer Schlachten und Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Im Zentrum stehen die Erlebnisse deutscher Landser fernab der großen Strategien am grünen Tisch.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hermann Weinhauer
Landser im Weltkrieg
Stuka – Mit der Ju 87 gegen die Alliierten
EK-2 Militär
Über die Reihe Landser im Weltkrieg
Jeder Band dieser Romanreihe erzählt eine fiktionale Geschichte, die vor dem Hintergrund realer Ereignisse und Schlachten im Zweiten Weltkrieg spielt. Im Zentrum der Geschichte steht das Schicksal deutscher Soldaten.
Wir lehnen Krieg und Gewalt ab. Kriege im Allgemeinen und der Zweite Weltkrieg im Besonderen haben unsägliches Leid über Millionen von Menschen gebracht.
Deutsche Soldaten beteiligten sich im Zweiten Weltkrieg an fürchterlichen Verbrechen. Deutsche Soldaten waren aber auch Opfer und Leittragende dieses Konfliktes. Längst nicht jeder ist als glühender Nationalsozialist und Anhänger des Hitler-Regimes in den Kampf gezogen – im Gegenteil hätten Millionen von Deutschen gerne auf die Entbehrungen, den Hunger, die Angst und die seelischen und körperlichen Wunden verzichtet. Sie wünschten sich ein »normales« Leben, einen zivilen Beruf, eine Familie, statt an den Kriegsfronten ums Überleben kämpfen zu müssen. Die Grenzerfahrung des Krieges war für die Erlebnisgeneration epochal und letztlich zog die Mehrheit ihre Motivation aus dem Glauben, durch ihren Einsatz Freunde, Familie und Heimat zu schützen.
Prof. Dr. Sönke Neitzel bescheinigt den deutschen Streitkräften in seinem Buch »Deutsche Krieger« einen bemerkenswerten Zusammenhalt, der bis zum Untergang 1945 weitgehend aufrechterhalten werden konnte. Anhänger des Regimes als auch politisch Indifferente und Gegner der NS-Politik wurden im Kampf zu Schicksalsgemeinschaften zusammengeschweißt. Genau diese Schicksalsgemeinschaften nimmt »Landser im Weltkrieg« in den Blick.
Bei den Romanen aus dieser Reihe handelt es sich um gut recherchierte Werke der Unterhaltungsliteratur, mit denen wir uns der Lebenswirklichkeit des Landsers an der Front annähern. Auf diese Weise gelingt es uns hoffentlich, die Weltkriegsgeneration besser zu verstehen und aus ihren Fehlern, aber auch aus ihrer Erfahrung zu lernen.
Nun wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen mit dem vorliegenden Werk.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis zu bieten.
Damit uns dies gelingt, sind wir sehr an Ihrer Meinung interessiert. Haben Sie Anregungen für uns? Verbesserungsvorschläge? Kritik?
Schreiben Sie uns gerne: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Heiko und Jill von EK-2 Militär
Horst Meier liegt auf dem Rücken in der Sonne und visiert mit einem Auge über einen Grashalm die Wolken an, die über den Himmel segeln. Wenn er eine richtig im Visier hat, dann macht er mit den Lippen »Prrrrr« und schießt die Wolke ab. Er spielt Luftkampf, und der Grashalm ist das Fadenkreuz seines Maschinengewehrs. Woraus zu ersehen ist, dass Horst im Augenblick nichts anderes zu tun hat, als sich die Sonne auf den Leib scheinen zu lassen. Der Uniformrock dient als Unterlage für seinen Kopf. Er befindet sich auf einer Wiese dicht am Ufer eines Flusses.
Vom Fluss her hört er hin und wieder Stimmen, und dann denkt er auch wohl an die beiden Männer, die sich dort im Wasser tummeln. Das sind zwei hochwichtige Leute für den Gefreiten Horst Meier. Der eine ist nämlich sein Leutnant und Flugzeugführer. In seinem Soldbuch steht der Name Heinz Dampf, aber schon als er noch Fähnrich war, hatten seine Kameraden das klangähnliche »Hansdampf« daraus gemacht, was ganz ausgezeichnet zu ihm passt. »Hansdampf« ist als Name so bekannt und geläufig bei den Offizieren der Staffel, dass sogar der Gruppenkommandeur gelegentlich fragt: »Was macht denn unser Leutnant Hansdampf?«
Stuka
Der andere Mann, der mit dem Leutnant badet, ist der Hauptfeldwebel, der gefürchtete »Spieß«, beim Heer die »Mutter der Kompanie« genannt, hier also die Mutter der Staffel. Hauptfeldwebel Schneider ist ein Hüne von Gestalt, ein großer und breiter Mann, mit entsprechender Lautstärke. Wenn er vor der Front steht und ein dienstliches Unwetter vom Stapel lässt, dann ist das so, als ob auch dem letzten Mann am linken Flügel des dritten Gliedes ein Hagelschauer bei Windstärke 8 um die Schnauze weht. Gefreiter Meier kennt das. Aber er weiß auch, dass man zu Schneider ruhig mal mit einem persönlichen Anliegen kommen kann. Braucht einer Rat und Hilfe, steht es außer Zweifel, dass Schneider nicht versagt und sich tatkräftig seiner annimmt.
Der sammelt Bäder, denkt Meier und meint damit seinen Leutnant. Denn der Leutnant hatte kürzlich erzählt, er habe im Kattegat an der dänischen Küste gebadet und im Fjord bei Oslo und in einem norwegischen Bergsee, in Brüssel und in der Seine. Nun, da man an der Loire in Frankreich sei, wolle er auf jeden Fall auch hier einmal gebadet haben.
»Nun ja, einer sammelt Briefmarken, der andere Spazierstöcke, der dritte spießt Käfer auf, warum soll ich da nicht Bäder sammeln? Mit jedem Bad bleibt mir die Erinnerung an ein Gewässer und eine Landschaft verbunden, das ist mir mehr wert als meinetwegen Briefmarken«, sagte der Leutnant dabei.
Und überall da, wo der Leutnant gebadet hat, haben sie schließlich auch gekämpft in diesem Krieg, da sind sie überall auch geflogen und haben ihre Bomben geworfen. Jetzt also badet er in der Loire, und Schneider badet mit.
Gerade kommt der Hauptfeldwebel triefend aus dem Wasser, steht am Ufer und blickt sich nach dem Leutnant um, der nicht genug kriegen kann und ein Stückchen stromaufwärts sich nochmals ins Wasser gestürzt hat, um sich mit der Strömung treiben zu lassen.
»Verdimmich, verdimmich«, ruft der Spieß, »bekommen Sie gar nicht genug?«
Die Loire sieht recht sauber aus, und das Baden macht Spaß.
Jetzt steigt auch der Leutnant aus dem Wasser, und bald sitzen sie alle drei splitternackt in der Sonne. »So«, sagt der Leutnant, »die Loire fehlte mir noch gerade in meiner Sammlung. Ein schöner Fluss, was Schneider?«
»Jawoll, Herr Leutnant«, meint der Spieß, »ich überlege gerade, wie man da wohl so’n paar Fische herausangeln könnte, und wenn’s nur was zum Futtern ist.«
»Na, was zum Trinken könnte uns auch nicht schaden! Sie müssen doch immer was zu organisieren haben.«
Der Leutnant lacht, der Gefreite lacht, und der Spieß lacht auch.
»Herr Leutnant, der Schuhmacher sagte, er habe im Weltkrieg einen Kameraden gehabt, der musste in jeden Fluss mal reingespuckt haben, das war nicht so umständlich, wie überall drin zu baden.«
»Aber es macht auch nicht so viel Spaß«, meint der Leutnant lachend.
Noch auf eine Zigarettenlänge liegen die drei im Gras. Schneider schimpft mal wieder Mord und Brand auf die pechschwarzen französischen Zigaretten, die es zur Truppenverpflegung gegeben hat, bis der Leutnant sich schließlich bequemt, den Wink mit dem Zaunpfahl zu verstehen. Er rückt eine von seinen englischen heraus.
»Gruß aus London«, sagt er scherzhaft, als er Schneider die Schachtel hinhält.
»Hoffentlich können wir den Dank bald persönlich drüben abstatten, Herr Leutnant«, meint Schneider und greift zu. Auch der Gefreite kriegt seinen »Sargnagel«, und dann paffen die drei, blinzeln in die Sonne und dösen.
Mal gehen die Gedanken in die Heimat zurück, mal beschäftigen sie sich mit den jüngsten Ereignissen oder der nächsten Zukunft. Das Tagewerk eines Soldaten ist immer auf das abgestellt, was gerade im Augenblick notwendig ist: auf den befohlenen Einsatz.
»Wie geht es Ihrer Frau, Schneider?« fragt der Leutnant plötzlich.
»Danke, Herr Leutnant, es geht ihr gut. Bei uns ist was im Anrollen.«
»So«, lacht Dampf, »das Erste?«
»Jawoll, Herr Leutnant, der Stammhalter hoffentlich.«
»Na, so genau wissen Sie das ja auch noch nicht, mein Lieber«, meint der Leutnant. Dann schweigen die drei wieder und genießen die Muße.
Dass auch Stukaflieger nicht Tag und Nacht nur fliegen und Bomben schmeißen können, ist ja selbstverständlich. Immerhin muss erklärt werden, wie die drei so allein in diese Gegend kommen.
Die Stuka-Gruppe, zu der sie gehören, liegt nämlich etwa 70 Kilometer weiter nordöstlich. Aber der Hauptfeldwebel hatte einen Requirierungsauftrag bekommen, und der Leutnant nutzte die günstige Gelegenheit, um für sich selbst und seinen Bordschützen einen Platz im Kraftwagen zu belegen und sich die Gegend, die sie bisher immer nur überflogen haben, aus der Nähe anzusehen.
»Was ist eigentlich aus dem Abschuss geworden, Herr Leutnant?«, fragt Schneider plötzlich.
»Ja, hat sich was!«, brummt Dampf und rupft mit einem ärgerlichen Ruck einen Grashalm ab. »Der ist uns nicht bestätigt worden. Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn man Meier den Franzmann zugestanden hätte.«
»Ich weiß gar nicht genau, wie die Sache eigentlich gewesen ist«, meint der Spieß und fordert damit gleichsam zum Erzählen auf.
»Meier weiß es noch genauer als ich. Bei dem Einsatz am Donnerstag voriger Woche war es. Wir hatten unsere Eier auf ein paar französische Bunker geschmissen. Auf dem Rückflug war ich hinter der Staffel etwas zurückgeblieben, weil ich erstens nach dem Angriff etwas südlicher weggedrückt hatte als die anderen und weil mir dann im Steigflug der Motor nachzulassen schien und ich ihn schonen wollte. Wir zuckelten hinter den anderen her, sodass wir sie noch sehen konnten, als plötzlich zwei französische Jäger auftauchten und sich von hinten an uns heranschlängelten. Es war am Nachmittag, die Sonne stand schon im Westen, und da wir nach Osten flogen, war es verdammt schwer, die Kerle zu sehen. Meier hatte sie auch erst erkannt, als sie schon ziemlich dicht heran waren. Er brüllte: »Jäger!«, und schoss. Ich flog zunächst noch Kurs, weil ich dachte, sie wären wohl noch nicht so dicht dran. Da spritzten aber schon ein paar Schüsse in die Flächen. Der erste brauste nach seinem Anflug über uns weg und zog dann vor mir hoch. In dem Augenblick nahm ich die Schnauze meiner Kiste auch schon nach oben und jagte ihm eine Garbe nach, die aber kaum mehr treffen konnte. Dann machte ich, dass wir wegkamen. Ich kippte ab, ging im Sturzflug bis dicht an den Boden heran, flog wenige Meter hoch, sprang über ein paar Zäune und Hecken, kurvte ein paar Mal, bis ich schließlich merkte, dass man uns offenbar in Ruhe ließ. Während dieser ganzen Geschichte hatte Meier hinten mehrfach geschossen und ich hörte auch, wie er brüllte ›Den hab‘ ich! Den hab‘ ich!‹
Ich konnte aber nur in einer Linkskurve, die ich im gleichen Augenblick einlegte, sehen, wie ein Jäger hinter uns steil abwärts aus dem Gesichtskreis verschwand. Dann musste ich auf unsere Kiste aufpassen und konnte mich im Augenblick um nichts anderes mehr kümmern. Meier hat das andere natürlich genauer gesehen.«
Während der Erzählung seines Leutnants ist in dem Gefreiten Meier das ganze Erlebnis jenes Fluges wieder so richtig lebendig geworden. Als der Leutnant zu Ende ist, legt er denn auch gleich los.
»Ich hatte die beiden Burschen auch erst ziemlich spät gesehen, weil sie gerade aus der Sonne kamen. Als ich zum ersten Mal schoss, war der nächste vielleicht schon auf 50 Meter ran, der andere kam etwa 100 Meter dahinter. Den ersten kriegte ich nicht mehr. Der hat uns was in die linke Tragfläche gesiebt, war dann aber so dicht ran, dass er abdrehen musste. Mit der Affenfahrt, die er vom Sturzflug hatte, zog er über uns weg. Den zweiten Jäger kriegte ich besser ins Visier. Zwar verschwand er mir einen Augenblick später wieder, weil Herr Leutnant kurz hochzog, aber dann bekam ich ihn wieder rein. Ich schoss, und bevor wir abkippten, konnte ich eine Garbe anbringen. Meiner Meinung nach war der Flugzeugführer getroffen, denn die Maschine torkelte aus dem Kurs und sauste dann über die linke Fläche nach unten. Als wir auch schon im Sturz hinuntergingen, habe ich den Franzosen noch aufschlagen sehen. Der andere Franzmann blieb dann verschwunden!«
»Tolle Kiste!«, meint der Spieß anerkennend.
»Ja, aber eben leider nicht als Abschuss anerkannt, weil ein anderer Augenzeuge fehlte«, sagt Dampf, um dann fortzufahren: »In dieser Hinsicht ist man oben fast zu genau. Keiner bekommt einen Abschuss bestätigt, der nicht auch von Zeugen beobachtet ist.«
Das geht den Jägern ganz genauso. Die haben ja viel öfter mit solchen Sachen zu tun, weil es schließlich ständig ihre Aufgabe ist, feindliche Kisten abzuschießen, während wir das bloß gelegentlich mal so nebenbei machen können.«
»Und mit viel Schwein«, ergänzt Schneider.
»Wat heeßt Schwein«, knurrt Meier in seinem heimatlichen Dialekt, »det war nischt wie kalte Berechnung.«
»Na, nächstes Mal, Meier!«, tröstet der Leutnant und schließt damit die Unterhaltung über den unbestätigten Abschuss. »Nächstes Mal landen wir neben der Klamotte, schneiden die Kokarden aus der Tragfläche und nehmen sie als Beweisstücke mit. Dann wird der Abschuss bestimmt geglaubt. Aber nun los, Meier! Anziehen und rein in den Wagen!«
Nach einer halben Stunde rollt der Kraftwagen in eine Stadt hinein, die zu Friedenszeiten vielleicht 80.000 Einwohner gehabt haben mag. An den ersten Häusern grüßen ein paar Landser. Dann fahren die drei Flieger durch verlassene Straßen. Sie fahren, fahren, und kein Mensch begegnet ihnen.
Sie fahren, sehen und schweigen.
Meier findet zuerst die Sprache wieder.
»Nee, sowat jibt’s doch nicht? Wo sind die Fijuren alle geblieben? Die können doch nicht samt und sonders verduftet sein, det wäre doch zu blödsinnig!«
»Zwangsweise evakuiert«, sagt der Leutnant kurz.
Dann stoppt der Wagen an einer Ecke, von der man in vier Straßenzüge hineinsehen kann. Die Flieger sehen sich um, aber nichts Lebendiges zeigt sich. Dabei ist kein zerstörtes Haus zu sehen. Die Stadt hat also kaum unter Fliegerangriffen oder Artilleriebeschuss zu leiden gehabt.
Ein Gefühl der Beklommenheit hat die drei Kameraden erfasst, die aus dem Auto steigen und zu Fuß die Häuser entlanggehen. Laut hallen ihre Schritte auf dem Pflaster.
So gespenstisch wirkt das alles, obwohl es Tag ist. Oder vielleicht gerade deshalb. Bei Dunkelheit könnte man sich vorstellen, dass in diesen stummen Häusern Menschen schlafen, dass hinter den schweigenden Wänden und dunklen Fenstern etwas lebt; dass dort Kinder atmen, Familien vom Tagewerk ausruhen.
Aber die Sonne scheint in Straßen und Höfe und enthüllt erbarmungslos die grauenhafte Leere. Der Krieg entvölkert das Land.
Durch den Torweg gehen die drei auf einen Hof. Wohnungen ringsum! Viele Türen sind offen. Dicht halten sich Schneider und Meier hinter ihrem Leutnant, so als ob sie jederzeit bereit sein müssten, ihm beizuspringen. Eine seltsame Spannung ist in ihnen. Irgendwie will ihr Gefühl nicht glauben, was ihr Auge sieht; irgendwie regt sich das Misstrauen. Meier fasst einmal instinktiv mit der Hand ans Koppel, um festzustellen, ob die Pistole griffbereit sitzt, und lässt sie gleich wieder sinken wie beschämt, weil sein Verstand ihm sagt, dass dies hier wohl doch nicht Gefahr, sondern hilfloseste Verlassenheit bedeutet.
Allmählich muss sich das Misstrauen von den Tatsachen überzeugen lassen.
Es ist wirklich niemand da. Keiner liegt im Hinterhalt. Nichts ist da als leere menschliche Behausung, verlassener menschlicher Besitz, der unvorstellbar armselig wirkt, wenn er nicht vom warmen Pulsschlag seiner Besitzer erfüllt ist.
Jetzt treten sie in eine Wohnung ein. Alles ist hier stehen und liegengelassen. In der Küche ungewaschenes Geschirr, in einem Topf Reste vom Mittag. Als ob die Hausfrau nur mal schnell zur Nachbarin klatschen gegangen ist. Schränke, Betten, Stühle, Bilder, die Uhr an der Wand, alles ist da. Alles sieht aus wie noch an diesem Tag benutzt. Aber die Uhr steht, der Herd ist kalt. Die Dinge sind entseelt, es fehlt der Mensch, der ihnen erst das Leben einhaucht.
Stille ringsum! Wenn die Dielen unter den Füßen knarren, horcht man auf, ob sich nicht doch noch irgendetwas Lebendiges verrät. Kopfschüttelnd sehen die drei Flieger sich um. Der Leutnant betrachtet die billigen Bilder an den Wänden, er findet Familienfotos, stößt in Gedanken mit dem Finger gegen den Topf auf dem Herd.
»Tja, traurige Sache, das«, sagt er.
»War das nu nötig, Herr Leutnant?«, fragt Schneider, »dass die Menschen alle ihre Wohnungen verlassen haben? Wir hätten ihnen doch gewiss nichts getan.«
»Freiwillig sind sie ja auch nicht gegangen, Schneider. Wenigstens nicht alle. Vorsichtig waren immer nur die Leute mit dem dicken Geld, von denen manche schon vor Monaten abgehauen sind. Die Franzosen haben ihren Volksgenossen und, ich glaube, auch ihrer Heeresführung mit der zwangsweisen Entvölkerung großer Gebiete einen schlechten Dienst erwiesen. Jetzt haben sich die Millionen in Südfrankreich gestaut, behindern die militärischen Operationen und müssen ernährt werden!«
»Na, gehen wir! Aber es war doch ganz interessant, mal so etwas gesehen zu haben.«
Damit machen die drei wieder kehrt. Als sie über den Hof zurückschlendern, bewegt sich doch etwas im Dunkel einer offenen Haustür. Ein kleiner Hund ist es, ein schwarzweißer Terrier, wie man ihn in Frankreich so häufig findet. Er kommt scheu näher, als man ihn ruft.
Meier gibt sich auch sofort liebevoll mit ihm ab, so als hätte er seit Wochen kein lebendiges Wesen mehr gesehen. Sichtlich macht es ihm Freude, hier doch noch einen Bewohner zu finden, und sei es auch nur ein vierbeiniger, der von den Menschen zurückgelassen worden ist. Heißhungrig schlingt der Hund ein Stück Brot hinunter. Dann wartet er wedelnd auf mehr.
»Völlig ausgehungert, das arme Tier«, sagt Schneider.
»Wir nehmen ihn mit, was Meier?«, fragt der Leutnant, der seinem Bordfunker den Wunsch schon von den Augen abgelesen hat.
Meier strahlt: »Jawoll, Herr Leutnant!«
»Wie wollen wir ihn denn nennen?«
»Karla«, sagt Dampf.
»Wieso Karla?«, fragt der Hauptfeldwebel.
Aber Meier hat schon begriffen. »Wie unsere Maschine, die Karla Berta.«
Da fängt Schneider mit seinem groben Bierbass barbarisch an zu lachen.
»Herr Leutnant«, prustet er, »es ist aber ein Hund und keine Hündin.«
Doch solch ein geringfügiges Versehen kann den Leutnant nicht im Mindesten erschüttern.
»So, ein männlicher Hund?«, fragt er erstaunt. »Na schön, dann heißt er eben Karl. Im Übrigen ist es ganz egal, ob wir ihn auch Karla nennen. Können wir uns leisten. Morgen wird er gewaschen und getauft.«
*
Großes Hallo empfängt sie bei der Staffel. Da gibt es schon ein paar Hunde. Karl guckt ein wenig fremd umher. Aber ängstlich ist er nicht. Das würde ihm auch nichts helfen. Man hat bei den Stukas keinen Sinn für lausiges Benehmen. Aber Karl hält sich, er setzt sich durch. Das kostet ihn zwar ein halbes Ohr, aber damit hat er sich seine Gleichberechtigung unter den anderen Hunden errungen.
Im Übrigen gehört Karl natürlich zur Karla Berta.
*
In dem unaufhaltsamen, blitzschnellen Vormarsch der deutschen Truppen in Frankreich spielen die Panzer und die Stukas eine entscheidende Rolle, häufig beiden Waffen in gemeinsamem Einsatz. Wie abgestimmt nach der Stoppuhr erfolgen ihre Vorstöße und Schläge, einer den anderen entlastend, einer dem anderen die Bahn brechend, ihm Luft schaffend. Ein Präzisionswerk an Schlagkraft und Schnelligkeit, dem der Gegner nichts entgegenzusetzen hat als Staunen, Schrecken und Flucht.
Auch die Sturzkampfgruppe, der die drei Flieger angehören, schlägt in unermüdlichem Einsatz immer wieder zu. Um die großen taktischen Zusammenhänge kümmert man sich wenig. Man nimmt sie zur Kenntnis, wenn sie soweit gediehen sind, dass der Rundfunk sie bekanntgibt. Man freut sich dann, wie glänzend alles ineinandergreift, wie hervorragend alles klappt. Im Übrigen nimmt man den Befehl entgegen, bereitet sich auf den Auftrag vor, sucht sein Ziel auf der Karte, fliegt, wirft und kehrt zurück – wenn's einen nicht erwischt.
Bei allen Besatzungen mehren sich die Feindflüge, die säuberlich ins Flugbuch eingetragen werden. Alle haben sie das EK 2, die meisten schon das Eiserne Kreuz erster Klasse, soweit es sich nicht um neu hinzugekommene Kameraden handelt, die eben erst an die Stelle von Gefallenen getreten sind.
Und mit jedem Einsatz werden die Männer verwegener, werden sie härter der Gefahr und dem Tode gegenüber. Wer bisher durchgekommen ist, der glaubt, es könne ihm auch weiterhin nichts geschehen und der macht sich auch keine Gedanken darüber. Männer mit Nerven wie Stahlseile, rücksichtslos im Einsatz bis zur Tollkühnheit – das sind diese Stukas! Das ist die Waffe, die der Franzose am meisten zu fürchten und am ersten auszusprechen gelernt hat, zugleich mit den Panzern.
Die Staffel von Leutnant Dampf ist in höchster Alarmbereitschaft. Jeder der Männer weiß genau, dass der Einsatz auf die Sekunde klappen muss. Wenn die Stukas angefordert werden, dann rechnet die Führung damit, dass sie in einer halben Stunde über dem Ziel sind und den Kampf am Boden genauestens in dem Augenblick entscheiden, in dem er gebraucht wird. Der Krieg ist von jeher höhere Mathematik gewesen, in der jener Feldherr im Vorteil ist, der die meisten bekannten Größen für sich buchen und richtig einsetzen kann. Nunmehr aber ist der Krieg durch die motorisierten Kräfte am Boden und durch das Flugzeug in der Luft zu einem Rechenexempel geworden, das außerdem mit ungeheurer Schnelligkeit gelöst werden muss.
Wenn französische Kampfwagen vorstoßen und die zur Abwehr angeforderten deutschen Sturzkampfverbände nur eine Viertelstunde zu spät eintreffen, so kann das den Tod von Hunderten, ja Tausenden deutscher Infanteristen bedeuten. Es kann der Verlust einer sauer erkämpften Stellung, eines Vormarschtages sein.
Das wissen die Stukaflieger.
Die Maschinen sind längst mit Bomben beladen. Böse und bissig sehen die Sturzkampfflugzeuge aus. Gefährlich droht die Last der dicken Brocken unter Rumpf und Flächen. Schon in ihren Kombinationen liegen die Besatzungen im Gras, die Flugzeugwarte neben ihnen. In den Motoren stecken die Andrehkurbeln, alle Maschinen sind warmgelaufen und abgebremst. Der ungefähre Raum, in dem sich das Ziel befinden wird, ist bekannt. Sorgfältig und mehrfach haben besonders die Staffelkapitäne den Flugweg studiert, sich Einzelheiten des Geländes eingeprägt. Das Wetter ist günstig. Nichts steht aus als der Befehl. Urplötzlich verstummen die Gespräche. Es ist wie eine Ahnung, denn noch sieht und weiß niemand etwas. Aber jetzt blicken viele Augenpaare dorthin, von woher jede Neuigkeit kommen muss – zur Befehlsstelle.
In höchster Fahrt jagt der Wagen des Gruppenkommandeurs holpernd und springend über die Grasnarbe des Platzes auf die Maschinen zu. Die Besatzungen sind schon aufgesprungen. Die Warte stehen schon neben den Maschinen. Die Staffelkapitäne eilen dem Kommandeur ein paar Schritte entgegen. Wenige Worte genügen. Endlich ist er da, der Einsatzbefehl!
Die Uhren werden verglichen. Es ist 15 Uhr 27. Start um 15 Uhr 40. Um 16 Uhr 20 über dem Ziel!
Der erste Motor springt an, heult auf . . . der dritte . . . der zehnte . . . der zwanzigste. Wie eine Meute böser, hungriger Teufel, so pfeifen und brüllen die Sturzkampfflugzeuge, in denen sich die Besatzungen mit hundertfach geübten Handgriffen zum Start fertigmachen. Flugzeugführer und Bordfunker haben die FT-Hauben mit den eingebauten Kopfhörern auf, der Funker setzt die Trommel auf sein Maschinengewehr, die Kabine wird geschlossen, die Bremsklötze werden von den Warten weggetragen. Ein Flugzeug hinter dem anderen, so rollen die Staffeln zum Start.
Dieser Anblick hat für die Zurückbleibenden jedes Mal von Neuem etwas Erregendes. Und jedes Mal packt er auch die Männer, die mitfliegen. Wenn die erste Hand, wenn die Hand des Gruppenkommandeurs den Gashebel vorschiebt, dann ist damit der Anlauf ausgelöst, der Tod und Vernichtung über den Feind bringen soll. Stahl, Leichtmetall, Sprengstoff, vor allem aber die Männer selbst – das Ganze eine Einheit! Das ist die Sturzkampfgruppe! Sie steigt empor von ihrem Horst, um niederzustürzen und zu töten wie ein Bündel von Blitzen.
Und jetzt stößt die Hand des Kommandeurs den Gashebel vor. Es folgt sein Adjutant, es folgen die anderen. Die erste Staffel . . . die zweite . . . die dritte . . . Der Boden bebt unter dem Gebrüll der Motoren, der Tausenden von Pferdestärken. Vom Rollfeld heben sich die Flugzeuge, sie sammeln sich, sie schließen zum festgefügten Verband auf, sie verschwinden wie ein böse brummender Hornissenschwarm feindwärts.
Frankreichs Erde gleitet unter den Flugzeugen des Stuka-Verbandes. Zuerst ist das Gelände noch bekannt, dann findet der Leutnant nur noch einige hervorstechende Einzelheiten, die mit dem Kartenbild in seiner Erinnerung übereinstimmen. Und nun stoßen die drei Staffeln nach oben durch die Wolken.
20 Minuten sind seit dem Start vergangen. Bald muss die Front auftauchen. Doch was heißt Front, es gibt ja keinen Stellungskrieg wie einst vor 25 Jahren. Die Wolken sind aufgelockert. Immer wieder kann man Blicke auf die Erde werfen. Gerade das richtige Wetter für die Stukas.
Fertigmachen! Wieder einmal ist der Augenblick der Entscheidung da. Durch Sprechfunk ist der Befehl zur letzten Vorbereitung gekommen. Ganz kurze Frist noch, dann wird der Sturzkampfverband die Deckung verlassen, hinter der er sich an den Gegner herangepirscht hat. Er wird zwischen den Wolken hindurch auf sein Ziel hinabstürzen.
Der Leutnant späht voraus. Da, jetzt sieht er auf der Erde Mündungsfeuer von Geschützen, jetzt sieht er auch die braunen französischen Panzer, drei . . . zehn . . . 20 . . . noch viel mehr! Auch der Gefreite hat die Lage erkannt.
»Die ham da allerhand für uns uffgestellt, Herr Leutnant!