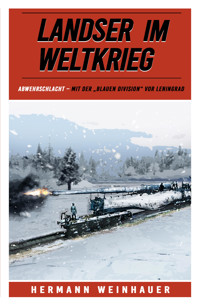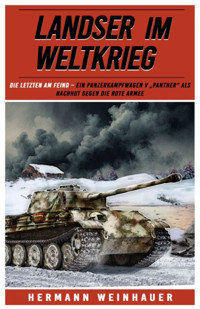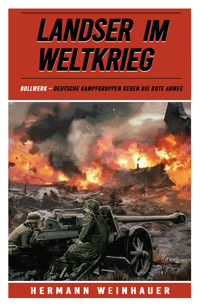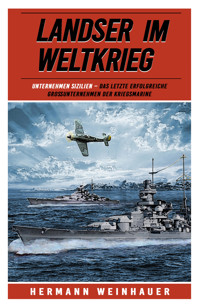
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Militär
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band „Unternehmen Sizilien” beschreibt den letzten erfolgreichen Einsatz einer großen Kampfgruppe der deutschen Kriegsmarine. Im Spätsommer 1943 bricht eine deutsche Marine-Kampfgruppe zu einer waghalsigen Mission auf: Die Zerstörung kriegswichtiger Einrichtungen auf der strategisch bedeutsamen Insel Spitzbergen. Unter dem Schutz einer beeindruckenden Flotte, angeführt von den Schlachtschiffen Tirpitz und Scharnhorst, stehen die mitgeführten Heeres-Soldaten vor einer nahezu unmöglichen Aufgabe. Nicht nur das ungewohnte Terrain fordert sie heraus, sondern auch der Kampf mit norwegischen und britischen Soldaten sowie die starken Küstenbefestigungen.
Wird es den deutschen Truppen gelingen, den Gegner niederzuringen? Werden es die deutschen Schlachtschiffe schaffen, die Landungsoperation erfolgreich vor der britischen Flotte abzuschirmen?
Über die Reihe „Landser im Weltkrieg“ „Landser im Weltkrieg“ erzählt fiktionale Geschichten vor historischem Hintergrund realer Schlachten und Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Im Zentrum stehen die Erlebnisse deutscher Landser fernab der großen Strategien am grünen Tisch.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hermann Weinhauer
Landser im Weltkrieg
Unternehmen „Sizilien“ – Das letzte erfolgreiche Großunternehmen der Kriegsmarine
EK-2 Militär
Über die Reihe Landser im Weltkrieg
Jeder Band dieser Romanreihe erzählt eine fiktionale Geschichte, die vor dem Hintergrund realer Ereignisse und Schlachten im Zweiten Weltkrieg spielt. Im Zentrum der Geschichte steht das Schicksal deutscher Soldaten.
Wir lehnen Krieg und Gewalt ab. Kriege im Allgemeinen und der Zweite Weltkrieg im Besonderen haben unsägliches Leid über Millionen von Menschen gebracht.
Deutsche Soldaten beteiligten sich im Zweiten Weltkrieg an fürchterlichen Verbrechen. Deutsche Soldaten waren aber auch Opfer und Leittragende dieses Konfliktes. Längst nicht jeder ist als glühender Nationalsozialist und Anhänger des Hitler-Regimes in den Kampf gezogen – im Gegenteil hätten Millionen von Deutschen gerne auf die Entbehrungen, den Hunger, die Angst und die seelischen und körperlichen Wunden verzichtet. Sie wünschten sich ein »normales« Leben, einen zivilen Beruf, eine Familie, statt an den Kriegsfronten ums Überleben kämpfen zu müssen. Die Grenzerfahrung des Krieges war für die Erlebnisgeneration epochal und letztlich zog die Mehrheit ihre Motivation aus dem Glauben, durch ihren Einsatz Freunde, Familie und Heimat zu schützen.
Prof. Dr. Sönke Neitzel bescheinigt den deutschen Streitkräften in seinem Buch »Deutsche Krieger« einen bemerkenswerten Zusammenhalt, der bis zum Untergang 1945 weitgehend aufrechterhalten werden konnte. Anhänger des Regimes als auch politisch Indifferente und Gegner der NS-Politik wurden im Kampf zu Schicksalsgemeinschaften zusammengeschweißt. Genau diese Schicksalsgemeinschaften nimmt »Landser im Weltkrieg« in den Blick.
Bei den Romanen aus dieser Reihe handelt es sich um gut recherchierte Werke der Unterhaltungsliteratur, mit denen wir uns der Lebenswirklichkeit des Landsers an der Front annähern. Auf diese Weise gelingt es uns hoffentlich, die Weltkriegsgeneration besser zu verstehen und aus ihren Fehlern, aber auch aus ihrer Erfahrung zu lernen.
Nun wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen mit dem vorliegenden Werk.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis zu bieten.
Damit uns dies gelingt, sind wir sehr an Ihrer Meinung interessiert. Haben Sie Anregungen für uns? Verbesserungsvorschläge? Kritik?
Schreiben Sie uns gerne: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Heiko und Jill von EK-2 Militär
Unternehmen Sizilien
Weit draußen im Norden, in der verlorenen Ferne der Unendlichkeit, schien der Himmel wie ein silbrig-grauer Vorhang im Meer zu versinken. Auf der sanften Dünung des Wassers tanzten die Sonnenstrahlen im Gegenlicht, warfen zitternde Bündel von gelben und rosaroten Reflexen auf den Spiegel der See. Nur ganz vereinzelt stießen Möwen hinab auf das Wasser und unterbrachen mit schrillen Schreien die weltverlorene Stille.
Es war ein Bild der Ruhe, des tiefsten Friedens. Doch dieses Bild täuschte. Es war Krieg, und dieser
Krieg hatte seine Fühler bereits zum äußersten Norden Europas ausgestreckt.
Noch aber blieb es still in diesem Land, und diese Stille zerrte an den Nerven der Soldaten, die hier in der Einsamkeit der norwegischen Fjorde ihre Stellungen bezogen hatten und warteten.
Warteten? Worauf?
Dass es wieder losging? Dass der Tommy“" kam und ihnen gründlich einheizte? Dass ein Befehl sie plötzlich zu irgendeinem anderen Kriegsschauplatz rief? Jeder hing seinen Gedanken nach und jeder wünschte, dass es noch möglichst lange so still und ruhig bleiben mochte. Denn sie waren ihn leid, diesen Krieg; sie hatten ihn zur
Genüge erlebt: das Inferno der Schlachten, die Schreie der Verwundeten, das große Sterben.
Lange konnte es trotzdem nicht mehr dauern. Irgendetwas schien in der Luft zu liegen. Die Männer der 181. Infanteriedivision wussten um diese Stunde nicht, dass ihre Ahnungen sich schon in wenigen Augenblicken bestätigen sollten.
Etwas unbeholfen schob sich Max Weber auf dem groben Felsbrocken zurück und besah sich die Skizze die er mit flüchtigen Strichen auf den Zeichenblock geworfen hatte.
Der Kunststudent und Gefreite ließ keine Gelegenheit aus, um seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Stundenlang saß er oft hier und sah hinauf das Meer, das ihm im ständigen
Wechsel der Lichter und Schatten schönste Motive für seine Malerei lieferte.
„Mensch, Max; was willst du bloß malen, wenn dieser verdammte Krieg mal vorbei ist?“
Otto Maschke; der schlaksige Berliner, war hinter den Gefreiten getreten und warf einen gelangweilten Blick auf das noch unfertige Kunstwerk seines Kameraden.
„Es wird sich schon was finden!“
Der Gefreite Weber erhob sich langsam und sah mit verlorenen Blicken hinaus auf das Meer.
Vor drei Monaten war er hierhergekommen.
Seine Verwundung war ausgeheilt, und sofort hatten sie ihn von seinem Hamburger Ersatztruppenteil in Marsch gesetzt.
In Tromsö sollte er sich beim Grenadierregiment 349 melden.
Weber war der Gruppe des Unteroffiziers Hegenau zugeteilt worden der auch Maschke angehorte. Sie war wie die gesamte 181. Infanteriedivsion zum Küstenschutz an der äußersten Nordecke Norwegens eingesetzt.
Weber war der Jüngste in der Gruppe.
Besorgt sah er jetzt auf seine Uhr und wandte sich an Maschke, der immer noch hinter ihm stand und das Koppelschloss an der Hose blank rieb.
„Mensch, Otto!“ entfuhr es Weber erschrocken, „gleich sieben. Los, wir müssen zurück!“
„Nun mal langsam.“ Maschke war, wie immer, die Ruhe selbst.
„Meinst du, wenn wir schneller machen, wär der Krieg eher aus?“
„Das nicht“, meinte Weber aufgeregt.
„Aber wenn wir jetzt nicht gehen, sind wir morgen beim Strafexerzieren bestimmt wieder dabei.“
„Na, und wennschon!“ brummte Maschke. Als er sah, das Weber seine Uniformjacke zuknöpfte und das Koppel zuschnallte, lenkte er ein.
„Also gut, dann gehen wir”, meinte er anscheinend uninteressiert.
„Außerdem ist es verdammt kalt geworden.“
Sie gingen beide den Abhang hinunter und sahen hinter der ersten Wegbiegung Tromsö liegen. Als die beiden Soldaten das Hoftor zu ihrer Unterkunft erreichten, klang ihnen schon die Stimme des Postens entgegen.
„Los, beeilt euch, ihr Heinis! Alarm!“
Otto Maschke schob den Mann mit einer sanften Bewegung zurück.
„Nun mach dir mal nicht gleich in die Hose.“
Sie passierten das Hoftor, und jetzt entdeckten auch sie, da etwas Besonderes vorgefallen sein musste.
Schrille Kommandos gellten von allen Seiten her über den Schulhof.
Männer mit vollem Marschgepäck rannten hin und her. Das Klappern der Gasmasken an den Feldspaten war hier im hohen Norden schon längst zu einem unbekannten Geräusch geworden.
Maschke entdeckte einige Leute vom zweiten Zug, die Waffen empfingen.
Drüben, am hinteren Ausgang der Schule, war eine Gruppe dabei, Material auf mehrere bereitstehende Lastwagen zu laden. Was es war, konnte Maschke aus dieser Entfernung
nicht feststellen. Die Aufmerksamkeit der beiden Soldaten war von dem ungewohnten
Bild auf dem Schulhof so in Anspruch genommen, dass sie das Erscheinen ihres Zugführers völlig übersahen.
Wie aus der Erde gewachsen stand Oberfeldwebel Stablack plötzlich vor ihnen. Der hünenhafte Unterführer hatte die Fauste in die Hüften gestemmt.
Er wippte ein paarmal mit den gespreizten Beinen und empfing seine beiden ,,ganz speziellen Falle“ auf seine im ganzen Zug gefürchtete
zynische Art.
„Sieh mal einer an, unsere beiden Herren! Vom Spaziergang zurück?
Schön frisch und ausgeruht? Na, dann wollen wir mal!“
Und dann schwoll die Stimme zu einem fürchterlichen Dröhnen an, dass die Halsadern wie knotige Bänder aus der Haut hervortraten.
„In einer Sekunde will ich nur noch Hacken sehen, ihr Weihnachtsmänner!“
„Herr Oberfeld ...!“ Webers Versuch einer Rechtfertigung ging im Toben des Zugführers unter.
„Schnauze! “ brüllte Stablack noch um Grade lauter. „In einer Minute feldmarschmäßig. Bin ich verstanden worden?“
„Jawoll!“ schrie Maschke herausfordernd scharf zurück und versetzte
Weber einen sanften Stoß in die Seite, um ihn vorwärts zu drängen. Mit Stablack war in solchen Situationen nicht zu spaßen.
Mit ein paar Sätzen hatten die beiden das Eingangsportal erreicht. Sie sprangen die Stufen hoch, hetzten in ihre Unterkünfte und standen kurz darauf feldmarschmäßig vor ihrem Zugführer.
„Los, sofort zu eurem Haufen!“ kommandierte Stablack aufgeregt.
Er schaute dabei unentwegt auf das Notizbuch, das er in seinen Händen hielt, und hakte mit dem Bleistift die einzelnen Positionen ab.
„Die Brüder fegen schon seit einer Viertelstunde durch die Turnhalle. Ich werde euch Beine machen.“
Maschke und Weber sahen sich entgeistert an. Das konnte doch nicht wahr sein! Was war eigentlich los mit Stablack? Kein Nachexerzieren? Keine Kniebeugen mit Gewehr in Vorhalt
mit Soloeinlage für den Hamburger Kunststudenten? Irgendetwas stimmte hier nicht ...
Die beiden liefen in Richtung Turnhalle, wo die anderen schon versammelt waren. Man spürte formlich die Unruhe, die nervöse Hast, die den Raum durchzog.
Weber wollte melden, aber Unteroffizier Hegenau winkte ab. Er war offenbar froh darüber, seinen Haufen wieder vollzählig beisammenzuhaben und teilte Weber und Maschke eine Aufgabe zu. Die beiden Soldaten griffen zu den Kisten, die zum Ausgang geschafft und dort gestapelt wurden.
„Sag mal, Dicker”, wandte sich Maschke mit dem sicheren Instinkt des fronterfahrenen Soldaten für das Außergewöhnliche einer Situation an den Sanitätsgefreiten Riedel, „was wird denn hier eigentlich gespielt?“
Riedel zuckte die Schultern.: „Ich glaube, es geht los!“
Admiral Kummetz, Befehlshaber der Marinekampfgruppe Nordnorwegen, hatte die Kommandanten und Flottillenchefs zu sich befohlen. Die entscheidende Besprechung, bei der diese schicksalsschweren Worte fielen, fand am Abend des 5. September 1943 auf dem größten Schlachtschiff statt.
Die Tirpitz lag um diese Stunde im Altafjord vor Anker, hunderte Kilometer nordostwärts von Tromsö.
Das Schiff war nach dem Verlust der Bismarck im Mai 1941 nicht nur die stärkste
schwimmende Festung, sondern auch das vom Feind am meisten gefürchtete der deutschen Flotte.
Wie viel dem Feind an der Vernichtung der Tirpitz gelegen war, ging allein aus einer einzigen Tatsache hervor: Seit Monaten kreuzten englische, amerikanische und russische Kriegsschiffe aller Klassen im Nordmeer mit dem einen Auftrag, die
Tirpitz zum entscheidenden Kampf zu stellen und zu vernichten.
Pausenlos waren Bomberstaffeln britischer Flugzeugträger im Einsatz, um den Liegeplatz des Schlachtschiffes auszumachen.
Allein durch ihr Vorhandensein band die Tirpitz starke Kräfte der gegnerischen Flotten. Sie
fehlten dem Feind bei seiner Kriegsführung gegen die deutschen U-Boote.
Es war fast wie ein Wunder, das die Tirpitz bisher der Vernichtung hatte entgehen können.
Unter dem Schutz der hohen, teilweise schon wieder schneebedeckten Berge lag die Tirpitz an diesem 5. September des Jahres 1943 verhältnismäßig sicher vor jeder Feindeinwirkung.
Das Wasser des Altafjords plätscherte gegen den riesigen Leib des Schiffes.
Hoch oben vom Mast wehte die Flagge des Admirals.
Die Tirpitz war nicht allein. Zerstörer und Vorpostenboote umkreisten wie wachsame Hunde den Kolos und sicherten ihn gegen U-Boote und Flieger. Mehrere hundert Meter weiter zurück, in einem noch stilleren Seitenarm des Fjords, hatte die Scharnhorst, das zweitgrößte
Schiff der deutschen Kriegsmarine, festgemacht.
Was in diesen Stunden draußen geschah, nahm kaum einer wahr. Drinnen in den Mannschaftsräumen und Kommandostellen ging es dafür umso aufgeregter und geschäftiger zu.
Admiral Kummetz war die Ruhe selbst. Er stand im Admiralsraum, über die große Seekarte gebeugt, und schob seine Mütze etwas aus der Stirn. Eine drückende Schwüle erfüllte den Raum. Kummetz deutete jetzt auf die Markierung des Schiffsstandorts, den Altafjord. Langsam schob er sein Finger auf der Karte weiter nach Norden. Plötzlich hielt er inne.
Sein Finger blieb auf dem weißen Fleck haften, der auf der Karte die Form eines Dreiecks besaß.
Für die umstehenden Offiziere, die dem Admiral gespannt zusahen, gab es über das Angriffsziel keinen Zweifel mehr: Es war die Insel Spitzbergen.
„Ja, meine Herren“, sagte Kummetz ruhig, ,,wir sind soweit!“
Dann wandte er sich an den Chef seines Stabes. „Kapitän Reinecke, schildern Sie bitte noch einmal kurz die Lage.“
Kapitän Reinecke, der I. Admiralstabsoffizier (I. Asto), nahm Haltung an und trat auf die Karte zu. Er richtete sich auf und sah den Admiral an.
Kummetz nickte.
„Es ist uns bekannt“, begann Reinecke, „was die Briten seit 1941 getan haben. Sie haben eine Funkstelle und eine meteorologische Station auf Spitzbergen errichtet. Außerdem haben sie systematisch mit dem Ausbau der Befestigungsanlagen begonnen.
Meldungen der V. Luftflotte zufolge sind diese Anlagen in den letzten Monaten erweitert worden. Außerdem wurden die Abbauanlagen der Kohlengruben verstärkt. Das bedeutet, dass die alliierten Geleitzüge einen überaus wichtigen Stützpunkt erhalten haben, von dem aus jederzeit Einheiten der britischen Flotte gegen Nordnorwegen auslaufen können.
Reinecke deutete den möglichen Verlauf einer solchen Flottenbewegung auf der Karte an. Ein Geräusch an der Tür unterbrach ihn in seinem Vortrag. Ein junger Kapitänleutnant hatte das Besprechungszimmer betreten.
Der Admiral sah ärgerlich zur Tür.
„Was ist denn?“ fuhr er den auf halbem Weg stehenbleibenden Offizier an.
„Bitte Herrn Admiral einen soeben eingegangenen Funkspruch des Militärbefehlshabers übergeben zu dürfen!“
„Geben Sie her!“ erwiderte Kummetz. Er nahm dem Kapitänleutnant das unterschriebene Papier aus der Hand, überflog es flüchtig und reichte es weiter an den Chef seines Stabes.
„Meine Herren, der Militärbefehlshaber hat das für das Unternehmen Sizilien bestimmte Bataillon gestern Abend mit Lastwagen in Marsch gesetzt.“
„Demnach dürfte die Infanteriekampfgruppe also in den nächsten Stunden hier eintreffen, warf Kapitän zur See Johannson, der Chef der 4. Zerstörerflottille, ein.
„Sicher!“ pflichtete ihm Reinecke bei.
„Wir müssen uns deshalb beeilen. Ich schlage daher vor, dass wir für unsere Einheiten ab Mitternacht Gefechtsbereitschaft befehlen.“
Der Admiral hob die Hand zum Zeichen, dass Reinecke fortfahren solle.
„Die SKL hat sich aus den eben erwähnten Gründen entschlossen, die feindlichen Anlagen auf Spitzbergen zu zerstören, und zwar nachhaltig zu zerstören, damit sie für längere Zeit
ausfallen.
„Demnach dürfte eine Besetzung der Insel wohl nicht in Frage kommen?“ erkundigte sich der Kommandant eines Zerstörers interessiert.
Reinecke zuckte kurz die Schultern und wandte sich wieder der Karte zu.
„Die Kampfgruppe, von Heerespionieren verstärkt, hat den Auftrag, die Grubenanlagen und Verladeeinrichtungen in Barentsburg und Longyearbien zu sprengen. Übrigens können Sie alle weiteren Einzelheiten meinen schriftlichen Befehlen entnehmen. Ich habe sie bereits ausgearbeitet und werde sie Ihnen gleich übergeben.
„Sonst noch Fragen?“ sagte der Admiral.
Nichts rührte sich. Keiner der Anwesenden Offiziere hatte noch eine Frage. Dann nahmen sie schweigend die Befehle entgegen, die sie und ihre Mannschaften zu einem Unternehmen führen sollten, dessen Ausgang noch völlig ungewiss war.
Wieder klopfte es an der Tür, und der junge Funkoffizier betrat den Raum. Admiral Kummetz sah auf und nahm den soeben eingegangenen Funkspruch der Seekriegsleitung entgegen. Schon beim Lesen der ersten Zeilen trat eine steile Falte auf seine Stirn. Er hielt das Schreiben in der Hand und beugte sich über die Karte. Diesmal verhielt sein Zeigefinger etwas länger auf einer bestimmten Stelle, dann drehte sich der Admiral ruckartig um und sah die versammelten Offiziere an.
„Meine Herren, die SKL funkt soeben, dass zwei Schwere Kreuzer und sechs Zerstörer im Anmarsch auf Spitzbergen sind. Damit ist die Lage klar, und wir wissen, was uns erwartet.
Das Unternehmen ist befohlen und wird durchgeführt. Wenn es hart auf hart gehen sollte, dann werden wir zeigen, dass wir zu kämpfen verstehen Ich danke Ihnen, meine Herren.”
Die Offiziere grüßten und verließen den Raum. Als sie gegangen waren, wandte sich Kummetz noch einmal an den I. Asto: „Kommen Sie, Reinecke, jetzt geht es an die Arbeit. Den Schlaf werden wir uns vorerst wohl verkneifen müssen.“
Reinecke kannte seinen Admiral und folgte ihm wortlos auf dem Weg zu den Gefechtsständen.
Mit laut aufheulenden Motoren schossen die Pinassen durch das eiskalte Wasser des Altafjords.
Die Offiziere der 4., 5. und 6. Zerstörerflottillen waren auf dem Weg zu ihren Schiffen. Schemenhaft tauchten vor ihnen die Umrisse der Kriegsschiffe auf, die in einem solchen Massenaufgebot vor Anker lagen, wie es der Altafjord niemals wieder erleben sollte: Schlachtschiffe, Vorpostenboote, Zerstörer. Dort die Erich Steinbrinck, dann weiter den Fjord hinauf die Theodor Riedel, Hans Lody, Karl Galster.
Der Plan der Seekriegsleitung schien klar. Dieser starke Flottenverband sollte bei günstiger Witterung nach Spitzbergen in den Eisfjord vorstoßen.
Unter dem Feuerschutz der beiden Schlachtschiffe kam den Zerstörern die Aufgabe zu, in den Grönfjord und die Adventsbucht einzudringen, um dort die Kampf- und Sprengtruppen des Heeres zu landen. Hier sollten die Infanteristen und Pioniere die feindlichen Stützpunkte
niederkämpfen und alle Nachschubbasen des Feindes sprengen.
Nur aus Tarnungsgründen trug dieses Unternehmen einstweilen noch den Namen Sizilien, damit der feindliche Abwehrdienst und norwegische Spione getäuscht wurden. So galt es als verhältnismäßig sicher, dass der Feind vor der entscheidenden Phase des Angriffs deutscher Einheiten auf Spitzbergen nichts erfahren würde.
Natürlich waren sich die deutschen Stäbe im Klaren darüber, dass die Ansammlung von Schlachtschiffen und Zerstörern auf die Dauer nicht geheim bleiben konnte. Um aber die
gegnerischen Geheimdienste möglichst lange an der Nase herumzuführen, sollte die von Tromsö kommende Kampfgruppe des Grenadierregiments 349 erst in der kommenden Nacht im Altafjord eintreffen und sofort auf die neun Zerstörer verschifft werden. Bei Morgengrauen durfte draußen kein Grenadier mehr zu sehen sein.
„Mensch, hast du so was schon mal gehört?“
Der hoch aufgeschossene, blonde Matrosengefreite Lüdde schien von den nur spärlich durchsickernden Nachrichten wie elektrisiert zu sein.
Er war alles andere als der Mann, der solche Nachrichten für sich behalten konnte. Ernst Hagen hörte ihm geduldig zu.
„Was, Peter?“
„Na, das mit den 75ern, mit den Landratten von Tromsö.“
„Ach, das meinst du“, stellte Hagen gelangweilt fest. Damit sagte Lüdde ihm nichts Neues.
„Genau das!“ Lüdde lachte.
„Mann, du schaltest ja schneller als die Strippentante.“
„Wenn ich nur wüsste, warum wir die Kameraden von der Infanterie an Bord nehmen sollen.“ Hagens Überlegungen kamen über diesen Punkt des bevorstehenden Unternehmens nicht hinaus.
„Mensch, denk doch mal scharf nach, riet Lüdde seinem Kameraden.
„Ist doch wohl sonnenklar. Hast du schon mal was von einer großangelegten Landung gehört?“
„Ist ja auch egal“, meinte Hagen kopfschüttelnd und spuckte aus.
„Aber eines will ich dir sagen, die Sache mit unseren Kojen gefällt mir gar nicht. Warum diesen Quatsch? Kannst du mir vielleicht mal sagen, warum wir unsere Miefkisten räumen sollen?“
„Damit die Kameraden sich auspennen können“, erklärte Lüdde lakonisch.
Hagen erhob sich schwerfällig von seinem Hocker und ging langsam auf das Mannschaftslogis im Unterdeck zu.
Seit Stunden waren die Männer schon auf Achse. In einer mühseligen Fahrt kletterten die Dreitonner über die Serpentinen der langen Gebirgsstraße, die von Tromsö aus zum Altafjord
fuhrt. Die Fahrt schien kein Ende nehmen zu wollen.
Doch hinter der Kehre eines steilen Bergvorsprungs lag das Ziel plötzlich vor ihren Augen. Lange genug waren sie darüber im Zweifel gewesen.
Nicht ein Sterbenswörtchen hatte man ihnen beim Aufbruch in Tromsö
gesagt. Nur der Leutnant und seine drei Unteroffiziere hatten bis dahin gewusst, wohin es gehen sollte, bis sie schließlich im letzten Fischerdörfchen vor dem Altafjord erfahren hatten,
welchen Auftrag sie zu erfüllen hatten. Karten und Lageplane waren ausgegeben, Instruktionen gegeben und die Gruppen für die Spezialaufträge eingeteilt worden.
Und jetzt plötzlich lag der Altafjord vor ihnen. Der Pioniergefreite Xaver Huber aus Oberbayern war der erste, der ihn vom Wagenfenster aus entdeckte. Er wies mit der Hand
nach unten, wo die Felsen fast steil ins Wasser abfielen. Der Leutnant ließ noch einmal absitzen und die Männer seines Kommandos zusammenkommen.
Die Pioniere staunten, als plötzlich der Name Longyearbien fiel.
Nichts, aber auch gar nichts wussten sie damit anzufangen.
„Wenn ich mich nicht täusche und meine Schulkenntnisse richtig sind“, entsann sich der Obergefreite Hannekamp schließlich, ,,dann muss das irgendeine Stadt auf Spitzbergen sein.‘
„Auf Spitzbergen?“ Huber verschlug es fast die Sprache.
„Dann wollen die uns gar mitten in die Eiswüste schicken? Warum nicht gleich auf den Nordpol?“
„Ruhe da!“ unterbrach ihn die Stimme des Unteroffiziers.
„Alles mal herhören!“
Er hatte ein Bein auf das Trittbrett des Lastwagens gestellt und wartete das Herankommen der
Männer ab, die langsam einen Halbkreis um ihn bildeten.
„Ich brauche zwei Freiwillige und Sie, Hannekamp!“
Hannekamp sah sich ungläubig nach seinen Kameraden um und trat einen Schritt vor. Er gehörte zu den Soldaten, die immer ein schlechtes Gewissen hatten. Auch jetzt fühlte er
sich nicht frei davon. Wie aus weiter Ferne horte Hannekamp die Stimme seines Unteroffiziers: „Na los, noch zwei Mann.“
Xaver Huber tauchte neben Hannekamp auf. Er zog die Hände aus den Hosentaschen und gab sich Mühe, einigermaßen militärisch vor seinem Unteroffizier zu erscheinen.
„Noch einer!“
Wenige Minuten später meldete sich Hannekamp mit seinen beiden Leuten beim Zugführer. Doch der schien diesmal nichts gegen ihn zu haben. Im Gegenteil, niemals war der Leutnant dem Obergefreiten so freundlich erschienen. Jetzt schlittelte der Leutnant ihm sogar die Hand.
Wenn da nicht irgendwo wieder ein Haar in der Suppe war!
„Hannekamp, ich habe Sie heute dem Kommandeur für eine besondere Aufgabe vorgeschlagen. Was es ist, weiß ich selbst noch nicht genau. Ich weiß nur, dass ich mich voll und ganz auf Sie verlassen kann.“
„Jawoll, Herr Leutnant!“ schrie Hannekamp.
Die Wagen ruckten an, langsam kam wieder Bewegung in die Kolonne.
Der Altafjord rückte näher und näher. Die Laster, die ihm entgegenfuhren,
waren bis zum Bersten vollgestopft — mit Flammenwerfern, Sprengmaterial, Minen und Handgranaten.
Doch an all das schien der Obergefreite Xaver Huber jetzt nicht zu denken.
Er saß am Fenster des Wagens und betrachtete den Fjord, dessen silbrig-graues Wasser sich in der leichten Abendbrise kräuselte. Wie gespenstische Schemen tauchten die Aufbauten der Schiffe aus der Dämmerung.
Huber faste Hannekamp beim Arm und wies mit der einen Hand voraus.
‘ ’
„Schau dir das an, Hannekamp, die Schiffe! Mein Gott ...!“
Er begann zu zählen, gab aber den aussichtslosen Versuch bald wieder auf.
„Wo kommen denn die bloß her?“
Auch die anderen Pioniere drängten sich jetzt über die offene Rückwand des Lastwagens. Ein plötzlicher Ruck ging durch das Innere.
Bremsen quietschten. Die Männer auf dem LKW wurden von der Wucht des plötzlich haltenden Fahrzeugs durcheinandergewirbelt.
Ehe noch einer von ihnen einen Fluch ausstoßen konnte, stand der Leutnant schon hinten an der Rückwand des Wagens.
„Los, aussteigen!“
Die Kommandos kamen knapp und klar. Wie auf dem Exerzierplatz, dachte Hannekamp.
Aber der Exerzierplatz sollte bald vergessen sein. Jetzt wurde es ernst. Blutig ernst.
„Abladen! In einer Stunde geht’s auf die Schiffe, klar?“
Kaum eine Stunde war vergangen, seit die Manner vor dem Altafjord abgesessen waren, da stampften die Pioniere mit ihrem Leutnant schon über das steinige Geröll dem Ufer zu.
Vollbepackt mit Waffen und Munition, mit Kisten und Kästen, schleppten sie sich weiter.
Auf dem Weg trafen die Pioniere mit Leuten des Grenadierbataillons zusammen, das ebenfalls vor dem Altafjord sammelte. Fragen flogen zwischen den marschierenden Soldaten hin und her. Fragen, Ahnungen und Parolen. Aber keiner wusste genau, was mit ihnen passieren sollte.
Die Dämmerung war stärker und der Blick auf den Fjord noch schwieriger geworden. Trotzdem war deutlich zu erkennen, wie Bewegung in die Schiffe kam. In langsamer Fahrt
näherten sich die Zerstörer der Küste.
„Die setzen ja Boote aus!“ stellte Huber überrascht fest.
„Kameraden, jetzt sind wir an der Reihe. Ich fresse einen Besen mit Stiel, wenn die uns nicht holen wollen.“
Huber blieben Besen und Stiel erspart. Die Boote kamen langsam an Land, ein paar Marineoffiziere stiegen aus, besprachen sich kurz mit den Führern der beiden Heereseinheiten
und gingen wieder zurück auf die Boote.
Kurz darauf kam das Kommando:
„Fertigmachen! – Antreten! – Ohne Tritt, marsch!“
Was nun folgte, spielte sich in wenigen Augenblicken mit kasernenmäßiger Exaktheit ab, als habe man dieses Manöver hundertmal vorher exerziert. Kaum waren die Grenadiere und Pioniere in die Boote gestiegen, da hielten die schnellen, vollbesetzten Fahrzeuge schon wieder auf die Zerstörer zu. Einmal, zweimal, dreimal - immer wieder.
Der Pionierleutnant hatte es plötzlich eilig. Seine Leute wurden schon ungeduldig, als sie entdeckten, dass jede einzelne Gruppe auf einen anderen Zerstörer kam. Nur der Obergefreite
Hannekamp und seine beiden, für das Sonderkommando ausgesuchten Freiwilligen blieben zurück.
Hannekamp machte ein bedrücktes Gesicht.
„Und was wird mit uns?“ wandte er sich bekümmert an seinen Leutnant.
„Ihr kommt mit einem Zug Grenadiere auf den Führerzerstörer, rief er ihnen im Fortgehen zu. Ehe Hannekamp etwas erwidern konnte, war er schon auf eines der bereitstehenden Boote gesprungen.
„Was hat er gesagt, der Alte?“ erkundigte sich Hannekamp bei seinen beiden ahnungslos zurückbleibenden Kameraden.
„Hals- und Beinbruch? Sieht mir auch ganz danach aus!“
Auch im Krieg gab es merkwürdige Dinge. Beispielsweise die neue Freundschaft zwischen Xaver Huber und dem Grenadier, der soeben zu den Pionieren gestoßen war. Ein waschechter Bayer und ein Berliner!
Sie saßen auf einer Kiste, an die Bootswand gelehnt, und rauchten die Zigarette, die der Berliner zum Auftakt der neuen Freundschaft spendiert hatte.
„Es ist die letzte“, stellte Otto Maschke betrübt fest und blies den Rauch vor sich hin, „ich hoffe, du kannst dich revanchieren.“
Immer näher kamen die Boote an die Zerstörer heran.
Maschke warf seine Kippe über Bord und lehnte sich weit nach vorn, um das Anlegemanöver besser verfolgen zu können.
„Mensch“, stellte er voller Anerkennung fest, „ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich noch einmal auf einem solchen Kahn fahren würde. Ist doch was anderes als unsere Spreeschatullen in Berlin.“
„Da siehst du mal wieder, mein lieber Otto“, schaltete sich jetzt auch der Gefreite Weber in das Gespräch der beiden ein, ,,was dir der Kommiss so alles zu bieten hat. Sogar eine Seereise.“
Maschke sah missmutig auf.
„Nu halt mal die Luft an, mein Lieber.“
Inzwischen hatte das Boot schon am Zerstörer angelegt. Ratlos standen die Grenadiere und Pioniere da. Von oben fielen ihnen Strickleitern entgegen. Sie griffen danach und stiegen schließlich mit unsicheren Bewegungen hinauf. Es verging fast eine Stunde, bis auch der letzte Mann an Deck des Zerstörers stand. Das Gedränge war furchtbar, es löste sich erst allmählich auf, als die Männer eingeteilt waren und in den zugewiesenen Kammern verschwanden. Endlich kam Ruhe in das Schiff.
Alles schien sich wie vorgesehen einzuspielen.
Nur Oberfeldwebel Stablack rannte noch wie ein Besessener hin und her, um seine Leute wieder zusammenzubekommen. Als er gerade die Tür zu einer Mannschaftsunterkünfte öffnen wollte, stieß er mit einem ihm unbekannten Soldaten zusammen.
Stablack schnappte nach Luft.
„Sie trübe Tasse, können Sie nicht grüßen?” fuhr er den Mann an und stellte sich breitbeinig zwischen Tür und Angel.
„Jawoll, Herr ...“, stieß der Mariner hastig hervor, während er versuchte, die Rangabzeichen des vor ihm stehenden Infanteristen zu erkennen.
„Wer sind Sie?“
„Obermarinezerstörergefreiter!“
Stablack sperrte vor Überraschung Mund und Nase weit auf. So etwas war ihm in seiner ganzen Laufbahn noch nicht vorgekommen. Doch ehe er sich wieder gefasst und den Matrosen
auf Vordermann gebracht hatte, war der Mann schon verschwunden und in der Menge untergetaucht.
Das Gelächter der Landser schwoll stärker an.
In das Gegröle tönte plötzlich die Schiffsglocke. Das Lachen verstummte.
Die Landser horchten auf und sahen sich ratlos an.
„Leute, nun macht mal flott. Es gibt Abendbrot.“
Maschke löste sich als erster aus der allgemeinen Erstarrung.
„Bei dir piept’s wohl, was?“ Der Sanitätsgefreite Riedel tippte mit dem Finger an die Schläfe.
„Was gilt die Wette?“
„Die verlierst du, mein Lieber“, schaltete sich jetzt auch der Obergefreite Hannekamp in die Meinungsverschiedenheit der beiden ein.
Maschke machte ein etwas betretenes Gesicht. Ganz wohl war ihm schon nicht mehr in seiner Haut.
„Woher willst du das wissen?“
„Hast du mal was von Gefechtsbereitschaft gehört? Wohl noch nicht, was? Bist ja auch noch nie auf einem solchen Pott gefahren. Aber ich, mein Lieber, ich schon, damals bei Drontheim“, erklärte Hannekamp.
„Kinder, nun macht euch mal auf was gefasst.“
„Und das sagst du erst jetzt?“
Maschke Schob sich näher an den Obergefreiten heran, um mehr zu erfahren.
„Und wie läuft der Laden hier nun weiter?“
„Abwarten!“ meinte Hannekamp in seiner besonnenen Art. „Meinst du, ich bin Hellseher?“ Aber vielleicht wusste Stablack mehr. Stablack? Wo war er geblieben?
Die suchenden Blicke des Obergefreiten erfassten jeden Zentimeter des Raumes, aber Oberfeldwebel Stablack schien sich in Luft aufgelöst zu haben.
Es war erstaunlich, wie schnell sich die seeungewohnten Männer mit der neuen Situation abfanden. Die Gruppe des Unteroffiziers Hegenau lag mit den Pionieren des Sonderkommandos zusammen in einem Raum. Hegenau hatte sich bereits in die Koje eines
Bootsmanns verdrückt und schlief. Das gleichförmige Rasseln seines Atems erfüllte den kleinen Raum. Die Landser waren unter sich.
„Leute!“ Otto Maschke unterbrach die Stille mit einem Vorschlag, wie er nur von ihm kommen konnte.
„Ich mache mich mal auf die Socken. Es muss doch irgendwo was zum Essen geben. Menschenskinder, hab’ ich einen Kohldampft.“
Er erhob sich schwerfällig und ging auf die Tür zu. Weiter kam er nicht.
Sanft schob ihn die Hand eines Matrosengefreiten in die Kammer zurück.
„Komm mir bloß nicht an die Wäsche“, riet Maschke dem Matrosen mit einem scharfen Unterton in der Stimme.
„Ich will hier raus. Man wird doch wohl noch etwas Luft schnappen dürfen.“
„Man darf eben nicht!“
Das breite Grinsen des Matrosengefreiten wirkte auf Maschke wie ein rotes Tuch.
„Da werde ich dich auch gerade noch fragen.“ Maschke schob den Matrosen beiseite und wollte das muffige Loch verlassen.
Abermals hielt ihn der Matrose zurück.
„Befehl vom Kommandanten! Kein Grenadier darf sich an Bord sehen lassen!“
Maschke kniff wütend die Augen zusammen und sah den Matrosengefreiten angriffslustig an.