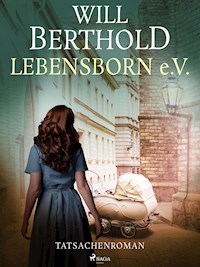
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser auf Tatsachen beruhende Roman beschreibt ein unfassbares Verbrechen der NS-Zeit: Der von Hitler ins Leben gerufene Verein "Lebensborn" zur "Züchtung" von Menschen nach den nordischen Idealen der Nazis. Die Fortpflanzung wurde vom Staat reguliert und erfolgte auf Befehl, doch kurz nach der Geburt wurden die Kinder den Frauen weggenommen und lernten ihre Eltern nie kennen. Will Berthold rückt dieses erschreckende Thema auf eindrucksvolle Weise in den Fokus. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Lebensborn e.V. - Tatsachenroman
Saga
Lebensborn e.V. - TatsachenromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1982, 2020 Will Berthold und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726444735
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
»Ich ließ zunächst mehr inoffiziell durchblicken, daß jede unverheiratete Frau, die sich allein auf der Welt befindet, aber gern ein Kind will, sich vertrauensvoll an den Lebensborn wenden soll. Die Reichsführung SS wird das Kind adoptieren und für seine Erziehung sorgen. Ich war mir klar, daß dies einen revolutionären Schritt bedeutete . . . Aber Sie können sich vorstellen, daß wir nur wertvolle und rassisch einwandfreie Männer als Begattungshelfer verwenden . . . Man wird sehen, was wir erst aus der Sache machen, wenn der Krieg vorbei ist. Da wird es für jede deutsche Frau Ehrensache werden, wenn sie mit dreißig immer noch kinderlos ist, ihr Kind auf diese Weise zu bekommen. Dann wird sich auch niemand mehr dagegen sträuben, wenn wir die Sache nicht mehr auf freiwilliger Basis machen, sondern gesetzlich erzwingen . . .«
Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, am 9. Mai 1943 zu seinem Leibarzt und späteren Biographen Kersten. (Aus dem Kapitel »Die neue Bigamie« der Kersten-Memoiren.)
Dieser Roman um mißbrauchte Mütter und verlorene Kinder stützt sich auf genaue Dokumentation durch Akten des Militärtribunals in Nürnberg, durch Aussagen von Lebensborn-Mitgliedern und von Müttern, die mit dem Lebensborn in Berührung gekommen sind, und durch eidesstattliche Erklärungen von Zeugen, die aus persönlichem Augenschein die Rassepolitik des Dritten Reiches kannten.
1. KAPITEL
Der Mai füllte die Luft mit Frühling. Am Nachmittag hatte es geregnet. Jetzt hingen die Dampfnebel der warmen, schwellenden Nacht in den Zweigen der Bäume wie weiße Tücher, die sich verfangen hatten. Von den Blättern fielen träge Tropfen. Um die steinernen Kandelaber der schmiedeeisernen Leuchten tanzten die ersten Mücken durch die feuchte Luft.
Nur Schritte auf dem knirschenden Kies unterbrachen die Stille des Abends. In der Ferne schlug eine Turmuhr an. Doris lehnte sich leicht gegen den Mann. Sie fühlte den Druck seiner Hand auf ihrem Arm. Sie wußte, daß sie seine Hand nach der Trennung noch lange spüren würde: fester als weich und drängender als kühl . . .
»Klaus«, sagte sie leise, fast bittend.
Der Mond drehte seine Scheibe aus den Wolken. Das Licht strich über den jungen Fliegeroffizier. Er war hochgewachsen, aber schmal, sehnig, aber nicht kräftig. Seine lederne Gesichtsfarbe paßte nicht zu seinem hellen Blondhaar, so wenig wie sein Alter zu seinem Mund. Klaus Steinbach war 24 Jahre alt, und die Kerben links und rechts der Lippen stammten aus mindestens doppelt so vielen Luftkämpfen.
»Klaus«, setzte Doris zum zweitenmal an, » . . . dieser Urlaub . . . war er schön?«
Er blieb stehen. Das Lachen löschte die Falten in seinem Gesicht. Jetzt war er wieder der unbekümmerte Junge, dem die Mädchen in die Augen sahen, während sie an seinen Mund dachten. Der junge Oberleutnant sah besser als gut aus. Aber er wußte es nicht. Er war ein Idealtyp seiner Zeit. Er konnte nichts dafür. Er glaubte an dieses Leben des Jahres 1941, und er lebte in diesem Glauben . . .
»Warum willst du es hören?«
»Weil ich es wissen möchte.«
»Und warum willst du es wissen?«
»Weil ich es glauben möchte . . .«
»Ja«, erwiderte er, »es war schön . . . es ist sehr schön.«
»Und morgen mußt du wieder zurück . . .«, sagte Doris.
»Ich kann nichts daran ändern«, antwortete er härter, als er wollte.
»Du kommst wieder . . .«, entgegnete das Mädchen mit banger Sicherheit.
»Zu dir«, erwiderte er.
»Zu uns«, sagte sie. Doris hatte lange, schmale Hände. Manchmal dachte Klaus, daß sie das Schönste an ihr seien. Aber sie hatte auch lange, schlanke Beine. Und am Ende solcher Betrachtungen fand er immer alles gleich schön an ihr: die fast unnatürlich großen Blauaugen, die sich verdunkeln konnten wie der Himmel. Die unnatürlich kleinen Ohren, die in ihren Wuschelhaaren steckten wie Ornamente. Der Mund, der gleichzeitig lächelte und grübelte. Nur vor ihrer Stirn empfand Klaus Scheu. Sie war hoch und streng. Es war die Stirne eines Mädchens und einer Frau zugleich. In seinen Gedanken wenigstens oder bestimmt in seinen Träumen.
»Was denkst du?« fragte Doris.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, strich ihm mit flüchtiger Hand das Haar zurecht.
Er straffte sich, wie immer, wenn sie ihn berührte. Aus Wilder Erwartung, wie aus verhaltener Scheu. Aber Doris merkte es nicht. Klaus sah in ihre Augen. Sie verschwammen vor ihm mit dem Dunkelblau, das die Nacht trug. Das unwirkliche Licht des Mondes versilberte den goldenen Flaum auf ihrer Stirne unter dem Haaransatz. Er mußte an sich halten, um sie nicht in seine Arme zu reißen.
»Was hast du?« fragte sie weich.
»Nichts«, versetzte er gepreßt.
Sechzehn Tage, dachte der junge Offizier, und kein Tag, kaum eine Stunde ohne Doris. Sie hatten zusammen Tennis gespielt. Sie waren an den Fluß gefahren. Sie saßen im Kino nebeneinander. Und sie besuchten sich gegenseitig bei den Eltern. Sie gingen über ihre Gefühle wie über Brücken, die zum gleichen Ufer führten.
Und doch blieb ein Rest. Er spürte diesen Rest, wenn er Doris küßte. Er küßte sie nie anders, wie er es das erstemal als Primaner getan hatte. Es war stets, als ob die Wilde Welle, die über ihm zusammenschlug, an einer gläsernen Wand aufliefe. Aber Oberleutnant Steinbach war kein Primaner mehr. Verdammt, er wollte kein Porzellan zerschlagen. Aber er wollte diese Glaswand zertrümmern. Sooft er Doris an sich zog, fühlte er ihr sanftes Ausweichen.
Schon zu Beginn des Urlaubs. Aber heute war das Ende. Die Zeit ließ sich nicht stoppen. In diesem Moment hörte der junge Offizier im stillen Stadtpark das Dröhnen der Motoren, das Belfern der Bordkanonen, das Krachen der Bomben, das Heulen des Sturzflugs . . .
Sie gingen weiter. Einen Moment war Klaus eifersüchtig auf die Dunkelheit, die sich um den schlanken Körper des Mädchens legte. Der Kies zerbrach unter seinen Stiefeln. Seine Hände wurden heiß. Er suchte nach Worten und fand sie nicht.
»Ist etwas . . . mit uns?« fragte Doris.
»Nein«, antwortete er rauh.
Sie hakte sich bei ihm ein. Die Schwüle der Nacht hatte für sie keinen Doppelsinn. Plötzlich lachte sie leise.
»Weißt du noch«, fragte sie, während sie mit dem Arm auf den kleinen Platz neben dem Parkweg deutete. Das Brett einer Kinderwippe lag im Mondlicht. Sie hatten den Spielplatz des Parks erreicht, » . . . wie mir der Junge die Sandformen wegnehmen wollte . . . und du ihn dafür verprügelt hast?«
»Ja . . . ich glaube . . .«, entgegnete der Oberleutnant zerstreut. Dann brummelte er: »Wir können doch nicht immer im Sandkasten spielen . . .«
»Eigentlich schade«, versetzte Doris lachend. Dann erst bemerkte sie seinen Trotz. Seine Augen wandten sich vom Spielplatz ab. Er starrte verbissen geradeaus. Das Mädchen betrachtete ihn von der Seite. Klaus, dachte sie: mit sechs sah er nur mein Spielzeug, mit acht meine Zöpfe, mit zwölf meinen Nacken, mit vierzehn sah er an mir vorbei, mit sechzehn sah er mir nach, und dann begegneten sich unsere Augen allmählich, und dann immer häufiger, um einander nicht wieder loszulassen.
Sie hatten das Ende des Parks erreicht. Der Weg gabelte sich.
Sie gingen nach links, nach Hause. Doris enttäuscht, daß ihre Parkpromenade so rasch endete, Klaus mit seltsam drängenden, ziehenden Schritten.
»Du«, sagte er heiser, »kommst du . . . ich meine . . . trinken wir bei uns noch . . . etwas?«
Die Befangenheit schnitt ihm den Faden ab. Er kam sich wie ertappt vor.
Doris erwiderte schlicht:
»Gern, Klaus.«
Plötzlich begann der Ball in seiner Brust zu springen. Er redete ohne Pause. Er kürzte den Weg mit Belanglosigkeit ab. Er hatte Angst, die Freundin könnte es sich anders überlegen. Aber sie dachte nicht daran. Sie verstand so wenig von ihm wie er von ihr. Und darum betrachteten sie beide ihre Gefühle wie ein unbegreifliches Wunder . . .
Im Hause brannte kein Licht mehr. Er ging voraus. Er dämpfte unwillkürlich seinen Schritt. Doris merkte es und wunderte sich. Heimlichkeiten waren ihr peinlich. Sie gingen über den dicken Läufer, erreichten das Zimmer, das Klaus schon als Junge bewohnt hatte, ganz oben, im Dachgeschoß.
Doris besuchte ihn nicht zum erstenmal. Langsam zog er die Tür hinter sich zu. Der junge Offizier stand ein paar Sekunden als ob er Wurzeln schlagen wollte. Er starrte das Mädchen an, betrachtete ihre Lippen, die halb kindlich, halb geöffnet waren. Sein Blick strich über den gelben Flaum auf ihren nackten Armen, die sich plötzlich wie von selbst verschränkten. Er tastete sich weiter zu dem viereckigen Ausschnitt ihres leichten Sommerkleides. Doris betrachtete ihn immer noch verwundert. Er wich ihren Augen aus.
»Setz dich doch«, sagte er mit belegter Stimme.
Gleichzeitig legte er den Arm um ihre Schultern und drückte sie auf die Couch. Er stieß mit dem Kopf an, aber er spürte es nicht. Er schmiegte sein Gesicht, seinen Mund an ihren Hals.
Doris schmollte leise. Ihre Hand umklammerte sein Armgelenk. Er rang wortlos um etwas, das sich nicht erzwingen ließ. Als er es merkte, lag er ganz still, beschämt, betroffen, geschlagen.
»Ach, Klaus . . .«, sagte Doris weich. Ihre Finger spielten mit seinen Ohren, seinen Haaren. Aber ihre Augen wanderten an ihm vorbei. Sie waren blau wie ein See im Sommer. Sie waren naß. Trotzdem nahmen sie in diesem Moment jede Einzelheit des Zimmers in sich auf. Dabei kannte Doris alles: den gemusterten Teppich. Den flachen Kacheltisch. Den bunten Aschenbecher, den sie ihm selbst geschenkt hatte. Den bequemen Klubsessel, der früher unten stand, aus dem sie als Kinder immer vertrieben wurden, weil sie mit den Schuhen nicht auf dem Leder herumsteigen sollten. Das Bücherbord, über dem, stilisiert und konserviert, das Hitlerbild hing. Daneben ein abgebrochener Luftschraubenflügel, als Souvenir der ersten Bruchlandung.
In Doris’ Augen saßen Tränen. Sie fürchtete, daß sie sein Zimmer, das für sie ein Stück Heimat bedeutete, unter seinem ungestümen Drängen Verloren hatte.
»Klaus . . .«, sagte sie bittend, während er seinen Kopf an ihrer Schulter versteckte, »versteh mich doch . . . wir wollen uns das doch aufheben . . . später nach dem Krieg . . . er ist ja bald zu Ende . . .«
Der junge Offizier schwieg.
»Es wäre so«, fuhr Doris mit der Stimme eines Kindes fort, »wie es . . . alle machen . . . so billig . . .«
Er richtete sich halb auf, stützte die Hand gegen die Schläfen.
»Morgen gehst du . . . an die Front . . . und am Abend davor . . . müßt ihr mit euren Mädchen . . .« Sie stöhnte leise und drehte den Kopf zur Seite. »Es ist so billig . . .«, wiederholte sie, »es ist wie ein Programm. Und davor habe ich Angst . . .«
»Ja«, entgegnete Klaus hart, »man kann es auch so nennen.« Und nach einer Weile sagte er: »Daß ich vielleicht nicht wiederkomme, daran hast du wohl nicht gedacht . . . und daß ich . . .«
Er brach erschrocken ab, weil ihm die Ungeheuerlichkeit noch rechtzeitig bewußt wurde. Er hatte sagen wollen: Und daß ich ein Recht darauf habe, bevor ich krepiere . . . wenigstens einmal glücklich zu sein . . .
Klaus machte sich von ihr los. Er stand schwerfällig auf. Mit fahriger Bewegung suchte er den Kognak. Er schenkte sich zuerst ein, kippte das randvolle Glas mit einem Zug hinunter.
Jetzt erhob sich auch Doris, strich ihr Kleid glatt. Er brachte sie die Treppe hinunter. Er stand vor ihr, zwischen Zorn und Verlegenheit.
Doris lehnte den Kopf an seine Brust. Er merkte, daß sie zitterte. Sie versuchte, ihn zu küssen. Aber ihre Lippen waren kühl, und sein Mund blieb verschlossen.
»Komm wieder, Klaus . . .«, sagte Doris.
Dann drehte sie sich rasch um und ging hinaus.
Er starrte ihr nach.
Noch ein paarmal schlägt der Propeller der Me 109 pfeifend durch die Luft. Dann reißt das leerlaufende Dröhnen der Maschine ab. Der Motor steht. Die Bordwarte stürzen wie schwarze Termiten über die Jagdmaschine, klettern auf die Flächen, reißen das Kabinendach auf, helfen ihrem Kommodore aus den Gurten. Unteroffiziere, Mannschaften, Offiziere des Jagdgeschwaders wetzen über den E-Hafen in Nordfrankreich, um dem Chef zu gratulieren. Bevor er landete, wackelte er dreimal mit den Tragflächen. Abschuß heißt das . . .
Oberstleutnant Berendsen winkt ab, während er sich aus der Maschine schwingt.
»Gebt mir lieber ’ne Zigarre«, schnarrt er gut gelaunt.
Er betrachtet den blauen Rauch der Brasil, die man immer für ihn bereit hält . . . falls er zurückkommt. Und dann blinzelt er in die Sonne, von der er eben auf eine Spitfire herabstieß.
»Alsdann«, sagt er und tippt lässig an die Mütze.
Seine Männer bilden eine Gasse. Er geht langsam über den Platz, im Knochensack. Er ist kleiner als seine jungen Leutnants. Sein Gesicht wirkt breit und bullig, mit einem Unterkiefer wie aus Nußbaumholz. Er ist ein Offizier nach dem Geschmack seiner Männer. Er sitzt lieber in der Kiste als am Schreibtisch, er trinkt lieber Schnaps als Wein, und er küßt lieber Schwarz als Blond. Sein Leben ist verdammt einfach: ein Draufgänger in der Luft, ein Haudegen im Suff. Sein bescheidenes Rezept lautet: fliegen, schießen, sterben und sterben lassen. Der Krieg ist ihm gleichgültig, aber Luftkämpfe interessieren ihn . . .
Das Donnern der Geschwadermaschinen, die nach ihm einfliegen, verebbt hinter ihm im Korridor der Horstkommandantur. Oberstleutnant Berendsen öffnet die Türe seines Zimmers mit einem Fußtritt gegen die Klinke, wie immer.
Der Adjutant, Hauptmann Albrecht, nimmt Haltung an.
»Nu, wie sieht’s aus?« schmettert Berendsen.
Der Adjutant hat die Unterschriftenmappe schon griffbereit.
»Nein, nein . . . lassen Sie mich doch mit dem Papierkrieg in Frieden . . . Was ist mit der zweiten Staffel?«
Hauptmann Albrecht betrachtet die Schreibtischplatte. Im Rahmen der psychologischen Behandlung seines Kommodore hätte er das lieber an den Schluß seines Berichts gesetzt. Er beginnt, die Pille zu versüßen:
»Hauptmann Wernecke hat zwei schöne Abschüsse gemeldet . . .«
»Na, großartig!«
Jetzt fährt der Adjutant trübsinnig fort:
»Aber Leutnant von Bernheim wurde leider abgeschossen.«
»So . . .«
»Oberfeldwebel Rissmann bei Bruchlandung schwer verletzt . . .«
»Auch das noch . . .«
Der Chef tigert in seinem Büro auf und ab, wie immer, wenn sich bei diesen Hiobsbotschaften seine Vorstellung vom fröhlichen Jägerleben trübt. Der Krieg wird ihm erst noch das Fürchten beibringen. Jetzt im Jahre 1941 ist für ihn der Heldentod nur Ungeschicklichkeit.
»Ist das alles?« knurrt er.
»Vorläufig«, erwidert der Adjutant vorsichtig. »Die Meldung der dritten Staffel steht noch aus . . .«
Oberstleutnant Berendsen deutet unvermittelt auf die Unterschriftenmappe.
»Na, zeigen Sie schon her . . .«
Der Hauptmann referiert die Eingänge: Nachschublisten, Bestandsaufnahmen, Geschwaderbefehle, Urlaubsverordnungen, Rapport-Meldungen . . .
Der Kommodore kratzt sich im Stehen mit der Füllfeder, ohne hinzusehen. Die Gurte seiner Kombination baumeln herunter. Hauptmann Albrecht blättert um. Er hat die Papiere nach Wichtigkeit geordnet.
»Lauter Mist!« brummt Berendsen.
»Hier noch eine Anfrage der Wehrbetreuung . . . ob wir ein Fronttheater wollen . . .«
»Ach . . .«, winkt der Oberstleutnant ab, »immer noch die alten Schicksen?«
»Nein, neue, Herr Oberstleutnant.«
»Dann brauchen Sie mich doch nicht zu fragen . . .«
Der Kommodore bleibt vor seinem Schreibtisch stehen, holt eine Flasche Kognak aus dem Fach, füllt zwei Gläser.
»Noch etwas?« fragt er.
»Ja«, erwidert der Adjutant, »ein Rundschreiben von der SS . . . die haben da eine Organisation . . . werben Mitglieder . . .«
Oberstleutnant Berendsen nimmt zerstreut das geheime Schreiben in die Hand.
»Bei uns?« fragt er etwas hilflos.
»Auch«, bestätigt Hauptmann Albrecht. »Lebensborn e. V. . . . jeder Deutsche kann beitreten . . . kostet eine Mark im Monat . . .«
Der Chef pafft an seiner Zigarre.
»Was . . . Lebensborn? Klingt wie ’n Kindergarten . . . Was ist denn das schon wieder für ein arischer Schmonzes?«
Der Adjutant nimmt ihm das Schreiben aus der Hand.
»Darf ich?« fragt er.
Dann liest er leiernd:
» . . . Ein Volk, das sein höchstes Gut, seine Kinder vernachlässigt, ist reif für den Untergang . . .«
»Nicht so viel Theorie, Albrecht«, unterbricht ihn Berendsen ungeduldig, »was wollen die denn eigentlich?«
»Mitglieder«, antwortet der Adjutant lakonisch. »Das Rundschreiben ist von Himmler selbst unterzeichnet«, setzt er dann hastig hinzu, » . . . die Bewerber sollen groß und blond sein . . . nur Männer mit einwandfreiem, nordischem Aussehen . . . und überzeugte Nationalsozialisten . . .«
Das Gesicht des Kommodore bleibt undurchsichtig.
»Na ja«, brummt er. »Aber wir können nicht dauernd Fehlanzeigen melden . . . einer muß in den sauren Apfel beißen! . . . Suchen Sie einen jüngeren Offizier aus, der sich freiwillig meldet . . .«
Hauptmann Albrecht hat Falten auf der Stirn.
»Nordisch . . . nordisch . . . nordisch«, murmelt er.
»Wie wär’s mit Steinbach?« fragt der Kommodore, »der sieht doch aus, als ob er aus Walhalla entlaufen wäre . . . Nehmen Sie den . . .«, sagt er abschließend.
Dann reicht er seinem Adjutanten den Kognak.
»Sagen Sie mal, Albrecht, Sie lieben wohl den Reichsführer SS nicht besonders?«
»Nach Ihnen, Herr Oberstleutnant«, erwidert der Adjutant vorsichtig.
»Gut . . . trinken wir auf den Geschmack.«
Noch bevor das Glas geleert ist, fliegt die Tür auf. Ein Unteroffizier der Funkstelle meldet sich mit strammer Ehrenbezeigung. Berendsen betrachtet ihn irritiert.
»Was ist los?«
»Meldung von der ersten Staffel . . . Oberleutnant Steinbach . . . abgeschossen . . .«
»Abgeschossen?« wiederholt der Kommodore mechanisch. Er schluckt, geht an das Fenster.
Hauptmann Albrecht fragt bitter:
»Soll ich nun für den Lebensborn ein anderes Mitglied namhaft machen?«
Oberstleutnant Berendsen dreht sich langsam um.
»Scheiße!« sagt er.
Dann verläßt er langsam den Raum.
›Lebensborn e. V.‹ verfügte über ein Dutzend Heime, über 700 Angestellte und ein paar hunderttausend Mitglieder. Die meisten von ihnen wußten nicht viel von den eigentlichen Zielen des eingetragenen Vereins. Sie waren nur fördernde Mitglieder. In seinem ersten Befehl sprach der Reichsführer SS davon; daß man kinderreiche Mütter unterstützen müßte. Das klang beinahe vernünftig und einleuchtend. In seiner zweiten Anordnung tönte Himmler bereits, daß man auch der unehelichen Mutter den vollen Schutz der Gesellschaft geben müßte. In seinem dritten Erlaß aber befahl Heinrich Himmler mit Verhohlener Offenheit, das uneheliche Kind planmäßig zu zeugen. Wie man Autos produziert. Wie man Geflügel auf der Hühnerfarm züchtet.
Die Wände der Zentrale glichen zur Hälfte einer Kinderklinik und zur anderen einer Bildersammlung. Sie hingen im Rahmen an der Wand, waren gleich groß und gleich kitschig: der Rassechef persönlich, fahl und nicht eben nordisch. Der entlaufene Architekt Rosenberg. Der Propagandaminister Goebbels. Der Arbeitsführer Ley. Sie alle blickten mit gläsernen Augen aus hölzernen Rahmen auf ein Werk, wie es die Geschichte nicht noch einmal kennt. Auf eine Erfindung ohne Beispiel. Auf einen Frevel ohne Grenzen.
Und auf der anderen Seite hingen unschuldige Kinderköpfe in einer Reihe.
Der Nationalsozialismus hatte Gott abgeschafft, die Stukas und den Kunsthonig erfunden. Das braune Reich hatte den Heldentod in Mode gebracht. Und jetzt machte sich das System daran, Kinder am Fließband herzustellen. Mit einer am Papier errechneten Kopfform. Mit einer vorher bestimmten Augenfarbe. Mit einer Mindestkörpergröße. Gezeugt ohne Liebe. Erzogen ohne Gott. Heranwachsend ohne Mutter. Kinder, die statt beten boxen und statt lieben hassen lernen sollten. Kinder des Führers . . .
Auch SS-Sturmbannführer Westroff-Meyer sah nicht gerade aus wie das Endprodukt seines unheimlichen Werkes. Er leitete die Aktion römisch zwo, arabisch eins, Heim Z. Er war prall in den Hüften und massig im Genick. In seinem Gesicht kontrastierte das schlaffe Maul eines Karpfens mit den kleinen Augen eines Hechtes. Daneben trug er an den Wangen das Emblem des Korpsstudenten, Säbelschmisse, die aus der Zeit stammten, als der Führer noch nicht den Boxhandschuh entdeckt hatte.
Der Sturmbannführer diktierte erregt und konfus, wie immer mit erhobener, salbadernder Stimme, wenn er Ungeheuerlichkeiten schwarz auf weiß festlegte. Er hatte Jura studiert und Schiffbruch erlitten. Er war auf Medizin ausgewichen und im Physikum hängengeblieben. Seinem Vater wurde es zu dumm. Er entzog ihm den Monatswechsel. Und so verstärkte Heinz Westroff-Meyer das namenlose Heer der Abenteurer, die hinter dem Hakenkreuz herliefen.
Er aber wollte nicht namenlos bleiben.
» . . . Deshalb . . .«, diktierte er seiner Sekretärin, »sind alle Maßnahmen besonders geheimzuhalten . . . Es ist dafür zu sorgen, daß die künftigen Mütter schon vor der Geburt auf ihre Kinder verzichten. Die Säuglinge sind rechtzeitig von den Müttern zu trennen . . . Nur in Ausnahmefällen darf gestattet werden, daß die für die Aktion ausgewählten Mädchen unter einskommasiebzig groß sind. Auch verheiratete Frauen sind grundsätzlich zugelassen; So ihre Männer an der Front stehen, ist Sondergenehmigung einzuholen . . . Es besteht Veranlassung, noch einmal auf die absolute Geheimhaltung hinzuweisen. Zu gegebener Zeit wird sich der Reichsführer SS zu diesem großen Werk für Großdeutschland bekennen . . . Bis zu dieser Zeit aber ist alles zu unterlassen, was die kämpfende Bevölkerung beunruhigen könnte . . . Die Volksaufklärung wird zur rechten Zeit einen Wandel der öffentlichen Meinung herbeiführen . . .«
Der Sturmbannführer unterbrach seinen Fußmarsch.
»Haben Sie es?« fragte er seine Sekretärin.
» . . . einen Wandel der öffentlichen Meinung herbeiführen«, leierte das blasse Mädchen.
»Gut«, antwortete Westroff-Meyer, »Heil Hitler . . . das Übliche . . .«
Er ließ sich auf einen Stuhl fallen, zündete sich eine Zigarette an.
»Ich fahre selbst zur Aktion II-1, Heim Z . . . Große Sache, einmalige Sache!« setzte er hinzu. »Der Reichsführer ist ein Genie!«
Das Mädchen nickte mit willigem Nacken. Sie hieß Schmidt, und da sie kleiner als einskommasiebzig war, nannte man sie Schmidtchen. Sie hatte sich abgewöhnt, den Kopf zu schütteln. Sie glaubte an die Bewegung. Aber seitdem sie beim Lebensborn war, bewegte sich in ihrem armen Kopf zuviel . . .
1939 entstand diese seltsame Organisation mit dem unauffälligen Status eines eingetragenen Vereins, dessen Führung Himmler persönlich übernommen hatte. Er rechnete sich aus, daß im Zweiten Weltkrieg Hunderttausende, wenn nicht Millionen junger Männer fallen würden. Er zog sie von der Summe der gleichaltrigen Frauen ab, die zwangsläufig nicht mehr heiraten konnten. Die Bilanz war der Kinderverlust.
Das brachte ihn auf den Gedanken: die Toten des Zweiten Weltkriegs sollten zuerst noch ihre ›biologische Pflicht‹ erfüllen. Es sollte, nach Himmler, zumindest kein Blondschopf mehr unter dem Birkenkreuz eingegraben werden, bevor der Gefallene nicht Vater geworden war. Die Zeugung der reinen nordischen Rasse freilich blieb das Endziel des Lebensborns, der jetzt eben aus dem Stadium der Planung heraustrat.
Das SS-Rasse- und Siedlungshauptamt wollte deshalb das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden und schickte sich an, eine Art Rassensteuerung zu betreiben. Die Versuche, die der ahnungslose Pfarrer Gregor Mendel mit Pflanzen angestellt hatte, verpflanzten die Machthaber des Dritten Reiches einfach auf Menschen. Mit allen Mitteln. Vielleicht beleuchtet nichts deutlicher die Bewegung als der Lebensborn: der Sieg der Ignoranz über die Intelligenz. Die Auflösung des Anstandes in Wahnsinn.
Für die unsauberen Ziele erfand man als Afterwissenschaft die Rassenhygiene. Ein Herr Günther wurde zum Propheten der Dummheit und lieferte die Würze zu dem braunen Plan.
Selbst in der Hilfsschule konnte man lernen, daß sich das deutsche Volk aus einem Schmelztiegel von Völkern im Laufe der Jahrhunderte gebildet hatte. Mit diesem geschichtlichen Prozeß wollten nunmehr Männer à la Westroff-Meyer kurzen Prozeß machen. Sie schickten sich an, eine ›neue Rasse‹ mit den gleichen Mitteln zu schaffen, wie man einem morschen Apfelbaum einen frischen Ast aufpfropft . . .
»So«, sagte der SS-Sturmbannführer, »fertig für heute.«
»Wo ist denn eigentlich das Heim Z?« fragte Schmidtchen.
»In Polen«, antwortete er, »vorläufig . . . wir werden es bald nach Oberbayern verlegen . . .«
»Und die Mädchen sind . . . einfach so . . . so bereit?«
»Wie meinen Sie das?« fragte Westroff-Meyer scharf.
»Na, ich denke . . . ich meine . . . die Kinder . . .«
»Die Kinder?« fragte er mit gehobenen Augenbrauen.
»Was sind das . . . für Mütter . . . die ihre Kinder . . .«
Der Sturmbannführer schwoll an. Seine fleischigen Ohrläppchen wurden rot.
»Schänden Sie nicht das Opfer dieser deutschesten aller Frauen!« brüllte er.
Er knallte die Tür zu, wuchtete über den Gang.
Wir haben noch eine harte Erziehungsarbeit vor uns, dachte er . . .
2. KAPITEL
Er spürte den Ruck nicht mehr, mit dem sich der Fallschirm geöffnet hatte. Aber nach ein paar Sekunden kam Oberleutnant Klaus Steinbach zu sich, pendelte nach links, nach rechts. Eine Fangleine hatte sich über die weiße Seide gezogen. Und der Fallschirm glitt mit erhöhter Geschwindigkeit als ›Brötchen‹ zur Erde; statt mit fünf Metern Fallgeschwindigkeit sauste er mit acht bis zehn nach unten.
Dem jungen Offizier war es gelungen, in 3000 Meter Höhe, Sekunden vor der Explosion, aus der brennenden Me auszusteigen. Er sah nach unten, und die Welt schaukelte vor seinen Augen.
Ein Wäldchen. Der Wind trieb ihn nach rechts, auf die Bäume zu. Ein Hochspannungsmast. 200 Meter unter ihm. Ein paar Sekunden glitt er auf gleicher Höhe nach unten. So lange stellte er sich vor, wie er an den Drähten zu einem Klumpen zusammen-, schmoren würde. Er zappelte hilflos an den Leinen. Er bäumte sich dagegen.
Dann klatschte er in einen Strauch. Die Äste zerschnitten ihm das Gesicht. Sein Fuß schmerzte höllisch. Er versuchte sich zu bewegen. Nichts zu machen. Er konnte nicht mehr aufstehen. Das Gelenk war verstaucht oder gebrochen. Er konnte nur kriechen.
Nach ein paar hundert Metern gab er es auf, legte sich auf den Rücken, spürte die noch warme Septembersonne, umfaßte mit einem Blick den wolkenlos blauen Himmel der Normandie, döste ein, erwachte wieder am späten Nachmittag, hatte fürchterlichen Hunger, konnte sich noch immer nicht rühren.
Seitdem liegt er Stunde um Stunde. Der Knochensack klebt nicht mehr am Leib. Er friert. Kein Mensch zu sehen. Keine Spur von Orientierung. Der Bauer, der ihn hier findet, kann sein Mörder sein. Oder sein Helfer. Es gibt gute und schlechte Menschen in Frankreich. Aber alle hassen sie die Boches. Nach der Meinung des jungen Oberleutnants grundlos . . .
Der Fuß schmerzt noch mehr. Das Gelenk ist verstaucht, nicht gebrochen, denkt er, sonst müßte mir viel übler sein. Er sieht die Sterne am nachtklaren Himmel. Er sucht mechanisch den Großen Bären, den Kleinen Bären, den Polarstem. Vielleicht sieht auch Doris, die längst beim weiblichen RAD ist, jetzt nach oben, überlegt er, und denkt jetzt an mich, wie ich an sie . . .
Auf einmal ist ihm noch kälter. Jetzt erst wird ihm bewußt, wie dicht er am Ende vorbeigegangen ist.
Am Morgen kommt ein Mistfuhrwerk. Der junge Oberleutnant ruft den Bauern an. Der Mann hält erschrocken, hilft dann dem Verletzten beim Aufsteigen. Geschafft, denkt Klaus. Mit vereinten Kräften kommt er über den Eingang der Mairie, findet ein Telefon, lacht schon wieder.
Nach einer Stunde endlich ist der Adjutant Hauptmann Albrecht in der Leitung.
»Mensch, Sie leben!« brüllt er, stellt die Ortschaft fest. »Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich schicke Ihnen einen Wagen.«
So fein ist die Luftwaffe noch im Herbst des Jahres 1941.
150 Kilometer sind es zum E-Hafen. Und jeden von ihnen spürt Klaus in seinem Bein. Ein französischer Zivilarzt hat ihn untersucht und verbunden. Es ist eine handfeste Stauchung, weiter nichts. Der Oberleutnant rechnet sich aus, daß er in vierzehn Tagen schon wieder fliegen kann.
Die Kameraden haben seine Rückkehr ins Leben bereits gefeiert. Am nüchternsten wirkt noch der Kommodore, der am meisten getrunken hat. Er klopft Steinbach auf die Schulter.
»Freut mich«, sagt er, »freut mich ganz außergewöhnlich!«
Neben ihm steht der Adjutant.
»Helfen Sie mir doch . . .«, wendet sich Berendsen an ihn, »da war doch etwas mit Steinbach . . . oder?«
»Ja«, erwidert Hauptmann Albrecht, »Lebensborn . . .«
Der Geschwaderchef setzt sich auf einen Stuhl neben Klaus.
»Hören Sie mal«, beginnt er, »wie groß sind Sie?«
»Einen Meter zweiundachtzig.«
»Prima . . . HJ?«
»Ja.«
»Führer?«
»Gefolgschaftsführer, Herr Oberstleutnant.«
»Partei auch?«
»Selbstverständlich, Herr Oberstleutnant.«
»Noch ’ne Gliederung?«
»Ja . . . NS-Fliegerbund.«
»Na, Mensch. Sie sind in allem drin . . . da kommt’s Ihnen doch auf einen Haufen mehr oder weniger nicht mehr an?«
»Wie meinen Herr Oberstleutnant?«
»Es wird ein überzeugter Nationalsozialist gesucht . . . schön«, fährt der Kommodore grinsend fort. »Aber er muß auch noch groß und blond und was weiß ich sonst noch sein . . . Wollen Sie, Steinbach?«
»Zu Befehl, Herr Oberstleutnant.«
»Quatsch, nicht Befehl . . . freiwillig müssen Sie sich melden!«
»Ich melde mich selbstverständlich freiwillig, Herr Oberstleutnant.«
»Das klingt prima . . . und jetzt trinken Sie einen, und unterschreiben Sie den Wisch.«
Der junge Oberleutnant, der darauf brennt, sich für Führer, Volk und Vaterland zu bewähren, tut beides.
Er unterschreibt die Beitrittserklärung zum Lebensborn.
Er ahnt nicht, daß er einen Blankoscheck für sein eigen Fleisch und Blut ausstellt . . .
Die Mädchen schufteten im Trainingsanzug. Sie hatten am Vortag der Besichtigung die Baracken zu scheuern. Sie taten es mit viel Wasser und ebensoviel Hysterie. Die Größe der Zeit machte es erforderlich, daß sie marschierten, schrubbten und sangen. Im gleichen Schritt und Tritt . . .
Am Abend tobte die Lehrgangsleiterin beim Appell, weil noch ein Müllkübel nicht geleert und ein Führerbild nicht abgestaubt war. Hundert Jungführerinnen des weiblichen Reichsarbeitsdienstes standen vor den Spinden der Führerschule und beeilten sich, in ihren Gesichtern Schuld auszudrücken. Denn sie verwechselten die Angst ihrer Chefin vor der Besichtigung mit eigenem Versagen.
Unter ihnen war die blonde Doris Korff. Sie kam vor vier Monaten zum RAD. Die ungelüfteten, engen Stuben der Baracke hatten sie den Blumenduft in der weitläufigen Villa ihrer Eltern längst vergessen lassen. Nicht ungern, denn Doris hatte das Leben der väterlichen Wohlhabenheit bereitwillig mit der Stunde der Bewährung vertauscht. Klaus stand an der Front, also hatte sie sich an eine andere Front zu begeben. Das war ihre einfache, gerade Überzeugung. Der Vater hatte vergeblich versucht, sie davon abzubringen. Aber die eigene Mütter bestärkte sie. Mit Stolz in den Augen hatte Frau Direktor Korff auf einem ihrer politischen Tees den Kränzchenfreundinnen mitgeteilt, daß ihre einzige Tochter Doris nun auch dem Vaterlande diene.
Mit Besenstiel, Unkrauthacke und Kartoffelmesser . . .
Doris schwang den Besenstiel, als wäre er ein Tanzpartner. Sie trug das grobe, braune Tuch wie eine elegante Abendrobe. Sie jätete so verbissen Unkraut, als gelte es, Deutschlands Feinde auszumerzen. Sie verdarb sich die Hände und verschnitt sich die Frisur. Sie verzichtete auf Parfüm und gewöhnte sich an den Mief. Sie wollte kein Mädchen sein, sondern eine Maid. Für Führer, Klaus und Vaterland . . .
Nach zwei Monaten schon war ihr Eifer aufgefallen. Nach vier wurde er belohnt. Man ernannte Doris außer der Reihe zur Jungführerin. Dann beorderte man sie auf die Führerschule. Sonderlehrgang. Und morgen sollte die Besichtigung sein. Keineswegs die erste, und noch lange nicht die letzte. Denn die Kommissionen waren an der Barackenordnung . . .
Erst spät in der Nacht gab sich die Lehrgangsleiterin mit dem Zustand des Lagers für den großen Tag zufrieden.
»Na, nun bin ich aber mal gespannt, was für nette Onkels uns morgen bekieken werden«, sagte Erika, eine der beiden Stubenkameradinnen von Doris, und verschränkte dabei die Arme über dem karierten Kopfkissen.
Lotte, die andere, lag still und steif in ihrem Bett.
»Ich bin müde«, sagte Doris, »nun macht endlich das Licht aus.«
»Immer so ’n Theater«, brummelte Erika, »muß das ganze Lager kopfstehen, bloß weil da ein paar Heinis kommen. Und was wolln sie besichtigen? Nichts anderes als unsere Beine . . . Ist doch jedesmal dasselbe.«
Lotte setzte sich steil in ihr Bett. Sie trug die Gretchenfrisur zur Nacht aufgesteckt, als hätten die alten Germanen die Haarnadeln erfunden.
»Ich verbitte mir das!« schrie sie ihre beiden Stubengenossinnen an, »daß ihr so . . . so gemein über unsere Führer sprecht . . .«
Die Besichtigung am änderen Tag verlief ungefähr so, wie es Erika vorausgesagt hatte. Ungefähr.
Dieses Mädchen bewies überhaupt einen Sinn fürs Praktische. Erika war nicht aus Begeisterung zum RAD gegangen, sondern aus Mangel an Begeisterungsfähigkeit. Sie hielt die Uniform für angenehmer als die Rüstung, und für das, was sie ihre Freiheit nannte, nahm sie zeitweiligen Zwang gern in Kauf. Zur Führerinnenlaufbahn hatte sie sich gemeldet, weil die Luft oben gesünder war als unten. Ihren Spind stattete sie mit Männerfotos aus, und in ihrer Freizeit verschickte sie Grüße, daß es ihr gut ginge.
Erst im Gemeinschaftsraum merkten die Mädchen, daß diesmal die Besichtigung von einem SS-Führer geleitet wurde. Die Stühle und Mädchen standen still, als ihm die Lehrgangsleiterin meldete.
Der SS-Offizier dankte mehr als herzlich. Dann wandte er sich dem hakenkreuzverhängten Podium zu, neben dem ganzjährig die gleichen Grünpflanzen standen, wie sie gern in Metzgerauslagen ausgestellt werden.
»Schnieker Bursche«, sagte Erika und spitzte die fülligen Lippen.
»Kameradinnen«, rief der SS-Führer in den Saal.
Lotte hielt den Kopf fast andächtig schief. Auf ihrem Mausgesicht erschienen hellrote Kreisflecken, als hätte man ihr das Parteiabzeichen als Abziehbild hinaufgedrückt.
»Ich freue mich, daß ich heute zu euch sprechen darf«, schmetterte der Schwarzuniformierte. Seine Haare, borstig kurzgeschnitten, sahen aus, als ob sie sich beim Anblick der 20 Stuhlreihen voll braun uniformierten Charmes sträuben würden.
»Wir alle kämpfen für eine Idee, einen Gedanken, ein Werk: für den Endsieg! Ihr Mädchen, ihr jungen Frauen, ihr Führerinnen, die ihr daran teilhabt, die ihr eure ganz persönlichen Opfer dafür bringt, seid gewiß, daß es euch der Führer mit seiner Sorge in seinen einsamen Stunden täglich hundertmal vergilt . . .«
Die geleckten, abgegriffenen Worte der Parteisprache quollen wie Nebel in den Raum. Die Mädchen überlegten nicht, wie ihnen Hitler die Tonnen abgeraspelter Kartoffelschalen je vergelten könnte, sondern sie bekamen bei dem Gedanken an des Führers blaue Augen sehnsüchtige Lippen. Nicht alle, aber der SS-Führer rechnete ohnedies nur mit einer Minderheit . . .
»Ihr alle werdet sagen, wenn ich euch jetzt frage: Seid ihr Nationalsozialisten? Da werdet ihr sagen: ja . . . Aber seid ehrlich! Seid ihr es wirklich? Mit heißem Herzen, ganzer Hingabe, mit jeder Faser eures Lebens, eures Daseins . . .?«
Es rauschte durch die Stuhlreihen. Ein paar helle Mädchenstimmen riefen:
»Ja!«
Über ihnen lag Lottes Zustimmung wie ein Supersopran.
Der SS-Führer lächelte nicht. Er senkte den Kopf. Es sah aus, als ob er seine Ergriffenheit verbergen wollte.
»Wenn ich euch aber nun frage«, er schlug die Augen wieder auf, und sein Blick war wie verschleiert, »wer von euch will dem Führer ein wirkliches Opfer bringen? Ein echtes, großes, einmaliges Geburtstagsgeschenk . . .? Wer würde es tun . . .?. Wer?« brüllte er mit gesteigerter Stimme in den Saal.
Hundert Arme fuhren fast gleichzeitig in die Höhe. Der Funktionär des Systems war ebenso geschickt wie verlogen, ebenso plump wie gerissen. Er winkte lächelnd ab. Mit modulierter Stimme erklärte er den Mädchen, um was es sich handelte, ohne ihnen etwas zu erläutern.
»Ihr sollt euch nicht leichtsinnig in etwas stürzen, zu dem ihr dann nicht stehen könnt«, sagte er. »Eure Bereitschaft ehrt euch . . . aber ihr sollt wissen, daß es ein hohes Opfer ist, das ihr bringen dürft . . . das höchste Opfer einer deutschen Frau . . . Überlegt es euch!« hetzte er weiter, »ihr habt alle Freiheit, euch zu entscheiden . . .«
Und wieder brannte der Wille zur Bewährung in den jungen Gesichtern. Dabei hatte keine der Maiden eine Ahnung, wovon der Sprecher redete. Er benutzte die vermeintliche Offenheit als Mantel der Lüge.
Es waren keine hundert Mädchenarme mehr, die sich in die Luft reckten. Ein paar fielen in sich zusammen wie zaghafte Flämmchen. Dann noch ein paar. Aber es waren nicht allzuviele, die im Angesicht der Kameradinnen den Mut aufbrachten, feige zu sein. Auf diesem Trick basierte die Rechnung. Der SS-Führer konnte, lächelnd mit den Fingern gegen das Pult trommelnd, das Endergebnis abwarten.
Doris streckte die Rechte noch immer aus. Jetzt zögerte sie eine Sekunde. Sie spürte ein Kribbeln in den Fingerspitzen. Aber die neben ihr sitzende Lotte verfolgte mit hämischen Augen alle, die ihre Meldung zurückzogen.
»Eine Schande«, zischte sie, »so eine Schande!« Lotte fand es unglaublich, daß ein deutsches Mädchen sich weigern konnte, dem Führer etwas zu schenken, was er forderte.
So fing sich Doris wieder. Es blieb bei ihrer Meldung. Was soll schon kommen, dachte sie ernst und schlüssig. Der Führer will nichts Unrechtes! Man wird uns auf Frontlazarette verteilen. Ich werde Klaus näher sein. Ich bin ihm diese Meldung schuldig, dachte sie . . .
Der Werber zählte noch einmal die Hände. Dann stellte er die Geburtstagsliste zusammen. Die Mädchen mußten einzeln vortreten und sich eintragen. Die Falle schnappte zu . . .
Lautlos zunächst. Es ging wie am Fließband. Während der Offizier seine Rede gehalten hatte, bauten seine bis dahin unsichtbaren Helfer in den drei angrenzenden Barackenräumen Schreibtische und Geräte auf.
Wenn die Arbeitsmaiden am Podium ihre Namen nannten, wurden sie in den Nebenraum geschleust. Doris sah auf dem Aktendeckel die Aufschrift ›Lebensborn‹. Es sagte ihr nichts.
Dann standen zwei Ärzte im weißen Kittel vor ihr. Unter den Mänteln starrten die Militärstiefel hervor, aus den Kragen die SS-Runen. Es kamen jeweils fünf Mädchen in den ersten Raum.
»Schöner Gabentisch«, sagte Erika leise zu Doris und deutete auf die ärztlichen Instrumente.
Die Ärzte hantierten wortlos. Vor den Augen der Mädchen tanzten Meßgeräte. Zirkel wurden an die Hinterköpfe gesetzt. Seltsame Holzleisten gegen die Stirn gepreßt. Die Männer in den weißen Kitteln murmelten Zahlen, die sie von ihren Geräten ablasen, warfen sie ihren Schreibern zu wie ein Kammerbulle den Rekruten zu kurz geratene Uniformstücke.
Doris versuchte, den Ärzten in die Augen zu sehen. Aber sie begegnete nur ausdruckslosen Blicken, die wohl ihren Kopf, aber nicht das Gesicht zur Kenntnis nahmen. Nur den Schädel. Er wurde betastet wie eine Ware. Minutenlang.
»Nordisch«, konstatierte einer der Ärzte befriedigt.
»Guter Kopf«, erwiderte der andere, »ideale Form.« Er sagte es nicht zu Doris, sondern zu seinem Kollegen, als spräche er nicht über ein Mädchen, sondern über einen Gaul beim Roßmarkt.
»Da hinaus«, sagte der Schreiber.
Doris und Erika betraten den nächsten Raum.
Die kesse Berlinerin flüsterte:
»Wußte gar nicht, daß bei der SS lauter Spezialisten für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten sind.«
»Schädelmessung haben wir in der Schule auch schon gehabt«, entgegnete Doris tapfer.
Jetzt waren Ärztinnen da. Die Mädchen mußten sich ausziehen. Die Untersuchung war gründlich und dauerte lange.
Schließlich standen sie alle wieder angekleidet auf dem Flur, Dann wurden mehr als die Hälfte abberufen. Sie waren geprüft und für tauglich erklärt worden. Lotte keuchte:
»Gott sei Dank, sie haben mich doch genommen!«
Es blieben noch 14 Mädchen übrig, die die Kommission für würdig befunden hatte, im Namen der deutschen Frau dem Führer ein Opfer zu bringen. Sie sahen einander ratlos an. Sie konnten nicht ahnen, was ihnen bevorstehen sollte.
»Donnerwetter«, sagte Erika auf einmal. Ihr Blick ging schnell von einer Kameradin zur anderen. »Blondinen bevorzugt, wie?« stieß sie hervor. »Alle blond . . . alle blaue Augen . . . alle groß?«
Die Arbeitsmaiden starrten sich an. Sie erschraken auf Kommando wie junge Katzen, die sich erstmals im Spiegel begegnen.
»So ein Zufall.« Lotte lächelte hohl.
»Bei mir schon«, grinste Erika, »mein Alter hat ’ne Glatze, meine Mutter ist fuchsrot, und meine Brüder sind pechschwarz . . . Glück muß der Mensch haben . . . und blond muß er sein!« Die anderen Maiden schwiegen betreten.
Der SS-Führer erschien wieder.
»Sie können sich gratulieren«, trompetete er, »Sie sind angenommen ., . wir bleiben in Verbindung.«
Die Kommission fuhr wieder ab. Die Mädchen gingen zurück auf ihre Stuben. Am ersten Tag nach der Untersuchung rätselten sie noch. Am zweiten gaben sie es auf. Am dritten hatten sie es vergessen. Am vierten schrubbten sie wieder Böden, putzten wieder Bohnen und hackten wieder Kartoffeln. Sie lernten, wie man RAD-Führerin wird, und was es heißt, junge Mädchen bei sinnloser Arbeit sinnvoll zu kommandieren.
Acht Tage später stürzte Erika zu Lotte und Doris atemlos in die Stube.
»Die haben uns ’reingelegt!« schrie sie außer Fassung. Sie sah die stets beleidigte Lotte und stieß sie an. »Weißt du, was du unserem Führer schenken sollst, du Schneegans?« Ihre Stimme überschlug sich. »Ein Kind sollst du ihm schenken.«
Doris betrachtete die Stubenkameradin wie eine Verrückte.
»Ihr glaubt’s wohl nicht?« zischte Erika. »Ich hab’s selbst gelesen . . . in der Schreibstube.«
Doris schüttelte den Kopf.
»Wir kommen alle in ein Heim«, rief Erika . . . »Die Männer sind auch schon bestellt . . . und dann«, ihre Stimme wurde wieder überlaut und häßlich. »Und dann, na . . . gute Nacht! Viel Vergnügen . . . Bruthennen seid ihr, weiter nichts.«
»Halt den Mund!« fuhr Lotte sie an.
»Das gibt es nicht«, erwiderte Doris leise. Sie hatte recht. Nur wußte sie noch nicht, daß man recht haben und trotzdem irren kann . . .
Sie wischte die Gedanken aus ihrem Bewußtsein. Das war dummes Geschwätz der Miesmacher.
Am nächsten Tag erschien SS-Sturmbannführer Heinz Westroff-Meyer auf der RAD-Schule und versammelte die ausgewählten vierzehn Maiden, alle blond, alle blauäugig, alle übereinssiebzig groß, um sich.
Die Auserwählten saßen in einer Reihe wie verängstigte Hühner nach einem Gewitter. Sie teilten den Blick zwischen dem Barackenboden und dem Sturmbannführer Westroff-Meyer. Sie trugen grobe Röcke in der häßlichsten Farbe, die es gibt, und dazu weiße Blusen, aus denen sich wie hilflos die gebräunten Arme schälten. Die Zeit schrieb ihnen vor, Schuhe mit flachen Absätzen zu tragen und Lieder mit platten Texten zu singen. Vorne, am rechten Flügel: Lotte, gläubig, beinahe verzückt; daneben Doris, ängstlich, beinahe entsetzt; hinter ihr Erika, belustigt, beinahe verächtlich. Dann das Rudel der anderen elf Mädchen, alle blond, alle groß, alle blauäugig, alle jung, alle idealistisch, alle dazu ausersehen, zwischen die Mühlsteine des Systems zu geraten.
»Kameradinnen«, begann der Sturmbannführer, »ich komme aus Berlin . . . ich soll euch den persönlichen Dank des Führers für euer einmaliges Opfer übermitteln.«
Ihr Stolz kämpfte mit ihrer Unruhe. Sie horchten und hofften, freudebang, doch ahnungsschwer.
»Die Stunde der Bewährung ist gekommen. Ihr fahrt morgen in den Einsatz. Ich will versuchen, ihn euch zu erklären . . .«
Seine dunkelbehaarte Hand, die an einem seltsam dünnen rosa Gelenk hing, bewegte sich unruhig am Lederkoppel.
»Die arische Rasse verblutet in einem Schicksalskampf gegen den bolschewistischen Untermenschen. Wir werden diesen Krieg gewinnen! Aber unter großen Opfern. Es gilt, das Volk und seine Rasse zu erhalten . . .!«
Der Sturmbannführer brach ab. Sein Blick zielte nach den Augen der Mädchen, schnell und durchdringend. Die roten Schmisse in seinem Gesicht zuckten. Sein Karpfenmaul wurde zum Torpedorohr. Seine Lippen katapultierten die Maiden, die wie hypnotisiert auf ihren Schemeln saßen.
»Ihr werdet ab morgen an einem Sonderlehrgang teilnehmen. Ihr werdet auf Männer stoßen, die sich im Kampf bereits bewährt haben und deren rassische Substanz von uns ebenso geprüft wurde wie die eure. Ihr dürft stolz darauf sein, daß ihr zur Elite, zur höchsten Auswahl, die es geben kann, gehört . . .«
Jetzt mußte Westroff-Meyer ins Detail gehen. Er mußte diesen 14 Mädchen das ungeheuerliche Programm mitteilen, das seine Organisation, der Lebensborn, ›durchführen‹ wollte. In diesem Moment war er nicht mehr der dunkelhaarige, olivhäutige Cäsar mit dem hehren, hohlen Pathos, sondern er wirkte ganz schlicht wie eine in die Ecke getriebene Ratte.
Doris schaltete ab. Die rassehygienische Berieselungsanlage tropfte an ihr vorbei. In diesem Moment sah sie Klaus, den Oberleutnant der Luftwaffe, vor sich. Er lächelte ihr zu, und die Kerben links und rechts seiner Lippen verschwanden. Er war wieder der unbekümmerte Junge, dem die Mädchen in die Augen sahen, während sie an seinen Mund dachten. Ihre Lippen formten lautlos seinen Namen. Sie lächelte. Er hatte recht gehabt. Sie mußten jetzt die Scheu abstreifen. Sie gehörten zusammen. Vor aller Welt. Für alle Zeit. Doris spürte seinen Arm auf ihren Schultern, Seine Augen brannten auf ihrem Gesicht. Sie streichelte seinen Namen, seine Haare, seine Schläfen. Sie sah ihn, wie er in die Maschine stieg, und über ihr Gesicht huschte die Angst. Und dann rollte die Me aus. Das Kabinendach wurde beiseite geschleudert, und ein schlaksiger Junge mit einem strahlenden Gesicht stieg aus. Doris wollte nach ihm greifen, wollte ihm etwas sagen . . . im nächsten Urlaub, Klaus . . . – da stand wieder der SS-Sturmbannführer Westroff-Meyer vor ihr.
»Es ist mein Wunsch, es ist der Wunsch des ganzen Volkes, daß diese edelsten Männer, die an dem Lehrgang teilnehmen, eure Partner werden . . . ich will nicht verhehlen, daß sich der Lebensborn aus dieser Begegnung ein Kind erwartet . . .«
Er hob sofort abwehrend die Hände.
»Am liebsten wäre es uns, wenn ihr euch zu einer Ehe mit diesen Männern entschließen könntet. Aber . . .«, fuhr er gedehnt fort, »die Bewegung kann ihren Nachwuchs nicht mehr dem Zufall überlassen . . . deshalb müssen wir im großen, im ganz großen Stil, künftig die Elternauswahl treffen . . . auch da, wo eine Ehe unmöglich ist, die sonst den vollen Schutz des Nationalsozialismus genießt.«
Er entlastete seine strapazierten Stimmbänder, sprach jetzt weich und gefällig:
»Und ihr werdet sagen: und wo bleibt die Liebe? Jawohl«, gab er sich selbst die Antwort, »die Bewegung ist auch für die Liebe. Aber nur zwischen geeigneten Partnern . . . Die schmutzige, schwüle, sinnliche Erotik herkömmlicher Art . . . – das muß einmal deutlich gesagt werden – ist eine jüdische Erfindung, die wir nicht weit genug von uns weisen können. Wir wollen Sauberkeit statt Schmutz! Wir fördern Verantwortung statt Kitsch . . .! Wir erwarten keine Kinder des Zufalls, sondern Garanten des Reiches!«
Die 14 Arbeitsmaiden des Führerinnenlehrgangs erschraken in Linie zu einem Glied. Selbst Lotte zuckte zusammen, lächelte mit fahlen Lippen. Aber dann wurden ihre Augen groß, gläubig. Ihr Gesicht rötete sich, gab die Antwort: sie war bereit. Als erste.
Erika schüttelte ganz einfach den Kopf. Irene sah auf den Boden. Sie wollte aktive RAD-Führerin werden. Sie hatte zu tun, was man ihr befahl.
Vor Doris drehte sich alles. Niemals, dachte sie! Das kann kein Mensch von mir verlangen, nicht einmal der Führer, der vielleicht von dieser Sache gar nichts weiß.
Sie schwiegen. Sie schwitzten. Sie husteten. Sie wagten es nicht, einander anzusehen. Sie brauchten noch Zeit, um die ungeheuerliche Förderung zu verdauen.
»Ich muß noch einmal sagen«, fuhr der Sturmbannführer fort, »daß alles freiwillig ist. Ihr seid bei dem Lehrgang nicht genötigt, euch zu etwas zu entschließen, zu dem ihr hinterher nicht stehen könnt . . .«
Er suchte wieder schnell und einschüchternd ihre Augen.
»Ihr seid als Vorkämpferinnen auserwählt. Seid stolz darauf, Vorposten für Großdeutschland zu sein! Ich weiß, die Zeit ist noch nicht reif, um euer Opfer ganz zu erfassen . . . vielleicht sind eure Eltern noch zu sehr im Gestern verwurzelt, um eure einmalige Tat zu begreifen . . . vielleicht habt ihr persönliche Gründe, sie nicht offenkundig werden zu lassen . . . Wir haben deshalb Vorkehrungen getroffen, euch unter den vollen Schutz der Bewegung zu stellen . . .«
Wieder senkte er die Stimme. Wieder kämpfte er einen Augenblick mit der Verlegenheit. Und wieder siegte die Routine über den Anstand.
»Es wird keine Eintragung eurer Kinder in das standesamtliche Register erfolgen . . . ihr werdet sie in einem Heim des Lebensborns zur Welt bringen, der sie dann geschlossen zu guten Deutschen, zu Nationalsozialisten erzieht . . . ihr dürft sie in den besten Händen wissen. Sie werden die Führergeneration von morgen stellen. Die Sorge um sie nimmt euch der Staat ab. Ihr werdet weder seelisch, noch wirtschaftlich durch sie belastet sein . . . und ihr sollt euch auch nicht an euren Partner gebunden fühlen . . . Wir erwarten noch viel mehr von euch: ihr sollt heiraten. Und ihr sollt dann mehrfache Mütter werden . . . aber das erste Kind für Adolf Hitler!«
Er redete noch zehn Minuten, in einer seltsamen Mischung aus Aufruhr und Besänftigung, dem üblichen Rotwelsch der Partei. Er nützte die Verwirrung der Mädchen aus. Er peitschte sie mit Worten. Er streichelte sie mit Phrasen. Er ließ sie nicht zum Nachdenken kommen.
Und dann rief er sie einzeln in den Nebenraum, zur endgültigen Verpflichtung für den Lebensborn. Er wollte sich jede noch einmal einzeln vornehmen.
13 Arbeitsmaiden blieben zurück, sagten nichts, lösten sich dann allmählich in Gruppen auf, die halblaut miteinander sprachen. Am Fenster standen Doris, Lotte und Erika, die in einer Barackenstube wohnten.
»Was sagt ihr jetzt?« fragte Erika.
»Unmöglich!« erwiderte Doris mit steifen Lippen.
»Ein Kind . . .«, begeisterte sich Lotte. Ihre Worte streichelten es bereits.
»Du dumme Gans kriegst sicher Zwillinge«, versetzte Erika hart.
Lotte überhörte es. Sie hatte ein neues Evangelium. Und sie war bereit, ihm blind zu folgen.
»Ein Glück, zu dieser Elite zu gehören.«
»Bestimmt«, versetzte Erika spöttisch, »je reinrassiger, desto dümmer . . . das siehst du schon im Hundezwinger.«
Bevor sie etwas entgegnen konnte, wurde Lotte aufgerufen. Sie ging schnell, als ob sie sich verspäten könnte.
Die zurückgebliebenen Mädchen berieten ratlos. Gefühlsmäßig waren sie fast alle gegen diese entmenschte Zumutung. Aber die Bewegung, in der sie aufgewachsen waren, hatte sie gelehrt, daß der Schnee heiß und das Feuer kalt, die Nächte hell und die Tage dunkel sind. So schwankten sie oder sie waren zu feige, zurückzutreten oder sie waren schlüssig, nein zu sagen . . . wenigstens, bis sie der Sturmbannführer noch einmal einzeln ins teuflische Gebet nahm.
Selbst Erika entschloß sich, zur Überraschung aller, den Vertrag zu unterschreiben, ganz einfach aus Neugier, wie die Sache weiterginge, in der Gewißheit, daß sie damit fertig würde.
Doris war als Vorletzte an der Reihe.
»Ich trete zurück«, erklärte sie.
»Warum?« fragte Westroff-Meyer.
»Persönliche Gründe«, erwiderte sie, »ich bin verlobt.«
Er nickte.
»Sie wissen, daß der Einsatz freiwillig ist?«
»Deswegen will ich ja nicht daran teilnehmen . . .«
»In erster Linie handelt es sich um einen Lehrgang«, fuhr der Sturmbannführer fort, »um eine Schulung . . . das andere . . . das ist nur ein Zweck am Rande . . . Kameradin«, sagte er mit plötzlichem Du, »ich glaube, eine Schulung kann gerade dir nicht schaden!«
Doris hob hilflos die Schultern. Westroff-Meyer machte ein paar schnelle Schritte und blieb neben ihr stehen.
»Bist du eine Nationalsozialistin?«
»Ja . . . das schon«, entgegnete sie zögernd.
»Hast du Vertrauen zum Führer?«





























