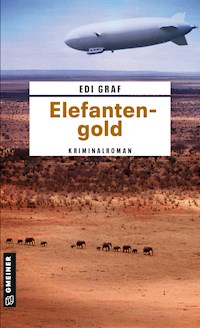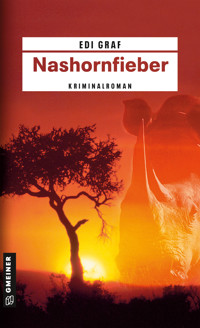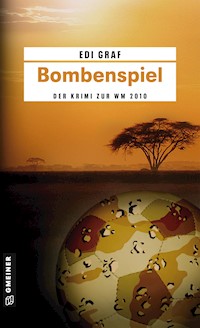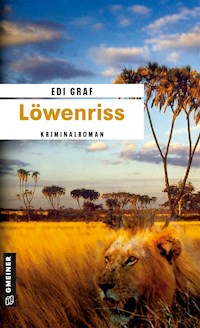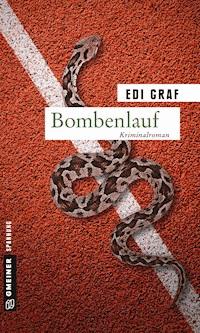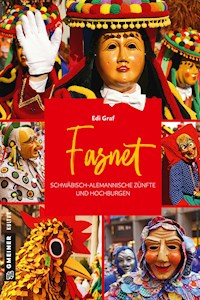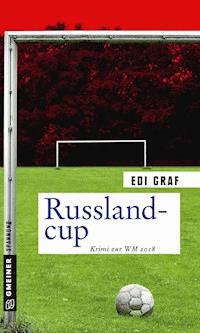Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalistin Linda Roloff
- Sprache: Deutsch
Er tötet seine Opfer wie ein Leopard. Die Leichen versteckt er auf Bäumen, seine todbringende Spur zieht sich vom Bodensee über den Schönbuch bis nach Afrika. Die Polizei jagt einen Mörder, der den Namen "Chui" - Leopard - trägt, und nur ein Ziel zu kennen scheint: Rache. Auf der Liste seiner Opfer taucht auch der Name der Tübinger Journalistin Linda Roloff auf. Sie ahnt, dass nur einer sie retten kann: der kenianische Safariführer Alan Scott, der weiß, wie "Chui" denkt. Doch Scott ist seit Wochen in Afrika verschwunden ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edi Graf
Leopardenjagd
Linda Roloffs vierter Fall
Zum Buch
Von Rache getriebenEr tötet seine Opfer wie ein Leopard. Die Leichen versteckt er auf Bäumen, seine todbringende Spur zieht sich vom Bodensee über den Schönbuch bis nach Afrika. Die Polizei jagt einen Mörder, der den Namen »Chui« – Leopard – trägt, und nur ein Ziel zu kennen scheint: Rache. Auf der Liste seiner Opfer taucht auch der Name der Tübinger Journalistin Linda Roloff auf. Sie ahnt, dass nur einer sie retten kann: der kenianische Safariführer Alan Scott, der weiß, wie »Chui« denkt. Doch Scott ist seit Wochen in Afrika verschwunden ...
Edi Graf, Jahrgang 1962, studierte Literaturwissenschaft in Tübingen und arbeitet als Moderator und Redakteur bei einem Sender der ARD. Zuhause ist er in Rottenburg am Neckar. Seit über 30 Jahren bereist der Autor den afrikanischen Kontinent und lässt neben seinen Protagonisten, der Journalistin Linda Roloff und ihrer Fernliebschaft, dem Safariführer Alan Scott, die gemeinsam zwischen Schwarzwald, Neckar und Afrika ermitteln, auch Tierwelt und Natur tragende Rollen zukommen. Er greift aktuelle und bewegende Themen auf und liefert dazu detailliert recherchierte Hintergründe, die er geschickt in den Plot integriert. Durch authentisch beschriebene reale Handlungsorte haucht er seinen Krimis Echtheit und Leben ein.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von Schwarzvogel, Photocase.de
ISBN 978-3-8392-3048-0
Widmung
Für unsere Tochter Rahel– afrikanische Sonne in unserem Leben –
Zitat
Rache trägt keine Frucht!
Sich selbst ist sie die fürchterlichste Nahrung,
ihr Genuss ist Mord, und ihre Sättigung das Grausen.
Friedrich Schiller – Wilhelm Tell
PROLOG
Montag, 21. November 1994, Kenya, Südküste
Der weiße Mann sah regungslos zu, wie die Leiche der Frau von der unruhigen Brandung am Riff verschlungen wurde. Der Ozean würde den Rest für ihn erledigen. Er konnte es sich nicht leisten, dass man ihre Leiche fand, zu viel stand auf dem Spiel. Spiel ist der passende Ausdruck, dachte er. Sie hatte mit ihm gespielt, und sie hatte verloren, weil sie das Spiel zum falschen Zeitpunkt beenden wollte.
Ihre letzten Minuten waren grausam gewesen, doch daran mochte er jetzt nicht denken. Das brodelnde Meer hatte seine milchige Gischt wie ein wogendes Leichentuch über ihren Körper gebreitet. Dort, wo noch vor wenigen Sekunden ihr gelbroter Sari aus dem Wasser ragte und ihm ein toter brauner Arm, von den Wogen emporgetrieben, zuwinkte, wie einst Käptn Ahab seiner Mannschaft, als er, an den Weißen Wal gefesselt, in den Fluten versank, war jetzt nichts zu sehen als das ewige Kommen und Gehen der grauen Unendlichkeit des Ozeans.
Der Regenschauer hatte die Touristen kurz vor Sonnenuntergang in die Hotels zurückgetrieben, und er war allein am Strand gewesen, als er das weiße Laken mit der Leiche in dem Auslegerboot verstaut und sich auf den Weg zur Riffkante gemacht hatte. Der Strand war menschenleer gewesen, das Meer eine grau in grau wabernde Wassermasse. Ein düsterer Regenvorhang, aus Süden kommend, entzog das kleine Boot bald dem neugierigen Blick des dunkelhäutigen Jungen, der dem weißen Mann unbeobachtet an den Strand gefolgt war und sich hinter dem Stamm einer Palme versteckt hielt.
Der weiße Mann blieb mit dem Ausleger am Riff, bis er auf die Haut durchnässt war und sicher sein konnte, dass die Leiche nicht wieder auftauchen würde. Hier, 300 Meter vor der Küste, würde niemand nach der Frau suchen. Die zurückgehende Flut würde sie aufs offene Meer hinaustreiben, wo die Räuber des Indischen Ozeans ihr Festmahl abhielten. Bewusst hatte er darauf verzichtet, sie mit einigen Kilo Blei aus dem Tauchcenter zu beschweren; sollte sie wider Erwarten an den Strand gespült werden, würde man sie für eine Ertrunkene halten und kein Mensch würde auf den Gedanken kommen, sie zu obduzieren, niemand würde ihren Körper nach Spuren absuchen, nach dem Sperma, das er in ihr hinterlassen hatte. Die blauen Male an ihrem Körper und die klaffende Wunde an ihrem Kopf, die der letzte, tödliche Hieb mit der Panga verursacht hatte, würde man als Verletzungen aus dem Meer ansehen. Vielleicht war sie im Kampf der Ertrinkenden gegen das Riff geschleudert worden, vielleicht war sie aus einem Boot gefallen und in die Schraube geraten, vielleicht, vielleicht, vielleicht …
Viel wahrscheinlicher war, dass man sie nie finden würde, ja, nicht einmal vermissen, zumindest nicht hier an der Küste, denn ihre Familie lebte weit entfernt im zentralen Hochland von Kenya. Er konnte nicht ahnen, dass es den kleinen Jungen gab, denn sie hatte ihren Sohn vor ihm geheim gehalten, nie über ihn gesprochen, nie von ihm erzählt.
Der Knabe hatte in der kleinen Hütte in Ukunda gewohnt, mit den anderen Kindern gespielt, sie hatte ihn nie mit ins Hotel gebracht. Nur dieses eine Mal war er ihr gefolgt. Heimlich. Geräuschlos wie Chui, der Leopard, auf seinem Beutezug. Wie es ihm die Älteren gezeigt hatten. Am Abend ihres Todes.
Er hatte ihre Spuren im Sand erkannt, war bis zu dem Zaun geschlichen, der das Hotelgelände umgab, und dort, wo er die schwarzweißen Mantelaffen über den Ast eines Flammenbaums aus dem Hotelgarten klettern sah, war er hineingelangt. Den Baum hinauf, auf dem Ast über den Zaun und hinunter ins Gras. Wie die Affen. Wie Chui.
Es hatte lange gedauert, bis er seine Mutter fand. Die Hütte stand neben einem kleinen Haus unter einer Akazie, abseits, von den übrigen Gebäuden der Hotelanlage durch eine hohe Hecke getrennt. Eine Kette versperrte den schmalen Zugang. Zuerst hatte er ihre Stimme erkannt, dann die Stimme des Mannes gehört. Sie hatten in einer Sprache gesprochen, die er nicht verstand. Er war unter der Kette hindurchgekrochen und hatte durch das glaslose Fenster in der Lehmwand gespäht. Eine Pritsche, ein paar Möbel, ein Durcheinander von leeren Kanistern, verbeulten Blechfässern, Holzstangen, Müll.
Er hatte gesehen, wie der Weiße seine Mutter an den Haaren zerrte und zu Boden warf. Hart traf die Faust ihr Gesicht und brach ihr das Nasenbein. Ihr gelbroter Sari war bis zu den Hüften hochgeschoben, blutend und wimmernd lag sie im Dreck, ihre schlanken Finger krallten sich in den klammen Lehmboden der Hütte, doch die kühle Erde vermochte nicht, das Brennen auf ihrer nackten Haut zu kühlen. Die Worte des Weißen klangen hart, aus ihrem Mund kam nur ein leises Wimmern. Er schlug zu, immer wieder, trat sie mit den Füßen wie im Rausch, schlug noch einmal zu, obwohl sich die Frau nicht mehr bewegte. Dann nahm er die Panga von der Wand und spaltete ihr den Schädel. Er hielt erst inne, als er das Geräusch an der Fensteröffnung vernahm.
Der Junge stand wie erstarrt und vermochte nicht, sich zu rühren. Tränen traten aus seinen Augen, sein Magen verkrampfte sich, Übelkeit stieg in ihm auf. Hatte der Mann ihn gesehen? Der Junge duckte sich, rannte zur Hecke und übergab sich.
Der Weiße trat vor die Hütte. Er hatte nicht die Augen, um Spuren zu finden. Der Junge lag, zitternd vor Angst, in seinem Erbrochenen und schloss die Augen. Er hörte, wie sich die Schritte des Weißen näherten. Er stapfte einmal um die Hütte und schien zu fluchen. Dann kam er auf sein Versteck zu. Zielstrebig. Er musste ihn entdecken!
Der krächzende Schrei ließ den Jungen zusammenzucken. Er riss die Augen auf und sah aus seinem Versteck zur Hütte hinüber. Die Mantelaffen jagten mit weiten Sätzen über das riedgedeckte Dach und suchten Schutz im dichten Blätterwald der Akazie. Der Weiße schimpfte jetzt laut und schleuderte den Affen ein paar Schoten hinterher, die verstreut im Gras lagen. Dann kehrte er in die Hütte zurück. Er musste sich beeilen, die Dämmerung hatte eingesetzt.
Als er Minuten später mit der Leiche der Frau, die er in ein Laken geschnürt hatte, aus der Hütte trat, folgte ihm Sam Mushowa.
Hinunter zum Ozean, der das Grab seiner Mutter werden sollte.
TEIL I SEEUFER
1
Zwölf Jahre später, Tsavo-Ost, Kenya
Hatte er einen Mörder beobachtet?
Er sah dieses Bild vor sich, immer und immer wieder. Diesen Mann, der dabei war, einen leblosen Körper auf einen Baum zu hieven. Die schlaffe Hülle, die als Last über der Schulter des schwer Atmenden hing. Das entsetzte Gesicht, als ihn der Überraschte anstarrte. Nur mit Mühe konnte er sich auf die rotsandige Piste konzentrieren, die über das flache Buschland entlang des Athi-River nach Südosten führte. Hier begann früher die für Touristen unzugängliche Region, die fast zwei Drittel des gesamten Tsavo-East umfasste. Doch jetzt wurde auch das ausgedehnte Gebiet entlang des Tiva für den Tourismus erschlossen und die Zeiten, wo er sich hier oben im Norden einsam in die Wildnis zurückziehen und seinen Gedanken nachhängen konnte, waren ein für allemal vorbei.
Die Sonne würde in einer Stunde hinter den Bergen des Yattaplateaus, die sich im Westen gegen den Horizont schoben, untergehen, dann würde die Nacht binnen weniger Minuten alles in Dunkelheit hüllen und den Jägern der Finsternis Tarnung bieten. Er musste versuchen, noch vorher den Parkausgang bei Maneaters Point und somit die Straße nach Voi und Mombasa zu erreichen.
Er hasste den Uhuru-Highway, die lange, monotone A 109, die von Nairobi zur Küste führte, und hatte den Umweg über Kitui gewählt, war in Mutomo abgebogen, um wieder einmal durch den Tsavo zu fahren. Zu lange würde er in den nächsten Wochen darauf verzichten müssen, und er liebte diese rotbraune Erde, in der er schon als Kind seine Fußabdrücke hinterlassen hatte. Tsavo, das war sein Afrika, zumindest ein Teil davon. Das Land der roten Erde. Große Herden von Elefanten, rot gefärbt durch die Staubbäder im trockenen Sand, unermessliche Savannen, endlos bis zum Horizont, Heimat von Büffel, Zebra, Leopard. Unten am Galana der schmale Streifen eines alten Galeriewalds, in dessen Bäumen Gelbschnabeltokos ihre Bruthöhlen und Weißrückengeier ihre Nistplätze hatten. Von den tiefhängenden Ästen stürzten sich die Graufischer auf ihren Jagdzügen ins Wasser und hoch über ihnen hielt der Kampfadler nach Beute Ausschau. Auf den sandigen Uferbänken sonnten sich regungslos die gepanzerten Echsen in trauter Zweisamkeit mit den dickleibigen Flusspferden, die ihre tonnenschweren Leiber an Land gewälzt hatten.
Er würde nach Deutschland fliegen, nachdem er in seiner kleinen Hütte am Diani-Beach noch das Notwendigste eingepackt hatte, und er wusste noch nicht, wie lange er blieb. Zum ersten Mal seit Jahren war er wieder verliebt. So verliebt, dass er sogar mit dem Gedanken spielte, Afrika für immer zu verlassen. Er hatte das Gefühl, dass seine Liebe zu Linda stark genug war, um diesen Verlust zu überwinden. Und vielleicht, so hoffte er im Stillen, wäre sie ja auch eines Tages bereit, ihm nach Afrika zu folgen.
Er hatte die Fahrt noch einmal genossen, die Herden an sich vorüberziehen lassen, Grantgazellen, Wasserböcke, Giraffen, Warzenschweine. Und die roten Elefanten. Jetzt musste er kräftig aufs Gas drücken, der Weg zum Tsavo-Tor war noch weit. Dort würde er als Erstes die Polizei verständigen.
Während der Landcruiser im schwächer werdenden Licht des scheidenden Tages über die Waschbrettpiste holperte, ging ihm diese seltsame Begegnung durch den Kopf. Zwei Männer, der eine tot, der andere, den Toten geschultert, unter den weit ausladenden Ästen der Schirmakazie verharrend, um deren Stamm sich die Wurzeln der Würgefeige wie eine hölzerne Todeskralle geschlungen hatten. Im Schatten der beiden ineinander verwachsenen Bäume hatte er den Mann erkannt. Der hatte gerade versucht, die Last von seiner Schulter auf den untersten, waagerecht verlaufenden Ast zu heben.
Seine scharfen Augen, die es gewohnt waren, im Busch die kleinste Bewegung wahrzunehmen und sogar die Fährte des zierlichen Löffelhundes während der Fahrt neben der Piste zu entdecken, hatten die seltsame Gestalt schon Minuten vorher entdeckt und beobachtet, wie sie ein schweres Bündel aus einem Fahrzeug hievte, schulterte und in Richtung der Würgefeige schritt. Im Fernglas hatte er das Gesicht des Tragenden für Sekunden scharf gestellt. Auf Höhe der beiden Bäume hatte er den Landcruiser ausrollen lassen und sich noch einmal vergewissert, ob ihn der Blick durch das Rohr nicht getäuscht hatte. Nein, er war sich trotz der großen Entfernung sicher gewesen: Den Mann kannte er. Sie hatten sich zwar schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen, doch es gab keinen Zweifel. Und so hatte er aus dem stehenden Fahrzeug heraus den Namen des anderen gerufen. Der war erschrocken herumgefahren, hatte die Last abgeworfen, eine Waffe gezogen und ohne Warnung auf ihn geschossen.
Er, der unbewaffnet war, hatte noch irgendetwas gerufen wie Hey, was soll das, begrüßt man so einen alten Freund, und seinen Namen hinübergebrüllt, doch der andere hatte zwei weitere Schüsse abgegeben, die ebenso wie die ersten fehlgegangen waren. Er hatte sich hinter die Beifahrertür gebückt, den Rover gestartet und versucht, so schnell es ging aus der Schusslinie zu kommen. Wirre Gedanken waren ihm durch den Kopf gegangen. Was hatte all das zu bedeuten? In jenem Moment, als das Bündel am Boden lag, hatte er darin den Körper eines Menschen erkannt und wußte, dass sein Bekannter hier im Tsavo versuchte, eine Leiche zu beseitigen.
Und Alan Scott war sich sicher, in ihm Lucas Wayne erkannt zu haben.
2
Der Befehl war eindeutig: Der Mann, auf den Nickson Kitema neben der Piste wartete, durfte die Straße nach Mombasa nicht erreichen. Weshalb – danach hatte er nicht gefragt. Es ging ihn nichts an, und es interessierte ihn auch nicht. Das Honorar würde stimmen. Im Geist fühlte er schon das Bündel Geldscheine in seiner Brusttasche. Für diese Summe würde er ihn locker umlegen. Es würde ihm nichts ausmachen. Seit er damals, 1997, im Vorfeld der Parlamentswahlen in seinem Land, an den Anschlägen auf Hotels und den Überfällen auf Touristen beteiligt war, machte er diesen Job. Sein Auftrag lautete, ihn unbemerkt verschwinden zu lassen. Dazu würde er ihn zunächst lebendig an einen sicheren Ort an der Küste bringen, eine verlassene Fischerhütte, 30 Kilometer südlich von Mombasa, in der Nähe von Ukunda. Ein gutes Versteck. Und das Meer wartete geduldig auf eine mondlose Nacht.
Er spähte durch das Glas. Sah den Landcruiser in der Ebene. Keine Täuschung. Er hielt den Atem an. Das musste sein Mann sein. Wer sonst sollte um diese Zeit noch durch den Tsavo fahren? Die Touristen hatten sich entweder in ihre Lodges verkrochen und fuhren erst am nächsten Morgen wieder hinaus, oder sie hatten, wie die meisten es taten, den Park noch vor Einbruch der Dunkelheit verlassen, um in ihre Hotels an der Küste zurückzukehren.
Hier, wo Kitema zwischen den hohen Dornbüschen lauerte, musste das Fahrzeug, wenn es dem kürzesten Weg Richtung Voi folgte, ein ausgetrocknetes Bachbett durchqueren. Es war selbst für einen Fourwheeler die einzige Stelle weit und breit, an der die steilen Ufer passierbar waren. Der Landcruiser würde sich langsam schaukelnd den Weg zwischen den mächtigen Steinquadern und den knietiefen Erdlöchern suchen, den selten Wasser führenden Zulauf des Athi überqueren und auf der anderen Uferseite wieder die Böschung erklimmen. Zwei schmale Rillen, hinterlassen von den zahlreichen Fahrzeugen, die an dieser Stelle schon den Bachlauf passiert hatten, wiesen den Weg, und es kostete den Fahrer volle Konzentration, hier nicht auszubrechen oder im weichen Ufersand steckenzubleiben.
Sobald der Landcruiser an dieser Stelle war, würde Kitema schießen. Der Rest wäre dann ein Kinderspiel. Seine Hand strich über den Mündungsfeuerdämpfer. Der leere Tank würde den Fahrer kurz darauf zwingen, anzuhalten und auszusteigen.
Dann würde Kitema zuschlagen.
3
Alan Scott liebte die holprigen Waschbrettpisten, die Gravelroads abseits der üblichen Fahrwege, die selbst einem alten Safariguide höchste Fahrkünste abverlangten. Wenn man sie mit einer stetigen, nicht zu langsamen Geschwindigkeit befuhr, schienen die Räder über die schmalen Querrillen hinwegzugleiten, nur die Schlaglöcher wurden dann eine leicht zu übersehende Gefahr. Rechtzeitig zu reagieren, sie zu umfahren, ohne mit dem Fahrzeug ins Schlingern zu kommen, das war die hohe Kunst der Bushdriver. Diese Straßen waren sein Leben, die Pfade, auf denen er am liebsten durch Afrika fuhr. Weil er wusste, wie er sie zu nehmen hatte, gehörten auch Gäste mit lädierten Bandscheiben und wertvollen Fotoausrüstungen zu seinen zufriedenen Kunden. Nie in seiner langjährigen Karriere als Safarifahrer war er in einem Warzenschweinloch gelandet oder hatte eine Ölwanne geschrottet.
Er schlug genervt mit der flachen Hand auf das Lenkrad, als er den Zeiger der Tankuhr schlagartig in den roten Bereich pendeln sah. Im Schatten einer gewaltigen Schirmakazie, deren überhängende Äste aus der Piste einen turmhohen Tunnel machten, trat er unbeherrscht auf die Bremse und blieb in der dichten Staubwolke, von den Reifen im roten Sand aufgewirbelt, stehen. Lärmend stob ein Schwarm Dreifarbenglanzstare aus dem Akaziendickicht hervor, und eine Horde Paviane floh, aufgeregt kreischend, auf den Baum. Missmutig kroch Alan von seinem klebrigen Sitz, knallte die Fahrertür zu und ging nach hinten, um den Reservekanister in den Tank zu füllen. Das Schweißband seiner Legionärsmütze war nass geschwitzt und er fuhr sich mit dem Handrücken über die glänzende Stirn.
Er schleppte den schweren 20-Liter-Kanister zum Tank, öffnete den Verschluss und schraubte den rüsselförmigen Einfüllstutzen auf das Ventil des Kanisters. Glucksend entleerten sich die ersten Liter in den Tank, während der Kanister, den er gegen den Jeep stemmte, Schluck um Schluck leichter wurde. Alan lauschte dem gleichmäßigen Schmatzen der zähen Flüssigkeit, als ihn plötzlich ein anderes Geräusch ablenkte.
Das laute Rascheln kam aus dem Dickicht hinter seinem Rücken und ließ ihn herumfahren. Fast entglitt ihm bei der raschen Drehung der Kanister. Das Rascheln wiederholte sich, und er suchte mit seinen Augen den Busch ab, ohne den Kanister abzusetzen. Nichts war zu sehen.
Wen er nicht bemerken konnte, war der Mann – Kitema –, der sich dem Rover von der anderen Seite genähert hatte und hinter einem kurzstämmigen Busch kauerte. Zwei Wurzelstücke, die er über den Rover und Alan hinweg in das Dickicht geschleudert hatte, hatten die Geräusche verursacht, die Alan von ihm ablenken sollten, wenn er sein Jagdmesser mit aller Kraft in den rechten Vorderreifen des Rovers stieß. Die Luft entwich zischend, doch das Geräusch verebbte im Glucksen des einlaufenden Benzins.
Alles war ruhig geblieben. Alan schraubte den Tankverschluss zu und bemerkte auf seinem Weg zur Fahrerseite sofort, dass etwas nicht stimmte; der Wagen schien zur einen Seite hin abzusacken. Zunächst dachte er an eine Unebenheit der Piste, eine Mulde, den Eingang zu einem Erdferkelloch, der einen Teil des Reifens verschluckt haben konnte, doch dann sah er die Deformierung des grauen Gummis und trat fluchend gegen den platten Reifen. Das hatte ihm gerade noch gefehlt! Okay, Reifenpannen gehörten dazu, waren Bestandteil jeder Safari. Einen Reifen zu wechseln, war eine Kleinigkeit im Busch. Trotzdem: Wenn es einen Platten gab, war es gewöhnlich im denkbar schlechtesten Augenblick. Auf dem Weg zur Flugpiste, wenn die Zeit wirklich drängte; mitten in der Büffelherde, die gerade dabei war, vielhundertköpfig die Piste zu überqueren; oder kurz vor Einbruch der Dunkelheit, wenn es kaum noch Tageslicht gab und die Batterie der Stirnlampe mal wieder schlappmachte.
Der Reifen war hin, und Alan stapfte ein weiteres Mal zum Heck, um das Reserverad und den Wagenheber zu holen. Mit einer Hand griff er nach einem Stein und setzte ihn als Bremsblock vor das linke Hinterrad. Den schlängelnden Körper, der unter dem Stein davonglitt, bemerkte er nicht. Die Nacht war in greifbare Nähe gerückt, nur ein Fingerbreit hob sich die Sonne noch über die Hügel im Westen. Die plötzliche Stille, die sich immer dann im Buschland breitmachte, wenn der Tag zur Neige ging und sich die friedlichen Sänger, Zupfer und Zirper zur Ruhe begaben, um den leisen und geräuschlosen Räubern der Dunkelheit Platz zu machen, hatte auf einmal etwas Unheimliches, und er vergegenwärtigte sich noch einmal den Augenblick vor wenigen Minuten, als er bei einem Blick in den Rückspiegel geglaubt hatte, eine menschliche Gestalt über die Piste huschen zu sehen, schemenhaft nur, verwackelt durch die holprige Fahrt und undeutlich im Staub, den der Landcruiser hinter sich aufwirbelte. Er hatte es als eine Täuschung abgetan, ein Tier vielleicht, ein großer Pavian. Doch jetzt, nachdem so kurz aufeinander erst der Tank leer und dann der Reifen geplatzt war, hatte er Verdacht geschöpft.
Seine Augen suchten die Umgebung nach verdächtigen Bewegungen ab, doch nicht ein Lufthauch bewegte die dürren Äste der Dornbüsche, kein Vogel kreiste in der Luft und auch die Paviane waren nicht mehr zu hören. Er kam sich vor wie auf einem ausgetrockneten Friedhof. Das Knirschen, als er sich in den Sand kniete, war das einzige Geräusch, und sein lang gezogener Schatten das Einzige, was sich bewegte. Alan suchte nach der Metallnase im Unterboden des Cruisers, um den Wagenheber anzusetzen. Er musste sich auf den Rücken legen und unter den Wagen robben, um sie zu finden. Für einige Sekunden schloss er die Augen, um sie an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann fand er mit der rechten Hand die Stelle und tastete mit der anderen ins Freie nach dem Wagenheber.
– Zsssssst –
Das Zischen unmittelbar neben seinem Ohr durchschnitt die Stille, und Alan hob erschrocken den Kopf. Die Bewegung war so heftig, dass er mit der Stirn gegen den rauen Unterboden stieß. Etwas glitt dicht neben seinem Kopf an seinem Körper entlang. Er hielt den Atem an und spürte, dass sein Herz wie ein Hammer gegen die Rippen schlug.
– Zsssssst –
Das Zischen wiederholte sich, zwar kürzer, aber dafür deutlicher als zuvor. Und irgendwie schien es aggressiver geworden zu sein.
Schon zum zweiten Mal war das Reptil gestört worden. Zuerst hatte der Feind es aus seinem Versteck unter dem Stein vertrieben, dann, als es seinen wechselwarmen geschmeidigen Schuppenkörper im Schatten des Wagens eingerollt hatte, nahm die auberginenfarbene, gespaltene Zunge den bedrohlichen Geruch erneut wahr. Das erste Zischen war als Warnung gedacht. Der Feind hatte sie missachtet. Das zweite Zischen war eine Gnade, die eigentlich keinem Opfer gewährt wurde; nur den mächtigen Feinden, vor denen es unter anderen Umständen die Flucht vorgezogen hätte. Doch dieser Feind war zu nah, eine Flucht nicht mehr möglich. Es blieb nur noch der Ausweg der Verteidigung.
Und während Alan sich seinen schmerzenden Kopf hielt und mit der anderen Hand nach dem Wagenheber tastete, zischte die Puffotter neben seinem Ohr zum dritten Mal.
– Zsssssst –
4
Der kühle Wind trieb die grauen Wolkentürme von Westen her über die Berge und ließ die glühende Hitze des Tages allmählich verglimmen. Die Leopardin lag, dicht an den breiten Ast geschmiegt, regungslos in der Krone der Akazie, gut getarnt durch das schützende Blattwerk, dessen spärliche Lücken die letzten Sonnenkringel auf den Rosetten ihres Fells tanzen ließen. Das hechelnde Maul geöffnet, blitzten die Reißzähne der Katze weiß zwischen den schwarzen Lefzen, nur ein seltenes Blinzeln der Augen und das leichte Zucken des Schwanzes verrieten Leben in der sonst regungslos Lauernden. Die Jägerin war mit all ihren Sinnen hellwach, die gelben Augen erfassten jedes Detail ihrer Umgebung, die großen, behaarten Ohrmuscheln fingen, einem Radar gleich, jedes noch so leise Geräusch ein, ihre Nase hatte die Witterung der Grasfresser aufgenommen, die ihr der Abendwind aus der weiten Savanne zutrug. Nicht ahnend, welche Gefahr sich im dichten Blattwerk der Akazienkrone verbarg, näherten sich die Antilopen arglos der kleinen Baumgruppe, um sich in ihrem Schutz zur Nachtruhe zu versammeln. Die Sonne verlor in diesen Minuten den Kampf gegen die Wolken über dem Höhenzug, ein Zittern ging durch den Körper der Leopardin. Die Zeit der Jagd war gekommen.
Die Jungen in ihrem Bauch rumorten, und sie spürte, dass es ihre letzte Jagd sein würde, ehe die Kleinen zur Welt kamen. Der Hunger nagte in ihr, das letzte Opfer war nur ein Frankolin gewesen, mehr Federn und Knochen als Fleisch, ihre große Beute, ein Grantgazellenbock, war ihr nach zähem Kampf von einem Löwenrudel abspenstig gemacht worden, noch ehe sie ihr Baumversteck erreicht hatte.
Langsam löste sich der Schatten aus der Baumsilhouette und glitt geräuschlos zu Boden. Die Schwarzfersenantilopen hatten sich wieder in Bewegung gesetzt, nachdem der Bock witternd stehen geblieben war, um mit einem Flehmen seiner Oberlippe all die Gerüche aufzunehmen, die der dichte Busch um das Rudel herum barg. Doch außer den Pavianen, die unter einem Feigenbaum nach Früchten suchten, nahm er keine Lebewesen wahr. Der Westwind kam günstig für die gefleckte Jägerin, Meter um Meter schlich sie näher, verharrte schließlich geduckt im Gras, lauernd, jede Muskelfaser angespannt, die Schulterblätter als höchste Erhebung des geschmeidigen Körpers, den Kopf nach vorn gestreckt, bereit zum tödlichen Sprung auf jenes Impala, das am Rand der kleinen Herde stand und durch ein leichtes Hinken eines Vorderlaufs ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Ihre gelben Augen fixierten ihr Opfer, keine andere Bewegung im Busch vermochte sie jetzt noch davon abzulenken.
Ein gellendes Aufkreischen machte alles zunichte. Der Warnruf aus der Pavianhorde ließ das Impalarudel in wilder Panik davonstieben, selbst das verletzte Böckchen schaffte es, mit den anderen Schritt zu halten. Die Leopardin fuhr herum und sah sich einem ausgewachsenen Pavianmännchen gegenüber, einem der wenigen Tiere außer Löwen und Hyänen, vor denen sie sich in Acht nehmen musste. Zumindest war der Pavian tagsüber als Gegner nicht zu unterschätzen, mit seinen dolchartigen Eckzähnen konnte er der Leopardin gefährliche Bisswunden beibringen, sie waren eindrucksvolle Waffen, und die Katze wusste, dass mit einem erregten Pavian nicht zu spaßen war. Aufgerichtet stand der Patriarch auf seinen Hinterbeinen, ließ sich geifernd nach vorn fallen und drang auf den Leoparden ein. Mit einer Kakofonie durchdringender Schreie liefen die anderen Paviane in alle Richtungen auseinander, Mütter retteten sich mit ihren Kindern auf die nahen Akazien, die älteren Männchen blieben aufmerksam zurück, um ihrem Patriarchen zur Hilfe zu eilen, falls er es nicht allein mit dem gefleckten Feind aufnehmen konnte. Doch die Leopardin hatte wenig Lust, sich dem Pavian zu stellen, dessen Kreischen inzwischen in ein grelles Bellen übergegangen war. Die hundeähnliche Schnauze gekräuselt, fixierte der wehrhafte Affe seinen Todfeind mit seinen eng stehenden gelben Augen, aus denen Wut und Angst zugleich sprachen. Wieder raste er, einem Mini-Kingkong gleich, Sand aufwirbelnd auf den gefleckten Jäger zu, den Kopf unmutig schüttelnd und Laute von sich gebend, die der Leopardin unmissverständlich klarmachten, dass sie hier nicht willkommen war.
Die Katze drehte ab und verschwand im dichten Buschwerk. Die Jagd auf die Impalas konnte sie ohnehin vergessen, und ein Kampf mit einem Pavian, dem seine Herde Rückhalt und zur Not Beistand gewährte, war ihr mit den Jungen im Bauch zu riskant. Schon einmal hatte sie in einem solchen Fall den Kürzeren gezogen und Bekanntschaft mit den Reißwaffen eines Pavians gemacht. Die klaffende Wunde zog sich heute noch als schwarze Narbe durch die Rosetten ihres linken Hinterlaufs.
Die Leopardin suchte ihren Schlafbaum auf, eine knorrige Akazie mit dichter Krone, von einer Würgefeige fast erdrückt, in der sie nicht zu sehen war, wenn sie dort oben lag und die versteckte Beute verzehrte. Schon seit Tagen hatte sie keine Antilope, keinen Hasen mehr in die Astgabel gezerrt, um sie in aller Ruhe auszuweiden und zu verspeisen, ungestört von Löwen oder Hyänen, die ihr nicht in ihre luftige Vorratskammer folgen konnten.
Ein seltsamer Geruch hielt sie davon ab, in gewohntem Schwung die Akazie zu erklettern und sich auf dem breiten Hauptast zur verdienten Siesta niederzulassen. Sie roch das Blut, roch, dass es noch frisch war, und sie witterte das fremde Fleisch, anderes Fleisch als jenes, das sie sonst in der Krone lagerte, weder Antilope noch Gazelle, kein Klippschliefer, kein Warzenschwein. Misstrauisch schlich sie näher. Ein Affe vielleicht? Welches Tier im Busch versprühte diese Ausdünstung?
Sollte ein anderer Leopard ihren Baum als Jagdversteck genutzt haben? Oder war ein fremdes Tier in die Astgabel geklettert und dort verendet? Doch woher kam dann dieser Blutgeruch? Warm und frisch, sie fühlte es, ihre feine Nase hatte die Witterung aufgenommen.
Ihre Augen starrten zum Wipfel des schirmartigen Baums, das Blätterdach ließ kaum Licht durch, und sie harrte auf eine Bewegung. Sollte er sich doch zeigen, der Feind, sie würde ihn schon ordentlich begrüßen, doch nichts geschah. Kein Geräusch, kein knackender Ast, kein Rascheln im Laub, nur dieser fremde Geruch nach warmem Blut und frisch geschlagenem Fleisch. Ihre Krallen zerrissen die Rinde der Akazie, laut war das Schaben zu hören, doch nichts rührte sich dort oben. Jetzt hielt sie die Neugier nicht mehr länger zurück. Mit einem gewaltigen Satz war sie oben, lauschte auf dem untersten, waagerecht ausladenden Ast, ob sich nicht doch etwas rührte in den oberen Stockwerken. Doch es blieb ruhig. Mit Hilfe ihrer Tasthaare umkreiste sie den von der Würgefeige umschlungenen Stamm und schraubte ihren schweren Körper langsam nach oben. Dann sah sie ihn.
Der Kadaver hing wie ein aufgeblasener Sack in der Astgabel. Die Jägerin verharrte argwöhnisch und erst als sich auch nach Minuten nichts an dem gekrümmten Körper rührte, als sich ihre Nase an den Geruch gewöhnt hatte, wagte sie sich näher heran. Ihre Schnurrhaare ertasteten zwei Beine, zwei Arme und die verkrampften Finger der Leiche, und der Blutgeruch in ihrer Nase vermischte sich mit jenen Düften, die sie den seltsamen Wesen zuordnete, die immer wieder mit ihren stinkenden und lärmenden Ungetümen in ihr Revier eindrangen. Instinktiv hatte sie gelernt, dass Menschen etwas Fremdes, aber nichts Bedrohliches waren. Sie kannte die Geräusche, die sie von sich gaben, wusste, dass viele andere Tiere vor ihnen flohen, obwohl keine Gefahr von ihnen auszugehen schien. Noch nie war sie auf die Idee gekommen, einen von ihnen anzugreifen oder gar zu reißen. Ihre Beute roch anders, bewegte sich anders, sah anders aus.
Doch jetzt, tot und regungslos auf dem Ast liegend, duftete das Blut plötzlich ähnlich verlockend wie das eines Pavians. Das Feindbild flackerte vor ihrem inneren Auge auf, die Paviane, die ihr gerade die Impalas abspenstig gemacht hatten, kamen ihr in den Sinn, und sie gab unfreiwillig ein grimmiges Knurren von sich. Ohne diese verfluchten Affen würde sie jetzt mit einem frisch geschlagenen Impala in der Baumkrone sitzen und sich nicht um diesen Menschenkadaver kümmern müssen.
Der Hunger begann erneut in ihr zu nagen, die Jungen in ihr zehrten an ihren Kräften. Wenn das Blut nun doch angenehm roch, warum sollte dann das Fleisch nicht genießbar sein? Es kam auf einen Versuch an. Noch einmal sah sie sich vorsichtig um, witterte nach allen Richtungen. Sie konnte keine Falle entdecken, keinen Feind, der sich im Schutz des dichten Blätterdachs versteckte. Ihre Zunge fuhr heraus und leckte dem Toten über das Gesicht. Sie schmeckte das Blut, das aus dem Schnitt in der Kehle über seine Backenknochen rann. Das Fleisch roch frisch und ihre Zähne begannen, die Nackenwirbel freizulegen. Noch verriet ihre Haltung Anspannung und ihr Blick drückte Argwohn aus, doch je mehr ihr Gaumen mit dem Geschmack der fremden Beute vertraut wurde, desto freier wurden ihre Bewegungen. Schließlich ließ sie sich entspannt neben dem Kadaver nieder, riss mit ihren dolchartigen Eckzähnen das khakifarbene Hemd in Fetzen und begann zu fressen.
5
Der erste Brief
Hallo Linda,
gestatten Sie mir, dass ich Sie Linda nenne, denn Ihr Nachname ist mir noch nicht geläufig. Als wir uns damals kennenlernten, waren Sie nicht verheiratet, und wie ich herausgefunden habe, sind Sie auch schon wieder geschieden. Aber das nur nebenbei.
Der Grund meines Schreibens liegt in einem Verfahren vor ziemlich genau 14 Jahren, wenn es nach dem Willen des Hohen Gerichts gegangen wäre, hätten es sogar 15 Jahre sein müssen. Na, macht es klick? Blättern Sie doch bitte mal in Ihrem hübschen Kopf 14 Jahre zurück und schlagen Sie die Seite »12. April« auf!
Klick?
Oder das Kapitel »Mein Karrieresprungbrett«.
Klick?
Denn als solches darf ich mich doch sicher bezeichnen? Ich habe sehr wohl mitverfolgt, wie es mit Ihrer Karriere voranging, nachdem ich Ihnen durch mein Zutun auf die Sprünge geholfen hatte, wenn auch unfreiwillig, wie Sie zugeben müssen. Na, hat es immer noch nicht klick gemacht? Haben Sie mich wirklich schon vergessen, in nur 14 Jahren?
Nun, ich kann Ihnen versichern, ich habe Sie nicht vergessen. Sie und die anderen, die mir mein Leben um 14 Jahre verkürzt haben.
Klick?
Ich habe weder vergessen noch vergeben.
Als gebildete Journalistin werden Sie mit den Klassikern der deutschen Dichtung vertraut sein. Wovon ist wohl die Rede, wenn Schiller in Wilhelm Tell sagt: »Ihr Genuss ist Mord und ihre Sättigung das Grausen«?
Nun, ich will Sie gern ein bisschen auf die Folter spannen, meine Liebe.
Von Mord wird bald die Rede sein. Und das Grausen werden Sie kennenlernen.
Aber im Gegensatz zu mir damals werden Sie eine kleine Hoffnung haben: Bringen Sie endlich die Wahrheit ans Licht!
Ach, und noch etwas, so ganz nebenbei. Behalten Sie den Inhalt meiner Briefe für sich. Das geht nur uns beide etwas an.
Hochachtungsvoll
Chui
6
Linda Roloff betrachtete das Bild, das auf ihrem Nachttisch stand, ihre Finger strichen über das reflexfreie Glas, und sie versuchte, sich das Kribbeln in Erinnerung zu rufen, das sie gespürt hatte, wenn ihre Fingerkuppen über seinen Dreitagebart geglitten waren. Sie versuchte, sich seinen Geruch zu vergegenwärtigen, diesen wilden Buschgeruch, unparfümiert, männlich, intensiv. Den Duft seiner Haut, seiner Haare, seines Atems. Sie versuchte, seine Küsse zu spüren, seine Stimme zu hören, sein Lachen. Und dann versuchte sie, ihn zu vergessen. Wenigstens für den Rest dieser Nacht. Sie brauchte dringend ihren Schlaf. Sie knipste das Licht aus und schloss die Augen. Sie hatte aufgehört, die Nächte zu zählen, die Nächte ohne eine Nachricht von Alan Scott.
Es war wenig los gewesen – eine halbe Ewigkeit schien es ihr her zu sein – auf der Ankunftsebene des Stuttgarter Flughafens. Linda war sich ein wenig verloren vorgekommen, nachdem die Wartenden um sie herum ihre Angehörigen in Empfang genommen und mit lachenden Gesichtern das Ankunftsterminal verlassen hatten. Linda hatte in dem kleinen Blumengeschäft drei rote Rosen gekauft, mit einem kleinen grünen Anhänger, auf dem die Worte Herzlich willkommen zu lesen waren. Alan würde sich darüber freuen, hatte sie gedacht.
Ihre Augen hatten an der großen, schwarzen Anzeigetafel geklebt, wo die gelben Buchstaben immer wieder durcheinandergerattert waren und neue Flüge angekündigt hatten. Noch immer hatten die beiden grünen Leuchtdioden neben der Flugnummer abwechselnd geblinkt, als Zeichen dafür, dass sein Flugzeug gelandet war. Sie hatte noch einmal die Flugdaten verglichen, die sie sich notiert gehabt hatte, Flugnummer, Start- und Landezeit waren identisch gewesen.
Nervös war sie auf und ab gegangen, hatte das Klappern ihrer hochhackigen Schuhe auf dem grauen Steinfußboden gehört und wie sich ihre Schritte mit dem Rattern der Gepäckwagen, den Stimmen anderer Menschen und den wiederkehrenden Lautsprecherdurchsagen zu der bekannten Flughafengeräuschkulisse gemischt hatten.
Sie hatte noch einmal zur Uhr gesehen, nein, sie hatte sich nicht verspätet gehabt, sie hatte außerdem jetzt schon eine knappe Stunde gewartet. Und sie hatte den Ausgang der Ankunftshalle nicht einen Augenblick aus den Augen gelassen, auch nicht, als sie sich einen Espresso in der kleinen Kaffeebar bestellt hatte.
Sie hatte vor der Tafel gestanden, die einen Überblick über die Einrichtungen des Flughafens bot. Informationen eine Etage höher, im Abflugterminal eins. Sie hatte die Rolltreppe genommen, oben angekommen die Warteschlange am Infoschalter gesehen und war wieder nach unten gespurtet. Genervt hatte sie auf einem der schwarzen Wartestühle Platz genommen und versucht, ihren Puls unter Kontrolle zu bringen. Immerhin war es möglich gewesen, dass er den Anschlussflug in Frankfurt verpasst hatte. Doch selbst wenn, warum meldete er sich nicht?
Der Flug Frankfurt-Stuttgart war inzwischen von der Anzeigetafel verschwunden gewesen. Sie war noch einmal zum Infoschalter gegangen und hatte ihr Glück versucht. Der Flug aus Kenya war pünktlich in Frankfurt gelandet, wo steckte Alan Scott? Noch einmal hatte sie auf der Wartebank gegenüber dem Blumengeschäft Platz genommen.
Später hatte sie sich, nachdem sie allein vom Flughafen zurückgekehrt war, spontan zum Märchensee aufgemacht, um auf andere Gedanken zu kommen. Als sie den See später verlassen hatte, waren drei rote Rosen auf der Wasseroberfläche zurückgeblieben. Ein grünes Kärtchen mit dem Aufdruck Herzlich willkommen war allmählich im Teppich der Wasserlinsen verschwunden, die fast den ganzen See bedeckten.
Unruhig wälzte sie sich jetzt in ihrem Bett hin und her, doch der Alptraum kehrte immer wieder. Nicht die Rosen trieben dort im See, sondern die Leiche eines Mannes. Schweißgebadet wachte sie auf.
Sie hatte das Gesicht des Toten erkannt.
7
Donnerstag, 24. August 2006, Alter Landungssteg, Friedrichshafen
Lichtblitze, grell, schnell, hell, in regelmäßigem Abstand von 30 Sekunden, ein kalter Wind aus Südwest, Stärke sieben, die Oberfläche des Sees aufpeitschend, Regen, der fast waagerecht durch die Luft zu jagen schien. Unwetter.
Die Sturmwarnung hatte schon vor drei Stunden die letzten Segler in die sicheren Häfen getrieben, und selbst die Fischer waren angesichts der Witterung an diesem Spätsommerabend nicht mehr hinausgefahren. Nur die Fähre pflügte zielstrebig dem Aussichtsturm an der Mole zu, dessen Treppengerüst skelettgleich in den wolkenverhangenen Abendhimmel ragte und die Einfahrt zum Hafen markierte.
Das kleine Ruderboot schien verlassen draußen auf dem wild gewordenen Wasser zu tanzen, dann wieder abzutauchen in den Wellentälern, ohne Willen, schien zu treiben, ziellos, ohne den Mann, der es steuerte. Ein Spielball von Wind und Wasser. Und doch näherte es sich, langsam und unauffällig, dem ehemaligen Landungssteg im Westen der Stadt. Die mehrgeschossige Fassade der Schlosskirche ragte düster in den Himmel, flankiert von den beiden mächtigen Zwiebeltürmen, Wahrzeichen Friedrichshafens. Hoch hoben die Wellen den Bug des Ruderboots, trugen es für den Bruchteil einer Sekunde auf ihrem Kamm und ließen es, kaum hatte es seinen Schwerpunkt verloren, schlingernd eintauchen in das nächste Tal. Wasser schwappte ins Innere, bedrohlich schwankte der Kahn und setzte dann, die Ruder wie von Zauberhand gelenkt, seine Fahrt Richtung Ufer fort.
Das Leuchtfeuer der Sturmwarnung, das rings um den Bodensee seine Blinksignale zum Wasser hin aussandte, huschte wie ein orangefarbener Schatten von links nach rechts über die brodelnde Wasseroberfläche, vertauschte für einen kurzen Augenblick das Wellenspiel mit der wankenden Tanzfläche einer Diskothek, um danach wieder den grauen Schatten des tanzenden Wassers zurückzulassen. Jetzt hatte das Boot den Radius des Leuchtfeuers am Landungssteg erreicht und für den Husch eines Augenblicks, in dem das Licht das Wasser streifte, war der gebeugte Rücken eines Mannes zu erkennen, der in durchnässtem Overall, geduckt, ja zusammengesackt im Boot kauerte und die Ruder bewegte.
Ständig glitt ihm das Boot aus der Bahn, zeigte der Bug zu weit nach Osten oder Westen, und doch ließ sich sein Kurs erahnen. Mühevoll kam er voran, Meter um Meter, Wellendach und Wellental, und bei jedem Eintauchen in das Leuchtfeuer schien er der Ufermauer um einen Meter näher gekommen zu sein. Seine Hände, nass glänzende Haut, krampften sich um die Ruderstangen, über die Schulter warf er einen Blick zum nahen Ufer, aus dem Schatten der Kapuze heraus, um sein Ziel anzupeilen. Und er stellte jedes Mal erfreut fest, dass er allein war. Kein Mensch war zu sehen. So hatte er es geplant. Allein und unbeobachtet an einem stürmischen Abend auf dem See.
Das menschengroße Bündel, das im Heck des Ruderboots lag, bewegte sich nicht.
Der Regen ließ etwas nach, und er steuerte das Boot in waghalsigem Manöver an den Resten des ehemaligen Landungsstegs vorbei, schwarzen, baumstammdicken Pfählen, die aus dem Flachwasser des Sees ragten und immer wieder von den Wellen überspült wurden. Er hielt auf das westliche Ende der schmalen Landzunge zu, ein fast kreisrundes Areal, das sich mit dem schmalen Zugangsweg in Form einer Schöpfkelle an der Schlossmauer entlang zum Wasser hin ausdehnte. Im Schatten der efeubewachsenen Mauer stieg er an Land, nachdem er das Boot am schmiedeeisernen Geländer der Ufermauer vertäut hatte.
Er musste jetzt darauf achten, nicht in den Lichtschein des Leuchtfeuers zu geraten, der ein paar Meter auf die Halbinsel hüpfte, bevor ihn der Schatten der Blende verschluckte. Geschickt huschte er an der Mauer entlang und schlich sich geduckt hinüber zu den Bäumen, die das Ziel seiner geheimnisvollen nächtlichen Aktion waren. Als er an dem breiten Gitterportal vorbeikam, gewahrte er den Lichtschein in einem der Fenster im obersten Stockwerk des Schlosses. Doch es war niemand zu sehen. Er verharrte, überzeugte sich davon, dass der Ort seiner Tat nicht von dort oben eingesehen werden konnte, und setzte seinen Weg fort. Er hatte sich viel vorgenommen in dieser Nacht, es war Teil eines langen Plans, den er in den nächsten Nächten durchzuführen gedachte, und er hatte lange Zeit mit den Vorbereitungen verbracht.
Der Mann, der sich in jener sturmgepeitschten Sommernacht den drei Kastanienbäumen näherte, war von hünenhafter Gestalt, doch elegant und geschmeidig, ja fast katzengleich waren seine Bewegungen, kaum knirschte der Kies unter seinen Schritten, kein Atemgeräusch, kein Keuchen war zu hören, als er mit seiner Arbeit begann. Ständig glitt sein Blick hinüber zu dem Weg, dem einzigen Zugang zum halbinselartigen Gelände vor dem Schloss.
Er befand sich hier auf historischem Grund, dem Hafengelände des ehemaligen Klosters Hofen, wo noch zu Zeiten des württembergischen Königs Friedrich die Raddampfer anlegten und Waren aus der Schweiz angeliefert wurden. Drüben, wo heute die Schiffe der Weißen Flotte, aber auch Katamaran und Fähre einliefen, lag damals die Reichsstadt Buchhorn, ebenfalls mit eigenem Hafen, und nachdem Friedrich Kloster und Stadt zusammengelegt und in Friedrichshafen umbenannt hatte, verlor die Schiffslände vor dem Schloss zusehends an Bedeutung. Was blieb, war der idyllische Platz mit seinen Bänken und Bäumen, Geheimtipp für Sonnenuntergänge am Bodensee und zugleich Endpunkt des für die Öffentlichkeit zugänglichen Bodenseeufers im Westen der Stadt.
Seine Hände ruhten auf der feuchten, rissigen Rinde der Kastanie. Er sog den Duft des nassen Holzes ein und schloss die Augen. Der Baum gab ihm Kraft, er schien sein Freund, er war Teil seines Plans. In seinen Gedanken war er wieder daheim, dort, wo es den mächtigsten aller Bäume gab, den Giganten, den von den Göttern im Zorn mit dem Astwerk in der Erde versenkten alten Baobab, dessen Äste wie verkümmerte Wurzeln aus seinem Tonnenstamm ragten, zerfurchte Rinde wie Elefantenhaut, kürbisgroße Früchte, Schattenspender für Impalaharems, Spielplatz für Meerkatzen, Wohnstatt für Nashornvögel. Er hatte die Bäume geliebt, schon als Kind, nicht nur den Baobab, der wie eine Säule den Eingang zu ihrer Farm markiert hatte, auch die Riesenfeigen, Kletterbäume seiner Jugend, den glühend blühenden Flammenbaum und den Sausagetree, dessen längliche Früchte dem Lilablumigen den deutschen Namen Leberwurstbaum eingebracht hatten.
Schon mit vier Jahren war er geklettert wie ein Äffchen, hatte in den Bäumen nach Vogelnestern und Bruthöhlen gesucht, Flughunde von ihren Schlafplätzen vertrieben und eines Tages einen jungen Leoparden mit nach Hause gebracht. Niemand wusste, was seiner Mutter zugestoßen war, warum er allein in der Astmulde gekauert hatte, drei Nächte lang. Abgemagert und mit zerzaustem Fell, von Zecken übersät und ausgetrocknet, hatte er ihn schließlich vom Baum gezerrt, ein fauchendes, kratzendes und beißendes geflecktes Fellbündel mit den schönsten Augen, die er je gesehen hatte, in Gold gefasst, und einer rosaroten warmen Nase.