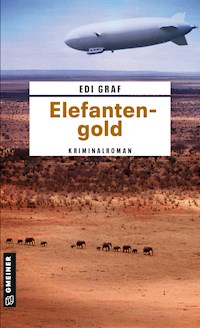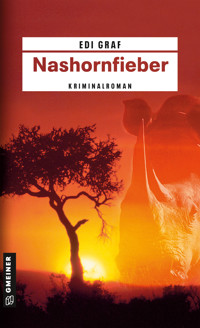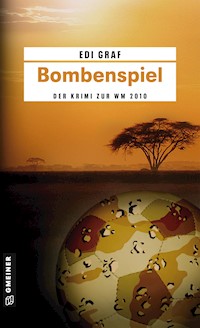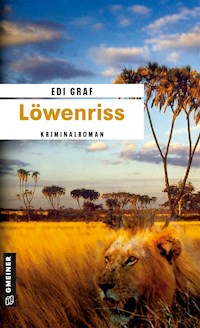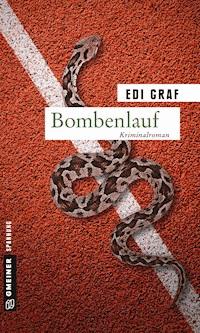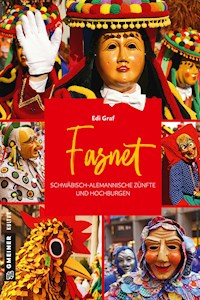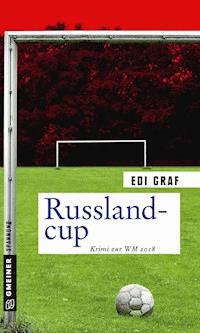Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalistin Linda Roloff
- Sprache: Deutsch
An der Schweizer Grenze wird eine Rentnerin tot aufgefunden. Die Tübinger Journalistin Linda Roloff erfährt von dem mysteriösen Mord und ihre Neugier ist sofort geweckt. Bei ihren Recherchen stößt sie auf ein dubioses Speditionsunternehmen und lernt die Nigerianerin Hadé kennen, die von skrupellosen Menschenhändlern nach Deutschland verschleppt wurde, um hier als Prostituierte zu arbeiten. Als Linda schließlich selbst in die Gewalt der Menschenhändler gerät, beginnt ein Wettlauf mit dem Tod …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edi Graf
Verschleppt
Linda Roloffs sechster Fall
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2012 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Christoph Neubert
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
Handlung und Namen sind frei erfunden.
Die Weißen haben Afrika als illegale Einwanderer betreten, oder hatte irgendein Sklavenjäger ein Visum?
Vorwort
›Auf Herbergssuche‹ titelte die Südwestpresse am Heiligabend 2011 ihren BRENNPUNKT. Und weiter: ›Bootsflüchtlinge aus Afrika hoffen auf einen Platz in Europa, den sie Zuhause nennen können.‹
Zu diesem Zeitpunkt war das Manuskript für diesen Roman fertiggestellt, und mir wurde die Aktualität der Thematik bewusst.
Schätzungen der UN zufolge warteten zwischen 2006 und 2008 bis zu zwei Millionen Flüchtlinge aus Westafrika in Libyen, Tunesien, Marokko und Mauretanien auf eine Überfahrt nach Europa. Fast täglich landen Flüchtlingsboote auf den Kanaren, Malta, Sizilien und Lampedusa. Allein auf dem Weg über den Estreco, die Meerenge von Gibraltar, sterben nach Schätzungen des Internationalen Zentrums für Migrationspolitikentwicklung jedes Jahr 2000 illegale Einwanderer.
Unter den Menschen, die in Europa ein neues Zuhause suchen, sind viele Frauen, deren Wege von skrupellosen Schleusern und Menschenhändlern gelenkt werden. 79% aller Opfer von Menschenhandel werden wegen ›Zwangsprostitution und anderen Formen sexueller Ausbeutung von Frauen und Mädchen‹ verschleppt, veranschlagt das Büro der Vereinten Nationen für die Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Das Bundeslagebild Menschenhandel vom 26. September 2011 spricht allein in Deutschland von 470 Ermittlungsverfahren wegen ›Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung‹. Die Zahl der nigerianischen Opfer stieg dabei innerhalb eines Jahres von 34 auf 46 Frauen.
Das Bundeskriminalamt nennt bei Opfern aus schwarzafrikanischen Ländern besondere Formen der Einschüchterung – wie Voodoorituale – die dazu führen, dass die Opfer nicht zu Aussagen bereit sind. Diese Aussagen sind jedoch von zentraler Bedeutung, um gegen die Täter überhaupt ermitteln zu können. Daher fehlen laut UNO-Bericht über moderne Sklaverei gesicherte Zahlen, wie die taz am 12. Februar 2009 schreibt.
Wer nun meint, Menschenhandel durch skrupellose Schleuserbanden und Zwangsprostitution beschränke sich auf Antwerpen, Turin, Wien und Berlin, irrt:
Wir schreiben den 18. Januar 2011: auf der Raststätte Sinsheim bei Karlsruhe bemerkt ein georgischer LKW-Fahrer Stimmen aus dem Container seines Sattelzugs und alarmiert die Polizei. Die Flüchtlinge stammen aus dem Iran und aus Afghanistan und sind stark unterkühlt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen türkische und iranische Schleuser.
Im Mai 2011 beleuchtet ein Fernsehbeitrag des SWR mit dem Titel »Die Menschenhändler von nebenan« Zwangsprostitution und Zuhälterei im Schwarzwald-Baar-Kreis.
So spielt meine fiktive Geschichte ›Verschleppt‹ mit dem traurig-realen Kontext eben nicht irgendwo in einer anonymen Großstadt, sondern in einer ländlichen Region, im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet am Bodensee, im idyllischen Hegau.
Ich habe mir als Autor erlaubt – aus für die Geschichte relevanten Gründen – auf der Höri am Bodensee ein Kieswerk anzusiedeln. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlich in der Region existierenden Betrieben ist reiner Zufall. Das ›Kieswerk Reiter GmbH & Co. KG‹ ist mit all seinen Details ein Kind meiner Phantasie, und den Ort Gaienholzen wird man auf der Bodenseelandkarte vergebens suchen.
31. Dezember 2011, Edi Graf
Prolog
Die dunkelhäutige Frau sah das Land ihrer Träume zum ersten Mal durch ein schmales Fenster, das nicht größer war als der Platz, den ein Huhn zum Schlafen braucht. Es war durch eiserne Gitterstäbe geteilt, davor eine verschmutzte Glasscheibe, so dass sie ihre Arme zwar durch das Gitter hindurch stecken, nicht aber ins Freie greifen konnte. Und es befand sich so weit oben in der Wand, dass sie auf den Zehenspitzen stehen musste, um überhaupt einen Blick auf die Landschaft zu erhaschen.
Sie sah das Land ihrer Träume als Gefangene. Aus einem sicheren Versteck, wie der Schlepper es genannt hatte. Denn wenn man sie fand, hatte er gesagt – ohne Pass und Visum – würde man sie abschieben, zurück nach Hause, nach Nigeria, wo sie vor Monaten aufgebrochen war. Hier würde sie warten, bis die Männer Madames sie holten. Doch das Versteck war ein Gefängnis, denn die Tür des kahlen Containers war verriegelt.
Was sie sah, war ein grauer Himmel, wolkenverhangen, düsterer als in der Regenzeit zu Hause. Wolken, die nicht zu ziehen schienen, die keinen Regen brachten, die nur die Sonne verdunkelten, so wie sich ihre Seele verdunkelt hatte, als sie ihre wahre Bestimmung geahnt hatte.
Wenn ihr Blick das Fenster erreichte, sah sie schwarze Schatten von Bäumen, die mit hängenden Ästen wie trauernde Pfähle in den Himmel ragten, düster und bedrohlich wie die Wolken, sah die vom Wind bewegten Zweige, hörte aber nicht die raschelnden Blätter und die seltsamen Vogelstimmen, die sie nur einmal wahrgenommen hatte, als die Tür für kurze Zeit offen geblieben war, krächzende Stimmen, die riefen, als würden sie die Menschen in ihrem Verlies verspotten.
Kein Geräusch drang bei geschlossener Tür von außen herein, und sie wusste, dass auch die Laute der Menschen in dieser Düsternis, selbst ihr Schreien und Klagen, nur als Echo in den kalten Wänden ihres Gefängnisses verhallten, und nicht ein Ton nach draußen drang.
Ihre Tränen hatten helle salzige Spuren auf ihrer fast schwarzen Haut hinterlassen, als Madames Männer ihr die große Schwester Sema aus den Armen gerissen, und sie – vor Angst schreiend und die Arme Hilfe suchend nach ihr ausgestreckt – aus dem Container gezerrt hatten.
Die anderen hatten den Kopf geschüttelt und ihr durch Gesten und Worte zu verstehen gegeben, dass ihre Schwester nicht zurückkommen würde. Doch sie hatte auf Sema gewartet, den ganzen Abend, die Nacht hindurch, den nächsten Morgen und wieder den ganzen Tag. Und eine weitere Nacht und einen weiteren Tag. Und während ihre Tränen zu salzigen Rinnsalen trockneten, die sich wie helle Schatten auf der dunklen Haut ausnahmen, vergingen weitere Nächte und Tage, und sie wurde sich darüber im Klaren, dass sie ihre Schwester nie wieder sehen würde, dass die anderen recht hatten.
Also waren sie wahr, die Geschichten, die ihr die anderen auf der Reise erzählt hatten. Geschichten, die schaurig klangen wie die düsteren Märchen ihrer Heimat, grausam und beängstigend, und doch so unwahrscheinlich, dass sie kein Wort davon geglaubt hatte.
»Ihr werdet eure Freiheit bezahlen müssen«, hatten die Männer erzählt, als sie auf dem Weg vom Meer hierher – eng zusammengepfercht wie die Ziegen auf den Transport zum Markt – über 20 Menschen zählten.
»Wir alle werden unsere Freiheit für viel Geld kaufen müssen, aber ihr werdet zahlen für uns! Ihr Frauen bezahlt für eure Männer und Kinder, für eure Brüder und Söhne!«
Geglaubt hatte sie es nicht. Sie war von zu Hause aufgebrochen, weil man ihr das Paradies versprochen hatte, im Land ihrer Träume. Sie hatte auf dem langen Weg durch die Wüste gelitten und alle Qualen und Erniedrigungen über sich ergehen lassen, um dieses Land zu erreichen, hatte in dem kleinen Boot gekauert, den Tod des Ertrinkens vor Augen und hatte, zusammengepfercht mit den anderen in diesem Versteck auf ihre Freiheit gewartet.
Versprochen hatte man ihr Arbeit – vielleicht als Kindermädchen – einen Platz zum Leben, eine Wohnung für sie und ihre Familie, die nachkommen würde, sobald sie alles geregelt hätte, dort in dem Paradies, das man Europa nannte.
So war sie voll Zuversicht aufgebrochen, hatte die Schrecken Afrikas verlassen, um die Verheißungen Europas zu erlangen, und war dort in der Hölle gelandet.
Während das Versteck leerer geworden war von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht, weil die Frauen ihren Leib zum Opfer brachten für die Freiheit ihrer Familien, waren die Zweifel gekommen. Sie hatte gehört von Madame, die ihren Pass in Verwahrung genommen hatte, von ihren Helfern, den Trolleys, die sie auf dem Weg durch die Wüste begleitet hatten und sie auch jetzt begleiten würden.
Und wie die anderen wartete auch sie auf ihre Stunde. Als sie kam, war der Morgen kalt und klar, die düsteren Wolken hatten sich verzogen, doch die Sonne war noch nicht aufgegangen. Madames Männer, die immer kamen, um eine von ihnen oder auch einen der Knaben abzuholen, öffneten die Tür des Containers, einer mit schwarzem Bart zeigte auf sie, zu zweit zerrten sie an ihren Armen, bis sie aufstand, klamm von der kalten Nacht, blind von der Dunkelheit, die auch der kleine Fensterschacht nicht besiegen konnte, und zitternd vor Angst vor dem Unbekannten, das sie erwartete.
Zwei Jahre waren seit diesem kalten Morgen vergangen. Von Sema hatte sie nie wieder etwas gehört. Sie selbst war inzwischen frei geworden. Freigekauft durch das Feilbieten ihres Körpers.
Als sie die letzten 500 Euro bezahlt hatte, um wieder selbst über sich und ihren Körper bestimmen zu können, als sie sogar noch genügend Geld gespart hatte, um endlich aus der Hölle zu entfliehen, war einer von Madames Männer zurückgekehrt. Der mit dem schwarzen Bart. Hatte sie aufgesucht in ihrem kleinen Zimmer mit den roten Wänden und ihr gesagt, dass ihre Tochter angekommen war.
Doudou!
Ihre Tochter! Ihr Leben. Alles, was sie noch hatte! Endlich! Dann hatte sich alles gelohnt, all die Qualen, die Jahre in der Hölle. Sie war frei, und ihre Tochter war gekommen. Ihre Tochter Doudou, die sie vor fast vier Jahren in ihrer Heimat zurückgelassen hatte, um sie nachzuholen, sobald sie das Paradies erreicht hätte.
Doch dann hatte der Schwarzbart gegrinst. Gelacht. Sie verhöhnt. Wir könnten deine Tochter auch selbst für uns arbeiten lassen, hatte er gesagt, ein junger Körper verkauft sich gut. Aber du bist auch tüchtig, und die Freier stehen auf dich. Warum sollen wir dir verbieten, das Geld für deine Tochter zu verdienen? Wenn du dich ranhältst, kann auch sie in ein paar Monaten frei sein!
Die Tränen waren zurückgekehrt und mit ihnen die Schatten auf ihrem Gesicht. Schatten, die sie in zwei Jahren mehr altern ließen, als die 25 Jahre, die sie in Afrika verbracht hatte. Sie hatte geweint und den Schmerz hinausgeschrieen, hatte um sich geschlagen und sich die Arme blutig gekratzt, bis sie kamen und sie in ihrem Zimmer auf das Bett banden.
Dann hatte sie den Entschluss gefasst. War zurückgekehrt. Heimlich. An den Ort, an dem sie vor zwei Jahren in Deutschland gestrandet war.
Verschleppt.
Ich nenne sie Hadé.
Dies ist ein Teil ihrer Geschichte …
1
Der Nebel hatte den See seit Tagen fest im Griff.
Für die Menschen hier war das nichts Ungewöhnliches. Man brauchte oft nur wenige Kilometer zu fahren, ins nahe Linzgau oder auf einen der Vulkanberge des Hegau, und man sah die Nebelbänke unter sich, während von oben die Frühlingssonne vom wolkenlosen Himmel schien. Doch der Nebel gab dem See sein ganz eigenes Gesicht, fand Lene Grandel.
Die alte Frau liebte die Nebelmonate. Dann hatte sie den See für sich. Die Touristen blieben fern, und außer ihr verirrte sich kaum ein Mensch ins Ried oder zu den Beobachtungsplattformen am Ufer. Höchstens die Praktikanten vom BUND, die unterwegs waren, um Vögel zu zählen oder Wege auszubessern. Oder einer der Ornithologen von Euronatur, der sich auf die Suche nach einem der seltenen Wintergäste machte, Brandgans oder Lappentaucher.
Meist jedoch war sie allein. So wie am Morgen dieses Tages, als sie zwei Stunden lang die Singschwäne – Überwinterer aus dem hohen Norden – von der Ruine am Reichenaudamm aus beobachtet hatte. Allein. Der See spiegelglatt und eisgrau, die Schilfflächen wie bizarre starre Wände aus dem trockenen Uferschlick aufragend, darüber wie ein feiner Schleier der Nebel, aus dem die schlanken Hälse und weißen Köpfe der Singschwäne ragten, wenn sie ihre Nahrungssuche unter Wasser unterbrachen und ihnen kalte Tropfen von den gelben Schnäbeln trieften. Ihr Spektiv – ein Fernrohr mit 75-facher Vergrößerung – zeigte jedes Detail der prächtigen Vögel, und sie hielt immer wieder den Atem an, wenn die Vögel mit majestätischen Bewegungen durch das Bild zogen.
Jetzt, am Abend, war sie wieder allein. Der Nebel war am Tag landeinwärts gewabert, hatte sich in den Buchen und Lärchen des Waldes verfangen, und machte den Schiener Berg zu einem Geisterwald. Außerdem war es kalt geworden.
Sie beeilte sich, denn sie wusste nicht, wie lange sie Zeit hatte, um ihren Plan umzusetzen. Der Mann, auf den sie in dem unzugänglichen Waldstück gewartet hatte, war noch nicht gekommen, und sie machte sich allein daran, den Zaun durchzuschneiden. Die Drahtschere gehorchte ihren klammen Fingern, bald war das Loch groß genug; sie schlüpfte hindurch und sah in der Dämmerung nicht die Fußspuren, die sie in der feuchten Erde hinterließ.
Die Wand des Containers schimmerte hell zwischen den kahlen Zweigen der jungen Buchen, und sie verharrte kurz, als sie das Geräusch hinter sich wahrnahm. Wahrscheinlich Jakob. Hatte er den Weg also doch noch gefunden. Sie war sich nicht sicher, ob es richtig gewesen war, ihn einzuweihen. Doch wie sollte sie es allein schaffen?
Da! Erneut das Geräusch.
Konnte es jemand anderes sein? Einer vom Kieswerk? Oder die Frau, die sie vor zwei Tagen hier gesehen hatte? Auf einmal war sie unsicher, ob es richtig war, was sie vorhatte. Warum informierte sie nicht einfach die Polizei? Nein! Das kam nicht in Frage.
Sie dachte an das Geld, das Monat für Monat auf ihrem Konto in der Schweiz gelandet war. Doch jetzt hatte sie genug. Das Spiel war ausgereizt. Sie hatte hoch genug gepokert, und gesehen, dass der andere sogar bereit war, eine sechsstellige Summe für die Bewahrung seines Geheimnisses zu bezahlen. Das Leben Unschuldiger war mehr wert, und darum hatte sie die Aktion geplant. Aber wo blieb Jakob? Ohne ihn hatte sie keine Chance.
Fand er den Weg nicht? Sie hatte ihn doch so genau beschrieben. Vorbei an den Kieshalden, den Fuhrweg um den Baggersee herum und auf den breiten Kiesweg, der bergauf in den Wald hinein führte und wie ein Hohlweg in die enge Schlucht mündete. An der Schranke vor der Lichtung wollten sie sich treffen. Vor einer halben Stunde.
Wieder dieses Rascheln. Schritte? Jakob? Nein! Vor ihr! Plötzlich, wie aus dem Waldschatten gewachsen, eine nachtschwarze Gestalt. Sie blickte in das erstarrte Gesicht, stieß einen Schrei aus, und das Letzte, was sie sah, war der lange Gegenstand, der auf sie niederfuhr. Mit ungebremster Wucht zertrümmerte das Brecheisen ihre Schädeldecke.
Der Mann hatte gerade die Drahtschere, die am Zaun lag, aufgehoben und eingesteckt, als er den Schrei hörte. Gleich darauf noch einer, dann sah er schemenhaft die Gestalt, doch das dichte Gestrüpp und der Nebel verhinderten, dass er mehr erkannte. Als er das Motorrad aufjaulen hörte, verschwand er so schnell er konnte auf dem schmalen Pfad, den er gekommen war.
2
Die Sonne beleuchtete die Ruine des Hohenkrähen, drüben über der Autobahn Richtung Schaffhausen ragte wie ein Mahnmal der Urzeit der Vulkankegel des Hohentwiel in den Himmel, und das Sonnenlicht tauchte die alten Festungsmauern in ein gleißendes Gold. Wie ein mattgrauer Spiegel lag der Bodensee in der Ferne mit den beiden Fingern des Untersees, dem Gnadensee und dem Zeller See, dahinter die Halbinsel Höri, deren waldiger Höhenzug in nebligem Grau schimmerte.
Dort unten lag Gaienholzen, ein altes alemannisches Dorf mit leuchtendem Fachwerk, alten Höfen, einer romanischen Kapelle und einem lebendigen Ortskern mit Marktplatz und Narrenbrunnen in seiner Mitte. Am Dorfrand, Richtung Schiener Berg, wo die Eisdecke des alten Baggersees schon wieder aufgetaut war, zogen sich Streuobstwiesen an den sanften Hängen entlang, Schottische Hochlandrinder weideten auch im Winterhalbjahr auf den satten Wiesen, und in der Neubausiedlung hatten sich Anwälte aus Radolfzell und Professoren aus Konstanz ihre Eigenheime nach den Plänen moderner Architekten errichten lassen.
Oberhalb des Baggersees, gegenüber dem Kieswerk, lagen an einer Nebenstraße am Ortsrand eine Handvoll Häuser. Im Garten des letzten, das auch das älteste in der Straße zu sein schien, kauerte ein Mann neben einer regungslos am Boden ausgestreckten Frau.
Die Frau sah erstaunlich gut aus für ihr Alter, auch als Leiche, dachte der Mann. Die hellblond getönte Frisur schimmerte nur am Haaransatz leicht silbern, und die Falten im Gesicht waren durch dezentes Make-up geschickt kaschiert. Blassroter Lippenstift betonte die Linien des im letzten Atemzug leicht geöffneten Mundes, auf den Lidern lag das schwache Glitzern eines verblassenden Schattens, und die Linien der schmalen Augenbrauen waren leicht nachgezogen worden.
Er wusste, dass er das leuchtende Blau ihrer lachenden Augen nie mehr sehen, ihre näselnde Stimme nie mehr hören würde. Auch wenn sie vor ihm lag, als ob sie nur schliefe, die Lene war tot.
Das verriet nicht nur das Blut an ihrem Kopf, sondern auch die gekrümmte Haltung ihres Körpers und das fehlende Senken und Heben ihres Brustkorbs. Er hatte seine Nase und sein Ohr über ihren Mund gehalten, um den Atemhauch zu spüren, seine Finger hatten an ihrem Hals nach dem Puls getastet, dann hatte er sie für tot erklärt.
Die Lene war alt gewesen, gewiss. Aber zu jung, um zu sterben. Und dass er sie hier in ihrem eigenen Garten fand, war für ihn mehr als fragwürdig. Er nahm noch einen Schluck aus der Flasche, ging zu seiner Vespa am Gartenzaun und steckte die Pulle wieder in die Satteltasche. Dann kehrte er zu Lene zurück. Der rote Wein war einer seiner besten Freunde und half ihm auch über den seltsamen Tod der alten Frau hinweg.
Auch er war alt, immerhin 68, doch sein vernachlässigtes Äußeres trug dazu bei, dass er um Jahre älter wirkte. Die graue Haut seines Gesichts schien trocken und ledrig, tiefe Falten gruben sich wie Furchen in seine Wangen, die Backenknochen traten kantig hervor, dicke Tränensäcke hingen unter den tief in ihren Höhlen liegenden Augen. Bart und Haaren sah man an, dass sie seit Tagen kein Wasser abbekommen hatten. Aus seiner Nase wuchsen dichte Haarbüschel, die sich mit den Haaren des ungepflegten Bartes zu einem wilden Urwald vereinigten.
Gelbe Flecken in den Mundwinkeln und an Zeige- und Mittelfinger seiner linken Hand verrieten den Kettenraucher, der flackernde Blick und das nervöse Zucken seiner Gesichtszüge waren Spuren, die der Alkohol hinterlassen hatte. Seine Haltung war gebückt, die Bewegungen langsam, fast chamäleonhaft schleichend, dabei ging sein Atem pfeifend wie bei einem Asthmatiker, unterbrochen von einem lauten, röchelnden Raucherhusten.
Schwerfällig stand er jetzt auf und sah sich um. Im Garten der Alten blühten die ersten Veilchen, und in den Beeten setzten weiße, violette und gelbe Krokusse bunte Farbtupfer. Schneeglöckchen und Märzenbecher waren schon hinüber, aber die Schlüsselblumen eroberten jetzt die kleine Wiese mit ihren gelben Blüten.
Die tief stehende Sonne, die an diesem Märzentag vom wolkenlosen Himmel über dem Hegau lachte, verstärkte die Wirkung ihrer Farben, die Wärme auf der Haut tat gut. Er hatte seinen alten Mantel über den Gartenzaun gehängt und trug nur ein zerschlissenes kariertes Wollhemd, das lose über der abgetragenen Cordhose hing. Rasiert hatte er sich seit Tagen nicht mehr und gewaschen ebenfalls nicht.
Er selbst hatte kein Problem damit. Und der Lene war das auch egal gewesen. Sie hatte die Menschen so genommen, wie sie waren. Sie hatte auch ihn so akzeptiert, wie er war und nie nach dem Warum gefragt. Das hatte er sehr an ihr gemocht. Unter anderem. Dabei hätte er ihr sogar das eine oder andere erzählt. Über sich. Über seine Vergangenheit. Sein Leben. Seine Familie. Seine Einsamkeit.
Dass er einen ordentlichen Beruf erlernt hatte und als Schreiner in einem Betrieb in Radolfzell angefangen hatte. Dass es ihn dann aber auf den Bau zog und er Kranführer geworden war. Wie er es genossen hatte, die Welt dort von oben zu sehen. Und dann der Unfall. Manchmal hörte er das Geräusch in seinen Träumen. Wie sich die Stricke der Palette lösten und die Backsteine den Kollegen unter sich begruben. Wie sie ihm die Schuld gaben und er zu trinken anfing. Und dann Helga. Seine Frau, die sich nach dem Unfall auf dem Bau für ihn schämte und den Dorfklatsch nicht ertrug. Seine beiden Kinder, die er über alles liebte, die er vergötterte. Und die sich vor ihm versteckten, weil die anderen in der Schule schreckliche Dinge über ihn erzählten. Und die ihn schließlich hassten.
Dann sein Bruder. Dieses Schwein! Nie vergaß er das Bild.
Helga und sein Bruder Olaf.
Die Scheidung, der Unterhalt, der Ruin. Sein Selbstmordversuch. Sein Absturz. Lene hätte er das alles erzählt. Und sie wäre die Einzige gewesen.
Lene war auch die Einzige gewesen, die nie ›Pulle‹ zu ihm gesagt hatte. Und die nichts dagegen hatte, wenn er trank. Sie hatte ihn ›Herr Eberle‹ genannt. Und später Jakob und ›Sie‹. Er hatte sich nie getraut, ihr das ›Du‹ anzubieten, nicht weil er die paar Jahre jünger war. Nein, eher weil er zu schüchtern war. Vielleicht auch, weil er es genoss, dass sie ihn siezte, ihn respektierte, ›Guten Tag, Jakob, wie geht es Ihnen‹ sagte, und nicht: ›Hoi, Pulle, na wieder mal nüchtern?‹.
Er war ihr Gärtner, ihr Handwerker, und einmal im Monat ihr Bote. Der frische Strauchschnitt der letzten Tage lag zu Bündeln verschnürt noch dort, wo er ihn für sie gelagert hatte. Heute war er gekommen, um der Eibe die Krone zu nehmen und den Hibiskus zurechtzustutzen. Und er wollte ihr helfen, die Kakteen, die den Winter in der Waschküche verbracht hatten, auf die Terrasse zu tragen, wo sie sich in den nächsten trüben, aber warm angesagten Tagen ans Frühlingslicht gewöhnen sollten. So wie er ihr in den letzten Jahren immer geholfen hatte bei Dingen, die eine 75jährige im Garten allein nicht bewältigen konnte. Und auch sonst.
›Jakob, waren Sie schon auf der Bank?‹
Seine Hand tastete nach dem Umschlag in seiner Hosentasche. Das Kuvert. Sie hatte Vertrauen zu ihm. Das mochte er ebenfalls an ihr. Für sie war er kein verkommenes Subjekt, kein Säufer, der im Sommer am Ufer des Untersees schlief und sich im Winter in den Lagerschuppen des Kieswerks auf der Höri einquartierte.
Für sie war er ein Mensch. Ihr Vertrauen schmeichelte ihm, und er hätte es nie missbraucht. Der Umschlag erinnerte ihn daran. 500 Franken. Die hatte er ihr bringen wollen, wie jeden Monat. Stattdessen fand er ihre Leiche.
Konnte er das Geld jetzt behalten? Schnell verdiente Fränkli? Wie kamen sie Monat für Monat in das Bankfach in Stein? Er hatte sich das schon oft gefragt, doch es ging ihn nichts an. Würde das Geld auch im nächsten Monat noch dort sein, obwohl sie dann schon unter der Erde lag?
Er würde es herausfinden. Würde mit seiner Vespa hinfahren, über den Schiener Berg wie jeden Monat, würde über die Grenze fahren und in die Bank in Stein spazieren wie jeden Monat. Würde das Schließfach öffnen und sehen. Vielleicht hatte er ja Glück?
Er ging noch einmal die paar Meter zu seiner alten Vespa, die er am Gartenzaun abgestellt hatte, und fischte die Flasche wieder aus der versifften grauen Satteltasche. Er zog den Korken heraus und ließ sich den trockenen Schwarzriesling in großen Schlucken die Kehle hinunter laufen.
Er würde die Vespa heute stehen lassen, wie immer, wenn er trank. Eigentlich trank er fast immer. Manchmal vergaß er, die Vespa dann stehen zu lassen, doch er hatte stets Glück gehabt. Die ›Narrenzunft Grünweiß‹ hatte ihn noch nie erwischt. Grünweiß! Er kicherte. ›Blausilber‹, musste das jetzt heißen. Obwohl …? Vielleicht kehrte der neue grüne Ministerpräsident ja wieder zur grünen Polizeifarbe zurück? Er steckte den Korken in die Flasche und dachte an die alte Frau.
Sie war noch fit gewesen, erstaunlich fit sogar. Stundenlange Spaziergänge, am See und im Ried, drüben in Wollmatingen, am liebsten allein in der Natur, keck in khakifarbigen Allwetterklamotten, Thermohose und Windjacke, Schlapphut. Das Spektiv in der Umhängetasche über der Schulter, den Riemen des kleinen Fernglases um den Hals. So hatte man sie gekannt, die naturverbundene rüstige Rentnerin. Witwe seit zwölf Jahren, kinderlos, tierlieb. Von den Vogelarten im Ried kannte sie alle, konnte stundenlang von der Beobachtung eines Brachvogels schwärmen, hatte am Protest gegen die Vergrämung der Kormorane teilgenommen und alte Wollsocken als Nistmaterial für Beutelmeisen in den Weiden am Riedkanal aufgehängt.
Jetzt war sie tot. Was würde die Polizei denken? Er sah sich um. Kein Stein, keine Unebenheit im Gelände, über die sie gestürzt sein könnte. Welche anderen Möglichkeiten gab es für die Polizei? Herzinfarkt? Zusammengebrochen und dann mit dem Kopf aufgeschlagen? Der Boden war weich, die frostige Erde aufgetaut. Woher kam der Spalt in ihrem Schädel?
Sein Blick fiel auf den schmalen Gegenstand im Gras. Der Stiel einer Schaufel? Nein kürzer!
Eine Fahrradpumpe? Nein, raue Oberfläche, verrostetes Metall. Er machte die paar Schritte darauf zu.
Bückte sich.
Berührte kaltes Eisen.
Hob es hoch.
Schwer.
Ließ es wieder zu Boden fallen. Das eine Ende bohrte sich in den lockeren Rasen, dann kippte das Brecheisen und lag wieder mit seinem gesamten Gewicht eben auf der Wiese. Eine tödliche Schlagwaffe.
Hatte man ihr damit den Schädel eingeschlagen? Er dachte an die letzte Nacht.
Verdammt, durchzuckte es ihn, jetzt sind deine Fingerabdrücke da drauf!
3
»Was machsch’n do, Pulle?«, hörte er und erkannte den Mann, ohne sich umzudrehen, an seinem Dialekt und an seiner tiefen Stimme.
Michel betrieb im Ort eine kleine Autowerkstatt, in der alten Scheune eines heruntergewirtschafteten Bauernhofs. Reparierte alles, was einen Motor hatte, vom Rasenmäher über den Traktor bis zum Daimler.
Blaumann, grauer Arbeitskittel voll Ölflecken, Ärmel hochgekrempelt, die behaarten Unterarme voll Wagenschmiere, das Gesicht unrasiert, die Brille krumm, die Haare zerzaust wie eben erst aufgestanden. Michel eben. Er trat durch das niedrige Gartentor, sah die Leiche und sah zu Pulle.
»Isch die tot?«
Pulle nickte und ließ die Rotweinflasche in seiner weiten Hosentasche verschwinden. Michel tat, als bemerke er das nicht und zeigte auf die Gestalt am Boden.
»Was isch passiert?«
Pulle zuckte mit der Schulter.
»Lag so da, als ich kam. Einfach so.«
»Da isch Blut an ihrem Kopf!« Michel hatte die Leiche umrundet und war in die Hocke gegangen. »Und Glasscherben!«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!