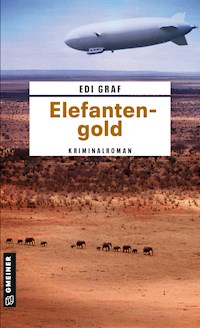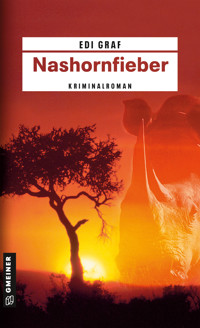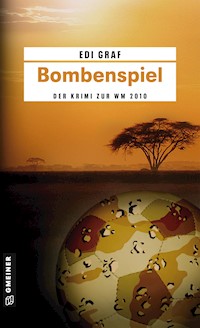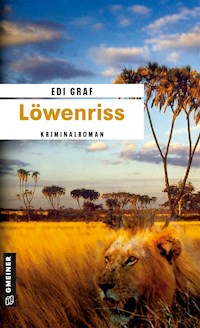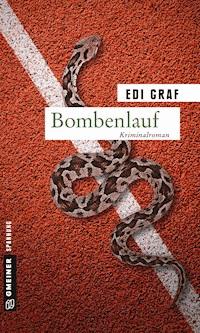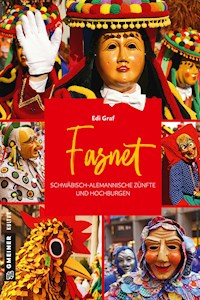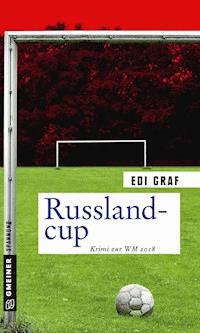Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalistin Linda Roloff
- Sprache: Deutsch
Der Wolf ist zurück im Schwarzwald. Seit ein einzelnes Tier dutzende von Schafen getötet hat, ist der Nordschwarzwald Wolfsgebiet. Als im Wald neben der Leiche eines Mädchens Wolfsspuren im Schnee gefunden werden, steht der graue Jäger als Täter fest. Doch die Tübinger Journalistin Linda Roloff stößt auf Spuren, die auf einen kaltblütigen Mörder schließen lassen, der mit Isegrims Waffen tötet. Zusammen mit dem afrikanischen Safariführer Alan Scott sucht sie nach der Fährte des Wolfs und macht dabei eine grausame Entdeckung …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edi Graf
Wolfsgebiet
Kriminalroman
Zum Buch
Mit Isegrims Waffen Er ist zurück. Der Wolf ist zurück im Schwarzwald. Seit ein einzelnes Tier bei einer Attacke dutzende von Schafen getötet hat, ist der Nordschwarzwald wieder Wolfsgebiet. Als im Wald neben der Leiche eines Mädchens Wolfsspuren im Schnee gefunden werden, steht der graue Jäger als Täter fest. Die Tübinger Journalistin Linda Roloff zweifelt daran, dass der Wolf das Mädchen getötet hat. Ist da draußen ein kaltblütiger Mörder unterwegs, der mit Isegrims Waffen tötet? Als eine zweite Leiche gefunden wird, beginnt eine wilde Hetzjagd in der bisher trügerischen Idylle des Schwarzwalds. Zusammen mit ihrer Liebe, dem Safariführer Alan Scott, sucht Linda nach der Fährte des Wolfs. Während sich im Wald die Schlinge um den Wolf immer enger zusammenzieht, macht Linda eine grausame Entdeckung und stößt auf eine Spur, die sie zum wahren Mörder führt. Hoch oben, auf der WildLine, der Hängebrücke auf dem Bad Wildbader Sommerberg, kommt es zum dramatischen Finale und zur Antwort auf die Frage: Ist der Wolf Täter oder Opfer?
Edi Graf, geboren in Friedrichshafen, studierte Literaturwissenschaft in Tübingen und arbeitet als Moderator und Redakteur bei einem Sender der ARD. Zuhause ist er in Rottenburg am Neckar. Seit über 30 Jahren bereist der Autor den afrikanischen Kontinent und lässt neben seinen Protagonisten, der Journalistin Linda Roloff und ihrer Fernliebschaft, dem Safariführer Alan Scott, die gemeinsam zwischen Schwarzwald, Neckar und Afrika ermitteln, auch Tierwelt und Natur tragende Rollen zukommen. Er greift aktuelle und bewegende Themen auf und liefert dazu detailliert recherchierte Hintergründe, die er geschickt in den Plot integriert. Durch authentisch beschriebene reale Handlungsorte haucht er seinen Krimis Echtheit und Leben ein.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
info@gmeiner-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © MARIMA / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6104-0
Vorbemerkung
Handlung und Namen, auch die einiger Orte, sind frei erfunden, nicht jedoch die Hintergründe und das Wolfsgebiet …
*
»Warum können wir den Wolf nicht einfach Wolf sein lassen?«
Andreas Beerlage, Wolfsfährten. Alles über die Rückkehr der grauen Jäger.
Vorwort
Es war im Schwarzwald, bei »Doppelmord«, einer der gemeinsamen Lesungen meines Freundes und Krimiautors Bernd Leix und mir, als wir auf den Wolf zu sprechen kamen: »Das ist doch dein Thema«, meinte Bernd, »Tiere spielen doch in allen deinen Krimis Hauptrollen!«
In der Tat. Ob in den Linda-Roloff-Krimis als Opfer in »Nashornfieber« oder »Elefantengold«, oder als vermeintliche Täter in »Löwenriss« oder »Leopardenjagd«. Selbst in den schrägen Kommissar-Zufall-Fällen schlagen ein getarnter Höhlenbär, ein zahmer Geier und eine dressierte Hyäne zu. Und in »Bombenlauf«ziert eine Schlange, die hochgiftige Jararaca, das Cover.
Warum also nicht der Wolf?
Ich bin dem grauen Jäger zum ersten Mal im Yellowstone in Amerika begegnet und habe ihn Jahre später an der finnisch-russischen Grenze heulen hören. Unvergessliche Momente. Als ich die Geschichte im Frühjahr 2017 zu schreiben begann, war der Wolf noch nicht im Land und so spielte sie auf der Schwäbischen Alb.
Doch dann holte mich – wie schon so oft beim Schreiben – die Realität ein: Die erste Sichtung eines lebenden Wolfs in Baden-Württemberg seit 1866 erfolgte am 21. Juni 2017: Seine Spuren zogen sich von Überlingen am Bodensee über die Baar bis in den Schwarzwald, wo man am 8. Juli 2017 ein erschossenes Exemplar im Schluchsee fand.
Im November desselben Jahres tauchte er im Nordschwarzwald auf und sorgte Ende April 2018 durch einen Angriff auf eine Schafherde für Schlagzeilen. Ich verlagerte den Schauplatz meiner Geschichte in den Schwarzwald und folgte der Fährte des Wolfs. Neben Recherchen vor Ort am Wildsee, im Enztal, auf dem Sommerberg und im Wolfstal war mir dabei vor allem das Buch »Wolfsfährten« von Andreas Beerlage eine wertvolle Quelle.
Ich habe mir als Autor somit erlaubt, die Geschichte in einem realen Wolfsgebiet im Nördlichen Schwarzwald, irgendwo im Nirgendwo zwischen Murg- und Enztal spielen zu lassen. Die Orte Wintersbach und Otterholz wird man auf der Schwarzwaldlandkarte jedoch vergebens suchen.
Ich danke an dieser Stelle meiner Familie für die Geduld und das Verständnis während der Zeit, in der ich dem Wolf auf der Spur war. Besonderen Dank meiner Privatlektorin Veronika Wieland, die mit mir an so manchen Abenden Inhalt und Handlung diskutierte und unermüdlich und mit großem Engagement Fehler und Unstimmigkeiten im Manuskript aufspürte.
Und der Wolf?
Ist er Täter, falsch Verdächtigter oder Opfer?
Dies mag der geschätzte Leser in diesem Krimi selbst herausfinden …
Edi Graf, 30. November 2018
Prolog
Blut.
Es riecht nach frischem Blut.
Die Fähe schnürt trotz der Dunkelheit zielsicher am verschneiten Waldrand entlang. Ihr Lauftempo ist ein leichter Trab, bei dem sie automatisch ihre etwas kleinere Hinterpfote in den Abdruck der Vorderpfote setzt, was beim Treten im nachgiebigen frischen Schnee Energie spart.
Es hat aufgehört zu schneien, und die tief hängenden grauen Wolken haben einem klaren Nachthimmel Platz gemacht. Sterne schieben sich aus der Finsternis über die Wipfel der hoch aufragenden Fichten, deren schneebedeckte Äste den Wald wie ausgestreckte Flügel in eine tiefe Dunkelheit tauchen. Zwischen den Bäumen bahnt sich das schmale Flussbett seinen Weg, von dessen anderem Ufer die Geräusche der Schafherde an die Ohren der nächtlichen Jägerin dringen.
Die Fähe hat die Höhle seit der Geburt ihrer Jungen nicht verlassen, doch heute hat sie der Hunger, der seit Tagen in ihr nagt, dazu getrieben, die fünf Welpen zum ersten Mal allein zu lassen. Sie braucht Nahrung, um ihre Jungen säugen zu können, und da sie allein ist, muss sie selbst auf die Jagd gehen. Der Geruch des frischen Blutes weist ihr den Weg.
Der Mond, der vor einer halben Stunde aufgegangen ist, streut vor dem Waldsaum genügend Licht, um über der verschneiten Wiese einen matten Silberglanz auszubreiten, über den wie ein Schatten die Schleiereule gleitet, heimliche unheimliche Jägerin der Nacht. Doch in dieser Nacht ist sie nicht allein in ihrem Revier.
Die Fähe hat tagelang nichts mehr gefressen und der Hunger quält sie. Sie hat den verlockenden Blutduft aufgenommen und gefühlt, dass nicht weit entfernt junges Aas auf sie wartet. Sie bevorzugt zwar frisches Fleisch von Tieren, doch um ein Reh oder ein Wildschwein aufzuspüren und es zu verfolgen, braucht sie Zeit, und um es zu hetzen und schließlich zu schlagen, benötigt sie die Hilfe des Rudels. Allein kann sie allenfalls Mäusen auflauern oder einen Hasen überraschen. Und sie ist allein. Einsam im neuen Territorium.
Sie weiß nicht, was aus ihren Einjährigen geworden ist, seit sie mit dem Rüden das Rudel im alten Revier verlassen hat. Es war zu eng geworden in dem Wald mit seinen sandigen Flächen, wo sie groß geworden war und mit ihren Eltern und Geschwistern gejagt hat. Der Wald dort ist zu klein geworden, um noch ein weiteres Rudel zu ernähren, die Rehe waren zu scheu und die Hütehunde bei den Schafherden zu wachsam.
Sie waren den Zweibeinern immer näher gekommen, ihrem Vieh auf den Weiden und in den Ställen, den Männern mit ihren Waffen und den Frauen mit ihren Schreien. Es war fast so, als seien die Fähe und der Rüde nirgendwo willkommen gewesen.
Sie waren aufgebrochen, hatten den Wald in der Ebene verlassen und ein neues Revier gesucht. Der Rüde und sie. Ein unschlagbares Team, ein Leben lang. Bis in den Tod.
Geflohen.
Vertrieben.
Verfolgt.
Gejagt.
Nicht geduldet, wohin sie auch gekommen waren.
Andere Rudel.
Fremde Rüden.
Hunde.
Zweibeiner.
Schüsse.
Lichter.
Zäune.
Überall.
Sie hatten Wälder durchquert, waren über Felder geschnürt, hatten Hindernisse übersprungen, Flüsse durchschwommen, Berge und Täler hinter sich gelassen, auf der Suche nach einer neuen Heimat, Richtung Süden. Dort, wo es noch keine Markierungen anderer Wölfe gab. Dort, wohin sich noch keiner ihrer Art gewagt hatte. Hatten sich von Mäusen und Ratten ernährt und nach Maulwürfen gegraben, bis der Schnee gekommen war. Leise Flocken, weiße Flächen, helle Nächte.
Ranzzeit.
In der Nacht des ersten Schnees hatten sie und der Rüde sich gepaart. Danach hatten sie ein Blutbad unter Hühnern angerichtet und zwei Tage später drei Lämmer gerissen. Mit den Hunden waren ihnen die Zweibeiner ziemlich nahe gekommen, nur ihre Gerissenheit und Erfahrung hatten sie gerettet. Sie waren ihren Verfolgern im Bachlauf entkommen.
Dann wieder die Lichter. Grelle Augen.
Die sich bewegten.
Sie blendeten.
Die näher kamen, schneller als jedes Tier.
Die flackernd auf sie zurasten.
Sie blendeten.
Laut rauschend.
Brüllend vorbeischossen.
Zischend.
Lärmend.
Und rot leuchtend verschwanden.
Schneller als jedes andere Lebewesen.
Sie waren an der breiten, dunklen Brache stehen geblieben, die sich, nass glänzend und düster, in zwei Richtungen erstreckte und sich erst in weiter Ferne verlor. Sie hatten unter den hohen Bäumen im dichten Buschwerk Deckung gesucht und ausgeharrt, bis die lärmenden, grellen Lichter an ihnen vorbeigerauscht waren und sich die zwei roten Augen der seltsamen Ungeheuer in der Nacht verloren.
Dann war der Rüde aufgebrochen.
Er hatte zwei der rasenden, grellen Augen zu spät bemerkt. Nicht erkannt, dass sie schon da waren, kurz nachdem sie am Ende der breiten, nass glänzenden Brache aufgetaucht waren.
Die aufgerichteten Ohren der Fähe hatten den dumpfen Schlag vernommen, mit dem die Augen des Ungeheuers den Rüden ergriffen und ihn niedergerissen hatten. Ein schmerzhafter, dumpfer Schlag.
Sein Jaulen.
Das Verschwinden der roten Lichter.
Stille.
Endlose und unheimliche Stille.
Von da an war sie allein gewesen.
Mit krummem Rücken und eingezogener Rute hatte sie sich geduckt über die dunkle Brache gewagt, an deren Rand der Leib des Rüden wie ein flacher, schwarzer Hügel in den Nachthimmel ragte.
Sie hatte sein Blut gerochen und seinen Tod. Die Brache hatte sich an den nackten Sohlen ihrer Pfoten kalt und feucht angefühlt, wie der Schnee, durch den sie gemeinsam gezogen waren, doch nicht so weich.
Sie hat die Jungen in sich gespürt, gefühlt, wie sie wuchsen und sich bewegten. Sie brauchten Schutz und sie hat nach einer Wurfhöhle gesucht, einem Versteck in der Nähe eines Wassers. Und sie hat gewusst, dass sie auf sich allein gestellt war. Allein und einsam hat sie ihre Jungen zur Welt gebracht, fünf Welpen, taub und blind.
Jetzt, nach Tagen der einsamen Wanderung und den Nächten in der Höhle bei ihren Jungen, fühlt sie wieder den Schnee, die Nässe und die Kälte vor der Höhle. Und die Leere in ihrem Bauch. Es ist der Hunger, den sie seit Tagen nicht gestillt hat.
Sie hat nicht gejagt.
Allein hat sie keine Chance.
Endlos quälender Hunger.
Sie braucht Nahrung, um Milch für ihre Jungen zu haben.
Der Blutgeruch gibt ihr Hoffnung.
Frisches Blut.
Frisches Fleisch.
Doch es ist kein Reh, was sie riecht.
Kein Wildschwein.
Auch kein Schaf.
Obwohl, etwas an dem Geruch erinnert sie an die drei Lämmer. Es ist aber nicht der Duft der jungen Schafe. Auch nicht die seltsam vertraute Witterung der Hunde, die ihr so nahestehen und ihr doch so fremd sind, weil sie sich mit den ärgsten Feinden verbündet haben. Noch ein anderer Duft liegt in der Luft.
Der Duft nach etwas Jungem.
Kein Kitz, kein Frischling, kein Lamm.
Junge Beute.
Tote Beute.
Verbunden mit diesem bedrohlichen Geruch.
Doch ihr Hunger ist größer als ihre Angst vor dem Unbekannten.
Sie ahnt, von welchem Lebewesen das Blut stammt, das ihre feine Nase gewittert hat, sie weiß es, als sie ihre Zähne in das Fleisch schlägt, doch sie ahnt nicht, welche Folgen es für sie und ihre hilflosen Jungen haben würde.
Niemand hätte ihre verräterischen Spuren bei dem Kadaver entdeckt.
Niemand hätte sie für eine kaltblütige Mörderin gehalten.
Niemand hätte Angst gehabt vorm bösen Wolf.
Niemand hätte sie gehetzt.
Niemand.
Wenn sie nicht in jener Nacht in dem einsamen, verschneiten Tal das Blut des jungen Zweibeiners gerochen und ihren Hunger gestillt hätte.
Teil 1 Wolfsfährte
1
Am selben Abend, einige Stunden zuvor.
»Ich ruf jetzt die Polizei«, sagte Katja Gassner. »Luisa müsste doch längst zu Hause sein!«
»Nein«, widersprach ihr Mann und umklammerte ihre Hand, die nach dem Telefon gegriffen hatte. Roland Gassners Stimme klang ungewöhnlich scharf: »Die stellen nur wieder Fragen. Ich such sie selbst!«
»Und wo?«, fragte Katja, doch die Worte gingen im Schluchzen unter und ihre Augen schimmerten feucht. Die braunen, strähnigen Haare hingen ihr wirr ins Gesicht, die Wangen leuchteten rot und waren von durch Wimperntusche verschmierten Tränenspuren gezeichnet, und ihre gepiercten Lippen zitterten. Die junge Mutter, Mitte 30, machte sich Sorgen um ihr einziges Kind. Verständnis oder gar Trost hatte sie von ihrem Mann nicht zu erwarten, das wusste Katja Gassner. Es war ja schließlich nicht sein Kind.
Luisa war 14, ging in die neunte Klasse. Hatte das Wochenende bei ihrem Vater verbracht, wie sie es alle 14 Tage tat. Um 17 Uhr hätte sie zu Hause sein sollen. Luisa ging den Weg gewöhnlich allein, im Sommer fuhr sie mit dem Rad, im Winter lief sie zu Fuß.
Die beiden Dörfer lagen in Sichtweite voneinander entfernt. Die Landstraße führte in ein paar langgezogenen Kurven in dem von Wald gesäumten Tal zwischen den Wiesen hindurch, zum Fluss hin verlief parallel ein geteerter landwirtschaftlicher Hauptweg, ein geschotterter Feldweg zog sich kerzengerade in der Talsohle durch den Wald, der sich am anderen Ufer der Enz den Hang hinaufschob. Man sah den Wasserlauf leuchten, wenn man aus dem Waldschatten auftauchte, so nah am Waldrand verlief die Enz.
Luisa fuhr oder lief am liebsten durch den Wald, es war der schnellere, der kürzere Weg. Und der einsamere, dachte Katja und putzte sich die Nase, nachdem sie ihre Hand vom Telefonhörer genommen und Roland sie losgelassen hatte. Die Glocke auf dem nahen Kirchturm schlug viermal. Die volle Stunde. Katja zählte unbewusst die darauffolgenden tieferen Schläge mit.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht.
Luisa war seit drei Stunden überfällig! Ihr Vater ging nicht ans Telefon und am Handy stieß Katja seit zweieinhalb Stunden nur auf die Mailbox. Sie war die Strecke zweimal abgefahren, kurz nach sechs und zuletzt vor einer Viertelstunde.
Alle drei Wege.
Die Landstraße, ständig mit Blick auf den parallel verlaufenden Landwirtschaftsweg, und zurück den Waldweg. Es gab nicht viel Verkehr hier im Tal. Drei Autos waren ihr entgegengekommen, zwei hatten sie überholt, weil sie langsam fuhr, um kein Detail am Fahrbahnrand zu übersehen. Sie hatte an Haralds Wohnungstür geklingelt und gewartet. Doch es war niemand zu Hause gewesen. Keine Spur von Luisa.
Auf dem Rückweg hatte sie den Waldweg im Schritttempo genommen. Mit klopfendem Herzen hatte sie am Steuer gesessen, die Hände wie ans Lenkrad geschweißt, den Blick starr durch das ungeachtet der Schneeflocken heruntergekurbelte Fenster auf den Wegrand gerichtet, den vom frischen Schnee weiß gefärbten Rain abgescannt, Spuren gesucht, ihren Namen gerufen, Meter für Meter.
Ihre tränennassen Augen hatten jede Bewegung im Unterholz registriert, sie hatte das Reh an seinen reflektierenden Lichtern erkannt, einen Sekundenbruchteil, bevor es über den Weg gehuscht war. Es war das einzige Lebewesen gewesen, das ihr begegnet war auf der nächtlichen Fahrt durch den Wald, zwischen den beiden einsamen Dörfern, in dem abgelegenen, verschneiten Schwarzwaldtal.
Als sie nach Hause gekommen war, hatte Roland auf sie gewartet, sein Bier in der Hand. Es war sein drittes, wie ihr die beiden leeren Flaschen auf dem Couchtisch signalisierten. Er war im Sportheim gewesen, wie jeden Sonntagnachmittag. Sie schauten dort Fußball.
Die Männer im Dorf nannten ihn Role. Schwäbische Koseform für Roland. Er war sieben Jahre älter als sie und man sah auf den ersten Blick, dass er körperlich arbeitete. Jetzt, als er im ärmellosen Unterhemd und mit langer Sporthose vor ihr saß, schienen die Oberarmmuskeln mit ihren Tattoos und die breite Schulterpartie fast den weißen Feinrippstoff zu sprengen.
Role war es immer zu warm. Selbst wenn sie im dicken Fleece auf der Couch saß und zitterte, weil er die Heizung mal wieder zurückgedreht hatte, brauchte er keine Jacke, kein T-Shirt. Er arbeitete in Pforzheim in einem Baumarkt. Fahrtzeit im Winter eine Stunde täglich. Einfach. Mit dem Bus bis Bad Wildbad, ab da mit der Bahn. Sobald es die Witterung zuließ, fuhr der Biker mit seiner Yamaha Enduro und nützte die Geländetauglichkeit seiner Maschine für Wege abseits der Straßen.
Roland war vorbestraft. Drogen, Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Sie verstand ja, dass er keine Lust auf die Polizei hatte. Aber für Katja in ihrer Verzweiflung war es der einzige Weg, Hilfe zu bekommen.
»Wo warst du?«, hatte er schroff gefragt, ohne auf ihre verheulten Augen zu achten.
»Luisa suchen«, hatte sie gestammelt und sich auf einen Wutausbruch Rolands gefasst gemacht. Er hasste es, dass Luisa jedes zweite Wochenende bei ihrem Vater verbrachte, er hasste es, dass Harald immer noch im Nachbardorf wohnte und jede Bewegung seiner Ex zu kontrollieren schien. Er hasste Harald aus vielerlei Gründen. Am meisten, weil er glaubte, dass Katja noch immer etwas für ihn empfand.
»Ich hab sie gesucht«, hatte Katja wiederholt. »Überall. Bin die Strecken abgefahren, hab bei Harald geklingelt. Da war niemand.«
Ihre Stimme war in ihrem Schluchzen erstorben.
Roland hatte erst reagiert, als sie zum Telefon gegangen war.
Jetzt leerte er im Stehen die Flasche, streifte sich die Trainingsjacke über und ging zur Tür.
»Was hast du vor?«, fragte sie und folgte ihm in den Hausflur.
»Ich suche deine Tochter!«, antwortete er und gab dem Wort ›deine‹ diese seltsame Betonung, eine Mischung aus Hohn und Hass, die sie so kannte, wenn sie aus anderen Gründen über Luisa redeten. Oder besser: stritten.
Sie stritten meist, wenn es um Luisa ging. Roland war oft anderer Ansicht und leicht in Rage zu bringen, schon beim geringsten Anlass. Weil Luisa ihr Zimmer nicht aufräumte, weil sie nicht laut genug »Guten Morgen« sagte oder weil sie nachts noch ins Bett machte.
»Mit 14!«, höhnte Roland dann. »Deine Tochter gehört mal übers Knie gelegt, damit sie weiß, wie sie sich zu benehmen hat«, zischte er dann. »Heulsuse!«, höhnte er, wenn Luisa wimmerte, weil er ihr eine Ohrfeige verpasst hatte, nachdem sie einen Tropfen Ketchup auf ihre Bluse gekleckert hatte.
»Hau ab, in dein Zimmer! Wer mit 14 noch nicht essen kann, braucht keine Pommes mit Ketchup!« Und Katja sah zu und schwieg.
Katja widersprach auch jetzt nicht. Sie sah Roland nur eindringlich an.
»Keine Angst, ich tu ihm schon nichts, deinem Harald! Aber wenn ausgemacht ist, dass Luisa um fünf hier ist, hat er sich daran zu halten, dein geliebter Ex! Und wenn er das noch immer nicht kapiert hat, werde ich ihm das so deutlich sagen, dass er es nie mehr vergisst!«
»Bitte, bring mir Luisa wieder«, flüsterte sie eindringlich.
»Und die kann auch was erleben!«, drohte er. »Sich nachts noch draußen rumzutreiben! Nur weil sie zu blöd ist, eine Uhr mitzunehmen! Die bleibt die ganze nächste Woche nach der Schule zu Hause, das kann ich dir sagen!«
»Ich hoffe nur, es ist ihr nichts passiert«, sagte Katja mehr zu sich selbst als zu Roland, der schon in der offenen Wohnungstür stand.
»Was soll ihr schon passiert sein?«, brummte er. »Dein Harald wird ja wohl auf sie aufpassen können, wenn er sie schon ständig bei sich haben will. Wozu musst du auch Luisa dauernd zu ihm schicken?«
»Immerhin ist er ihr Vater!«, sagte sie.
Und wusste, dass sie log.
2
Die Wölfin ist in die Wurfhöhle zurückgekehrt. Sie hat nicht viel gefressen in dieser Nacht, zu sehr hat sie der Geruch gestört, der Blutgeruch ihres größten Feindes. Und sie hat eine andere Witterung aufgenommen, Witterung einer Beute, die sie auch allein schlagen kann, wenn sie es geschickt anstellt. Sie wird ihre Jungen säugen, ein wenig schlafen und dann noch einmal losziehen.
Eng aneinandergeschmiegt, liegen die fünf Welpen in der Höhle. Die Geschwister wärmen sich gegenseitig, solange die Mutter nicht da ist. Noch können sie ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren und brauchen immer wieder das wärmende Fell der Wölfin.
Die Fähe spürt das schnelle Klopfen der fünf kleinen Herzen und weiß, dass die Jungen Hunger haben, wenn sie jetzt aus ihrem Schlaf erwachen. Leises, flehendes Fiepen und Mucken dringt an die Ohren der Wölfin.
Noch können die Jungen sie nicht sehen, aber sie fühlen jetzt wieder die beruhigende Nähe ihrer Mutter, spüren ihr weiches Fell und die endlich wieder prall gefüllten Zitzen, die mit ihrer Milch locken.
Mit pendelnden Bewegungen suchen sie die Nahrungsquelle, um ihren Hunger zu stillen. In der Wölfin nagt er nach wie vor mit quälender Leere.
Sie wird jagen müssen, unbarmherzig Beute schlagen, um ihn zu stillen.
3
Schäfer Johann merkte an diesem Morgen sofort, dass mit der Herde etwas nicht stimmte. Er stellte seinen Suzuki Vitara unter der hohen Rottanne ab, die wie eine einsame Wegmarke neben dem Schafspferch in den Morgenhimmel ragte.
Der Schäfer trug einen filzigen grünen Poncho, der seinen ganzen Oberkörper bedeckte und ihn vor Regen, Schnee und Kälte schützte. In sein wettergegerbtes, bartloses Gesicht hatten sich zahlreiche Falten gegraben, die Augen waren schief und wurden von dichten, buschigen Brauen und ledrigen Tränensäcken eingerahmt, eine Warze ragte wie eine Wulst zwischen Wange und der hakenförmigen Nase heraus und seine grauen Haare waren nicht zu sehen, denn der Alte hatte einen schmalkrempigen Hut aufgesetzt. In der Armbeuge trug er die langstielige Schäferschippe, Werkzeug, Stütze und Stock zugleich.
Basko kam ihm entgegen und sprang aufgeregt innerhalb des Zauns am Nylongeflecht entlang und sein Japsen schien eine wichtige Botschaft an seinen Herrn übermitteln zu wollen.
»Ja, was isch denn los, Alter, was bisch denn so unruhig?«, fragte Schäfer Johann seinen Berner Sennenhund, doch als er die Herde dicht gedrängt in einer Ecke der Umzäunung stehen sah, ahnte er nichts Gutes. Er war es gewohnt, dass die Tiere neugierig an den Zaun kamen, da sie ihn kannten und wussten, dass es nach der langen Nacht im Pferch wieder hinaus auf die Winterweide ging.
Der bislang milde Winter hatte ihn dazu bewogen, die Schafe noch im Freien zu lassen. Wieder kein Schnee zwischen Weihnachten und Neujahr, fast milde Nächte und sonnige Tage. Es tat der Herde gut, noch draußen zu sein und über die immer noch satten Wiesen im Tal und entlang der grünen Hänge zu ziehen, die bisher keine geschlossene Schneedecke niedergedrückt und braungrau verfärbt hatte.
Jetzt, nach den Schneefällen der letzten Tage, würde er sie zurücktreiben müssen. Zwei Tage würden sie mindestens brauchen, über die verschneiten Wiesen, bis sie den großen Stall am Ende des Tals erreicht hätten.
Einen Augenblick hatte der Schäfer ein schlechtes Gefühl gehabt, als er aus dem Suzuki ausgestiegen war und die verstörte Herde bemerkt hatte. Rasch hatte sein Blick die Linie des Weidegatters abgewandert und er hatte keine Schäden entdeckt. Das gleichmäßige Ticken aus dem Weidestromgenerator verriet ihm, dass der Elektrozaun funktionierte. Er schaltete das Gerät aus und ließ den Hund aus der Einfriedung. Sofort schnürte der Rüde los, zielgerichtet an der Außenseite des Zauns entlang, um die Ecke, blieb am oberen Ende der schmalen Seite – genau gegenüber der Stelle, wo die Herde kauerte – stehen und wartete pflichteifrig auf den Schäfer.
Johann Kerner schritt den Zaun ab und ließ dabei seine Herde keinen Augenblick aus den Augen. Was hatte die Schafe dermaßen beunruhigt? Weshalb hatten sie so dicht zusammengedrängt die Nacht verbracht und kamen auch jetzt nicht wie sonst an den Zaun?
Als er bei dem Berner Sennenhund anlangte, sah er die Fährte im Schnee. Er bückte sich und betrachtete eingehend die Pfotenabdrücke, die sich im frischen Schnee hier in weitem Umfeld abzeichneten.
»Oh verreck!«, zischte er und suchte die Umgebung mit seinen Augen ab. Woher kamen die Spuren, wohin führten sie? Und vor allem: Wie viele waren es?
Johann Kerner war lange genug Schäfer, wie es auch schon sein Vater und Großvater gewesen waren, und hatte dabei täglich mit Hunden zu tun. Und er hatte einen Vortrag besucht, damals, als dieser Naturschutzbeauftragte als »Wolfsberater« hier aufgetaucht war, nach der Attacke in Nonnenmiß. Und so wusste er, dass diese Spuren im Schnee nicht von Hunden stammten. Weder Basko noch ein Schäferhund oder ein Ungarischer Kuvasz hinterließen solche Abdrücke. Baskos Spuren waren deutlich auf der Zauninnenseite im Schnee zu erkennen, der Unterschied war eindeutig. Offensichtlich hatte sich der Hund erfolgreich zwischen die Herde und den Eindringling gestellt.
Der Schäfer umrundete den Pferch in der Gegenrichtung und war beruhigt, auf den anderen drei Seiten keine weiteren Fährten zu finden. Er zählte die Schafe, die nahezu regungslos gedrängt zusammenstanden, und stellte erleichtert fest, dass kein Tier fehlte. Auch Verletzungen oder Blutspuren sah er nicht.
Er pfiff seinem Hund, der schwerfällig angetrabt kam. Man sah es ihm an, dass er nicht mehr der Jüngste war. Aber zuverlässig und mutig, dachte der Schäfer.
»Na, mein Alter, hosch du super gmacht«, lobte er Basko und tätschelte ihm sein langes schwarzes Fell. »Hosch den Kerl vertrieba!«
Der Schäfer kniff die Augen zusammen und seine Backenknochen mahlten. Tiefe Falten zeigten sich auf seiner Stirn, er schob den schmalkrempigen Hut in den Nacken und ließ seinen Blick durch das Tal schweifen.
War es soweit?
War er jetzt dran?
Waren seine Schafe jetzt die nächsten?
Trieb sich der Wolf wieder hier herum? Oder diesmal gar ein ganzes Rudel?
Hatte der Wolf seiner Herde heute Nacht einen Besuch abgestattet?
Die Spuren schienen der Beweis zu sein.
Sie waren da gewesen. Einer, zwei oder viele? Hatten Bekanntschaft mit Basko und dem Elektrozaun gemacht und die Herde in Panik versetzt. Gott sei Dank hatte der Zaun gehalten.
Doch wie würde das in den nächsten Tagen aussehen? Würde er sie unbehelligt nach Hause treiben können? Ein oder zwei Nächte musste er noch riskieren. Er hatte noch das logistische Problem mit dem Weidezaun zu lösen. Der Pferch musste am Morgen abgebaut werden und noch am selben Abend wieder an Ort und Stelle stehen, wenn die Herde am Stall ankam. Der Stall allein bot zu wenig Platz für alle Tiere. Doch wer würde den Zaun transportieren und errichten, während er die Herde mit Basko Richtung Heimat trieb?
Er brauchte Hilfe.
Er würde Role anrufen. Wenn er ihn gut bezahlte, würde er zwei Tage Urlaub nehmen und ihm helfen. Der Schäfer ging zu seinem Suzuki und nahm das Smartphone aus der Halterung. Roles Nummer war eingespeichert.
Er stieß auf die Mailbox. Er hasste es, auf Anrufbeantworter zu quatschen, und legte auf.
Schäfer Johann Kerner hatte noch eine andere Idee und suchte die Nummer in der Namensliste. Als er das Wort »Wolf« ausgesprochen hatte, sagte ihm der Mann am anderen Ende sofort zu, das Problem zu lösen.
»Kümmere du dich um deine Herde«, schlug der andere am Telefon vor, »ich übernehme den Wolf!«
»Ich möchte damit nicht allzu lange warten«, antwortete der Schäfer, »am liebsten noch heute!«
»Das schaffe ich nicht«, entgegnete die Stimme am Smartphone. »Morgen früh?«
Schließlich verabredeten sie sich für den nächsten Tag, nach der Morgendämmerung. Die eine Nacht würde Basko noch einmal wachsam sein müssen.
4
Der Irish Setter war unruhig. Das prächtige braune Fell leuchtete rostrot in der Morgensonne, die nach der klaren Nacht ihre ersten Strahlen auf das verschneite Tal im Schwarzwald sandte und den wolkenlosen Winterhimmel in ein pastellenes Hellblau tauchte.
Für Förster Heinz Werkmann war es das schönste Stückchen Erde, das es gab. Er mochte die Waldeinsamkeit, die Stille oben am Wildsee und die tosenden Wildbäche im Tal. Gerade jetzt im Winter, wenn die Touristen höchstens zum Skifahren auf den Kaltenbronn kamen, oder bei entsprechender Schneelage auch zum Langlaufen ins Tal, und am frühen Nachmittag wieder verschwanden, nach Baden-Baden, Karlsruhe und Stuttgart.
Im Frühling liebte er die Lichtungen im Tal mit den dunklen Veilchentupfen im niedrigen Gras, den Duft der feuchten Erde oben im Moor und das Erwachen der spärlichen Vegetation auf den kahlen Grinden, im Sommer die grünen Hänge mit dem schmalblättrigen Weidenröslein und den rosaroten Kuckuckslichtnelken und im Herbst den angenehmen Wind, der hier oben fast immer wehte und im Winter das Laub von den Buchen und Eichen fegte.
Die roten Buntsandsteinfelsen, die dann aus den golden schimmernden welken Farnwäldern wie Hinkelsteine hervorragten und im Sonnenlicht kupfern glänzten, dazu die Kargheit der Disteln und Herbstzeitlosen, zwischen denen dann die Herde von Schäfer Johann weidete. 200 Tiere, frei zogen sie über die Wiesen zwischen den Waldhängen, wie schon in seiner Kinderzeit auf der Schwäbischen Alb, wo er aufgewachsen war.
Er erinnerte sich an den Schäfer aus seinem Dorf oben bei Münsingen, der noch im Schäferwagen gehaust hatte. Jetzt stand die alte Karre als Denkmal neben dem Rathaus in Gruorn, dem verlassenen Dorf mit dem alten Friedhof und der Kirche, am Rand des ehemaligen Truppenübungsplatzes.
Touristen kamen dorthin, wo die alten Mauern und verwilderten Gärten Geschichten aus vergangenen Tagen erzählten, Wanderer durchstreiften das Biosphärenreservat, wo noch vor 20 Jahren Schützenpanzer gerollt und Schießübungen abgehalten worden waren. Und neugierige Kinder fragten ihre Väter beim Spaziergang, warum es Krieg gegeben hatte, während sie in den Spielen ihrer iPhones auf Comicfiguren schossen.
Heinz Werkmann hatte die Unruhe seiner Irish Setter Hündin schon vor einigen Minuten bemerkt. Aufgeregt war sie auf ihn zugerannt, hatte ihn, ohne einen Laut von sich zu geben, mit ihren wunderschönen großen Augen auffordernd angesehen und war in weiten Sätzen den Weg zurückgesprungen, den sie gekommen war. War stehen geblieben, mit hoch erhobener Rute, immer wieder die feine Nase auf eine Spur gerichtet, die dort im Schnee zu verlaufen schien, wahrscheinlich ein Fuchs, ein Marder, ein Wiesel.
Wieder kam die Hündin zurück, der Schnee wehte zwischen ihren langen Beinen auf, flog ihr um die Ohren und bestäubte ihr herrliches Fell. Kein Jaulen, kein Japsen drang aus ihrer Kehle, als sie hechelnd und mit triefenden Lefzen bei ihrem Herrchen anlangte.
»Na, Leila, was bist du denn so aufgeregt, das kenn ich ja gar nicht an dir, altes Mädchen«, murmelte der Förster und tätschelte ihr das Fell. Ein leises Winseln ließ sie nun doch vernehmen, aber es war nicht der kehlige Wohlfühllaut, den sie sonst von sich gab, eher ein nervöses, ungeduldiges Flehen. Ungestüm drängte sie ihren schlanken Körper an seine Beine und schien ihn aufzufordern, ihr doch endlich zu folgen.
Heinz Werkmann kannte die Sprache seiner Hündin und wusste, dass sie ihm etwas mitteilen wollte. Nur hatte er jetzt, mit über 70 Jahren, nicht mehr die Energie, Leila auf jede der von ihr aufgespürten Fährten zu folgen, selbst wenn die Entdeckung für den Hund noch so wichtig war.
Der Förster blickte sich um, seine hohe Stirn lag in Falten, der grüne Filzhut beschirmte seine wachen braunen Augen und verbarg sein schütteres Haar, das auch im Alter immer noch mehr blond als silbern glänzte. Er rieb sich mit einer Hand den hellen Vollbart, der nur von wenigen grauen Fäden durchzogen wurde, und seine Zähne kauten nervös auf der Unterlippe, was er immer tat, wenn er in Momenten wie diesem seine Pfeife nicht zur Hand hatte. Seine Hand tastete in der Tasche des grünen Anoraks, doch er musste die Pfeife im Wagen gelassen haben.
Heute, das spürte er, war irgendetwas anders. Nur selten war die Hündin so ungestüm, wenn sie auf eine einfache Wildspur gestoßen war. Dafür gab es selbst hier im Nordschwarzwald einfach zu wenig aufregendes Getier.
Zwar zog ab und an mal ein Rothirsch durch das Revier, doch meist hielten sie sich weiter oben auf, wo in den Heidelbeeren der Auerhahn kollerte. Selbst der Luchs, der sich vor einiger Zeit in der Gegend gezeigt hatte, war inzwischen wieder verschwunden, vielleicht hinunter ins Donautal, wo auch der Uhu jagte, oder hinauf zu den Grindenplatten zwischen Ruhestein und Mummelsee.
Die Zeiten, wo die Schwarzwälder Gefährten des Steinzeitälblers Rulaman hier Bären und Auerochsen gejagt hatten, waren längst vorbei. Heute zogen nur die Wasserbüffelherden von Büffel-Willy drüben auf der Schwäbischen Alb über ihre Weiden und suhlten sich in den künstlich angelegten Wasserlöchern, aber jetzt, im Winter, waren auch sie in ihren Ställen. Die Bisons im Südschwarzwald hatten ihre Heimat in einem Gatter im Mundenhof bei Freiburg, und der Bär würde wohl kaum wieder eine Heimat in den engen Schwarzwaldtälern finden.
Nur der Wolf würde kommen, sagten sie und erwarteten ihn mit gespannter Aufmerksamkeit, die einen mit offener Freude, die anderen mit blankem Hass. Befürworter und Gegner standen sich im Tal frontal gegenüber. Fast wie damals, als man sich zum Nationalpark bekannte oder ihn bekämpfte. Der Nordschwarzwald war vom Wolfserwartungsland in Teilen zum Wolfsgebiet geworden.
Immer wieder war der Wolf seit einigen Jahren hier aufgetaucht, einzelne Exemplare, zuerst überfahren auf der A5 bei Lahr oder erschossen, unten am Schluchsee im Südschwarzwald. Übers Donautal und die Baar würden sie aus der Schweiz einwandern, meinten die Experten, oder von Norden kommen, da war einer am Neckar aufgetaucht, in der Nähe von Ludwigsburg. Auf dem Weg in den Süden.
Und dann die Attacke vor einem Jahr hier im Tal. Förster Heinz Werkmann war dabei gewesen, als sie die toten Schafe auf der Weide bei Nonnenmiß gezählt hatten. Es war ein entsetzlicher Anblick gewesen.
»Na gut, meine Süße, dann zeig mir doch mal, was du so Aufregendes gefunden hast!«, meinte der Förster und folgte dem wild davonstiebenden Setter. Nach 100 Metern blieb die Hündin stehen und verharrte.
Förster Heinz Werkmann starrte auf die Spur, die sich vor ihm als ein regelmäßiges Muster entlang des Waldsaums im Schnee abzeichnete. Der leichten Biegung der Enz folgend, die Wald und Wiese trennte, zog sie sich mit der Gleichmäßigkeit einer einsamen Eisenbahnschiene dahin, verlor sich in der Unendlichkeit der verschneiten Fläche wie die Spur eines einbeinigen Langläufers.
Heinz Werkmann war lange genug im Wald unterwegs gewesen, um die Spur eines Hundes auf den ersten Blick zu erkennen. Ebenso die von Fuchs und Waschbär. Andere Räuber, die ähnliche Fährten dieser Größe hinterließen, gab es hier oben nicht. Und selbst beim Fuchs hatte er noch nie einen Abdruck dieser Größe gefunden. Mindestens acht Zentimeter, schätzte er.
Während Leila reglos verharrte, betrachtete er die Fährte eingehend, bückte sich über die deutlichen Trittsiegel im Schnee, Abdrücke der Ballen und Zehen, und schüttelte den Kopf.
Das Tier, das hier entlanggeschnürt war, hatte im frischen Schnee eine gut lesbare Visitenkarte hinterlassen. Die Spuren waren von der vergangenen Nacht, dessen war sich der Förster sicher. Es hatte bis in die Abendstunden hinein geschneit, danach nicht mehr. Der Schnee war in der Nacht verharscht und ausgefroren und die Trittsiegel hatten sich deutlich verewigt. Sogar die Abdrücke der vier Krallen waren am vorderen Ende der ovalen Vertiefungen auszumachen.
So weit hätte es auch die Spur eines Schäferhundes sein können. Was jedoch das Kopfschütteln des Försters verursachte, war die Gesamtansicht der Fährte. Dieses Lineal, diese Gerade, dieses Nichtabweichen vom Ziel. Die immerzu in eine Richtung schnürende Spur aus regelmäßigen Abdrücken im Abstand von schätzungsweise 50 Zentimetern. Wie Perlen aneinandergereiht, zwei übereinander und wieder zwei übereinander.
Er kannte diese Fährte aus Finnland. Karelien. An der russischen Grenze. Sie hatten Braunbären beobachtet. Und ihre Spuren gelesen. »Spur von Bär«, hatte der finnische Führer gesagt und auf den morastigen Boden gedeutet. Und die andere Fährte hatte er ihnen auch erklärt.
Ein Abdruck, der wie aus zwei verschobenen Einzelabdrücken aussah. Eine Fährte in der Fährte, zwei Spuren ineinandergelegt. Zwei übereinander und wieder zwei übereinander.
Der sie hinterließ, hatte Energie gespart und seine Hinterpfote immer genau in den Abdruck seiner Vorderpfote gesetzt. Kein Hund schnürte auf diese Weise. Beim Hund überlappten sich Trittsiegel von Hinterpfote und Vorderpfote, sie lagen nicht ineinander.
Der Förster richtete sich auf und blickte sich misstrauisch um. Er war sich sicher, auf eine Wolfsfährte gestoßen zu sein.
»Du bist also immer noch da, Meister Isegrim!«, murmelte er.
Schäfer Johann würde seine Freude haben …
5
Das schrille Scheppern der Haustürglocke riss Harald Haag aus dem Schlaf. Er schielte auf seinen Wecker und erkannte durch die Lamellen der herabgelassenen Jalousien, dass es draußen schon hell war. Kurz nach halb neun …
Früher hatte er selbst bei Spätdienst um diese Zeit längst im Bus nach Pforzheim gesessen, frisch geduscht und rasiert, den kleinen Rucksack mit der Thermoskanne Kaffee und dem Vesperbrot, das ihm seine Katja liebevoll gerichtet hatte, neben sich auf der freien Sitzbank und den Blick hinaus auf die Landschaft, die sich zwischen den Dörfern erstreckte.
Er hatte es geliebt, in der Arbeitspause im Baumarkt seinen Kaffee zu trinken und das Wurstweckle auszupacken, den Duft der groben Hausmacher Leberwurst einzuatmen und den ersten Bissen zu genießen. Eine hauchdünne Schicht Butter unter der Leberwurst musste sein, und genau so schmierte ihm Katja sein Brötchen, jeden Morgen, jeden Tag.
Seitdem er geschieden war, leistete er sich weder Butter noch Leberwurst. Nicht einmal Brötchen. Im Kühlschrank fanden sich – wenn überhaupt – drei, vier Flaschen Bier und ein Glas Essiggurken. Der Joghurt war oft abgelaufen, der Käse verschimmelt. Er war kein Hausmann. Und kein Ehemann mehr.
Nicht einmal ein richtiger Vater. Trotzdem lag im Kühlschrank immer wenigstens eine Tafel Kinderschokolade für Luisa. Mindestens. Manchmal, wenn er wusste, dass sie kam, auch ein Überraschungsei. Das mochte sie.
Der zweite schrille Schepperton der Haustürglocke schien ungeduldiger und lauter als der erste und Harald Haag wälzte sich aus dem Bett und machte Licht. Er hatte in Unterhose und Unterhemd geschlafen, zog das Hemd an, das von gestern noch auf der anderen, unbenutzten Hälfte des Doppelbetts lag, und schrie laut: »Jaaaaaa! Ich komm ja!«, als die Haustürglocke zum dritten Mal schepperte. Seit sie ihm gekündigt hatten, war er nicht mehr so früh aufgestanden.
Das Scheppern nervte noch ein viertes Mal. Da scheint es jemand verdammt eilig zu haben, dachte Harald Haag, als er in die Jeans schlüpfte, sich Wollsocken anzog und ohne Schuhe aus dem Schlafzimmer wankte. Der Flur war noch dunkel, da alle Jalousien unten waren, doch er kannte den Weg durch den L-förmigen Gang.
Statt des Schepperns dröhnte ihm nun ein dumpfes Poltern von der Haustür entgegen, Fäuste schlugen gegen das milchige Glas und Haralds Hand fuhr zum Lichtschalter, um dem Ungeduldigen zu signalisieren, dass er auf dem Weg war.
»Geht’s noch?«, fauchte er zornig und bog um die Ecke Richtung Eingang. Der Schnee im Hof leuchtete in hellem Grau. Harald Haag erkannte durch das Milchglas die dunkle Silhouette eines Mannes im Gegenlicht des sonnigen Morgens. Er sah den Schattenriss der Arme und der zu Fäusten geballten Hände, die jetzt ein Trommelfeuer gegen die Tür eröffneten.
»Sag mal, spinnst du? Hör sofort auf!«, schrie er dem Unbekannten entgegen. Der schien ihn gehört zu haben und das Faustfeuer setzte aus. Zwei Schritte und Harald war an der Tür.
»Wer ist da?«, rief er so laut, dass man es draußen hören konnte.
»Ich! Los, mach schon auf!«
Er erkannte die aufgebrachte Stimme von Role Gassner.
»Mach auf, oder ich schlag dir die Tür ein!«, drohte Role jetzt und das Faustfeuer trommelte erneut gegen die Tür.
Harald Haag zögerte. Er wusste, dass der Neue seiner Ex ein grober Klotz war und auch schon in Rottenburg eingesessen hatte, vielleicht sogar mehrmals. Drogen, Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Auch er hatte mit ihm schon Auseinandersetzungen gehabt, Streitereien wegen Katja oder Luisa, doch es war nie zum Äußersten gekommen. Leere Drohungen, eine aufgeschlagene Bierflasche, ein Kratzer im Auto aus einer Wut heraus, mehr nicht.
»Los, mach auf!«, brüllte Role weiter. »Ich will zu Luisa!«
Luisa, durchfuhr es Harald. Wieso Luisa? Sie war doch gar nicht bei ihm!
Er drückte die Klinke nieder und die Tür, die er auch nachts nie abschloss, ging nach innen auf.
»Wo ist sie?«, schrie Role und schob sich zwischen Harald und der geöffneten Tür in den Flur.
»Wo ist Luisa?«
Er fuhr herum und starrte Harald mit weit aufgerissenen Augen an. Seine Hände packten ihn am Kragen und seine starken Arme drückten ihn gegen die Wand. Mit einem Fuß schob er die Haustür zu, und als sie schwer ins Schloss gefallen war, zog er Harald bis auf wenige Zentimeter zu sich heran.
Harald Haag spürte den feuchten Atem in seinem Gesicht und roch die Ausdünstung aus kaltem Kaffee, fahlem Biergeschmack und ungeputzten Zähnen. Der Mundgeruch von Role war so übel, dass ihm schleimige Galle hochkam.
»Wo – ist – Luisa?«
Role spuckte ihm die drei Worte ins Gesicht und fast berührten sich ihre Nasen, so dicht stand der Aufgebrachte jetzt vor ihm.
»Ich weiß es nicht«, stammelte Harald Haag und würgte den Schleim in seiner Kehle hinunter.
»Red keinen Scheiß!«, brüllte Role und schmetterte ihn mit den Schultern gegen die Wand, dass das Bild, das ihn mit Katja und Luisa beim Skifahren zeigte, vom Nagel sprang, zu Boden fiel und das Glas zerbarst. Das Klirren holte ihn aus seiner Teilnahmslosigkeit, er packte Roles Arme und versuchte, sich aus dessen Griff zu befreien.
»Sie ist nicht hier! Sie muss doch schon seit gestern Abend wieder bei euch sein. Ich hab sie pünktlich losgeschickt!«, ratterte er los, bevor Role weiterbrüllen konnte.
»Sie sollte gestern Abend um fünf zu Hause sein«, schrie Role weiter und lockerte seinen Griff an Haralds Hemdkragen, »war sie aber nicht!«
Er atmete schwer, sein Blick wanderte von Harald in den Flur, wo aus dem Gang um die Ecke Licht kam. Er stieß Harald noch einmal gegen die Wand, ließ ihn los und eilte dem Licht entgegen.
Harald folgte ihm wie in Trance. Role kam schon wieder aus dem Schlafzimmer zurück, das er leer vorgefunden hatte, und stieß die nächste Tür auf. Er warf einen kurzen Blick in das Zimmer, schrie laut »Luisa!« und nahm sich das nächste Zimmer vor. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, Klo. Mehr gab es nicht in der kleinen Dreizimmerwohnung. Doch! Luisas Zimmer, gleich neben dem Hauseingang.
Harald Haag war im Flur stehen geblieben und hatte Role fluchend eine Tür nach der anderen aufstoßen sehen, wie besessen rannte er von Zimmer zu Zimmer, schlug die Türen auf und wieder zu, riss dabei weitere Bilder von den Wänden, fegte das Telefon von seinem Tischchen und kam jetzt wieder auf ihn zu.
Luisas Zimmer!
Nein, dort durfte er nicht hinein! Es war ihr Reich. Und sein Reich. Es war Luisas und sein Zimmer. Ihre Kuschelecke. Die Schummerlichtleiste an der Wand, die sie mit Fernbedienung in allen Farben leuchten lassen konnte. Er mochte es am liebsten in Rot.
Und ihre Bücher, ihre Bilder. Bilder, die sie und ihn zeigten. Liebevolle Bilder. Bilder von Vater und Tochter. Das war nichts für diesen Brutalo!
Harald Haag stellte sich Role in den Weg. Doch gegen die tätowierten Oberarmmuskeln hatte der Schmächtige keine Chance. Role hob ihn mit Leichtigkeit hoch und schleuderte ihn gegen die Tür zu Luisas Zimmer, dass sie nach innen flog und Harald in einem schmerzhaften Aufprall auf dem Boden vor Luisas Bett landete. Zusammengekrümmt blieb er auf der Seite liegen.
Role trat ins Zimmer und sah sich um. Sah die Bilder, die Lichtleiste, auf einem Stuhl Kleider, die er nie an Luisa gesehen hatte, den Teddybären neben dem Kopfkissen.
Er starrte auf die zurückgeschlagene Bettdecke.
»Luisa war heute Nacht hier!«, zischte er und versetzte dem am Boden Kauernden einen harten Tritt in die Rippen. Harald jaulte auf und schrie:
»Nein, verdammt! Sie war nicht hier! Sie ist nach Hause gegangen!«
Er zitterte, weil er nicht die Wahrheit sagen konnte.
»Und wieso sieht ihr Bett dann so aus? Sie hat hier drin geschlafen, willst du mich verarschen?«
Er stand vor dem Bett, schleuderte die Bettdecke zur Seite und starrte auf das Bild, das darunter lag.
Er ergriff die Fotografie und seine Kieferknochen mahlten.
»Du perverses Schwein! Du Mistkerl!«, brüllte er und trat und kickte mit seinem rechten Fuß wieder und wieder auf Harald ein. Der hatte sich in seiner Seitenlage zusammengerollt und seine Arme schützend über die angezogenen Knie verschränkt, doch die Tritte kamen von allen Seiten und er schrie bei jedem Schlag auf.
Role ging in die Hocke und hielt ihm das Bild vor das Gesicht: »Was macht dieses Foto in ihrem Bett, ha?«
Er knüllte den Papierausdruck zusammen und warf ihn in eine Ecke. »Was machst du in ihrem Bett?«
Harald lag wimmernd auf dem Boden und wagte es nicht, Role anzusehen. Jeden Augenblick fürchtete er einen neuen Hieb, einen Tritt in die schmerzenden Rippen, gegen seine Beine, in sein Gesicht.
»Ich … war nicht … ihrem Bett«, stammelte er. »Und … sie war … heute Nacht … nicht hier, ich schwör’s!«
»Und du?«, fauchte Role. »Wo warst du?«
Einen Augenblick lang war nur Haralds Wimmern zu hören. Role brüllte weiter:
»Ich war gestern Abend zweimal da. Es war alles dunkel und niemand da. Ich hab Sturm geklingelt! Es ging auch keiner ans Telefon. Kein Anrufbeantworter!«
»Der ist … kaputt«, brachte Harald heraus und verstärkte den Druck seiner Arme um die angezogenen Knie, jeden Moment den nächsten Tritt und einen höllischen Schmerz erwartend.
»Was hast du mit Luisa gemacht? Warum ist sie nicht nach Hause gekommen?«, fragte Role schwer atmend. »Los, raus jetzt mit der Sprache, oder ich schlag dich zu Brei! Das würde mir sogar großen Spaß machen!«
»Luisa … ist kurz … vor fünf … von hier losgegangen. Ich … wollte sie … fahren, aber … sie wollte unbedingt … zu Fuß … durch den Schnee…«, winselte er.
»Du lügst! Dann wäre sie ja um fünf zu Hause gewesen! Du lügst, du lügst, du lügst!«
Roles Stimme steigerte sich zu einer Lautstärke, einem Brüllen, das in Haralds Ohren schmerzte. Seine Hände fuhren nach oben, um die Ohrmuscheln zu schützen, und Tränen der Angst und der Hilflosigkeit rannen ihm übers Gesicht.
Roles Pranken packten ihn an den Handgelenken, rissen ihm die Hände von den Ohren, er drehte ihn auf den Rücken und fuhr ihn an:
»Hör mir gefälligst zu, wenn ich mit dir rede! Ich weiß, was du für ein widerliches Schwein bist! Katja hat mir erzählt, was du im Bett alles von ihr verlangt hast! Aber wenn du das jetzt auch mit Luisa …!«
Er zögerte, und dann, mit einem Ausbruch von Wut und Unbeherrschtheit, schrie er:
»Ich bring dich um, du Sau!«, und im selben Augenblick zertrümmerte seine Faust Haralds Nasenbein.
Haralds Schrei klang wie der Laut eines gequälten Tieres und ging in ein wehleidiges Jaulen über. Er krümmte sich und hielt mit beiden Händen seine Nase. Er spürte das Blut, das zwischen seinen Fingern warm zu Boden rann und den Teppich schwarz färbte.
Er fühlte, wie sein Herz raste und wie die Angst sich in ihm ausbreitete. Der würde Ernst machen, durchfuhr es ihn, und ihn totschlagen, und er hatte keine Chance, ihn daran zu hindern. Vorsichtig öffnete er hinter vorgehaltenen Händen seine Augen und versuchte, Role zu entdecken. Breitbeinig stand er über ihn gebeugt und plötzlich spürte er seine Finger in den Haaren. Sein Kopf wurde ins Genick zurückgezogen und Roles Augen tauchten direkt vor den seinen auf, das erkannte er zwischen den gespreizten Fingern, mit denen er sein Gesicht zu schützen suchte. Role starrte ihn an und flüsterte:
»Ich geb dir einen halben Tag Zeit, Luisa zu uns zurückzubringen. Wenn ich später wiederkommen muss, drehe ich dich durch den Fleischwolf! Haben wir uns verstanden?«
Roles Kopf verschwand und Harald ließ seine Hände sinken, um bessere Sicht zu haben. Das war ein Fehler. Wieder traf ihn Roles Schlag ins Gesicht, diesmal hatte er mit der flachen Hand zugehauen und versetzte ihm mit dem Handrücken gleich noch eine zweite Ohrfeige. Der Schmerz durchfuhr Harald dumpf, er schob die Hände erneut als Schutzschild vor sein Gesicht und als er vorsichtig die Augen öffnete und zwischen seinen Fingern hindurchlinste, war Roles Fratze wieder direkt vor ihm.
»Und versuch nicht, dich aus dem Staub zu machen, hörst du? Ich finde dich, egal wo du dich versteckst!«, zischte er. »Haben wir uns verstanden?«
Harald nickte und sah, dass Role sich wieder aufrichtete, über ihn hinwegstieg. Er schloss die Augen und hörte, wie sein Peiniger Richtung Türe ging.
»Das war nur ein Spaß gegen das, was dich erwartet, wenn Luisa nicht bis heute Mittag bei uns ist. Ich zerleg dich in deine Einzelteile, ich schwör’s dir, also streng dich an! Und wenn du irgendjemandem auch nur das kleinste Sterbenswörtchen von unserer Unterredung hier erzählst, kannst du auch dein Testament machen. Also, lass dir was Nettes einfallen wegen deiner blutenden Nase, der Rest ist ja nur halb so schlimm!«
Harald hörte das Öffnen der Tür und wie sie von außen ins Schloss fiel, doch er blieb reglos liegen und begann, wie ein kleines Kind zu heulen. Die Ausweglosigkeit seiner Situation war ihm bewusst und ebenso, dass Role mit seiner Drohung Ernst machen würde.
Er betastete seine Rippen und versuchte, die stechenden Schmerzen zu ignorieren. Seine Nase tat höllisch weh und blutete immer noch. Von den anderen Schlägen würde er einige blaue Male davontragen. Vorsichtig versuchte er, sich auf die Knie zu stemmen, doch das Stechen der gebrochenen Rippen machte jede Bewegung zur Qual. Liegend zog er sich so weit über den Boden, dass er im Flur um die Ecke sehen konnte. Das Telefon lag auf dem Boden, neben dem umgekippten Tischchen. Zwei Meter, vielleicht drei. Es würde schmerzen, höllisch schmerzen, aber er musste es schaffen.
Harald war kein Held. Er hatte schon als Kind immer gleich losgeheult, wenn sein Vater ihn schlug, galt in der Schule als wehleidig und als Feigling. Körperliche Schmerzen waren ihm unerträglich, er zuckte schon zusammen, wenn einer der größeren Jungs ihm nur mit einem Finger ins Gesicht schnippte.
Vor Zahnarzt und Spritzen hatte er bis heute grässliche Angst. Vielleicht fühlte er sich deshalb zu Schwächeren hingezogen, zu Kindern, zu kleinen Jungs und kleinen Mädchen? Vielleicht war seine Angst der Grund für alles?
Einen Meter hatte er geschafft. Auf dem Bauch liegend, stemmte er die Ellbogen unter sich und schob sich Zentimeter für Zentimeter über den Teppichboden Richtung Telefon. Er streckte seinen rechten Arm aus und tastete nach dem Hörer, der ihm am nächsten lag. Er angelte ihn mit den Fingerspitzen und zog über das geringelte Kabel das Telefon zu sich heran. Sein rechter Zeigefinger hackte die fünfstellige Zahl, die er auswendig kannte, in die Tastatur. 25766. Er nahm die Hörmuschel ans Ohr und hörte die rasche Folge der fünf Tastentöne. Hoch, tief, tiefer, höher, gleich hoch, in rasender Geschwindigkeit.
Er wusste nicht, ob der andere zu Hause war, falls nicht, würde er ihn zurückrufen, da war er zuverlässig. Harald überlegte, wo sein Handy lag. Zur Not würde er ihm eine Whatsapp schicken oder eine Sprachnachricht. Er musste ihn erreichen.
Falls nicht, blieb ihm keine Wahl, er musste mit der Wahrheit ans Licht.
Harald Haag atmete auf, als er das Knacken in der Leitung hörte.
6
Heinz Werkmann konnte sich den Wolf gut vorstellen hier oben in der Weite, in den Waldrücken zwischen den Flusstälern und wenigen Siedlungen, am Rand des Nationalparks, Futter hätte er genug. Rehe und Wildschweine, sogar Hirsche. Und Schafe, das hatte er ja schon blutig bewiesen.
Die wenigen Schäfer in den Schwarzwaldtälern zogen Zäune um ihre Herden, doch ihre Hunde waren darauf getrimmt, Schafe zu hüten und nicht, einen Wolf anzugehen. Doch es stand fest, der Wolf war zurück im Schwarzwald, Förster Heinz Werkmanns Revier war jetzt Wolfsgebiet.
»Leila, hier!«, befahl er und der Setter gehorchte. Sein Herrchen nahm die Leine von der Schulter und legte sie der Hündin an. Dann folgten beide der Fährte, etwa einen Meter Richtung Wiese, um sie nicht zu verwischen.
Von Zeit zu Zeit blieb der Förster stehen und lauschte. Er hielt das Gewehr, das er am Schulterriemen umgehängt getragen hatte, jetzt entsichert in den Händen, die Schlinge der Hundeleine hing lose in seiner Armbeuge, der Setter blieb an seiner Seite.
Sie waren der Wolfsfährte mehr als schätzungsweise 200 Meter gefolgt, als sie in einem fast rechten Winkel über den Graben führte und in den lichten Wald abbog. Etwa zehn Meter, vielleicht zwölf, dann blieb Heinz Werkmann wie angewurzelt stehen. Was der Förster sah, ließ ihm in der eisigen Kälte des klaren Wintermorgens sein Blut in den Adern gefrieren.
»Leila, bleib!«, zischte er, als der Setter ungeduldig an der Leine zerrte.
Der Förster blickte zunächst nur auf den roten Fleck im Schnee.
Dann starrte er auf den Riss. Er erkannte die menschlichen Formen des kleinen toten Körpers und die Farbfetzen dessen, was einmal Kleidungsstücke gewesen waren.
Schließlich sah er den Schuh.
Ein Mädchenschuh!
Der Anblick schnürte ihm die Kehle zu. Er würgte und wandte sich ab.
»Leila, komm!«
Er zerrte den Hund aus dem Wald, zurück ins Licht. Blieb schwer atmend stehen, lauschte, sah sich um, riss sich die Handschuhe herunter und fischte sein Smartphone aus der Anoraktasche, fluchte, weil er hier in der Waldeinsamkeit kein Netz hatte. Ob der Notruf trotzdem funktionierte?
Er drückte zweimal die Eins und einmal die Zwei.
Nichts.
Null.
Tot.
Verdammt! Auch noch der Akku leer! Fraß bei Kälte einfach zu viel. War nicht das erste Mal.
Er ließ seinen Blick über die verschneite Landschaft schweifen, folgte mit seinen Augen dem Verlauf der Fährte auf der Strecke, die sie gekommen waren. Er setzte das Fernglas an und suchte den Waldessaum ab. Sicher ist sicher, dachte er. Doch vermutlich hatte der Wolf längst das Weite gesucht, spätestens, sobald er die Witterung des Hundes aufgenommen hatte.
Der Förster rang mit sich, was er tun sollte. Er musste zu seinem Subaru zurück, wo er sein Smartphone ans Autoladekabel hängen und die Polizei verständigen konnte, so viel stand fest. Nahm er Leila mit, riskierte er, dass der Wolf sich zurücktraute und womöglich die Beute wegschleppte. Ließ er Leila hier, und der Wolf kam zurück …, was dann?
In dem verschneiten Tal rührte sich nichts. Nicht mal ein leichter Windhauch war zu spüren. Totenstill, dachte der Förster. Die dünne Schneedecke wies kaum Spuren auf, fast schien es, als wären alle Tiere in der Walddeckung geblieben. Da fiel ihm auf, dass er den ganzen Morgen über noch kein Lebewesen gesehen hatte.
Kein Reh, keinen Fuchs, keinen Vogel.
Keine Amsel, keinen Spatz, kein Rotkehlchen. Kein Eichelhäherschrei drang an seine Ohren. Nicht einmal Raben zeigten sich auf den verschneiten Feldern. Totenvögel, schoss es ihm durch den Kopf. Sie waren die Ersten, die dem Fuchs an den Riss folgten, die sich über die Augen hermachten und mit ihren schwarzen Schnäbeln in die Körperöffnungen hackten.
Der Förster atmete tief ein und langsam aus, fast als wollte er sich Luft machen. Er sah Leila an, die still und aufmerksam im Schnee saß. »Tja, meine Große, was machen wir denn nun?«, murmelte er. »Kann ich dich eine halbe Stunde hier allein lassen?«
Die Hündin hatte sich aufgerichtet, blickte ihn mit wachen Augen an und ihre Lauscher schienen jedes seiner Worte aufzunehmen, so konzentriert wirkte sie.
»Du bleibst hier«, sagte der Förster entschlossen. »Hier draußen. Und wenn sich da drin etwas rührt, gibst du Laut! Laut, hast du verstanden, meine Große?«
Es war ihm fast, als signalisiere ihm Leilas Blick Zustimmung.
»Ja, du bist doch meine Kluge, du weißt, was ich meine. Brav!«, tätschelte er sie und sah sie noch einmal scharf an.
»Leila! Mach sitz! Und bleib!«
Er entfernte sich einige Schritte und sah zurück. Der Setter verharrte regungslos im Schnee, den Blick in den Wald gerichtet. Der Förster schulterte seine Büchse und stapfte in seinen eigenen Spuren den Weg zurück, den er gekommen war. Knapp 20 Minuten, schätzte er, würde er bis zum Auto brauchen, die Polizei informieren und dann über den verschneiten Waldweg auf kürzester Strecke zurückfahren. Mit dem Allrad kein Problem. Fünf Minuten später wäre er wieder bei Leila.
Wenn sich in dieser Zeit in der Nähe des Leichenfundorts etwas rührte, etwas bewegte, etwas veränderte, würde sie Laut geben. Dachte er.
7
Die Fähe ist ihrem Instinkt gefolgt und hat die unverhoffte Beute den Feinden überlassen. Sie weiß, wann es sich zu kämpfen lohnt und wann nicht. Doch sie hat sich nur so weit zurückgezogen, dass sie aus ihrem Versteck heraus alles beobachten kann, was sich am Riss abspielt.
Jetzt, nachdem der Zweibeiner sich entfernt hat und nur noch sein Geruch in der Luft hängt, wagt sie sich aus dem Dickicht heraus, aus der Deckung hinter dem gefällten Baumstamm, bleibt stehen und wittert.
Ihre feine Nase nimmt alle Duftnuancen ihrer Umgebung wahr. Dominant noch immer das Blut, eingebettet in den kalten, eisigen Geruch des neuen Schnees und dazu die strenge, herbe Markierung dieses anderen Tieres, das an zwei Bäumen am Rand der Lichtung Urinspuren hinterlassen hat. Dies alles in Summe signalisiert der Wölfin, dass die unmittelbare Gefahr zwar vorüber, die Luft aber noch nicht rein ist.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: