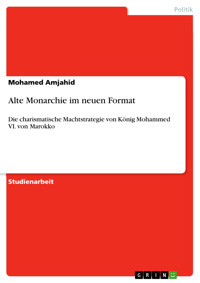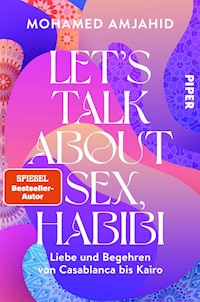
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Von den erotischen Abenteuern aus »Tausendundeine Nacht« bis hin zu den Debatten nach der sogenannten Kölner Silvesternacht: Die Sexualität »orientalischer« Männer, Frauen und Queers wird immer wieder fetischisiert. Mohamed Amjahid möchte in diesem Buch einen ungetrübten Blick in die Schlafzimmer Nordafrikas werfen und mit Klischees und rassistischen Stereotypen aufräumen. Auf Basis eigener Erlebnisse und der Erfahrungen seiner Bekannten, Freund*innen und Verwandten erzählt er berührend, witzig, intim und ehrlich, wie die alltägliche Sexualität der Nordafrikaner*innen wirklich ist und welche Sehnsüchte dahinter stecken. Dabei fragt man sich: Liegen wir am Ende doch alle im gleichen Bett?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Kondome und die Salafi-Apotheker
Tunis
Oran
Kairo
Meknès
Schwanzvergleich
Liebe Sünde
Hit Me Baby One More Time
Paragraf 490
Haram TV
Der Sexy Bexy Talk
Die dunkelste Ecke des Friedhofs
Donnerstagabend
Ein Nafri in der deutschen Sauna
Hajeb
Das Bordell nebenan
Marokkanischer Striptease
Mariage Blanc
Nachbarschaftsfreuden
Der Rizq
Always mit Flügeln
Mehr Gleitgel, bitte!
Sonia ist schwanger, aber nicht verheiratet
Bunga-Bunga
Poly…gamie!
Du bist geschieden! Du bist geschieden! Du bist geschieden!
Masturbieren auf Islamisch
Was meine allererste Freundin wirklich von mir wollte
Der Schleier
Liebeszauber
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Gewürzhändler
Orgien am Fuße des Atlas
Queere Magie, queerer Schmerz
Gefährliches Dating
BAMF steht für Bundesamt für Fickerei
Übergriffige Touristen
Die ewige Silvesternacht
Much Loved
Der coole Salafist
Beschneidung oder Verstümmelung?
Alle bleiben in der Familie
Angst essen Seele auf
Testosteron!
Frei in Casablanca
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Es liegt auf der Hand, dass Völkerverständigung am besten über Liebe betrieben werden kann: käufliche Liebe, liebevollem Sex, sexuellem Begehren. Indem man in die Schlafzimmer, unter die Schleier, eben in die Liebesleben der Menschen blickt, bekommt man ein wohliges Gefühl für die Kulturen, die einem zunächst fern und exotisch erscheinen mögen – davon bin ich überzeugt.
Als Reporter habe ich in den vergangenen Jahren viele Regionen Nordafrikas besucht, mit unzähligen Menschen zwischen Casablanca und Kairo gesprochen, aufwendige Recherchen zu Papier gebracht. Auch weil ich selbst in Marokko aufgewachsen bin und zum Land seit Jahren arbeite, kann ich berichten: Maroks sind Weltmeister*innen im Spaßhaben. Und genau diese orgasmische Lockerheit möchte ich einer breiten Leser*innenschaft mitgeben.
Denn nicht erst seit der sogenannten Kölner Silvesternacht wurde über die Sexualität der Nordafrikaner*innen verhandelt, ohne mit Nordafrikaner*innen selbst zu sprechen. Es fing mit dem Kolonialismus an, dass afrikanische Körper im literarischen Kanon und der eurozentrischen Erzählung der Menschheitsgeschichte anders gemacht wurden. Vorurteile, Desinformation, Orientalismus und Fetischisierung dominieren bis heute das Gespräch über (Nord-)Afrika in Deutschland und Europa. Ich würde ja behaupten, dass viele Menschen in Europa sehr wenig über das benachbarte Nordafrika wissen, dafür aber viele Vorurteile über diese sehr diverse Region pflegen. Ich habe mir schon so einige erstaunte Aussagen über mich selbst anhören müssen: Ich sei »soft«, »pittoresk« oder »für einen Mohamed irgendwie sehr fortschrittlich«, mal begleitete diese Aussagen ausgesprochen oder unausgesprochen der Zusatz »für einen nordafrikanischen Mann«. Egal, wie dieser auch immer in den Vorstellungen der Europäer*innen zu sein hat: Wir müssen als Menschen fair, geschichtsbewusst, faktenbasiert, empathisch und auf Augenhöhe aufeinander blicken, miteinander sprechen und zusammenleben.
In meinen beiden ersten Büchern Unter Weißen und Der weiße Fleck geht es um Privilegien und die Emanzipation von verletzbaren Minderheiten. Ich musste als von Rassismus betroffener Autor diese Bücher schreiben. Und ich habe sie gerne geschrieben, um meinen Beitrag zu leisten: zum Abbau historisch gewachsener Strukturen und Machtgefälle nach dem Kolonialismus. Dieses, mein drittes Buch, baut auf diese emanzipatorische Perspektive der Selbstermächtigung auf und verknüpft sie mit dem mediterranen Savoir-vivre, nach dem sich so viele Europäer*innen – nicht nur beim Strandurlaub – sehnen. Mehr ist dies aber ein Text, den ich unbedingt schreiben möchte. Mit anderen Worten: Ich habe diesmal richtig Bock.
Mit Erinnerungen aus meiner Pubertät, Begegnungen mit Frauen und Queers und der Betrachtung von Verletzbarkeiten möchte ich das facettenreiche Nordafrika mit meinen Leser*innen bereisen. Ich möchte mich auf die Spuren einer weitverbreiteten toxischen Männlichkeit und des feministischen Befreiungskampfes begeben. Einen kritischen Blick wagen auf das Verhältnis von Glaube, Tradition und Körperlichkeit, das andauernd bestimmen möchte, wen ich bitte schön zur Braut nehmen soll.
An dieser Stelle muss ich einen Hinweis loswerden: In diesem Buch kommen explizite Sprache und Erzählungen zu sexualisierter Gewalt und der Diskriminierung von verletzbaren Gruppen und Individuen vor. Diese Menschenfeindlichkeit ist Teil der Realität und kann nicht ausgeblendet werden. Dies ist ein sehr persönliches, erzählendes Sachbuch. Bedeutet: Alle Beschreibungen sind wahr, sie dienen als Fallbeispiele und Zugänge zu universal wichtigen Fragen. Um die Anonymität meiner Protagonist*innen zu wahren, habe ich die meisten Namen abgekürzt oder geändert, teilweise habe ich meine Beziehung zu den beschriebenen Menschen unkenntlich gemacht. Auch weil ich nicht immer die Möglichkeit hatte, sie um Erlaubnis zu bitten, in diesem Buch vorzukommen. Um Erzählungen abzugleichen und Fakten zu checken, habe ich lange mit anderen Menschen über meine Erinnerungen gesprochen, unter anderem mit meiner Mutter und meinen Schwestern. Denn einige Anekdoten liegen sehr weit in der Vergangenheit, in einer Zeit, bevor ich angefangen habe, als Reporter und Anthropologe Tagebücher zu schreiben.
Aber genug des Vorworts: Ich möchte diese (Reporter-)Tagebücher nun öffnen, ich will meinen Leser*innen so den Alltag am südlichen Mittelmeer näherbringen, den arabischen Witz übersetzen, das Lebensgefühl der Menschen dort transportieren. Ich möchte die Anliegen und Sehnsüchte der Nordafrikaner*innen in den Fokus dieses Buchs stellen, sie – wo immer es auch geht – für sich selbst sprechen lassen und damit aufzeigen, wie geil es sein kann, sich aufrichtig auf »andere« Gesellschaften einzulassen.
Let’s talk about Sex, Habibi!
Kondome und die Salafi-Apotheker
Sex ohne Schwangerschaft? Ohne sexuell übertragbare Krankheiten? Kondome sind da eine gute Wahl. Zumindest wenn ein Penis in die ganze Sache involviert ist und das Glied nicht zu so ’nem Typen gehört, der es partout blank irgendwo reinstecken muss, egal was das Gegenüber möchte, weil es sich sonst »nicht echt anfühlt« … Halt doch die Fresse und zieh dir einfach eins über!
Was ich aber eigentlich erzählen will: Ich habe in meinem Leben schon überall in Nordafrika Kondome käuflich erworben, wie man im Kapitalismus so schön sagt. In Deutschland geht man dafür in den Supermarkt (und wundert sich über die limitierte Auswahl) oder in die Drogerie (und ärgert sich über die horrenden Preise) oder zum Automaten (der auch im Jahr 2022 weiterhin nur 2-Euro-Stücke nimmt, die man natürlich nie dabeihat). In Tunesien, Algerien, Ägypten und Marokko geht man für Kondomshopping in die Apotheke. Dort wird man als Kund*in schnell in mal unangenehme und mal erkenntnisreiche Gespräche verwickelt.
Tunis
Die Sonne knallte erbarmungslos auf meinen Kopf, und ich irrte bei einer Recherche mitten in der Hauptstadt Tunesiens umher. Ich starrte – von der Hitze benommen – auf die Menschen, die an einer Tram-Haltestelle herumschwirrten. Im Geografieunterricht in Marokko hatte ich vier Fakten über sie gelernt: Die Tunesier*innen leben in einem kleinen Land, haben mit das höchste Pro-Kopf-Einkommen Nordafrikas, werden von einem autokratischen Polizeistaat unterdrückt, und sie können null kochen. Das mit der Autokratie war seit August 2013 fürs Erste Geschichte, der Rest stimmte.
Den Tunesier*innen wird auch nachgesagt, dass sie – gesellschaftlich betrachtet – besonders progressiv seien. Frauenrechte, Religionsfreiheit und sexuelle Befreiung: alles easy und viel besser als in so manchem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, wie Polen zum Beispiel. Immerhin hatte Habib Bourguiba, Tunesiens erster Präsident nach der Unabhängigkeit von der französischen Besatzung, im Fastenmonat Ramadan tagsüber und öffentlich einen Orangensaft geschlürft und eine Zigarette dazu geraucht. Diese geschmacklich fragwürdige Kombination fand im Jahr 1958 statt. Zur damaligen Zeit undenkbar in einem anderen mehrheitlich muslimischen Land, heutzutage hier und da auf jeden Fall unmöglich.
Also stieß ich – das Image der grenzenlosen Progressivität Tunesiens im Hinterkopf – mit Schwung die Tür zur kleinen Apotheke an der Tram-Haltestelle auf. Jede noch so kurze Pause vor den Sonnenstrahlen war willkommen, und ich wollte sowieso eine Packung Sodbrennen-Blocker (die tunesische Küche ist wirklich nicht mein Ding) und Kondome kaufen.
Hinter der chaotischen Glastheke, in der sich alte Flaschen mit Sonnenmilch und Babymilchpulver stapelten, lugte ein Mann hervor. Er hatte eine kleine weiße Gebetsmütze auf, die ihn direkt als orthodox-gläubig erkennbar machte. Dabei hätte er den Strickstoff auf dem Kopf gar nicht dafür gebraucht: Am minutiös-gerade rasierten 8-Tage-Bart und dem beachtlich großen und dunklen Gebetsfleck auf der Stirn konnte ich schnell erkennen, dass es sich hier um einen besonders überzeugten Bruder handelte. In Nordafrika wird zwischen jenen »Geschwistern« differenziert, die für sich orthodox leben, und anderen, die politisch ihren Glauben der Gesellschaft aufzwingen wollen. Vom parteipolitischen Islam haben sich – Allah sei dank – in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen in der Region abgewendet. Schon damals wusste ich, dass sich einige von ihnen durch eine Art Schönheitsoperation den Gebetsfleck auf der Stirn vergrößern ließen. Je imposanter der Fleck, desto ausgiebiger und intensiver der Niederwurf vor Allah im Gebet. Oder eben nicht, wenn man chirurgisch nachhelfen muss.
Dennoch rutschte mir das Herz in die Hose, als ich auf seiner Stirn den Gebetsfleck sah, der sich vor meine frisch geblendeten Augen wie der Mond vor die Sonne schob. Ich weiß nicht, ob mein sommerweichgekochtes Hirn meinem Herzen einfach nicht schnell genug in die Hose folgen konnte oder mein Kopf wieder mal in diesen Jetzt-erst-recht-Modus schaltete, der mich schon öfter im Leben in missliche Lagen befördert hatte; auf jeden Fall sprudelten beim Hineintreten in den muffigen Laden folgende Sätze aus mir heraus: »Salam Aleikum, Allahs Barmherzigkeit und seine Gnade sei mit euch. Ich hätte gerne etwas Starkes gegen Sodbrennen und eine Packung Kondome.«
Der Bruder schaute mich skeptisch an. Er kramte aus dem Regal hinter ihm eine rote 12er-Packung mit Magentabletten hervor und knallte sie auf den Tresen. Dann fragte er: »Bist du verheiratet?« Ich neigte den Kopf und fragte zurück, ob der Bund der Ehe Sodbrennen fördere. Ich fand den Witz äußerst lustig, merkte aber zugleich erschrocken, dass ich spätestens jetzt im trotzigen Mohamed-Modus gefangen war. Er sagte, dass sein »pharmazeutischer Ehrenkodex« es nötig mache, diese Frage zu stellen, und dass er sogar legal eine Heiratsurkunde verlangen könne, wenn ihm danach sei. Mein Blick schweifte auf eine kleine Vitrine am äußersten rechten Rand des Tresens. Dort waren eine Handvoll Packungen mit der Aufschrift »préservatifs« aufgereiht. Sie waren verstaubt. Seit Jahren hatte in dieser Apotheke niemand Kondome gekauft, so schien es.
Ich scannte die Reihe von rechts nach links und bat ihn, mir die größte und teuerste Packung zu geben. 65 tunesische Dinar (rund 20 Euro) stand auf dem Etikett. Dabei war »größte Packung« mit nur 12 Kondomen relativ. Aber hier ging es ums Prinzip, und der Apothekenbruder spürte meine Energy. Er überlegte kurz und schloss dann die Vitrine auf. Profitgier schlägt »pharmazeutischen Ehrenkodex« dachte ich mir und fühlte mich wie der arabische Dildo-König.
Während eine extreme Auslegung des Christentums darauf abzielt, Kondome ganz zu verbieten, damit sich jedes weibliche Ei und jedes Spermium in kleine Ministrant*innen verwandeln, ist es dem Muslimbruder wichtiger, dass es keinen außerehelichen Sex gibt. Innerhalb der Ehe geht für ihn bestimmt auch viel. Verhütung ist selbst für viele orthodoxe Muslim*innen kein Problem. Der Apotheker schien mir ein wenig baff, als könnte er es selbst nicht recht glauben, dass seine Hände nun eine winzige Plastiktüte über die Kondompackung stülpten. Ich bat ihn noch überheblich um eine größere Packung Magentabletten, bezahlte mit den größten Scheinen, die ich in meinem Portemonnaie hatte, und nahm die kleine Plastiktüte wie eine Trophäe mit in die Hitze der Stadt.
Oran
Dass es mit diesen Apothekenbrüdern auch anders geht, zeigt ein Kondomkauf etwas mehr als ein Jahr später in der westalgerischen Stadt Oran. Auch hier habe ich mich an die wichtigsten Fakten aus dem Geografieunterricht in meiner marokkanischen Grundschule erinnert: Die Algerier*innen leben in einem Staat, der sich vor allem mit den Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung am Leben hält und deswegen unabhängiger von Steuereinnahmen ist. Sie lassen fast keine europäischen Touris in ihr Land und vergeben nur wenige Visa (weil sich hier Ausländer, vor allem aus Frankreich, schon mal schlecht benommen haben), dennoch sprechen viele Algerier*innen gerne und gut Französisch. Fakt ist auch: Das Trauma des Bürgerkriegs in den Neunzigerjahren haben die meisten Algerier*innen nicht überwunden. Damals, nach dem Sieg der Islamisten bei der Parlamentswahl 1991, war zwischen den politisch-religiösen Kräften und dem Militär ein erbitterter Machtkampf entbrannt. Das Land war in eine blutige Kriegsdekade um Deutungshoheit, Identität und Ressourcen versunken.
Vielleicht lag es auch an dieser schmerzvollen Geschichte, dass der Muslimbruder in der hellen, aufgeräumten Apotheke im Zentrum der Stadt so ganz anders war, als ich es mir zunächst einbildete. Der Laden befand sich in einem schneeweißen Gebäude aus der französischen Kolonialzeit. Es war November, angenehmes Wetter, mein Kopf war kühl. Dennoch schaltete ich beim Anblick seines Gesichts samt Bart und Gebetsfleck innerlich wieder in den besagten Modus, auch wenn er, im Gegensatz zu seinem tunesischen Kollegen, keine weiße Strickmütze auf dem Kopf hatte.
»Ich hätte gerne Kondome«, sagte ich entschlossen. Er lächelte mich, ja flirtete mich förmlich an, bat mich, ihm in den Verkaufsraum hinter der Kosmetikabteilung zu folgen, und zeigte mir ein üppig bestücktes Regal. Egal was die verantwortungsbewusste Libido begehrte, es war dort zu haben: extradünn, genoppt, Tuttifrutti, Größen M bis XXL, schwarz oder beige, teuer oder ein bisschen weniger teuer, Markenprodukt oder No-Name. Ich schaute zum Bruder, nickte und bedankte mich. Damit wollte ich signalisieren: Okay, lass mich jetzt mal bitte kurz alleine in Ruhe schauen. Aber er wollte nicht von meiner Seite weichen. Zuerst dachte ich, dass er darauf achten wollte, dass ich nichts klaue, aber dann wurde mir klar: Er wartete darauf, mich beraten zu können. Ich griff nach einer Packung, auf der die französischen Worte »transparent et inodore« (durchsichtig und geruchsneutral) standen. »Excellent choix, Monsieur!« Ich hätte eine ausgezeichnete Wahl getroffen, sagte er, als wäre er der zuvorkommende Garçon in einem Michelin-Restaurant. Und fügte hinzu, dass die meisten Menschen sowieso von diesen fancy Kondomen überfordert seien. »Wer will schon, dass das Schlafzimmer wie ein Kaugummi riecht?« Der zumindest äußerlich als orthodox lebender Muslim zu erkennende Mann zeigte auf die billig anmutende Tuttifrutti-Packung, auf der Bananen, Ananas und Erdbeeren abgebildet waren. Ich konnte seiner Expertise nur zustimmen.
Zwar gelten die Algerier*innen nicht als superprogressiv, so wie ihre Nachbar*innen in Tunesien. Aber mir ist in der Vergangenheit schon hier und da ein algerisches Laisser-faire begegnet. Mir kam vor dem Kondomregal in Oran zwangsläufig eine Szene aus einem algerischen Spielfilm in den Sinn, in der das Höschen einer Schauspielerin ihre Beine herunterglitt. Damit wollte die Regie signalisieren: Jetzt wird gefickt – ohne den Akt selbst zu zeigen. Undenkbar im marokkanischen TV der Neunzigerjahre. Meine Mutter hatte vor dem Fernseher geflucht und gesagt, dass die richtig unverschämt seien in Algerien. Der Kolonialismus habe denen die Moral ausgetrieben.
Ich atmete tief durch, beförderte mich aus dem sexy Flashback wieder zurück in die Apotheke im Zentrum von Oran und versuchte, mir die Überraschung nicht ansehen zu lassen. Immerhin war ich davon ausgegangen, dass ich Fragen wie »Bist du verheiratet?« mit Witzen werde ausweichen müssen. Stattdessen befand ich mich quasi mitten in der musulmanischen Version der Kondomwerbung mit Hella von Sinnen von 1989. In diesem legendären Spot ruft eine Kassiererin quer durch den Supermarkt, »Tina, wat kosten die Kondome?«, und der Kunde an der Kasse möchte am liebsten im Boden versinken. Nur eine ältere Kundin löst die unangenehme Stille auf, weil sie weiß: »2,99, die sind im Sonderangebot.« Dieses Schauspiel hatte meine Mutter vor dem Fernseher damals sehr, sehr lustig gefunden und die Werbung gerne als Running Gag zitiert. Nix da mit Moral.
Der Bruder in der Apotheke nahm derweil eine große, dicke Tube in die Hand und zeigte damit auf meinen Körper. Vielleicht war er nur ein guter Verkäufer? Vielleicht bekam er für jedes verkaufte Produkt eine kleine Provision? Vielleicht war er einfach sexuell befreit im Kopf? Auf jeden Fall wollte er mir noch das passende geruchsneutrale Gleitgel zu den Kondomen andrehen. Ich schaute zuerst auf den horrenden Preis auf dem Etikett, dann in die Mitte der geräumigen Apotheke, wo wartende Kundinnen sich die Zeit mit Lauschen und Gaffen vertrieben, und lehnte dankend ab. Ich überreichte das Geld passend und verschwand ohne weiteren Blickkontakt aus meinem persönlichen Werbespot-Albtraum.
Kairo
Spätestens jetzt stellen sich zwei Fragen:
Erstens: Warum hat der Mohamed einen so großen Kondombedarf?
Die Antwort liegt, denke ich, auf der Hand. Außerdem verschenke ich oft welche, sicher macht mehr Spaß.
Zweitens: Warum sucht der Mohamed überall nur muslimbruderschaftliche Apotheken auf?
Tatsächlich gibt es einige Berufe, die bei sehr gläubigen Muslim*innen sehr beliebt sind. Dazu zählen (aus meiner eigenen empirischen Forschung und Umfragen in meinem Freundeskreis) folgende Bereiche: Handel (vor allem mit Textilien, Haushaltswaren und Kosmetik), Zahnmedizin und eben Pharmazie. Konsum und Heilung also. Alles, was die Kernfamilie und damit die Gesamtgesellschaft glücklich und kräftig macht.
Nach der Revolution in Ägypten Anfang 2011 war ich mehrfach am Nil für Studien- und Rechercheaufenthalte, manchmal auch monatelang am Stück. Plenty of time, Kondome einzukaufen. Ich musste eh oft in die Apotheke, weil die kohlenhydratbelastete und übertrieben fettige ägyptische Küche meinem Magen zu schaffen machte. Sodbrennen-Blocker und Kondome standen oft auf meinem Einkaufszettel. Ich habe sie deswegen alle gesehen: »Kein Sex vor der Ehe«-Brüder, »Darf ich Ihnen dazu noch das passende Gleitgel empfehlen«-Brüder oder, wenn auch selten, einfach nur Apotheker*innen, die ihren Job kommentarlos machten.
Besonders in Erinnerung ist mir der Besuch einer Apotheke in einem überdimensionalen Einkaufszentrum im Kairoer Stadtteil Heliopolis geblieben. Am Haupteingang des Konsumtempels – der Gold und Diamanten, teure Uhren und andere Luxusgüter anbietet – war ich zunächst abgewiesen worden. »Samstag ist Familientag«, hatte der Sicherheitsmann gesagt. Ich hatte spontan und sehr wütend erwidert: »Wie dumm, dass du meine Kreditkarte und Devisen abweist!« Und stampfte dann einige Schritte weg. Ich musste aber unbedingt in die blöde Shoppingmall, weil ich dort mit jemandem verabredet war. Ich rief also meinen Interviewpartner an, der mir sagte, dass es easy sei, trotzdem in das Einkaufszentrum zu gelangen: einfach den Eingang über das benachbarte Fünfsternehotel nehmen. Und tatsächlich klappte es, den erzkonservativen Kapitalismus mit einem kleinen Umweg auszutricksen.
Natürlich steckte meine Verabredung noch im Kairoer Megastau fest, ich konnte also schnell einige Dinge besorgen. Ich suchte gezielt nach der Apotheke, die eher wie eine zu grell ausgeleuchtete Parfümerie aufgemacht war. Eine Verkäuferin, übertrieben geschminkt und mit einem glitzernden Kopftuch, sprang zwischen den Regalen herum. Sie beobachtete offenbar voller Glück, wie ich die Kondompackungen inspizierte. Dann kam sie auf mich zu und fragte breit grinsend: »Kann ich dir behilflich sein?« Ich schüttelte den Kopf und sagte, dass ich schon gefunden hätte, was ich suchte. »Bist du aus Dubai?«, fragte sie mit großen, funkelnden Augen weiter, so als würden wir auf der Datingseite muslima.com chatten. Ich dachte nur »O my God, sehe ich so aus wie ein reicher Prinz aus den Emiraten?« und schüttelte gleichzeitig den Kopf. »Marokko«, erwiderte ich. Normalerweise folgte dieser Information immer ein kleiner Plausch. Diesmal aber nicht. Mit einem Wimpernschlag knipste die Verkäuferin das Leuchten in ihren Augen aus, fuhr das Lächeln zurück, drehte sich um und ging enttäuscht zurück an die Kasse. An einem sexuell aktiven Emirati mit Investments an der New York Stock Exchange, einem Tresor am Genfer See und Immobilien in Dubai war sie offensichtlich interessiert, an jeder anderen Person eher nicht. Sie kassierte stumm das Geld und sagte noch nicht mal Tschüss. Ich war ein bisschen gekränkt, um ehrlich zu sein.
Meine Verabredung erklärte mir später, dass das Einkaufszentrum ein Treffpunkt für frisch verliebte Jugendliche sei. Sie kämen hierher, teilten sich einen Frozen Yoghurt, atmeten die frostige Luft aus den Klimaanlagen ein und schauten sich tief in die Augen. (Spät-)Pubertierende Singles (jeden Geschlechts) würden manchmal auch einfach vorbeikommen, um den Vibe einzusaugen und davon zu träumen, demnächst auch einen überzuckerten und viel zu teuren Frozen Yoghurt mit der Liebe ihres Lebens zu teilen. Konservative Familien würden sich gestört fühlen bei so vielen Hormonen in der Luft, erklärte mir mein Gesprächspartner bei – natürlich – einem Frozen Yoghurt. Deswegen habe sich das Center-Management irgendwann dafür entschieden, nicht verheirateten Pärchen und vor allem alleinstehenden Männern an einigen Samstagen den Zugang zu verweigern. Ob die Apothekerin dachte, dass ich sie als Zweit- oder Drittfrau mit in mein Luxusleben nach Dubai nehmen würde?
Meknès
Das erste Mal Kondomshopping werde ich nie im Leben vergessen. Wahrscheinlich werde ich mich sogar über meinen Tod hinaus daran erinnern. So massiv prägend war diese Erfahrung. Denn ich hatte als 16-jähriger Gymnasiast bei dieser Mission eine sehr spezielle Person im Schlepptau. Oder sie mich?
Es war meine eigene Mutter, die sich mit mir in eine Apotheke begab, um eine kleine, unscheinbare und doch politisch so aufgeladene Sache zu kaufen. Als ich sie vorab gefragt hatte, hatte sie listig lächelnd geantwortet: »Ja klar gehe ich mit!« Auch weil sie wusste, dass einige Brüder hinter den Theken dumme Anmerkungen machen und Mama ihren Prinzen niemals in so eine unangenehme Situation laufen lassen würde. »Mir und meinem Tuch auf dem Kopf können die nix erzählen«, hatte sie gesagt.
Die Tür zur Apotheke war zwischen einem Bankautomaten und dem Eingang zu einem Supermarkt eingeklemmt. Ein junger Mann stand hinter dem Tresen. Er trug keine Strickmütze, keinen Bart, hatte keinen Gebetsfleck auf der Stirn. Er begrüßte uns beide mit einem »Bonjour« und fragte, was er für uns tun könne. Jetzt muss man wissen, dass meine Mutter übertrieben viel Fantasie besitzt. An dem Tag war sie die perfekte Schauspielerin, die marokkanische Scarlett Johansson, die natürlich mit einem Fingerschnippen in jede Rolle schlüpfen kann. In der Apotheke war sie die coole Mom, die ihrem Sohn wie selbstverständlich eine Packung Kondome kaufte. Schließlich schrieben wir das Jahr 2004.
Der junge Apotheker verstand die Welt nicht mehr, das war an der Schockstarre seines Gesichts klar zu sehen. Da stand diese ältere Dame vor ihm, die großen Wert darauf legt, dass sie Hadscha genannt wird – was so viel wie »nach Mekka gepilgert« bedeutet und eine religiöse Verwurzelung ausdrücken soll –, und fragte eiskalt nach Kondomen. Doch der Apotheker konnte, da hatte meine Mutter recht, der Autorität des Kopftuchs nichts entgegensetzen. Er zeigte auf die Auswahl an Kondomen, die er zu bieten hatte. Meine Mutter drehte sich zu mir um und fragte, ob die kleine Packung mit drei Kondomen reiche oder ich doch die große Packung brauche. »Sicher ist sicher, lieber die große Packung. Oder?«, sagte sie. Ich erwiderte (mit aufgerissenen Augen und zusammengepressten Zähnen), dass wir jetzt ohne Theater die kleine Packung kaufen und verschwinden sollten. Meine Mutter wandte sich aber wie in einem dramatischen Kammerspiel an den Apotheker und fragte nach dem Preis, obwohl er deutlich auf der Packung und am Regal zu lesen war. »Das ist zu teuer!«, sagte sie. Und ich versank von jetzt auf gleich im Boden. Ein Loch brach unter meinen Füßen auf. Ich fiel hinein. Physisch habe ich den Sturz in meinen Beinen, in meiner Brust gefühlt. Es war dunkel und kalt da unten im Loch, ich wollte nie wieder raus.
»Willst du ihn jetzt bei den Kondomen runterhandeln, oder was?«, zischte ich neben ihr, und der Apotheker beteuerte, dass alle Preise in der Apotheke fix seien. Man könne an diesem Ort prinzipiell nicht verhandeln. Das beträfe auch die Preise für Kondome. Ich legte das Geld in die Münzschale, er schaute mich verzweifelt an, so als wollte er sagen: WHATTHEFUCK, BRUDER? WASPASSIERTHIERGERADE? WARUMSEIDIHRSO? Dann gingen wir raus. Meine Mutter verabschiedete sich mit einem floskelhaften: »Möge Gott deine Eltern segnen.«
Schwanzvergleich
Die Kondome, die ich mit meiner Mutter gekauft hatte, brauchte ich für ein Referat in der Schule. Normalerweise gibt es so etwas wie Referate nicht im marokkanischen Frontalunterricht. Aber ich war halt ein komischer Schüler und überredete den Biologielehrer, uns ein bisschen reden zu lassen. Auch damit der Unterricht etwas interessanter wurde. Er willigte ein – und sollte es bald bereuen.
Hauptthema in diesem Schuljahr, das auch relevant für die Abinote war: die menschliche Fortpflanzung. Selbst die Rowdys, die den Unterricht meistens schwänzten, erschienen zum Biologieunterricht auf Arabisch und auf Französisch. Jedes Thema wurde zweimal durchgenommen. Doppelt hält besser. Alle wollten wir bis ins kleinste Detail wissen, wie Sex funktioniert, einige wollten wissen, wie Babys gemacht werden. Während einige Referatsgruppen den weiblichen Zyklus vorstellten, die Anatomie von Spermien oder die Funktionsweise von Milchdrüsen in der weiblichen Brust erklärten, sich also für sachliche Fragen und Körperfunktionen interessierten, drehte ich in meinem Kopf »You Can Leave Your Hat On« von Joe Cocker auf superlaut. Ich meldete mich freiwillig für den Höhepunkt: richtig verhüten und Spaß dabei haben.
Eigentlich war Sex keine so große Neuigkeit für uns Schüler*innen. Die menschliche Sexualität war schon seit den Achtzigerjahren fester Bestandteil des Biologieunterrichts in Marokko. Zumindest waren meine Schulbücher aus den Jahren 1980 bis 1985 voll damit. Zum Abschluss jeder Schulform ragten Schaubilder von Penissen und Vaginen aus dem Biologieheft: In der sechsten Klasse (Ende der Grundschule), neunten Klasse (Ende der Sekundarstufe) und zur dreijährigen Abiturphase am Gymnasium. Die Darstellung der Genitalien im Grundschulbuch hatte sogar kleine gezeichnete Schamhaare im Angebot. Mit zwölf haben wir gelernt, dass Kondome vor HIV und ungewollten Schwangerschaften schützen. Auch wenn die Lehrerin betonte, dass monogame Ehen und die Furcht vor Allah am effektivsten seien. Rechtzeitig rausziehen, wie sie uns unmissverständlich mit ihren Händen darstellte (sie formte mit der linken Hand einen Kreis, steckte den Zeigefinger rein und zog ihn schnappartig wieder raus), schütze ein bisschen vor ungewollten Schwangerschaften. Ziemlich fataler Tipp, wie einige später selbst herausfinden sollten. In den aktuellen Schulbüchern fehlt diese Verhütungslüge zum Glück.
Aber zurück zu meinem Referat: Zur Vorbereitung hatte ich die Gebrauchsanweisung aus der Kondompackung gelesen, im Internet recherchiert und die Kondome praktisch ausprobiert. Der Klasse erzählte ich zuerst was über die Anwendung der Pille für die Frau und stellte die Frage in den Raum, warum es eigentlich keine Pille für den Mann gibt. Ich erklärte, dass »rechtzeitig rausziehen« große Disziplin erfordere, die wenige bis gar keine Typen aufbringen könnten. Ich merkte an, dass das Berechnen der fruchtbaren Tage ebenfalls nur eine bedingt sichere Methode der Verhütung sei. Und das alles ja sowieso nicht bei sexuell übertragbaren Krankheiten helfe. »Chlamydien wandern auch ohne Befruchtung gerne von einem Genital zum anderen«, erklärte ich. Kichern im Raum. Das Gesicht des Lehrers lief derweil rot an. Als ich dann auch noch eine Banane auspackte und fest in meine linke Hand nahm, hatte er definitiv genug. Er sagte, dass ich nun die Verantwortung für die öffentliche Ordnung trage, und floh aus dem Klassenraum. Normalerweise würde in so einem Moment der absoluten Anarchie eine riesige Party in der Klasse steigen, Jungs würden auf die Tische klettern und tanzen, jemand würde virtuos auf dem hastig entleerten Papierkorb trommeln, die Mädels würden singen und freudig Ululationen herausschreien. Aber alle blieben ruhig und still und wie versteinert auf ihren Plätzen sitzen. Sie warteten gespannt darauf, was passieren würde. Keiner von ihnen regte sich aus moralischen Gründen auf.
»Das Reservoir oben am Kondom fest drücken, damit die Luft entweichen kann«, erklärte ich und rollte dann das Latex langsam und genüsslich mit meiner rechten Hand auf die steife Banane. Ich informierte meine Mitschüler*innen außerdem darüber, dass es auch ein bisschen auf die Anatomie des Penis ankomme. Nicht mit jedem Produkt ließe sich der maximale Tragekomfort erreichen. »Wenn es zwickt, schützt es nicht wirklich.« Valla, die Kondomindustrie hätte mich für dieses Referat bezahlen sollen. Meine Mitschüler*innen hingen mir an den Lippen, Fingern, Sätzen. Ich erklärte, wie das mit dem Gleitgel funktionierte und warum Latex niemals mit öligen Substanzen angewendet werden dürfe. »Sonst wird das Kondom brüchig, und ihr habt neun Monate später ein Baby, das ihr euren Eltern erklären müsst.« Einige Mädchen schauten zugleich schüchtern und skeptisch und aufgewühlt, machten sich aber sicher im Kopf Notizen. Am Ende meines Referats, ich schilderte, wie man ein volles Kondom sicher entsorgen könne, entbrannte tosender Applaus – das Zeichen für den Lehrer, wieder ins Klassenzimmer zu kommen. »18 von 20 möglichen Punkten.« Er zog mir zwei Punkte wegen meiner angeblich übertriebenen Schamlosigkeit und seiner peinlichen Prüderie ab. Die Jungs buhten ihn aus. Ich war auch der Meinung, dass ich die volle Punktzahl verdient hätte.
Später, als die Pausensirene (ja es war wirklich eine Sirene. An meinem ersten Schultag nach unserem Umzug nach Marokko 1995 dachte ich, dass ein Feuer ausgebrochen war und wir alle sterben würden, weil Sirene nun mal, so hatte ich es in Deutschland gelernt, gleich Gefahr bedeute. In Marokko läutet sie einfach die Pausen ein), als also die Sirene heulte, kamen alle Jungs zu mir an meinen Platz und gratulierten mir mit festen, feuchten Handschlägen zu meinem Erfolg. Ich fühlte mich wie Dr. Sommer der ganzen Schule. Ayoub – ein komischer Typ, der seit längerer Zeit völlig von seinen Hormonen gesteuert durch die Welt lief, zwei Jahre zuvor während des Unterrichts vom Französischlehrer beim Masturbieren in der letzten Reihe erwischt wurde und eigentlich immer ein bisschen säuerlich nach Sperma roch –, deutete auf die kondomierte Banane auf meinem Tisch.
Ich erinnerte ihn, dass Kondome nur einmal benutzt werden könnten, und fragte ihn in belehrendem Ton, ob er mir nicht beim Referieren zugehört habe. Er nickte und sagte, er habe sich sogar Notizen aufgeschrieben. Er dramatisierte und schob noch ein zweites »Notizen!« hinterher. Das Kondom wolle er zum Masturbieren nutzen, sagte er schambefreit, so als wolle er gleich einen formalen Antrag dafür vorlegen. Es sei doch schade drum, so ein teures Produkt an eine Banane zu verschwenden. Außerdem wollte er schon immer mal probieren, wie es sich so anfühle mit Kondom. Einige Jungs nickten zustimmend. Ich schenkte ihm die Banane gleich dazu.
Einige Tage später kam Ayoub auf dem Pausenhof aufgeregt auf mich zugerannt, um mir zu danken. Er habe jetzt auch die Kondomexperience hinter sich gebracht. Und es habe sich mehrmals jeweils anders angefühlt. »Mehrmals?«, fragte ich, und er nickte nur. Er könne jetzt sein eigenes Sperma sammeln und als Gleit… Ich stoppte ihn und wunderte mich dabei über so viel Offenheit gegenüber anderen Gleichaltrigen. Ayoub kannte so etwas wie Boundaries einfach nicht. Generell waren die meisten Jungs in meiner Abistufe sehr, manchmal zu offen. Ich war eher der Prüdeste von allen. Da war zum Beispiel dieser eine schwule Junge, der war so auf don’t ask, don’t tell, aber alle wussten Bescheid. Der Klassenschönling erzählte Geschichten von seiner Freundin, die sich nicht um ihre Jungfräulichkeit kümmerte. Und Ayoub war einfach ein dauergeiles Schweinchen. Wir nannten ihn auch so wegen seiner abstehenden Nasenlöcher. Es schien ihm egal zu sein, er nannte sich sogar selbst manchmal ironisch Schweinchen und fand diesen Kosenamen vielleicht sogar geil. Zumindest hat er sich nie darüber beschwert und lachte immer mit. Die Mädchen machten verständlicherweise einen riesigen Bogen um Ayoub. Die meisten anderen Jungs nutzten seine Erfahrungen, von denen er freimütig erzählte, sozusagen als Versuchslabor.
Er zeigte seinen hellbraun-blond behaarten Schwanz gerne allen, die ihn sehen wollten oder auch nicht. Zum Beispiel in der Umkleidekabine oder der stets versifften Jungstoilette. Ich war ja in zwölf Jahren kein einziges Mal in der Schule auf Klo, zu sehr habe ich mich davor geekelt. Also hatte ich auch verpasst, wie einige Jungs ihre Beschneidungen dort verglichen. War der Schnitt gerade? Virtuos? Lang? Kurz? Von diesem Wettbewerb, wo dabei sein wirklich alles war, wurde mir erst später berichtet. Und ich ärgerte mich damals doch ein bisschen über meine eigene westdeutsche Prüderie.
Ende der Leseprobe