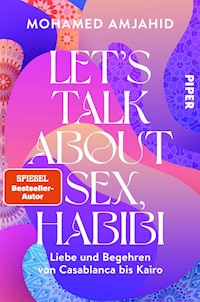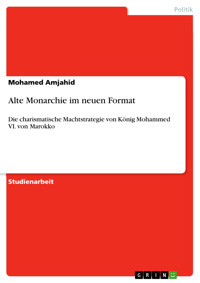17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rassistische und antisemitische Polizei-Chats, Machtmissbrauch im Amt, Racial Profiling, weit verzweigte rechtsextreme Netzwerke, tödliche Polizeigewalt – laut Innenministerien und Sicherheitsbehörden alles nur Einzelfälle. Doch basierend auf repräsentativen Studien, langjährigen investigativen Recherchen und persönlichen Erlebnissen deckt Mohamed Amjahid auf, wie tief das Polizeiproblem in Deutschlands Sicherheitsarchitektur verwurzelt ist. Von der systematischen Vertuschung von Machtmissbrauch bis hin zum NSU 2.0: Dieses Buch erschüttert das Grundvertrauen in die Institution Polizei und fordert eine ehrliche Debatte über das Polizeiproblem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1 Vorwort
2 Eine kleine Geschichte der Polizei
3 Deutsche Police Academy
4 Wer hat den längsten Schlagstock?
5 Polizeiliche Blauäugigkeit
6 Von der Polizeigewerkschaft bis hin zum Innenministerium
7 Der kurze Arm der Justiz
8 Hinter Gittern
9 Polizeireporter oder Pressesprecher?
10 Frühreife Dienstunfähigkeit
11 Die politische Einstellung macht’s
12 Polizei und Popkultur I: Tatort Deutschland
13 Polizei und Popkultur II: süße Polizeihunde
14 Racial Profiling: Die Missachtung der Menschenwürde
15 Kommt eine Hundertschaft in eine Shisha-Bar …
16 Polizeigewalt I: beiläufig und spontan
17 Polizeigewalt II: beiläufig, spontan und tödlich
18 »Leute Leute Leute … ihr seid doch total durch. Und genau deswegen mag ich euch«
19 Post vom NSU 2.0
20 Aufstände gegen die Polizei
21 Quittungen, Diversity, Oberpolizei und andere Reformansätze
Kontrollquittungen
Bodycams
Kennzeichnung
»Nicht tödliche Wirkmittel«
Verfassungstreue-Check
Künstliche Intelligenz
Mehr Transparenz
Schutz von Whistleblowing
Interne Kontrollmechanismen
Parlamentarische Kontrolle
Diversity
Vorurteilstraining
Community Policing
Deeskalationstaktiken
Polizeibeauftragte
Oberpolizei
Defund the Police
22 Was, wenn wir die Polizei ganz abschaffen?
23 Und was kann ich gegen Polizeigewalt tun?
24 Glossar
Weiterführende Literatur und Anmerkungen
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
1 Vorwort
Warum schreibe ich diesen Text? Mit dieser simplen Frage hat eigentlich jedes meiner Buchprojekte in den vergangenen Jahren begonnen. Das Thema Polizeigewalt begleitet mich als Recherche-Journalist schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich habe mit der entsprechenden journalistischen Arbeit in einer Zeit angefangen, in der es nicht selbstverständlich gewesen wäre, eine polizeikritische Schrift in einem großen Publikumsverlag zu veröffentlichen. Diese weiterhin bestehende Lücke in der Sachbuch-Literatur wollte ich nach sehr vielen Recherchen zum Polizeiproblem und mehr als zehn Jahren Reflexion schließen. Deswegen halten Sie diesen arbeitsreichen Text in Ihren Händen.
Bewusst früh möchte ich Sie an dieser Stelle darüber informieren, dass dieses Buch explizite rassistische, antisemitische, sexistische, queerfeindliche, ableistische, geflüchtetenfeindliche Sprache und Gewaltfantasien oder verherrlichende Aussagen zu den Verbrechen des Nationalsozialismus zitiert. Es beinhaltet dichte Beschreibungen von menschenfeindlichen Taten, die durch Polizist*innen begangen wurden. Die Darstellung dieser brutalen Realität ist Teil einer notwendigen Beweisführung, um das System hinter der Polizeigewalt aufzuzeigen. In diesem Buch versuche ich, auf verschiedene Aspekte bedrohlicher Polizeistrukturen zu blicken: historische Herleitungen, Gruppen- und Institutionsdynamiken, mediale Diskurse und Popkultur, (fehlgeleitete) kriminologische Ansätze, die Einbettung in das politische System, Übergänge und Überschneidungen zwischen Polizeibehörden und dem Rechtsextremismus. Ich sehe diese ungefilterte Darstellung der polizeilichen Realität als notwendig an, denn nach langer Überlegung bin ich zu folgender Haltung gekommen:
Niemand, wirklich niemand hat es verdient, Opfer von Polizeiwillkür oder -diskriminierung zu werden. Niemand hat es verdient, ins Visier von rechtsextremen Netzwerken mit polizeilichem Hintergrund genommen zu werden. Niemand hat es verdient, von Polizist*innen erschossen zu werden. Es ist klar, dass Polizist*innen aufgrund ihrer Arbeit häufig in gefährliche Situationen geraten. Bei Terroreinsätzen oder Geiselnahmen. Dass sie dann ihre Waffen und das Gewaltmonopol, mit dem sie nun mal ausgestattet sind, zu ihrer Verteidigung einsetzen. Polizeigewalt, wie ich sie in diesem Buch aber verstehe, bezieht sich auf eine unverhältnismäßige, politisch (oft rechtsextrem) motivierte und strukturell angelegte, von Polizist*innen ausgehende Gewalt. Und sie kann jede Person treffen. Darauf werde ich in diesem Buch in verschiedenen Kontexten ausführlich eingehen.
Um ebendiesen strukturellen Charakter des Phänomens zu erforschen, stütze ich mich auf die Ergebnisse meiner eigenen Recherchen, auf Erkenntnisse aus der unabhängigen Wissenschaft, des investigativen Journalismus und polizeikritischen Aktivismus. Ich habe mir große Mühe gegeben, dabei so barrierefrei und unterhaltsam wie möglich zu erzählen, sodass vielleicht sogar True-Crime-Fans auf ihre Kosten kommen. Dieses Buch verstehe ich auch als ungetrübten Blick hinter die Kulissen von Polizei- und Sicherheitsbehörden im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Ich hoffe, dass dies für die eine oder den anderen Fan von Aktenzeichen XY oder dem Tatort spannend sein kann.
Aber zurück zum Kern dieses Buchprojekts: Polizeigewalt trifft vor allem verletzbare Minderheiten wie Schwarze Menschen, muslimisch gelesene Menschen, Geflüchtete, von Armut Betroffene, Menschen mit (geistiger) Behinderung oder Drogenabhängige. Ich zeige in der Dokumentation vieler Fälle in diesem Buch aber eine wichtige Erkenntnis auf: Polizeigewalt kann jede Person in verschiedenen Intensitäten treffen – und das eben nicht nur in der Theorie. Das Polizeiproblem geht deswegen alle etwas an. Es ist ein Thema, das auch, aber nicht nur Minderheiten betrifft und auf die allgemeine politische Agenda gehört. Ich lade Sie deswegen ein, diesen schwierigen, teils bedrückenden und vielleicht schockierenden Text zu lesen, darüber nachzudenken, was das für Sie ganz persönlich bedeuten könnte. Insbesondere lade ich Sie ein, sich die (Teil-)Dokumentation der Namen der Todesopfer von Polizeigewalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz anzuschauen, die Sie im Umschlag dieses Buches finden. Diese und weitere unzählige Namen illustrieren die Fallhöhe des Systems hinter der Polizeigewalt, die Verantwortung, die insbesondere die (Innen-)Politik dafür trägt.
Wir haben es uns mit diesem Buch nicht leicht gemacht: Und an dieser Stelle ist es mir wichtig, von einem Wir zu sprechen. Die vielen Erkenntnisse zum System hinter der Polizeigewalt konnte ich in diesem Buch nur dank des Mutes von stark gefährdeten Whistleblower*innen innerhalb von Polizeibehörden, insbesondere aber von Betroffenen von Polizeigewalt und Expert*innen zum Thema festhalten. Unzählige Gespräche mit kritischen Anwält*innen, Forscher*innen, Aktivist*innen und engagierten Kolleg*innen im Recherche-Journalismus bilden einen Teil der Grundlage für diesen Text. Ausgiebig habe ich neben meinen eigenen investigativen Recherchen zudem Statistiken und Datensätze ausgewertet und dabei gemerkt, wie wichtig der Matheunterricht in der Schule und das Statistikseminar an der Uni waren. Viele Kolleg*innen vom Piper Verlag haben mir dabei geholfen, einen ausgewogenen Text für ein hoffentlich breites Publikum zu erstellen: Beim Lektorat, bei einem aufwendigen, professionellen Faktencheck und einer juristischen Prüfung haben wir gemeinschaftlich, pedantisch und nach bestem Wissen und Gewissen sichergestellt, dass die Daten, die Angaben, die Nacherzählungen der Fälle in diesem Buch stimmen. Das war mir als Autor ein großes Anliegen – auch weil ich vermute, dass die Ergebnisse meiner Arbeit durchaus viele Entscheidungsträger*innen persönlich beleidigen könnten.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es mir, eine Sache klarzustellen: Dieses Buch transportiert nicht (nur) meine Meinung. Das wäre mir als investigativer Journalist bei diesem Thema viel zu wenig. So etwas wie reine Objektivität existiert zwar nicht. Es ist aber möglich, sich diesem Idealzustand recherchierend und selbstreflektierend zu nähern. Das habe ich mit einer durchaus deutlichen Haltung zum Thema in diesem Buch versucht. Dies ist also kein reiner Debattenbeitrag, keine rein subjektive Antwort auf die Meinung einer Einzelperson oder Lobbygruppe. Vielmehr möchte ich mit diesem Buch einen realitätsbezogenen Beitrag leisten, eine Faktensammlung und Einordnung anbieten – im Sinne einer nötigen Debatte über die Funktion, die Arbeitsweisen und die Gefahren der Polizei in unseren Gesellschaften.
Eigentlich gehört ans Ende dieses Vorworts ein Cliffhanger, der Beginn eines Spannungsbogens, so wie in einem fesselnden True-Crime-Podcast, den man dann nicht mehr abschalten kann. Ich entscheide mich an dieser Stelle aber bewusst für einen Spoiler: Die Frage »Alles nur Einzelfälle?« ist mit Blick auf die Ergebnisse in diesem Buch rein rhetorischer Natur.
2 Eine kleine Geschichte der Polizei
Es wird einige schockieren, aber die Polizei ist nicht naturgegeben. Sie ist menschengemacht, sie wurde mit bestimmten Vorstellungen von Ordnung, Sicherheit, Gewaltanwendung und Verteilung von Ressourcen erfunden, weiterentwickelt, oft von autoritären Regimen pervertiert. Sodass einige von dieser Institution maximal profitieren – manchmal auf Kosten anderer Menschen und Gruppen in der Gesellschaft. Die Polizei hat sich mit der Zeit als unverzichtbar erscheinendes Phänomen in der menschlichen Zivilisation etabliert. So wie Sauerstoff, allzeit verfügbares, günstiges Fleisch auf unseren Tellern, superbillige Flugtickets oder leichte Unterhaltung auf unseren Smartphones. Okay, außer dem Sauerstoff sind all diese Dinge wirklich menschengemacht und irgendwie doch verzichtbar.
In prähistorischen, sogenannten primitiven Gemeinschaften wurden Konflikte von Stammesältesten oder Räten geschlichtet, die Regeln für das Zusammenleben aufstellten. Diese Tradition wurde teilweise zu Gesetzen und sozialen Normen gemacht, auf Gerechtigkeit ausgerichtet und so in einigen Regionen der Welt weiter bewahrt (siehe Kapitel 22). Mit dem Entstehen von Städten und komplexen Gesellschaften in der Antike kamen erste organisierte Sicherheitsmechanismen auf. Beispielsweise gab es in Mesopotamien sogenannte Stadtwächter, die für die Aufrechterhaltung der Ordnung und die Prävention von Kriminalität zuständig waren. Im alten Ägypten wurde eine königliche Wache etabliert, um den Pharao zu schützen und seinen Willen durchzusetzen.[1] Wenn man so will, gilt dieses System bis heute in Ägypten.
Im Römischen Reich wurde die Sicherheit durch das Militär und regionale Präfekten gewährleistet. Diese Beamten (es waren immer Männer) standen im Dienst des Staates, sie hatten militärische und polizeiliche Befugnisse, sie durften zum Beispiel Bürger*innen durchsuchen und festnehmen, Wege absperren oder privates Eigentum beschlagnahmen.[2] Sie waren für die Aufrechterhaltung der damals geltenden öffentlichen Ordnung verantwortlich. Da es sich hier um eine kleine Geschichte handelt, springe ich an dieser Stelle direkt ins Mittelalter. Dort entwickelten sich Stadtwachen und Bürgermilizen als Antwort auf die steigende Kriminalität in den Städten, diese Wachen und Milizen sind bis heute wichtig für unser eurozentrisches Verständnis von Polizei Die Stadtwachen wurden von der Stadtverwaltung angestellt, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Die Bürgermilizen hingegen bestanden aus freiwilligen Bürgern, die sich zusammenschlossen, um ihre Gemeinschaften zu schützen. Manchmal wurden sie aber auch zum Wachdienst verpflichtet. Hauptsächlich ging es darum, den Besitz von wenigen zu verteidigen.[3] Die Wachen und Milizen waren für jene da, die es sich leisten konnten, einen Sold zu zahlen.[4] Besitzverhältnisse waren gar nicht so deutlich festgeschrieben, wie wir es heute kennen. Es gab selten ein gültiges Grundbuch, in dem man nachlesen konnte, wer welches Gebäude oder Land besitzt. Reiche setzten auf eine private Polizei, um ihr (vermeintliches) Eigentum vor der verarmten Bevölkerung zu schützen, die naturgemäß ein Stück vom Kuchen abhaben wollte. Es ging darum, die proletarischen Massen zu kontrollieren und sie dem Adel und später dem Bürgertum als billige, ausgebeutete Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen.[5]
Die moderne Polizei, wie wir sie heute kennen, basiert auf diesem Prinzip: Menschen und vor allem Besitz sollen geschützt werden. Aber vor wem? Für wen? Von wem? Im 19. Jahrhundert wurden exakt diese Fragen in England geklärt. Wie meine Geografielehrerin schon zu sagen pflegte: Viel Schlimmes stammt aus Britannien. Der Staatsmann und Politiker Sir Robert Peel gilt als Begründer der konservativen Partei im Vereinigten Königreich[6] und des modernen Polizeiwesens dort und überhaupt. Im Jahr 1829 gründete er den Metropolitan Police Service in London und führte das Prinzip der »Polizei durch Zustimmung« ein.[7] Die Polizei sollte nicht länger ein Instrument der Unterdrückung sein, sondern in enger Verbindung mit der Bevölkerung arbeiten: auf demokratisch-parlamentarischer Basis, um die Kriminalität zu bekämpfen und die Ordnung zu wahren. Tatsächlich gab es damals – nicht nur in London – ein Problem mit Kriminalität und Gewalt. Der Schriftsteller Charles Dickens beschreibt zum Beispiel in seiner Romansatire Oliver Twist die Bandbreite der Delikte in der (vor-)viktorianischen Ära des langen 19. Jahrhunderts: Diebstahl, Raub, Einbruch, Körperverletzung, Totschlag und Mord.[8] Diese Gewalt war vor allem mit sozialen Problemen und der wirtschaftlichen Misere in den industrialisierten Großstädten verbunden[9], in denen insbesondere Arbeiter*innen und ihre Familien ihr Leben verbringen mussten. Dickens’ Satire zielt dementsprechend meist auf die Strukturen, die arme Menschen damals in die Kriminalität schubsten: Eine habgierige Kirche und ihre Wohltätigkeitsindustrie, die ausbeuterischen Produktionsverhältnisse der Industrie und der Sicherheitsstaat mit seiner erst jungen Polizei.[10] Hinzu kam eine sensationslüsterne Presselandschaft, die ab der Mitte des 18. Jahrhunderts Journalismus bewusst mit reiner, unkritischer Unterhaltung und der Wiedergabe staatlicher Perspektiven auf Kriminalität verwechselte (siehe auch Kapitel 9).[11]
Die faktische Existenz von Kriminalität und ihre übertriebene Abbildung in Zeitungen sorgte in der britischen Bevölkerung für ein vermehrtes Verlangen nach Sicherheit, für eine nachvollziehbare Sehnsucht nach Ordnung und einer vertrauenswürdigen, politisch neutralen Instanz, die diese aufrechterhalten kann. Robert Peel wollte mit einer demokratisch verankerten Polizei genau diese Nachfrage bedienen. Er wollte die Kriminalität eindämmen, sodass sich die gesetzestreuen Bürger*innen wieder sicher fühlen und somit produktiv sein konnten.
So zumindest in der Theorie. Die Polizei untersteht in Großbritannien der Krone und hat offiziell der Monarchie zu dienen. Was wie ein Satz aus der Vergangenheit klingt, holte britische Monarchie-Gegner*innen im Jahr 2023 ein: Bei der Krönung von Charles III. Anfang Mai 2023 nahm die Polizei in London Dutzende von ihnen fest – weil sie friedlich demonstrierten.[12] Demokratisch war und ist das nicht. Deswegen lohnen sich Fragen wie: Wem dient die Polizei eigentlich? Fast so alt wie die moderne Polizei im Vereinigten Königreich ist dort allerdings auch der Widerstand gegen sie als unterdrückerische Institution (siehe Kapitel 4). Meine Geografielehrerin hatte doch unrecht.
Der moderne Staat, wie wir ihn kennen und zu selten hinterfragen, ist eine Erfindung des Westfälischen Friedens von 1648. Ein wichtiges Prinzip dieses Vertrags bestand darin, dass ein Staat offiziell existiert, wenn ihn genug andere Staaten anerkennen.[13] Dementsprechend muss der anerkannte Staat diplomatische Beziehungen pflegen, seine eigene Wirtschaft und den Handel ausbauen und nach innen für Sicherheit sorgen. Die Polizei ging später im (zumindest theoretischen) Sinne von Peel in die Geschichte und politische Praxis des Staatswesens ein. Der Polizei wurden im Zuge der Erfindung und Etablierung von moderner Staatlichkeit auch eine maßgebliche Rolle beim Schutz staatlicher Grenzen zugewiesen. So begannen Polizeibehörden damit, die eigenen Staatsbürger*innen vor vermeintlichen »Eindringlingen« zu schützen – mit allen erdenklichen Mitteln (siehe Kapitel 21). Dies als menschengewollte Erfindung in Erinnerung zu rufen, hilft zumindest mir, meinen Blick auf diese Institution heute zu schärfen.
Peels Polizeimodell fand schnell Verbreitung in anderen Ländern, darunter auch den USA. Womit wir schon beim Thema Kolonialismus und Versklavung wären: Ohne das Prinzip der Polizei hätte es keine Gewalt von Europa aus und von den Nachfahren europäischer Siedler*innen in Amerika gegen die Völker der Welt geben können. Die Wurzeln der Polizei in den USA liegen im 18. und 19. Jahrhundert in den Slave Patrols.[14] Es handelt sich dabei um organisierte Milizen von weißen Sklavenhändler*innen und -besitzer*innen, die aus Afrika verschleppte und versklavte Schwarze Menschen kontrollierten, unterdrückten und töteten. Schwarze Männer wurden ausgepeitscht, gedemütigt, gelyncht – ohne Gerichtsverfahren, nur weil sich weiße Frauen über sie beschwerten.[15] So zum Beispiel im Jahr 1857 in Post Oak im texanischen Bexar County geschehen, als sich eine »deutsche Frau« über einen versklavten Schwarzen Mann »empörte« und eine Bürgerwehr ihn zur Strafe hängte.[16] Solche unzählig verübten öffentlichen Exekutionen dienten dazu, anderen Schwarzen Menschen Angst zu machen, sie gefügig zu machen. Die Slave Patrols spielten vor allem in den Südstaaten der USA eine zentrale Rolle, vor allem, weil sie später in das Staatsgebilde und das lokale institutionelle Gefüge übergegangen sind. In den USA sorgten die sogenannten Jim-Crow-Gesetze[17] auch nach der formalen Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1865 dafür, dass Schwarze Körper entmenschlicht, der gesellschaftlichen Diskriminierung und den Sicherheitsbehörden ausgeliefert wurden. Offiziell bis ins Jahr 1964 und zum Inkrafttreten des Civil Rights Act, der die Segregation gesetzlich verboten hat. Inoffiziell, dank der institutionellen Kontinuitäten, bis heute. Viele städtische und ländliche Polizeibehörden, die heute noch in den USA, aber auch in Brasilien zum Beispiel operieren, gehen auf die Slave Patrols zurück. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, wenn Schwarze Menschen in Amerika und auf anderen Kontinenten zum Abolitionismus, also zur Auflösung des herrschenden Polizeisystems, aufrufen (siehe Kapitel 22).[18] In den USA hat schließlich August Vollmer, Sohn deutscher Einwanderer im Bundesstaat Louisiana, Anfang des 20. Jahrhunderts die Polizei in Nordamerika professionalisiert und dazu beigetragen, dass sie militarisiert aufgestellt gegen Teile der eigenen Bevölkerung eingesetzt wurde.[19] Vollmer hat vor allem die Technisierung und Taktik der US-Armee in den von den USA besetzten Philippinen auf Polizeibehörden übertragen.
Ich möchte hier auf die oben genannten Fragen zurückkommen: Wer schützt wen und vor wem? Die Polizei sollte die weiße Bevölkerung Europas und Amerikas und ihre Privilegien vor den vermeintlich minderwertigen nicht-weißen Menschen, vor allem vor Schwarzen Menschen in den Kolonien »schützen«. Die koloniale Gewalt verbreitete sich über alle Kontinente dank des Militärwesens. Auch im deutschen Kolonialismus. Die Gewalt gegen »die Anderen« konnte sich über Jahrhunderte allerdings nur dank der disziplinierenden Funktion polizeiähnlicher oder polizeilicher Organisationen halten. In den Kolonien, egal ob in Afrika, Asien oder Amerika, wurden Menschen verdinglicht, und dieser vermeintliche Besitz wurde im Sinne der ursprünglichen Idee, was die Polizei überhaupt zu leisten hat, »geschützt«. Die einen profitierten maximal, die anderen mussten im Elend leben oder sterben.
In Deutschland etablierte sich im 19. Jahrhundert das moderne Polizeiwesen nach englischem Vorbild. In Preußen mit seinem autoritären Staatsverständnis oder in Bayern zeigte die Polizei allerdings eine massive Präsenz auf den Straßen der Städte und verhängte für jedes noch so kleine Vergehen Bußgelder: Auf der falschen Straßenseite zu laufen, hat in Deutschland mal ein kleines Vermögen gekostet[20]; Beamtenbeleidigung[21] oder ein Tanz an Karfreitag[22] können bis heute teuer werden. Die Polizei ging bei der Überwachung der Gesetze und der vorgeschriebenen öffentlichen Ordnung äußerst pingelig vor. Ausländische Besucher*innen machten sich über diese kleinkarierte Kultur lustig. Der englische Komiker Jerome K. Jerome schrieb nach einem Deutschlandbesuch über eine von ihm beobachtete Symbiose zwischen der deutschen Bevölkerung und deren geliebter Polizei. Sein satirischer Reisebericht Drei Männer auf Bummelfahrt erschien am 1. Januar 1900[23]: »Der Deutsche ist ein Soldat, und der Polizist ist sein Offizier. Der Polizist weist ihn an, wo er auf der Straße gehen soll und wie schnell er gehen soll. Am Ende jeder Brücke steht ein Polizist, der dem Deutschen sagt, wie er sie überqueren soll. Wäre kein Polizist anwesend, würde sich der Deutsche wahrscheinlich hinsetzen und warten – bis der Fluss versiegt ist.«[24] Diese satirisch überspitzt dargestellte bürgerliche Spießigkeit können wir heute noch gut nachvollziehen. Auch weil die Polizei großen Spielraum hatte, Bußgelder und andere Strafen für vermeintliche Vergehen festzulegen, war die polizeiliche Willkür groß. Aus diesem autoritär-skurrilen, punktuell willkürlichen Gebilde sollte im 20. Jahrhundert ein anderes grausames Kapitel in die Geschichte der deutschen Polizei eingehen: der Nationalsozialismus.
Das deutsche Naziregime war vor allem durch eine brutale, repressive, straff organisierte Polizeiapparatur geprägt. Schon vor der Machtübernahme durch Adolf Hitler etablierte die NSDAP Milizen und Bürgerwehren, auf die der nationalsozialistische Staat später zurückgreifen konnte. Von 1933 bis 1945 spielten die deutschen Polizeikräfte eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung der nationalsozialistischen Ideologie, der Unterdrückung jeglicher Opposition und der praktischen Umsetzung der Massenvernichtungspläne der Nazis. Die SS (Schutzstaffel) und die SA (Sturmabteilung)[25] spielten eine besonders verheerende Rolle in diesem mörderischen System. Sie wurden zu gewalttätigen Instrumenten des Regimes, bestückt mit besonders überzeugten nationalsozialistischen Verbrecher*innen. Nach der Machtübernahme der NSDAP im Jahr 1933 wurden die Polizeikräfte des Landes zentralisiert und unter der Führung von Heinrich Himmler in der Reichsführung-SS zusammengefasst.[26] Himmler kontrollierte nicht nur die Polizei, sondern auch die SS, die zu einer elitären und gefürchteten paramilitärischen Organisation wurde. Die Gestapo (Geheime Staatspolizei) war als politische Polizei auch dafür zuständig, Oppositionelle zu identifizieren und zu ermorden.[27]
Die Zusammenarbeit zwischen der SS und der regulären Polizei, also der Polizeiwache ums Eck, ermöglichte es dem Regime, eine umfassende Kontrolle über das ganze Land und die eroberten Gebiete, vor allem in Osteuropa, auszuüben. Die Polizei teilte Informationen mit der Gestapo, unterstützte sie bei Verhaftungen und half bei der Identifizierung von Menschen, die als »unerwünscht« oder »schädlich für den Volkskörper« angesehen wurden. Gemeinsam betrieben die verschiedenen Polizeibehörden der Nazis eine Politik der staatlichen Diskriminierung, Verfolgung und Ausgrenzung von Minderheiten und politischen Gegnern. Polizisten stürmten Wohnungen und suchten nach jüdischen Menschen jeden Alters in Kellern und auf Dachböden, sie nahmen Sinti*zze und Romn*ja fest, spionierten queeren Menschen nach, erklärten Menschen für psychisch krank und damit für nicht lebenswürdig, verfrachteten ihre Opfer in Konzentrationslager. Ohne die Polizei hätte es das nationalsozialistische Terrorregime und seine Verbrechen nicht gegeben, sie war direkt in die Umsetzung des Holocaust involviert (siehe auch Kapitel 8).
In Westdeutschland nahmen sich die Alliierten nach 1945 vor, den deutschen Polizeistaat mit klaren Gesetzen und einem föderalen System zu bändigen. Ein zentraler Punkt bestand darin, die öffentliche Verwaltung – insbesondere die Polizei – zu entnazifizieren. So genau nahmen es die Siegermächte aber nicht mit der Säuberung des braunen Drecks. Ein Blick in die Archive zeigt, dass diese Strategie an sehr vielen Orten in der Bundesrepublik gescheitert ist, gar wissentlich sabotiert wurde. Überall in Westdeutschland wurden Akten vernichtet, Biografien reingewaschen, die Vergangenheit verleugnet, damit Nazis unbehelligt weiter agieren konnten.[28] Immer wieder gelang es Beamt*innen, die im Nationalsozialismus im Dienst waren, in der BRD an ihre polizeiliche Arbeit anzuknüpfen und ihr Gedankengut nach 1945 in die westdeutsche Sicherheitsarchitektur einfließen zu lassen.[29] Von der Polizeiwache ums Eck bis hin zu den obersten Geheimdiensten.[30] Kein Wunder also, dass an der Spitze deutscher Verfassungsschutzbehörden heute noch dezidierte Rechtsextremisten jahrelang walten und schalten können.[31]
Derweil wurde in Ostdeutschland die Deutsche Demokratische Republik (DDR) aufgebaut. Im sozialistischen Unrechtsstaat spielte die Polizei von 1949 bis 1990 eine zentrale Rolle in der Unterdrückung der Menschenrechte und der Aufrechterhaltung des autoritären Regimes. Gebündelt wurde diese staatliche Aufgabe im Ministerium für Staatssicherheit (Stasi). Egal ob reguläre oder sicherheitsdienstliche Polizei, sie waren eng mit der SED verbunden und unterlagen der direkten Kontrolle der Partei. Jegliche Form von Opposition und Kritik sollte unterbunden werden.[32]
Die Stasi war eine der mächtigsten und gefürchtetsten Geheimdienstorganisationen in der Geschichte der Menschheit. Sie dient bis heute als Vorbild für andere autoritäre Polizeiregime (siehe Kapitel 20). Die Stasi hatte ein weitreichendes, ausgeklügeltes Netzwerk von Informant*innen und Spion*innen, die in allen Bereichen des Lebens präsent waren. Menschen wurden willkürlich verhaftet, gefoltert und inhaftiert, nur weil sie politisch »unliebsam« waren oder die Ideologie des Regimes infrage stellten. Die Stasi war berüchtigt für ihre brutalen Verhörmethoden, bei denen psychischer und physischer Druck auf die Gefangenen ausgeübt wurde, um Geständnisse zu erzwingen. Briefe wurden geöffnet, Telefone abgehört, Wohnungen durchsucht und verwanzt, ohne dass die Betroffenen davon wussten. Die Stasi erstellte detaillierte Akten über das Leben der Menschen, sammelte und archivierte eine unglaubliche Menge an Informationen, um potenzielle Dissident*innen auszuschalten und zu diskreditieren. Die Verselbstständigung der Stasi führt uns allen vor Augen, welche Gefahr aus einer Polizeibehörde erwachsen kann.
Es wird geschätzt, dass etwa jede*r 89. Bürger*in in der DDR als Inoffizielle*r Mitarbeiter*in (IM) für die Stasi arbeitete, insgesamt waren es 620 000 Spion*innen. In jeder Straße ein*e Spion*in, mehr Polizeipräsenz geht kaum. Die IMs sollten die politische Loyalität der Menschen überprüfen und jegliche oppositionellen Aktivitäten melden.[33] Polizeisystem außer Kontrolle. Nach 1990 gingen viele IMs trotz Überprüfungsmechanismus und gesellschaftlicher Debatten in die Verwaltungen, Sicherheitsbehörden und in die Politik über. Die Kontinuitäten dieser repressiven Polizeisysteme in der deutschen Geschichte können nicht verwischt oder unter den Teppich gekehrt werden.
Von der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung möchte ich hier nur eine kleine Szene teilen, die aus meiner Sicht viel erzählt: Während im August 1992 der Mob aus Neonazis und besorgten Bürger*innen Jagd auf Sinti*zze und Romn*ja, auf vietnamesische DDR-Vertragsarbeiter*innen und andere Geflüchtete in Rostock-Lichtenhagen machte, während das berühmte Sonnenblumenhaus belagert wurde, Scheiben zu Bruch gingen, Gebäude in Flammen standen, Rechtsextremisten die Parole »Ausländer raus!« skandierten unter dem Jubel der Anwohner*innen und dem Desinteresse der politischen Verantwortlichen, gab ein Polizist ein Fernsehinterview. Hinter ihm standen seine Kollegen, sie witzelten entspannt. Die nüchternen Worte des Polizisten sagen viel aus über den polizeilichen Blick auf die entsprechenden politischen Verhältnisse und die Sicherheit von verletzbaren Minderheiten: »Das ist klar, dass wir lieber mal weggucken, bevor wir irgendwas gegen irgendwelche Leute unternehmen.«[34]
Diese wirklich sehr kleine Geschichte der Polizei spielt sich also gar nicht so weit in der Vergangenheit ab. Sie weist heute noch deutliche Kontinuitäten in Deutschland auf und strahlt, wie es der Kampf von Millionen von Menschen weltweit zeigt, ihre autoritäre Kraft in die ganze Welt aus (siehe Kapitel 20). Es ist wichtig, die Funktion der Polizei im Jetzt historisch herzuleiten, diese Institution im Schatten ihrer Geschichte zu betrachten, um die Notwendigkeit einer kritischen Debatte rund um das Polizeiproblem zu erkennen.
3 Deutsche Police Academy
Der Fachkräftemangel betrifft fast jede Branche, fast jede öffentliche Verwaltung, auch die Polizei. Hier einige Schlagzeilen zum Kampf deutscher Polizeibehörden um neuen Nachwuchs:
In Sachsen-Anhalt hat die Landespolizei schon im Jahr 2017 eine Kampagne mit dem Titel »Nachwuchsfahndung« gestartet (das klingt etwas verzweifelt, fahndet man doch, sprachlich betrachtet, oft nach Personen, die man nicht auf Anhieb findet oder die sich aktiv verstecken).
[35]
Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Bewerber*innen für den Polizeidienst in Bremen um knapp 40 Prozent eingebrochen (eine abgelaufene Bewerbungsfrist wurde 2022 daraufhin auf unbestimmte Zeit verlängert).
[36]
Die Bundespolizei macht für sich Werbung mit dem polizeikritischen Akronym
ACAB
(All Cops Are Bastards), um junge Menschen in Großstädten zu erreichen und für den Beruf zu begeistern (die Auflösung dieser skurrilen Schlagzeile findet sich in Kapitel 4).
[37]
Darüber hinaus hat die Bundespolizei die Anforderungen für Bewerber*innen im Jahr 2020 gesenkt. Im Bereich Rechtschreibung wurde beim Aufnahmetest die maximal erlaubte Fehlerquote von 20 auf 24 Fehler erhöht – bezogen auf einen Text mit nur 180 Wörtern. Außerdem müssen Bewerber*innen beim Fitnesstest nicht mehr nachweisen, dass sie Liegestütze machen können. Laut Bundespolizei sei das allerdings keine Senkung der Standards, man habe die Voraussetzungen lediglich an die Bewerber*innen »angepasst« (so nach dem Motto: bolizeigewald braucht kaine korekkte Rechtsschreibung).
[38]
Die bayerische Bereitschaftspolizei konnte im Jahr 2022 zwar alle 60 Ausbildungsplätze besetzen, einige der geeigneten Bewerber*innen haben sich nach einer kurzen Vorbereitungsphase allerdings direkt wieder verabschiedet (sie haben offensichtlich gemerkt, dass der Beruf doch nichts für sie ist. Ob aus praktischen oder politischen Gründen, ist nicht bekannt).
[39]
Die Polizei hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr streng gezeigt, wenn es um die Voraussetzungen für die Zulassung zum Polizeidienst ging. Polizist*in sein galt nach 1945 in Westdeutschland durchgehend, in Ostdeutschland zumindest in den Anfängen der DDR als prestigeträchtiger Beruf. Das kann man zum Beispiel an den vielen polizeifreundlichen Serien und Filmen im Fernsehen heute noch ablesen (siehe Kapitel 12). Doch mit dem signifikanten Rückgang der Bewerbungen wurden auch die Ansprüche an die Bewerber*innen in den letzten Jahren zurückgeschraubt. Im Südwesten Deutschlands müssen Polizeianwärter*innen zum Beispiel nur noch 1,50 Meter groß sein.[40] Jahr für Jahr werden in den Bundesländern auf ein paar Zentimeter verzichtet, um den Kreis potenzieller Bewerber*innen zu erweitern. Im Jahr 2022 öffnete die Landesbehörde in NRW die Türen für eine Polizeilaufbahn ohne Abitur.[41] Nicht wegen der Chancengleichheit: Es haben sich schlicht zu wenige junge Menschen beworben, und auch hier soll durch diese Maßnahme der Kreis der Bewerber*innen erweitert werden. In Schleswig-Holstein wurde das Höchstalter bei Einstieg in den Beruf von 32 direkt auf 42 Jahre angehoben.[42] In Berlin werden mittlerweile Kinder an der Polizeischule zugelassen (siehe Kapitel 10).
Anscheinend sind weiterhin viele Grundschüler*innen fasziniert von der uniformierten Aura, immer mehr von ihnen wollen später aber keine Polizist*innen werden. Überall gehen die Bewerber*innenzahlen zurück. Tendenz weiter sinkend. 2021 suchte die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern weit nach Beginn des Ausbildungsjahres noch händeringend nach geeigneten Bewerber*innen. Der Leiter des zentralen Auswahl- und Einstellungsdienstes der Landesbehörde in Mecklenburg-Vorpommern klang im NDR-Interview etwas ratlos: »Wir haben alle [Bewerber*innen] persönlich angerufen. Trotz Zusage erscheinen sie nicht. Von den 1400 Bewerbern laden wir 1000 ein. Davon erscheinen vielleicht 760 oder 780.«[43] Die Zahl der Bewerbungen hat sich in wenigen Jahren nicht nur dort fast halbiert.
Einige Behörden greifen da zu umstrittenen Maßnahmen: Die Bundespolizei im niederbayrischen Deggendorf organisiert zum Beispiel seit 2014 regelmäßig die »Panther-Challenge«, nach eigenen polizeilichen Angaben das »härteste Schülercamp Deutschlands«, wo junge Menschen zwischen 14 und 19 Jahren gedrillt werden, spielerisch, wie in einem Action-Film – obwohl der wahre Polizeialltag wenig mit einem abenteuerlichen Parcours-Lauf und dem Wettrennen nach Preisen und Titeln zu tun hat. In einer Reportage der taz wird eine dieser »Challenges« so beschrieben: »Auf einer Rasenfläche zwischen Bürogebäuden und geparkten Einsatzfahrzeugen sind die Gruppen auf einer Art Viererholzski um die Wette gelaufen.«[44] Klingt ein bisschen nach Rummel.
Mit solchen spaßorientierten Camps, Online-Schnellbewerbungen, Schnuppertagen, Schul-Praktika, Werbeclips auf TikTok[45] oder eigenen Podcast-Reihen auf Spotify[46] versuchen sich in ganz Deutschland Polizeibehörden personaltechnisch über Wasser zu halten. Auf der Kurzvideo-Plattform TikTok und auf Instagram erscheinen Polizei-Werbevideos mit allgemeinen Hashtags wie #viral, #tiktokviral, #dankbar, #bestezeit. Unterlegt sind die Clips mit austauschbarer Popmusik, die bei Zehn- bis Zwölfjährigen stark angesagt ist.[47] Die Berliner Polizei schickt zum Beispiel »den Mario« ins Internet zu den Teenies. Er legt auf cool Handschellen an Handgelenke an, zu denen dann Sounds ertönen: klack. Wenn er sich eine kugelsichere Weste überzieht, hört man ein swuuuuusch. Die Schnitte sind schnell, die Clips dauern nur wenige Sekunden. Dann fordert der uniformierte Mario die Kids auf, ihm was in die Kommentare zu schreiben, damit seine Kolleg*innen sie dort in Chats zur Polizeiausbildung verwickeln.[48] Mit einem Dauergrinsen sieht der Mario in die Kamera, das ist Standard auf diesen Plattformen. Aber auch auf Sozialen Medien scheint die Polizei großes Pech zu haben: Beim Stöbern tauchen schnell Clips von jungen ehemaligen Polizist*innen oder Polizeischüler*innen auf, die psychisch und politisch keinen Bock mehr auf den Job hatten und ihren Frust vor der Kamera rauslassen.[49]
Die Polizei in Rheinland-Pfalz versucht diesem negativen Image und den schlechten Bewertungen im Netz entgegenzuwirken und startete im Jahr 2021 den Podcast »Polizei im Verhör«. Junge Menschen sollen mit dem Format anscheinend für den Polizeiberuf begeistert werden. Zumindest auf YouTube ist zu erkennen, dass der Podcast mit teilweise niedrigen dreistelligen Aufrufen auf mäßiges Interesse stößt.[50] Die Kommentarfunktion wurde dennoch gesperrt. Die Jugend zeigt der Polizei nicht nur die kalte Schulter, sondern geigt ihr auch deutlich die Meinung. Apropos Schulter: Überall sind in den vergangenen Jahren die Tattoo-Verbote für Polizeibeamt*innen gelockert oder ganz abgeschafft worden. In vielen Bundesländern in Deutschland[51], aber auch in Österreich[52] dürfen Beamt*innen nun sichtbar Tätowierungen tragen. Eine weitere Maßnahme, die zumindest den Kreis möglicher Bewerber*innen erweitern soll. Wichtig: Rechtsextreme oder verfassungsfeindliche Symbole sind weiterhin nicht erlaubt. Anscheinend braucht es diesen Hinweis noch mal explizit in der Polizeiausbildung.
Den Abwärtstrend können all diese Maßnahmen nicht stoppen, im besten Fall verlangsamen. Der Bewerbungsmangel ist dabei nur ein Teil des Problems. Auch die Fähigkeiten des Bewerber*innenpools sind ein wesentlicher Faktor. Die Auswahlverfahren in den verschiedenen Polizeibehörden ähneln sich. Oft gehören ein Sprachtest, ein kognitiver und psychologischer Eignungstest und ein Sporttest dazu. Immer weniger Bewerber*innen überwinden all diese Hürden, sodass viele rein rechtlich nicht zur Ausbildung zugelassen werden können. In einigen Bundesländern hat sich die Durchfallquote in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Laut Nordkurier zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern 2021 im Vergleich zu den neun Vorjahren.[53] Anderes Beispiel: Beim Diktat-Test sind in Schleswig-Holstein im langjährigen Schnitt vor 2020 rund 30 Prozent der Bewerber*innen durchgefallen. Rund 20 Prozent der Abiturient*innen und 45 Prozent der Bewerber*innen mit mittlerer Reife scheiterten am Thema Rechtschreibung.[54] Das ist viel. Beim sogenannten Intelligenztest und beim mündlichen Referat scheiterten jeweils 27 Prozent. Was ist da bloß los?
Ohne Zweifel hat sich das Image der Polizei in den vergangenen Jahren nicht zum Besseren entwickelt. Tatsächlich müssten die negativen Schlagzeilen rund um den kontinuierlichen Machtmissbrauch innerhalb der Polizei viele junge Menschen erschreckt und aufgerüttelt haben. Bis zuletzt haben Studien zwar gezeigt, dass Jugendliche ein relativ hohes Vertrauen in die Polizei pflegen, Parteien zum Beispiel sind bei jungen Menschen weniger angesehen (siehe auch Kapitel 22).[55] Nur möchten immer weniger von ihnen direkt mit der Institution Polizei zu tun haben.
Die Bezahlung kann schon mal nicht der Grund sein, aus dem sich viele junge Menschen von diesem Beruf entfremdet haben: In NRW[56], Sachsen[57] oder Bayern[58] liegt das Einstiegsgehalt für Polizeibeamt*innen bei über 40 000 Euro im Jahr (plus verschiedene Zuschläge und Privilegien). Das ist für Berufseinsteiger*innen im Vergleich zu vielen anderen Branchen wie dem Einzelhandel, dem Dienstleistungssektor, dem Handwerk oder der Logistik überdurchschnittlich. Zur politischen Problematik kommen aber herausfordernde Arbeitsbedingungen, die den Job unattraktiv machen: langweilige bürokratische Routinen, Dauereinsätze, Nachtschichten, wenig Möglichkeiten, sich in Uniform individuell zu entfalten. Auch die sportliche Ausbildung gestaltet sich sehr speziell: Physisch werden Polizeischüler*innen mittlerweile trotz der geringeren Fitness-Anforderungen im Bewerbungsverfahren durch knifflige Parcours geschickt. Dort sollen sie fit gemacht werden und lernen nach Purzelbäumen, mit ihrer nicht-dominanten Hand spontan und gezielt in die Brust einer Person zu schießen. Das Training kommt einem Überlebenskampf mit hyperaggressiven Taktiken gleich und legt nahe, dass sich die zukünftigen Beamt*innen im Krieg mit den Communitys befinden werden, die sie nach ihrem Abschluss kontrollieren und managen sollen. Es soll Menschen geben, denen dieses Survival-Training Spaß macht. Andere fühlen sich bei so einem paramilitärischen Drill wiederum abgeschreckt.[59]
Zu wenige Bewerber*innen, immer niedrigere Anforderungen und ein teils abgehobener Ausbildungsplan sorgen dafür, dass immer mehr Polizist*innen immer weniger qualifiziert sind, die große Bürde des Gewaltmonopols überhaupt zu stemmen. Das Polizeiproblem wird somit nicht nur zur Frage des Charakters und der strukturellen Funktionsweise der Behörden, sondern auch der individuellen Qualifizierung einzelner Beamt*innen. Hier geht es um elementare Fähigkeiten, die es braucht, um andere Menschen überhaupt ordnen und dafür eine gewisse Autorität ausstrahlen zu können. Fähigkeiten, die einigen Beamt*innen fehlen, wie das folgende Beispiel zeigt.
Eine gute Freundin von mir wurde im Jahr 2023 mutmaßlich vom Vater des rechtsextremen Attentäters von Hanau auf der Straße direkt vor dem Quartier der »Initiative 19. Februar« rassistisch beleidigt. Zuvor hatte die hessische Polizei damit Schlagzeilen gemacht, dass sie den Vater vor der angeblichen Rache der Angehörigen schützen wollte. Dabei scheint es so, dass sich der Hass in der Familie des Attentäters von der einen Generation zur nächsten vererbt. Der Vater beleidigt und bedroht bis heute regelmäßig die Hinterbliebenen, darüber haben mehrere Medien berichtet. Getan wird dagegen nichts.[60] So traf es dann auch meine Freundin. Sie war, laut ihrer Aussage und der von Augenzeug*innen, plötzlich seinen Hasstiraden ausgesetzt und rang mit sich, ob sie deswegen zur Polizei gehen sollte. Sie fragte mich nach meiner Einschätzung. Ich gab die Empfehlung ab: Wenn du keine Anzeige erstattest, wird der Fall nicht in die Statistik eingehen, was wiederum im Sinne des Täters wäre. In der Realität kommen sogar antirassistische Linke nicht um die Polizei herum (siehe Kapitel 23).
Also saß meine Freundin wenige Tage später am Schreibtisch eines sehr jungen Beamten, der ihre Zeuginnenaussage entgegennehmen sollte. Sie beschrieb ihn als »Typ ›Wir machen Polizei wieder cool‹«. Er muss erst kurz vorher die Ausbildung abgeschlossen haben und hätte für seine Behörde auch lässig auf TikTok mit Handschellen (klack) und kugelsicheren Westen (swuuuuusch) hantieren können. Der junge Polizist soll mit beiden Zeigefingern Buchstabe für Buchstabe die Aussage eingetippt haben. Immer wieder habe er sich vertippt und die Löschtaste betätigen müssen. »Es hat eine Ewigkeit gedauert«, erzählte meine Bekannte später. Er habe sie zwischendurch gefragt, wie man das Wort »dahingehend« schreibe. Habe nach dem Drucken des Protokolls mehrfach gemerkt, dass Wörter fehlten, Sätze grammatikalisch komplett falsch aufgeschrieben waren. Deswegen habe er das Dokument mehrfach anpassen und erneut ausdrucken müssen.
Polizist*innen werden darin geschult, bei Zeug*innenaussagen nach Ungereimtheiten zu suchen, kritische Fragen zu stellen. Und so habe der Polizist zwischendurch etwas triumphierend verkündet, dass die Ortsangaben meiner Bekannten nicht stimmen könnten. Er soll seinen Bildschirm umgedreht und ihr auf einem digitalen Stadtplan gezeigt haben, dass ihre Angaben zum rassistischen Überfall definitiv falsch seien. Sie soll daraufhin trocken erwidert haben, dass er sich im Kartendienst nicht auf dem Heumarkt in Hanau, sondern auf dem Heumarkt in Köln befinde. Dies ist zwar nur eine kleine Anekdote, aber sie macht mich bezüglich der Qualifikation von Polizist*innen stutzig.
Zur beruflichen Eignung von aktiven Polizeibeamt*innen gibt es natürlich keine öffentlichen Daten. Die Behörden, so vermute ich, wissen genau, warum sie diese nicht rausgeben: Solche Informationen wären vielleicht nicht im Sinne des sowieso ramponierten Polizei-Images. Was lernen Polizeischüler*innen eigentlich während ihrer mehrjährigen Ausbildung, wenn einige von ihnen später Zeug*innenaussagen nicht fehlerfrei oder zumindest fehlerarm aufnehmen, Stadtpläne, Presseausweise oder Dokumente nicht richtig lesen können?
Mir wird in vielen Gesprächen oft eine andere Frage gestellt: Woher kommt es, dass so viele Polizist*innen verfestigte rassistische Vorurteile formulieren und dann selbstbewusst und unreflektiert im Einsatz ausleben? Ich habe mir das Curriculum in verschiedenen Bundesländern näher angeschaut, um zu verstehen, wie in der Ausbildung Menschen zu Polizist*innen geformt werden. In Nordrhein-Westfalen bin ich auf eine verstörende Praxis gestoßen, die auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Niedersachsen oder Berlin, vorherrscht. Eine Komponente der Antwort lautet: Ihnen wird diese diskriminierende Sichtweise in Polizeischulen und -akademien beigebracht.
In der Polizeiausbildung in NRW kommt zum Beispiel ein Buch aus dem Verlag für Polizeiwissenschaft zum Einsatz. Der Titel: Türken und Araber verstehen und vernehmen. Auf dem Cover ist ein junger rassifizierter Mann in Kapuzenpullover zu sehen.[61] Er verzerrt wütend sein Gesicht. Die Botschaft: Diese Menschen sind nicht wie »wir«. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Beschreibung des Verlags: »Dem an einer schnellen und protokollfähigen Klärung des Sachverhaltes orientierten, klar und präzise fragenden deutschen Polizeibeamten sitzt eine Person gegenüber, die, lebhaft gestikulierend, weit ausholend und ausweichend reagiert, vielleicht zur ›Verstärkung‹ Familienmitglieder mitgebracht hat.«
Das Buch, das ich mir mit viel Aufwand besorgt habe, strotzt nur so vor solchen rassistischen, andersmachenden Bildern. Kein Wunder, dass die noch gut formbaren und sowieso oft auf »Law & Order« ausgerichteten Polizeianwärter*innen Menschen wie mich auf der Straße als Bedrohung wahrnehmen. Arabisch-, türkisch- oder kurdischstämmige Menschen werden pauschal als rückständig, als aggressiv, als archaisch dargestellt. Polizist*innen bekommen über dieses Lehrbuch beigebracht, sie nicht als Bürger*innen, sondern in erster Linie als Gefahr zu betrachten. Mit solchen Menschen könne man nicht normal reden, so der Tenor des Lehrbuches. Die Konsequenz daraus ist eine verfrühte, standardisierte, ja oft automatisierte Gewaltanwendung gegenüber Bürger*innen mit Einwanderungsgeschichte, speziell gegen jene, die von den Beamt*innen im Einsatz als arabisch, türkisch, kurdisch, nordafrikanisch, nahöstlich oder muslimisch gelesen werden. Manchmal entscheiden Bruchteile von Sekunden darüber, ob rassifizierte Menschen Polizeieinsätze überleben (siehe Kapitel 17). Solche Bücher senken die Überlebenschancen signifikant.
Auf solchen andersmachenden Curricula fußen zum Beispiel die Praxis des Racial Profiling (siehe Kapitel 14) oder die Strategie gegen die »Clan-Kriminalität« (siehe Kapitel 15). Diese wird zwar von Führungskräften innerhalb von Polizeibehörden und Innenministerien entschieden, die ganze Härte des Gesetzes müssen aber schließlich die Beamt*innen durchsetzen. Angelernter Rassismus sorgt dabei für sehr viel unverhältnismäßige, entmenschlichende Härte. Insbesondere werden »orientalische Männer« im besagten Buch verallgemeinernd und unwissenschaftlich als testosterongetriebene, zu bändigende Wesen dargestellt. Diese Art der ethnisierten Andersmachung habe ich schon in meinem Buch Let’s talk about Sex, Habibi ausführlich besprochen. Dies sind rassistische Mechanismen, die in eine ganz andere Epoche Deutschlands passen. Dabei habe ich den ultimativen Beweis, dass diese eurozentrischen Projektionen nicht stimmen können: Ich bin ein Mann, der als arabisch gelesen wird, und viele Leute sagen unabhängig voneinander, ich sei superdupernett. Spaß beiseite: Ironischerweise werden mit diesen Perspektiven auf Minderheiten in Deutschland vor allem institutionell konstruierte Männlichkeitsbilder innerhalb der Polizei gestärkt. So nach dem Motto: Wer hat hier den längsten Schlagstock? (siehe Kapitel 4)
Bei der Lektüre solcher Lehrbücher ist mir aufgefallen, dass diese besondere Polizei»wissenschaft« nicht verstanden hat, dass »arabisch und türkisch« so viele Hundert Millionen Menschen einschließt, die teilweise REINGARNICHTS eint. Weder kulturell noch sprachlich, geschweige denn im Sinne zu antizipierender Verhaltensmuster. Polizist*innen werden im Buch dagegen als »präzise«, »schnell«, effizient und emotionslos dargestellt. In den Sozialwissenschaften sind solche absoluten Aussagen und Dichotomien mehr als nur verpönt, sie entsprechen schlicht nie der Realität. Der genannte Verlag hat auch einen anderen Titel im Angebot: Russen verstehen – Russen vernehmen. Beschreibung: »Als Beschuldigte unbeugsam und undurchschaubar, als Opfer immens leidensfähig und als Zeugen misstrauisch und ausweichend (…)«. Dies sind Behauptungen, die weder mit Statistiken noch Erfahrungswerten belegt werden. In den Köpfen zukünftiger Polizist*innen mutieren sie dennoch zur absoluten Wahrheit. Schon früh kommen sie in Kontakt mit solchem gefährlichen Gedankengut. Ganz offiziell, politisch und pädagogisch gewollt.
Laut meinen Recherchen liegt es bei der Polizeiausbildung in den meisten Bundesländern im Ermessen des*der einzelnen Dozent*in, welches Buch und Lehrmaterial eingesetzt wird. Mir wurde von mehreren Insider*innen unabhängig bestätigt, dass sich nicht wenige Lehrende für die beiden Bücher (und ähnliches Material) entschieden haben und darüber hinaus auch selbst den Unterricht der angehenden Beamt*innen in die entsprechende Richtung lenken. In vielen Bibliotheken von polizeilichen Ausbildungseinrichtungen liegt dieses und vergleichbares Lehrmaterial zumindest für die Ausleihe bereit, das kann man über eine Katalogrecherche in der Bibliothek einsehen. Gleichzeitig haben mir drei verschiedene Dozent*innen unabhängig voneinander berichtet, dass sie auf solche diskriminierenden Praktiken im Unterricht verzichten. Dies sind laut meinen Recherchen aber eher Ausnahmen von der Regel.
Ich habe mir auch die Arbeit einer zufällig ausgesuchten Dozentin aus Hessen näher angeschaut, die ich aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen hier nicht namentlich aufführen darf. Das Ergebnis lässt sich wirklich sehr knapp zusammenfassen: In ihrer Klasse an der Polizeischule werden aktiv rassistische Stereotype an die Anwärter*innen weitergegeben. Diese Lehre sorgt im Großen und Ganzen dafür, dass junge Polizist*innen über ihre Ausbildung ein bestimmtes Set an Vorurteilen eingehämmert bekommen – bei einer gleichzeitigen Empfangsbereitschaft für solche Inhalte. Mit Blick auf die Fähigkeiten werden sie dagegen wenig für den Job qualifiziert, was weiter das Image der Polizei nach außen prägt. Das wiederum sorgt dafür, dass immer weniger junge Menschen sich für diesen Beruf begeistern können. Und so senken Polizeibehörden ihre Standards weiter, um theoretisch genug Bewerbungen zu bekommen und die (zukünftigen) Beamt*innen bei der Stange zu halten. Die Politik- und Sozialwissenschaft spricht in so einem Zusammenhang von einem Unterbietungswettlauf. Wo wird dieser enden?
Manchmal in der Currywurstbude: Im Januar 2024 wurde bekannt, dass sich 17 Mitarbeiter*innen der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) in Hannover im Rahmen einer Fortbildung haben bestechen lassen.[62] Ein Dozent hatte die Polizist*innen über fast einem Jahr mehrfach zum Schimanski-Teller[63] eingeladen: Currywurst (wahlweise mit oder ohne Darm), Pommes, Rot, Weiß. Benannt nach dem ARD-Tatort-Kommissar Horst Schimanski, dessen Leibgericht diese deftige Kombination war, auch bekannt als Manta-Platte[64] oder Ruhrpott Carpaccio[65]. Der Dozent in Hannover gab für die Einladungen etwa 2000 Euro aus und erhoffte sich damit, bei den Polizist*innen gute Bewertungen seiner Tätigkeit erkaufen zu können. Diese Klüngelei und Korruption im Rahmen der polizeilichen Aus- und Weiterbildung kann auch damit enden, dass politische Missstände in den Ausbildungsstätten und Behörden geduldet, vertuscht oder an den Stehtischen vor Currywurstbuden erst gar nicht erkannt werden.
In den vergangenen Jahren sind mehrere Dozent*innen an Polizeiakademien und -hochschulen durch die Nähe zu organisierten, rechtsextremen Vereinen und Kreisen oder mit sonstigem Fehlverhalten aufgefallen. Im Jahr 2019 berichtete der Tagesspiegel über den Fall eines ehemaligen Stasi-Mitarbeiters, der nach der Wende bei der Polizei in Brandenburg und seit 2016 als Dozent der Polizeihochschule Brandenburg arbeitete. Jahrelang soll der Dozent Mitglied im rechtsextremen Verein »Uniter« gewesen sein. Kein Einzelfall, wie der Leiter der Hochschule selbst zu Protokoll gab.[66]
Im Mai 2023 tauchten mehrere Fälle von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch an der Hochschule der Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen auf.[67] Wenige Wochen später, da liefen die internen Ermittlungen zu den MeToo-Fällen noch, machten Polizeischüler*innen mit sexistischen Teamnamen bei einem Sportwettbewerb an der Hochschule Schlagzeilen[68]: So hat sich zum Beispiel ein Team unter dem Namen »1. FC Golden Shower« zu dem Turnier angemeldet. Bei einer »Golden Shower« urinieren Sexpartner*innen gegen- oder einseitig aufeinander. Solche Geschichten illustrieren die Gender-Dynamiken und den Umgang miteinander an solchen Ausbildungsstätten (siehe auch Kapitel 4). Ein Gericht sprach den Dozenten letztendlich frei und gab der Beschwerdeführerin eine Mitschuld an den sexistischen Verhältnissen in der Hochschule (siehe Kapitel 7).[69]
In Lübeck tauchten 2021 rechtsextreme Texte von Stephan Maninger auf, Professor an der Bundespolizeiakademie. Zwar darf Maninger seitdem nicht mehr unterrichten, seine Geschichte zeigt aber exemplarisch, wie sich das Polizeiproblem schon in der Polizeiausbildung eingenistet hat.[70] Nach Bekanntwerden seines Œuvres wehrte sich die Hochschule gegen seine Absetzung durch das Bundesinnenministerium – in diesem Fall zum Glück vergebens.[71] Eine Recherche von Ippen-Investigativ[72] hatte aufgedeckt, dass Maninger als Redner an einer Veranstaltung im NSU-Umfeld teilnahm. Er war außerdem Sprecher der »Afrikaaner Volksfront«, einer separatistischen und extremistischen Bewegung in Südafrika, die sich für einen Volksstaat nur für Weiße einsetzte. Maninger soll außerdem die Ansicht vertreten haben, dass Frauen in Kampfeinheiten qua Geschlecht nicht »einsatzfähig« seien. Er verfasste darüber hinaus mehrere Texte für die Zeitung Junge Freiheit, die für rechtsradikale Inhalte bei Expert*innen bekannt ist. Nur ein paar Stichwörter aus Maningers Werk[73]: »Ethnosuizid«, »Afrikanisierung und Islamisierung Europas«, »Die ›Problemkinder‹ eines multikulturellen Deutschlands heißen am Anfang des nächsten Jahrtausends ›Mehmet‹ und ›Kaplan‹«.
4 Wer hat den längsten Schlagstock?
Der Begriff »Widerstandsbeamte«[74] beschreibt in der Forschung Polizist*innen, die bewusst aggressiv gegenüber Bürger*innen auftreten und somit einen »Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte« provozieren wollen. Diesen offiziellen Straftatbestand gemäß Paragraf 113 Strafgesetzbuch[75] ahnden Polizeibehörden in Deutschland wiederum sehr gern. So wird ein Teil der Kriminalität in der Statistik überhaupt erst durch das Wirken der Polizei erzeugt (siehe auch Kapitel 15). Oft ist der Grund für solche Eskalationen gegenüber der Staatsgewalt also das aggressive Verhalten der Polizist*innen selbst: willkürliche Kontrollen, verbale Provokationen, das Eindringen in den persönlichsten Raum eines Individuums, psychischer Druck, physische Attacken, polizeilicher Macht-Habitus, Drohungen, schlicht ein Aufplustern in Uniform.
Im vorherigen Absatz hätte ich getrost auf das Gender-Sternchen verzichten können. Widerstandsbeamte sind laut der Expertise mehrerer Polizeiforscher*innen weltweit zu einem sehr hohen Anteil, wenn nicht sogar fast ausschließlich, Cis-Männer.[76] Denn die Polizei fußt als Institution auf Männlichkeit, sie ist eine Parade von sehr selbstsicheren »Mackern«. Und das nicht nur, weil Frauen mit einem Anteil von 29,3 Prozent in den Reihen deutscher Polizeibehörden unterrepräsentiert sind (stand 2020).[77] Eine Tatsache, die Polizistinnen paradoxerweise aber nicht entschuldigt, wenn es um patriarchalische Strukturen innerhalb der Polizei geht. Auf die Rolle von Frauen in Polizeibehörden möchte ich später zurückkommen. Zunächst soll es hier um einen zentralen Faktor in der Polizeiarbeit gehen: die Männlichkeit selbst.
Männlichkeit ist ein soziologisches Phänomen, das die gesamte Gesellschaft betrifft und somit natürlich über die Betrachtung der Sicherheitsbehörden hinaus geht. Jungs und Männer bekommen von klein auf und kontinuierlich in ihren Familien, im Kindergarten, in Schulen, im Sportverein, in der Partnerschaft, in den Medien, allgemein im Leben ein Training, wie sie zu denken, (nicht) zu fühlen, zu agieren haben. »Jungs weinen nicht«, heißt es im traditionellen Verständnis der Geschlechterrollen. So lernen Männer, dass sie stark sein, sich in Abenteuer stürzen, »ihr gutes Recht« zur Not auch gewalttätig durchsetzen sollen. Kein Wunder, dass Männer in Deutschland einen überdurchschnittlichen Anteil an der Kriminalität zu verantworten haben: Im Jahr 2021 wurden 542 690 Männer rechtskräftig von Gerichten wegen diverser Straftaten verurteilt, ihnen standen lediglich 119 409 verurteilte Frauen gegenüber. Der Männeranteil liegt somit über die Jahre betrachtet stabil bei um die 80 Prozent. Weil die Polizei nicht immun gegen diese toxische Männlichkeit ist, findet sich das Problem dort ebenfalls – nur mit etwas höherer Giftkonzentration.
Ein erster Indikator dafür ist das Sexismus-Problem und der Umgang damit innerhalb von Polizeibehörden: Im Jahr 2023 lief gegen den ranghöchsten Polizisten in Baden-Württemberg ein Verfahren wegen sexueller Belästigung im Dienst.[78] Inspekteur Andreas R. wurde vorgeworfen, über Jahre mehrere Polizistinnen und Polizeianwärterinnen sexuell genötigt und sie unter Druck gesetzt zu haben.[79] Vor dem Landgericht Stuttgart wurde R. mangels Beweisen für einen nicht-einvernehmlichen sexuellen Übergriff auf eine Anwärterin für den höheren Dienst zwar im Juli 2023 freigesprochen, [80] der Bundesgerichtshof bestätigte im April 2024 diesen Freispruch: aus Mangel an Beweisen.[81] Was innerhalb von Polizeibehörden und auch in der komplizierten juristischen Auseinandersetzung zum Thema Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt als Einzelfall erscheint, ist aber in Wahrheit ein wiederkehrendes Muster auf allen Ebenen innerhalb von Polizeibehörden und Polizeischulen[82]. Studien zeigen[83]: Die Polizei hat intern (wie auch nach außen) ein Sexismus-Problem, dessen Ursache bestimmte, festgeschriebene, erlernte und innerhalb der Polizei verstärkte Männlichkeitsbilder sind. Eine der Studien besagt, dass die beschäftigten Frauen bei der Polizei in Deutschland von allen befragten Gruppen am häufigsten von sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz betroffen sind.[84]
Der vorherrschende Sexismus in Polizeibehörden spiegelt sich in der (privaten oder privat geglaubten) Kommunikation unter Beamt*innen wider. In Kapitel 18 werde ich ausführlich auf private Chats unter Polizist*innen eingehen. Sie erlauben einen ungetrübten Blick in die Gedankenwelt der Beamt*innen. An dieser Stelle möchte ich einen aufgedeckten Chat als Anschauung für polizei-patriarchale Strukturen nutzen: Denn dieser berühmte Fall aus Großbritannien steht exemplarisch dafür, wie Männlichkeit die Gruppendynamik innerhalb der Polizei prägt. Im Jahr 2023 wurden acht Polizist*innen in London suspendiert, nachdem ein jahrelanger Chat-Verlauf zwischen ihnen mit rassistischen, rechtsextremen und behindertenfeindlichen Inhalten aufgeflogen war.[85] Unter anderem wurde dort das Ex-Model Katie Price aufs Übelste sexistisch beschimpft und verunglimpft. Menschenverachtende Witze über ihren Körper wurden geteilt, ein Polizist schrieb über Price konsequent als »it« (es). Er verdinglichte Price, um seine Verachtung für sie und Frauen insgesamt zum Ausdruck zu bringen. Ein Polizist beschrieb einen Kollegen, der nach einer Vergewaltigung als Täter ohne Strafe davongekommen sei. »Er ist für mich ein Held«, schrieb der Beamte und glorifizierte damit Gewalt gegen Frauen, die Quintessenz toxischer Männlichkeit. Die anderen Beamt*innen im Chat machten mit bei dieser Parade, klatschten virtuell oder tolerierten diese Aussagen.
Dieser Fall aus Großbritannien erinnert mich an mehrere Gespräche, die ich in den vergangenen Jahren mit Informant*innen aus den Reihen der deutschen Polizei geführt habe. Ich habe es als Reporter zwar nie in die Umkleidekabine von Polizeiwachen geschafft, allerdings haben mir mehrere Quellen bestätigt, dass diese sexistische Sprache und das Handeln, das damit einhergeht, in (vermeintlich) geschützten Räumen wie Umkleidekabinen, Kantinen oder Kasernen zur polizeilichen Normalität gehören. Das Wort »Macker« erscheint in diesem Zusammenhang gar nicht mehr so aus der Luft gegriffen, vielleicht sogar etwas verharmlosend.
In Berlin wurde Mitte 2023 ein krasser Fall bekannt, der nur durch aufmerksame Nutzer*innen einer Dating-App aufgedeckt wurde. Auf der Plattform war ein Profil aufgetaucht, über das eine durch K. o.-Tropfen betäubte Frau zur Vergewaltigung angeboten wurde. Auf dem Profil erschienen Bilder von dem bewusstlosen Körper des Opfers. Nutzer*innen meldeten dies dem Betreiber der App. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Kurze Zeit später kam heraus: Ein Elitepolizist hatte einer Kollegin das Betäubungsmittel verabreicht, sie ohne Einverständnis fotografiert und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten.[86] Es sind diese Geschichten, die das Problem mit der toxischen Männlichkeit und der sexualisierten Gewalt in den Reihen der Polizei auf gruselige Art und Weise beleuchten.
In der Polizeiforschung spricht man in diesem Zusammenhang sogar von einem »Kult der Maskulinität«. Die Soziologin Jennifer Brown argumentiert, dass der Machismo innerhalb der Polizei den Hauptantrieb für die gesamte Institution darstelle.[87] Zwar widerspreche ich dieser absoluten Sichtweise mit einer ganzheitlichen Analyse in diesem Buch, bei der politische Entscheidungsstrukturen, historisch gewachsene Funktionsweisen, Klasse oder rassistische Kontinuitäten ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Doch der Machismo bleibt ein zentraler Faktor, der den Polizeialltag prägt und viele Polizist*innen in ihrem Denken, Sprechen und Handeln leitet.
Mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Polizei verlangt diese Institution qua ihrer ursprünglichen Idee nach traditionellen und stereotypen Männlichkeitsbildern, die vor allem von Stärke, Gewalt, Kompromisslosigkeit und Durchsetzungsvermögen geprägt sind. So entstand über Jahrhunderte eine Institution, die über Landesgrenzen und Kulturkreise hinweg hypermännlich geprägt ist. Nicht nur in ihrer Zusammensetzung, sondern auch in ihrem Selbstverständnis. Zur Grundausbildung von Polizist*innen gehört – jetzt mal wirklich simpel ausgedrückt – ein breitbeiniges Auftreten gegenüber den Bürger*innen, also jenen, die es zu ordnen und kontrollieren gilt.
Darüber hinaus bedingen sich Männlichkeitsbilder aufseiten der zu polizierenden und der Polizei gegenseitig: Wenn Kriminalität sehr männlich geprägt ist, muss die Kriminalitätsbekämpfung noch männlicher sein. So zumindest eine fatale Logik hinter der Funktionsweise der Polizei. Und nicht zuletzt wird ein »hartes Durchgreifen« von weiten Teilen der Öffentlichkeit erwartet, sogar eingefordert. Alles gesellschaftlich konstruiert, versteht sich. Das hypermaskuline Eingreifen in den Alltag von Menschen (egal ob sie nun kriminell in Erscheinung getreten sind oder nicht) ist so dermaßen normalisiert, dass nur wenige Bürger*innen es kritisch reflektieren können. Deeskalation, Kommunikation oder das Aufbringen von Verständnis finden sich traditionell selten im polizeilichen Instrumentenkasten (siehe Kapitel 21). Dies sind relativ neue Ansätze, die von einzelnen Polizeibehörden ausprobiert werden – selten konsequent, wenn man sich das Gesamtbild der Polizeipraxis anschaut.
In einigen Gesprächen mit Lokalpolitiker*innen, Autor*innen oder Sozialarbeiter*innen ist mir aufgefallen, dass Ausnahmen von der toxischen Männlichkeit in der Polizeiarbeit hochgelobt werden. Weil diese Ausnahmen ungewohnt herausstechen. Dann ist zum Beispiel die Rede von diesem einen Verbindungsbeamten bei der Polizeibehörde in Düsseldorf. Er wird dafür gelobt, dass er »den Anderen« geduldig zuhöre, sich für ihre Perspektiven nachvollziehbar interessiere, bei Konflikten mit viel Fingerspitzengefühl vermittle, sodass es noch nicht mal zu einem regulären Polizeieinsatz kommen müsse … Leider, schob die Gesprächspartnerin in diesem konkreten Fall nach, sei der nette Polizist aber schon längst im Ruhestand. Wie schade.
Die sonst als Standard geltende männliche Härte wird paradoxerweise vonseiten der Polizei oft mit einer männlichen Fragilität serviert. Performative Stärke und übertriebene Zerbrechlichkeit scheinen dabei zwei Seiten derselben Medaille zu sein. Ich möchte hier einige Statistiken kritisch besprechen, um diesen vermeintlichen Widerspruch aufzuzeigen: Jedes Jahr machen Zahlen Schlagzeilen, die eine angeblich steigende Gewalt gegen Polizist*innen abbilden sollen. So verkündete das Bundeskriminalamt für das Jahr 2021 zum Beispiel, dass 88 626 Beamt*innen in Deutschland »Opfer von Gewalttaten« geworden seien.[88] In der Berichterstattung zu dieser Angabe fehlte allerdings oft eine Differenzierung, die in der Statistik deutlich ausgewiesen wird: 48 Prozent dieser Fälle fallen unter die Kategorie »Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte«.[89] Mit Blick auf das Phänomen des Widerstandsbeamtentums erscheinen die Angaben des BKA damit in einem anderen Licht.
Im Jahr 2017 meldete sich ein Polizist nach einem Einsatz krank. Er habe sich den Fuß verletzt. Dummerweise nahm der Beamte während seiner vermeintlichen Genesungszeit an einem Hindernislauf teil. Er rannte dabei kilometerweit, hat, lückenlos dokumentiert, Sandkuhlen, Tunnel, Strohballen und Schlammgraben überwunden und immerhin Platz 127 von 649 Teilnehmer*innen belegt. Das alles mit einer vermeintlichen Fußverletzung, die er sich im Dienst zugezogen haben soll. Als wäre das nicht genug, feierte sich der Polizist noch selbst auf Facebook für seine sportliche Leistung. Diese exemplarische Geschichte ist in einem Urteil des Verwaltungsgerichts Cottbus nachzulesen.[90] Denn der Beamte wurde von seiner Behörde aufgrund seines von ihm öffentlich gemachten Missbrauchs der Krankschreibung entlassen. Dabei kommt es nicht oft vor, dass Polizist*innen Konsequenzen für ihre (männliche) Fragilitätsperformance befürchten müssen. Er klagte – wie es viele Polizist*innen, aber auch andere Menschen in anderen Berufen und Branchen nun mal tun, wenn ihre Tricksereien auffliegen – gegen diese dienstrechtliche Maßnahme – auch hier vergeblich.
Ich habe in den vergangenen Jahren für mehrere Recherchen als Beobachter in Gerichtssälen gesessen. In vielen Verhandlungen kamen und kommen Polizist*innen als Zeug*innen vor. Sie sind nun mal oft involviert, wenn es um Kriminalfälle geht. Mir ist über die Jahre aufgefallen, dass viele Polizeibeamt*innen offiziell noch krankgeschrieben waren, als sie als Zeug*innen ausgesagt haben. So zum Beispiel bei Verhandlungen in Aachen, Berlin und Osnabrück, die ich vor Ort journalistisch begleitet habe. Bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Köln, bei der ich im Jahr 2016 dabei war, machten drei Polizisten im Wartebereich vor dem Gerichtssaal Witze, dass es schön sei, ein bisschen Extraurlaub dank der Krankschreibung zu bekommen. Ihnen ging es augenscheinlich gut, sehr gut, exzellent sogar. Sie lachten und scherzten, hatten keine Bedenken, an einem öffentlichen Ort ihre gute Laune zu teilen. Komischerweise änderten sich ihre Körpersprache, ihr Auftritt und überhaupt ihr Dasein im Zeugenstand. Da machten sie plötzlich einen kränklichen, etwas depressiven Eindruck – was den Richter selbst leider sehr beeindruckte (zur Auflösung dieser Seifenoper siehe Kapitel 7).
Nach Großeinsätzen ist mir aufgefallen, dass sich viele Polizist*innen systematisch krankmelden. Auf den ersten Blick ergibt das Sinn. Diese Einsätze sind nicht selten physisch und psychisch belastend, egal auf welcher Seite man dabei unterwegs ist. Mit diesen Krankschreibungen machen wiederum Vertreter*innen der Polizeigewerkschaften, Innenpolitiker*innen und rechte Medien gern Stimmung im Sinne der Polizei. So nach dem Motto: Schaut her, so viele Polizist*innen haben sich für uns und unsere Sicherheit geopfert. Allerdings wird selten ein qualitativer Blick auf die Umstände geworfen, warum sich die Polizist*innen krankgemeldet haben. Aus Gründen des Datenschutzes verweigern Polizeibehörden oft die Herausgabe dieser Angaben. Allerdings habe ich im Gespräch mit Insider*innen in mehreren Bundesländern immer wieder folgende Einschätzung gehört: Oft sollen sich Polizist*innen wegen nichts krankschreiben lassen, Polizeigewerkschaften unterstützen sie dabei, und einige Mediziner*innen bei den ärztlichen Diensten der Polizeibehörden sind sehr locker, wenn es um die Ausstellung eines Krankenscheins geht. Ganz ehrlich: Wer hat nicht schon mal nach so einer Arztpraxis Ausschau gehalten, um einer unangenehmen Verpflichtung zu entgehen oder sich am Arbeitsplatz als Opfer zu stilisieren? Bei der Polizei ist dieses Phänomen aber aus machtpolitischen Gründen eine ganz andere Kiste. Wenn Beamt*innen beim Aussteigen aus dem Polizeiwagen ungeschickt umknicken, werden sie in der erwähnten BKA-Statistik mitgezählt. Wenn der Wind ihnen ihr eigenes Pfefferspray in die Augen weht, wenn sie unter ihren Helmen an heißen Tagen kollabieren, wenn sie sich beim Zuschlagen den Finger verstauchen oder wenn sie mal einfach eine Krankheit aus persönlichen oder politischen Gründen inszenieren möchten, gelten sie offiziell als krank und liefern ihren Dienstherren und den Medien Zahlen und Argumente, mehr Ressourcen für die Polizei einzufordern (siehe Kapitel 16).[91]
Eine meiner Quellen sagte mir: »Einige Kollegen fallen um, wenn sie von einem lauen Lüftchen erfasst werden.« Das passt so gar nicht zum harten Männlichkeitsbild, auf dem die Polizei fußt, aber sehr zur politisierten Forderungsmaschine aus Innenpolitik und Polizeigewerkschaften (siehe Kapitel 6). Um über anekdotische Beobachtungen hinaus neue Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Männlichkeitsbildern der Stärke und der Fragilität zu gewinnen, bräuchte es an dieser Stelle allerdings einen Zugang zu den entsprechenden Daten und Studien der kritischen Polizeiforschung. Belastbare Zahlen zur Praxis der Krankschreibungen von Polizist*innen wären nicht nur im Sinne von Steuerzahler*innen, sondern mit jedem erdenklichen Ausgang im Sinne der Polizei selbst. Die Außenwirkung dieses Phänomens ist aus heutiger Sicht zumindest fatal. Es kommt nicht selten vor, dass zum Beispiel bei Demonstrationen Polizist*innen ohne Fremdeinwirkung umfallen und unschuldige Anwesende später dafür haftbar gemacht werden sollen. Diese Fälle treten häufig auf und sind für die Demokratie selbst eine große Belastung. Mit Blick auf das Machtgefälle besteht ein großer Unterschied, ob ein*e Polizist*in – einfach ausgedrückt – schummelt oder ein*e Bürger*in ohne Uniform. Wenn der Anschein besteht, dass die Polizei – also der Staat – angegriffen wird, schlägt die ganze Wucht der staatlichen Gewalt zurück.
Zur »Gewalt gegen Polizist*innen« wird auch die Beleidigung von Beamt*innen gezählt. Und die hat sehr unterhaltsamen Charakter. In der kompletten Hierarchie von ganz oben bis hin zum Streifenpolizisten ist hierbei eine besonders ausgeprägte Zerbrechlichkeit zu beobachten. Mit Beleidigungen um sich werfen, ist nie ein Kavaliersdelikt, nur fällt im polizeilichen Kontext auf, dass es oft an der Verhältnismäßigkeit mangelt, wenn Polizist*innen oder ihre Vorgesetzten verbal mal derber was zu hören bekommen. Im Jahr 2021 schaffte es zum Beispiel eine Lokalposse aus Hamburg bis in die Washington Post.[92] Die Schlagzeile lautete: »A Twitter user called German politician ›a pimmel‹. Police then raided his house.« Ich merke, dass ich diese Geschichte hier doch von vorne erzählen sollte:
Auf Twitter (heute X) hatte sich im Mai 2021 der Hamburger SPD-Innensenator Andy Grote über Bürger*innen aufgeregt, die sich nicht an die damals geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gehalten hatten. Heikel: Grote selbst hatte ein Jahr zuvor mitten in einem Lockdown eine Party mit 30 Gäst*innen gefeiert und somit gegen die von seiner eigenen Stadtregierung erlassenen Schutzmaßnahmen verstoßen.[93] Grotes Aussagen werteten viele User*innen auf Twitter deswegen als scheinheilige Doppelmoral. Es hagelte Kritik. Im hitzigen Feld der Sozialen Medien tippte Marlon P. also eine etwas kindische Antwort unter den Tweet von Grote. »Du bist so 1 Pimmel«, lautete die Kritik im Stammtisch-Jargon. Mehr als drei Monate später stürmten mehrere Polizist*innen bei einer Razzia in die ehemalige Wohnung von P., in der er längst nicht mehr wohnte.[94] In Hamburg folgten daraufhin Auseinandersetzungen zwischen linken Gruppen und der Polizei: Die Staatsmacht war permanent damit beschäftigt, Sticker mit dem Spruch »Andy, du bist so 1 Pimmel« von Laternen und Fassaden in Hamburg zu kratzen.[95] Plakate wurden übermalt, Antifa-Gruppen machten sich einen Spaß daraus, sie in Nacht-und-Nebel-Aktionen wieder anzubringen. Dutzende Beamt*innen waren so, teils im Auftrag ihres politischen Dienstherren, gut beschäftigt. #PimmelGate war geboren. Fast ein Jahr später, im Sommer 2022, stellte ein Hamburger Generalstaatsanwalt das Verfahren ein und ließ damit alle Vorwürfe gegen Marlon P. fallen. Begründung: »Fehlendes öffentliches Interesse an der weiteren Strafverfolgung.«[96] Was blieb: die exemplarische Fragilität des obersten Dienstherren der Polizei in Hamburg, die eine monatelange Auseinandersetzung mit Bürger*innen und Gerichten auslöste. Diese Zerbrechlichkeit dient anscheinend als Inspiration für viele Polizist*innen.