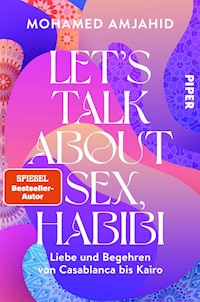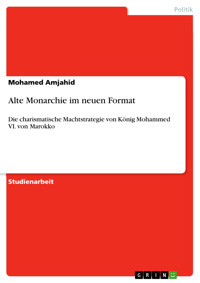11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eines der wichtigsten Sachbücher unserer Zeit: "Eine Anleitung zu antirassistischem Denken" In "Der weiße Fleck" zeigt Mohamed Amjahid die blinden Flecken unserer weißen Mehrheitsgesellschaft auf und erklärt, wie man es besser machen kann. Niemand möchte sich rassistisch verhalten. Viele tun es trotzdem. In "Der weiße Fleck" deckt der Journalist Mohamed Amjahid die Strukturen des Alltagsrassismus in Deutschland auf. Denn Diskriminierung ist auch dort, wo man sie vielleicht nicht vermutet und gerade weiße, privilegierte Personen, erklärt Amjahid, verhalten sich oft – ohne es zu wollen – verletzend. Schonungslos entlarvt Amjahid in seinem fesselnden Sachbuch die Strukturen einer Gesellschaft, in der Privilegien darin bestehen, dass sie für die Privilegierten nahezu unsichtbar sind, während die anderen umso mehr unter ihnen leiden. Eindringlich und überraschend humorvoll macht Amjahid diese blinden Flecken unserer Gesellschaft sichtbar. Mehr als bloße Anklage ist "Der weiße Fleck" deshalb auch eine Einladung, eigene Privilegien zu hinterfragen und den eigenen Rassismus wieder zu verlernen. Brandaktuell und wichtig – dieses Buch sollte jeder gelesen haben Durch den gewaltsamen Mord an George Floyd im Sommer 2020 und die im Zuge dessen weltweit aufflammenden #BlackLivesMatter-Proteste gibt es ein neues Bewusstsein für strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft. "Der weiße Fleck" ist neben den Büchern von Tupoka Ogette und Alice Hasters einer der wichtigsten Beiträge zur Antirassismusdebatte in Deutschland. »Ein wichtiger Beitrag zur Debatte über rechtsextremes Gedankengut und strukturelle Diskriminierung« ― B5 aktuell "Das interkulturelle Magazin" Statt nur aufzuzeigen, was falsch läuft, besticht Mohamed Amjahids Buch durch seine konstruktive Hands-on-Mentalität: 50 hilfreiche Tipps geben Anleitung für antirassistisches Denken und Handeln im Alltag. Ein ausführliches Glossar am Ende des Buches hilft beim Verständnis der Begrifflichkeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.deDer Autor dankt dem Thomas Mann House in Los Angeles für die Unterstützung.© Piper Verlag GmbH, München 2021Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutztSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Einführung
1 Vorsicht, zerbrechlich
2 Opferolympiade
3 Oder soll ich es lassen?
4 Die Neuerfindung der Welt
5 Was willst du eigentlich, Mohamed?
6 Refugee Porn
7 Erinnerungsüberlegenheit
8 Tödliche Vernunft
9 Lifestyle-Tipps für Süßkartoffeln
Literaturempfehlungen
Glossar
Widmung
Einführung
Mein Name ist Mohamed, und ich mache mir große Sorgen um meine körperliche Unversehrtheit, meine Existenz, mein Leben in Deutschland, in Europa, im sogenannten Westen. Denn es hat sich in den vergangenen Jahren so einiges getan: Westliche Demokratien, und das kann man deutlicher denn je sehen, sind – anders als von vielen angenommen – eben nicht immun gegen politisch organisierten Hass und Menschenfeindlichkeit. Donald Trump, Viktor Orbán oder Matteo Salvini zeigen exemplarisch, dass es möglich ist, in westlichen Gesellschaften Mehrheiten für Sexismus, Rassismus, Antisemitismus oder Queerfeindlichkeit – jeweils mit Gewaltandrohungen gepaart – zu gewinnen. Die politischen Erfolge der »Alternative für Deutschland«, der Freiheitlichen Partei Österreichs oder der Schweizerischen Volkspartei zeigen: Demokratie wird schon wieder zur großen Gefahr für verletzbare Gruppen in mehrheitlich weißen Gesellschaften.
Gleichzeitig sind viele Angehörige dieser Gruppen sprechfähiger denn je. Es wurde noch nie so viel über Machtstrukturen und die Benachteiligung von Minderheiten gesprochen – was wiederum eine Welle des Widerstands nicht nur an den Rändern der weiß-privilegierten Mehrheitsgesellschaften erzeugt hat. Dieser heimatnostalgische, hasserfüllte und wütende Gegenschlag spiegelt sich in Politik, Kultur, Medien und im Alltag wider. Die Polarisierung schreitet so immer schneller voran. Doch: Das weitere Erstarken von Rechtsradikalen in Europa und ihrer Verbündeten im Geiste, ein verschärfter Ton bei Debatten rund um Flucht und Migration, der teils gewalttätige Widerstand einiger Privilegierter gegen die Emanzipation von Minderheiten, das alles bedeutet nicht, dass es zu spät ist, gemeinsam am Ziel einer friedlichen, gerechten und inklusiven Gesellschaft in Europa und der Welt zu arbeiten.
Dies ist also ein Buch für alle weißen Menschen, die einen Wandel herbeiführen möchten, und für alle nichtweißen Menschen, die verstehen wollen, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Während in den vergangenen Jahren mehrere Autor*innen aus ihren Perspektiven und Lebensrealitäten heraus beschrieben haben, dass es strukturellen Rassismus, weiße Privilegien und eine lange Tradition der Andersmachung von verletzbaren Minderheiten gibt, tauchte immer wieder eine simple Frage auf, die mir vor allem weiße Leser*innen und Gesprächspartner*innen gestellt haben: Und nun?
Dieses Buch reagiert darauf und bietet neuen Input für die antirassistische Debatte im deutschsprachigen Raum. Es beschreibt sowohl auf strukturell-institutioneller als auch auf persönlicher Ebene, wie das System weißer Privilegien überhaupt wirkt, wie tief es in unser Leben eingedrungen ist – und was man als Gemeinschaft oder als Individuum konkret tun kann, um Racial Justice, also Gerechtigkeit zwischen allen Menschen, herzustellen. Über Anekdoten und Analysen möchte ich eine Denkhilfe bereitstellen, um dieses Ziel zu erreichen: angefangen bei der Offenlegung von Verhaltensmustern privilegierter Menschen (siehe Kapitel 1 und 2) über die Lage innerhalb verletzbarer Gruppen (Kapitel 3), das Hinterfragen, wie Wissen überhaupt produziert wird (Kapitel 4), die kritische Betrachtung von Entscheidungsräumen (Kapitel 5), eine makabre Exkursion in die menschliche Psyche, die erneut belegt, wie sehr rassistisches Denken in uns allen verankert ist (Kapitel 6), eine Dekonstruktion der deutschen Erinnerungskultur, die für ein egalitäres Miteinander unabdingbar ist (Kapitel 7), bis hin zur Enttarnung einer tödlichen Vernunft insbesondere in Politik und Medien (Kapitel 8) und einer konkreten Anleitung zum antirassistischen Denken für den Alltag und das eigene gesellschaftspolitische Engagement (Kapitel 9). Ein Glossar und weitere Literaturempfehlungen finden sich am Ende des Buches.
Diesen Text zu lesen, gar Geld dafür auszugeben oder es an die Liebsten zu verschenken ist weiterhin keine Selbstverständlichkeit. Ich danke Ihnen also für Ihre Bereitschaft, sich überhaupt mit den Themen Rassismus und Privilegien auseinanderzusetzen. Dieses Buch geht über das veraltete Rechts-links-Schema hinaus. Es betrifft uns alle. Es liegt mir als Autor of Color besonders am Herzen. Als Person of Color hat es für mich eine heilende Wirkung. Während ich über das Erlebte, die Schmerzen und meine Recherchen schreibe, erinnere ich mich daran, dass ich überhaupt existiere.
Der gesellschaftliche Wandel der vergangenen Jahre drückt sich nämlich in verschiedenen Weisen aus: Ehemals stille Gruppen werden sprechfähig und äußern sich zu ihren Belangen, für die weiße Mehrheitsgesellschaft unsichtbare Phänomene werden plötzlich glasklar sichtbar – zumindest für jene, die hinschauen möchten. Diesen »weißen Fleck« in der Betrachtung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens von Weißen und Nichtweißen möchte dieses Buch auflösen. Die Identifizierung und Aufhebung von blinden Flecken in unserer Wahrnehmung spiegelt sich auch in einer veränderten Sprache wider: Das Mitdenken von nicht binären und trans Menschen wird immer mehr zum Standard, eine egalitäre Gestaltung der Art und Weise, wie wir reden und schreiben, schreitet voran. Nur ein Beispiel: In diesem Buch schreibe ich Schwarz groß, wenn ich Schwarze Menschen meine. Das unterstreicht die Eigenbezeichnung, die eben Schwarze Menschen für sich gewählt haben. Ich schreibe aber weiße Menschen klein: Denn Weißsein ist weiterhin eine analytische Kategorie und keine Selbstbezeichnung von Weißen. Es sind diese vermeintlich nebensächlichen Dinge, die den Wandel der Gesellschaft gut illustrieren.
Mehrere Generationen werden sich noch an der Aufarbeitung des Kolonialismus und der postkolonialen Ausbeutung von Nichtweißen bis zum heutigen Tage und leider darüber hinaus abarbeiten müssen. Ich habe deswegen unzählige Bücher und Theorien der Race Studies, vor allem aus dem englisch- und französischsprachigen Raum, studiert, meine eigenen Beobachtungen und Analysen eingewebt und mir überlegt, wie die mir wichtigen und als produktiv erscheinenden antirassistischen Konzepte möglichst niedrigschwellig, unterhaltsam und lebendig Gedanken und Debatten anstoßen können. Die Auflösung des weißen Flecks ist die Grundlage für die zukünftigen Debatten in einer diversifizierten Gesellschaft, davon bin ich überzeugt. Und deshalb will ich mit diesem Buch einen weiteren Beitrag zur egalitären Gestaltung der Gemeinschaft, in der wir alle leben, leisten. Denn nur Gerechtigkeit und Gleichberechtigung führen zu einem Austausch, der wirklich alle Menschen – egal welcher Hautfarbe oder Herkunft – weiterbringen wird.
1 Vorsicht, zerbrechlich
Jede Person, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Sozialisation, hat mit inneren Komplexen zu kämpfen, verspürt manchmal Unsicherheiten im Umgang mit dem eigenen Umfeld, fühlt sich missverstanden oder ab und zu von anderen Mitgliedern der Gesellschaft beleidigt. Die aus dieser Gefühlslage heraus resultierenden Verhaltensweisen einzelner Individuen würde ich als menschlich beschreiben: Erwachsene werden zu trotzigen Kindern, versinken in Selbstmitleid oder fangen an, wild um sich zu schlagen. Manchmal fügen sich diese und weitere Gemütszustände zu einem Wollknäuel der Gefühle zusammen. Der Mensch ist halt ein emotionales Wesen.
Das gilt natürlich auch für Weiße. Ich kann allerdings nicht immer nachvollziehen, wie die Fäden in ihrem inneren Wollknäuel bei politischen Diskussionen rund um Privilegien und Rassismus, Kolonialismus und postkoloniale Machtstrukturen, Empowerment und Wiedergutmachung zusammenlaufen. Manchmal, so habe ich den Eindruck, verheddern sich weiße Menschen innerlich wegen Kleinigkeiten, die sie eigentlich locker aushalten müssten. Derweil reicht es sogar, Realitäten nüchtern zu beschreiben oder, auf Evidenzen basierend, einen Witz zu reißen, damit einige Weiße anfangen zu heulen, sich zu beschweren oder regelrecht durchzudrehen.
Im Zuge einer deutschen Twitterdebatte erreichte mich zum Beispiel eine private Nachricht von einem jungen weißen Mann. Wir kennen uns aus Uni-Zeiten, und er hat sich mir gegenüber öfter als Verbündeter im Kampf gegen den Rassismus geoutet. So etwas freut mich immer sehr, denn es braucht mehr Alliierte aus der Mehrheitsgesellschaft, um Strukturen der Diskriminierung von verletzbaren Minderheiten gemeinsam aufbrechen zu können (siehe Kapitel 9). Bevor ich zu seiner Zuschrift komme, muss ich aber ein wenig ausholen. Kontext ist ja immer wichtig:
Zur selben Zeit tobte auf Twitter nämlich eine Diskussion, ob die urbane Wortschöpfung Alman, mit der weiße Deutsche gemeint sind, beleidigend sei oder nicht. Alman ist an das Wort Almanya aus dem Arabischen, Türkischen, Kurdischen oder Persischen angelehnt. Almanya bedeutet schlicht: Deutschland. Ich wünschte manchmal, ich hätte das Problem, dass ich mich von so einer Bezeichnung beleidigt fühle. Auf Twitter habe ich mich aber bewusst entschieden, nichts Unmittelbares zu dieser Debatte beizusteuern. Stattdessen setzte ich an diesem Tag einen Tweet zum deutschen Kolonialismus ab. Der ehemalige Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, der sich als Deutschlands wichtigster Intellektueller zu jedem Thema gerne äußert, teilte im Zuge einer Friedenskonferenz für Libyen im Berliner Kanzlerinnenamt folgenden Gedanken mit seinen Follower*innen: »(…) Wir waren nicht am Libyen-Krieg beteiligt u. nie Kolonialstaat (…).« Ich entschied mich also für eine kurze, zugegeben etwas freche Antwort: »Der Sigmar kann nicht googeln.«
Könnte er es nämlich, würde Gabriel wissen, dass Deutschland Kolonialstaat war und bis heute von einer kolonialen Dividende profitiert (siehe Kapitel 7). Kurze Zeit später tauchte in meiner Timeline ein Tagesspiegel-Kommentar mit folgender Überschrift auf: »Libyen-Konferenz in Berlin: Jetzt braucht’s eine Angela Bismarck.« Zu sehen war eine ernst blickende Angela Merkel vor einer deutschen Fahne. Ich fühlte mich also wieder berufen und twitterte einen Screenshot vom Wikipedia-Artikel »Deutsche Kolonien«. Später machte ich mich über Bismarck-Fans lustig, die den historischen Fakt leugneten, dass die Berliner Konferenz zwischen dem 15. November 1884 und dem 26. Februar 1885, auch Kongo-Konferenz genannt, auf Einladung des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck stattfand und dort der afrikanische Kontinent unter den europäischen Kolonialmächten, darunter auch Deutschland, aufgeteilt wurde. Gegen Geschichtsklitterung hilft manchmal nur Humor.
Hunderte tief beleidigte User*innen (einer von ihnen nannte sich beispielsweise »Bismarck der Echte« und beschrieb sich auf seinem Profil mit den Worten »Mein Reichskanzler. Konservativ und Patriot. Für Gott, Vaterland und Kaiser! AfD seit 2013«) beschwerten sich, dass ich mit meiner Kritik und dem Wikipedia-Artikel ihren heiligen Bismarck, die deutsche Geschichte im Allgemeinen (!) und sowieso alle Deutschen verunglimpft hätte. Ich kann ebenfalls trotzig sein und legte einen Tag später mit einem Tweet im Social-Media-Slang nach: »Glaube ja, dass Almans in ihrer Liebe zu #Bismarck eigentlich 1 ganz anderes Gefühl zu einer mit Bismarck verbandelten Figur channeln.«
Und genau dieser Tweet trieb den jungen weißen Mann von vor drei Absätzen zur Weißglut. Er schrieb mir eine private Nachricht. Oder wie er es nannte: einen Hinweis. Meine ständige Kollektivierung und Provokation auf Twitter, so erklärte er mir, mache es Allies (also mit Minderheiten verbündeten Weißen wie ihm) schwer, nicht genervt zu sein. Er wolle mir nur Feedback geben und betonte noch mal, dass er meine Arbeit sonst sehr schätze. Seine gute Intention nahm ich ihm direkt ab, dennoch ist dieser kleine Vorfall ein passendes Beispiel, um ein auch in Deutschland weitverbreitetes Phänomen unter Weißen zu illustrieren.
Weiße Zerbrechlichkeit, aus dem Englischen White Fragility, bezeichnet die von Unsicherheit begleitete Interaktion von weißen Menschen in einer diversen Gesellschaft, in der immer häufiger von diskriminierten Minderheiten eine strukturelle Kritik an weißen Privilegien formuliert wird. Die US-amerikanische Autorin Robin DiAngelo beschreibt, dass Weiße meist in einem sozialen Umfeld leben, das sie vor Race-basiertem Stress schützt. Weiße sind demnach daran gewöhnt, dass ihr Weißsein gar nicht erst thematisiert wird. Sie existieren im Diskurs nicht als rassifizierte Personen, gar als homogen wahrgenommene Gruppe. Während in Medienberichten, politischen Debatten, Kunst- oder Kulturproduktionen oft von den Türken, den Arabern, den Muslimen, den Juden, den Geflüchteten und so weiter die Rede ist, existieren Weiße in der Öffentlichkeit meist nur als Individuen, als Persönlichkeiten, als Subjekte. Weiße Männer profitieren dabei mehr von dieser Darstellung als Frauen, die manchmal nicht als natürliche Personen, sondern lediglich als Ehefrauen, Partnerinnen oder schlicht Anhang von Männern wahrgenommen werden.
Angehörige der Mehrheitsgesellschaft erwarten aufgrund dieser speziellen Unsichtbarkeit (bewusst oder unbewusst), dass ihre Positionierung und ihre strukturellen Privilegien nicht Gegenstand einer Debatte sein sollten. Eine Haltung, die ihre innere Toleranz gegenüber rassismuskritischen Debatten schmälert. Viele Weiße, erklärt DiAngelo, könnten es nur schwer oder gar nicht aushalten, wenn allgemein über sie gesprochen wird. Egal, was dabei konkret gesagt wird. White Fragility beschreibt also den inneren Zustand weißer Menschen, bei dem schon ein Minimum an Racial-Stress unerträglich werden kann. Sie bauen dann eine defensive Haltung auf, wenn sie eine (egal ob harmlose, diplomatische oder humorvoll verpackte) Privilegienkritik hören.
Der junge weiße Mann konnte es augenscheinlich nicht aushalten, dass ich mit einem überspitzten Tweet darauf hinweisen wollte, dass zu viele Bismarck-Fans und weitere Deutsche Nachhilfe in europäischer Kolonialgeschichte brauchen. Er musste mir einen Hinweis geben, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich meine Kritik verpacken solle, damit er weiter als Verbündeter zur Verfügung steht. Das nennt sich dann Tone Policing. Um als weiße Person eine Allianz mit People of Color eingehen zu können, gibt es allerdings einige Empfehlungen für Allies und solche, die es werden wollen, wie sie diese Zusammenarbeit gestalten können und was sie tunlichst lassen sollten (siehe Kapitel 9). Bedingungen an People of Color zu stellen ist in diesem Zusammenhang zumindest problematisch. Es ist dabei anscheinend schwierig, als weiße Person auf »einen Hinweis« an Nichtweiße zu verzichten. Diese unberechenbare Fragilität, selbst unter Allies, macht es für Angehörige von Minderheiten anstrengend, Rassismus überhaupt anzusprechen. Stets stellt sich für People of Color die Frage: Wie reagiert mein weißes Gegenüber, wenn ich etwas zum Thema Rassismus sage?
An dieser Stelle sei noch mal betont, dass eine differenzierte Privilegienkritik nie essenzialistisch gemeint ist. Weiße sprechen und verhalten sich also nicht per se oder qua weißer Hautfarbe rassistisch. Niemand gehört alleine aufgrund seiner oder ihrer äußeren Erscheinung in irgendwelche Schubladen. Abgesehen davon, dass die Hautfarbe (sozial konstruiert) ein wichtiger Faktor ist, wie mit einer Person, egal wo auf dieser Welt, umgegangen wird, zählen im intersektionalen Sinne auch andere Kategorien von Identität wie Gender, Einkommen, Sexualität, Alter, Bildungsstand, Wohnungssituation, Gesundheitszustand oder Passfarbe. Es kommt oft auf den Mix aus diesen Kategorien an, ob man Erfolg hat oder scheitert.
Kein Individuum kann qua Herkunft die Verantwortung für die geltenden Normen in einer Gesellschaft, aus der es stammt, übernehmen. Was zählt, ist aber: Jede Person muss zumindest mitdenken, in welchen Strukturen sie sich bewegt, aus welcher Position sie über welche Themen spricht und was sie konkret (politisch) tut. Denn Strukturen sichtbar zu machen, die bestimmte Gruppen bevorzugen und andere pauschal benachteiligen, ist ein Grundanliegen der antirassistischen Kritik. Mit dem Finger auf einzelne Personen allein aufgrund ihrer Hautfarbe zu zeigen liegt mir persönlich fern. Erst nach Betrachtung von Aussagen, Wirken und Kontext kann man einzelne Menschen für konkrete Dinge haftbar machen. Und doch musste ich mich mit den Jahren irgendwie dazu verhalten, dass sich viele Weiße sehr angegriffen fühlen, wenn ich Kritik an Strukturen weißer Privilegien übe. Dem jungen weißen Mann schrieb ich letztendlich ein kurzes Gedicht zurück:
Man ist kein Ally,
sondern wird zum Ally.
Und das ist sehr aufwendig.
Man ist kein Alman,
sondern wird zum Alman.
Und das zum Teil ganz beiläufig.
Zum Beispiel, indem man sich von seiner weißen Zerbrechlichkeit leiten und ihr freien Lauf lässt. Alman ist ein humorvoll gemeinter, lässiger Begriff, der in den urbanen Zentren Deutschlands gewachsen ist, um auf die Stigmatisierung von Nichtweißen ausgehend von der Mehrheitsgesellschaft in diesem Land zu antworten. Alman ist ein Werkzeug, das vor allem junge People of Color nutzen, um für sich sprechen und ihre Umwelt beschreiben zu können. Wer sich davon beleidigt fühlt, dem sei nahegelegt: Chill dein Leben! Das Wort Alman wird kein einziges weißes Privileg neutralisieren. Den Fakt, dass die nostalgische AfD-Wählerschaft und ähnliche Anhängerschaft anderer politischer Lager den Zeiten von Bismarck oder anderen Epochen in der deutschen Geschichte nachtrauern oder sie verklären, muss man als weiß-deutsche Person einfach aushalten können. Einige Monate später griffen mich AfD-Politiker*innen, die Bild-Zeitung und Tausende besorgte Bürger*innen auf Twitter an – weil ich mich antirassistisch geäußert hatte. Der junge weiße Mann sah die Ausmaße dieser Attacke und schrieb mir eine Nachricht, dass er dazugelernt habe und mir nie wieder mit seiner White Fragility kommen werde. Während ich Julian Reichelt, Chefredakteur der Bild-Zeitung, selbstverständlich stumm geschaltet habe (siehe Kapitel 8), bin ich bereit, mit lernfähigen Weißen in Kontakt zu bleiben.
Ein Bismarck-Fan, davon gehe ich zumindest aus, ist nämlich längst verloren. Mit »AfD seit 2013« muss ich mich nicht noch aufhalten. Jemand, der Ally sein möchte, muss sich allerdings anstrengen, seine sozialisierte Fragilität in den Griff zu bekommen. Das ist viel verlangt, vor allem, wenn die betroffene Person beispielsweise einer harten Lohnarbeit nachgehen muss. Sich nach Dienstschluss hinzusetzen, über postkoloniale Theorie den Kopf zu zerbrechen und dabei seine Gefühle zu steuern kann mühsam sein. Zum Glück gibt es dafür aber Autor*innen, die bezahlt werden, um sich solche Gedanken zu machen, sie für ein breites Publikum aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.
Die Frage, die mich in diesem Zusammenhang oft erreicht, lautet: Kann man als weiße Person überhaupt noch etwas sagen? Darauf habe ich immer eine gültige Standardantwort parat: Abgesehen davon, dass man einer weißen Person in einer weiß dominierten Gesellschaft nur sehr schwer die Sprechfähigkeit nehmen kann, darf weiterhin jede Person sagen, was sie will. Man kann einfach nicht mehr erwarten, dass es keinen Widerspruch gegen die Andersmachung von Minderheiten gibt. Das ist alles. Einerseits musste ich mir sehr oft anhören, dass nichtweiße Menschen zu emotional seien, sich zu häufig beschweren würden und einfach »auf Rassismus abonniert« seien (ja, Weiße sagen mir so etwas ins Gesicht). Andererseits musste ich in den vergangenen zehn Jahren sehr häufig meine Emotionen steuern, manchmal unter großen Anstrengungen unterdrücken, während ich mit der weißen Zerbrechlichkeit meines Gegenübers zu tun hatte. Dieses Ungleichgewicht begleitet mich durch mein Arbeits- und sonstiges Leben. Ich habe dabei beobachtet, dass bei diesem gesellschaftlichen Streit besonders auf die Gefühle und Belange von Weißen geachtet wird, selten auf die von Nichtweißen.
Vor Kurzem wurde ich zu einer großen Konferenz eingeladen. Auf der Bühne sollte ich einen Impulsvortrag halten. Es ging darum, junge Menschen – die meisten von ihnen Studierende, zwanzig bis dreißig Jahre alt – mit frischen Gedanken, pointierter Gesellschaftskritik und konkreten Projektideen zu inspirieren. Hunderte Entscheidungsträger*innen und Führungskräfte von morgen auf einem Haufen: Klingt gut, dachte ich. Also habe ich zugesagt. Mit der Einladung bekam ich den Hinweis, dass im Publikum ein Stargast sitzen werde: Jan Böhmermann. Der Fernsehsatiriker sollte kurz nach meinem Auftritt mit seiner Performance auf die Bühne gehen. Ich habe mich deswegen entschieden, über rassistische Satire und meine Kritik daran zu sprechen. Ich hatte entsprechende Texte veröffentlicht, die sich unter anderem mit Böhmermanns Schmähgedicht zur Autokratie unter Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei beschäftigten. Böhmermann und andere weiß-deutsche Medienschaffende griffen dabei auf rassistische Bilder vom »ziegenfickenden Orientalen«, vom »pädophilen Moslem« und »stinkenden Anatolen« zurück. Gute Satire kann meiner Meinung nach auf solche billigen und diskriminierenden Pointen verzichten.
Als die weiße Veranstalterin von meinem Vorhaben erfuhr, rief sie mich panisch an. Was mir eigentlich einfalle, Jan Böhmermann kritisieren zu wollen? »Das geht nicht«, sagte sie schon zu Beginn des Gesprächs. Böhmermann sei ihr wichtigster Gast, und es sei nicht angebracht, seine Satire im Rahmen ihrer Veranstaltung zu besprechen. Er habe als Person der Öffentlichkeit außerdem sehr viel durchmachen und aushalten müssen. Man sollte ihm eine Pause gönnen. Sie bat mich, auf das Thema zu verzichten, und machte Druck, dass ich trotzdem auftreten müsse. Meine Stimme sei ihr äußert wichtig, nur Jan Böhmermann und deutsche Satire kritisieren, das gehe nicht. Eine halbe Stunde redete sie auf mich ein.
Ich mache mir noch heute Vorwürfe, weil ich eingeknickt bin und mein Thema gewechselt habe. Ich hatte sogar vorher ein von mir handsigniertes Buch vorbereitet, in dem ich meine Kritik an rassistischer Satire beschreibe. Dieses Buchexemplar steht noch heute in meinem Bücherregal. Auf der ersten Seite ist dort zu lesen: »Lieber Jan, ich weiß, dass Du genug Beef mit allem Bösen dieser Welt hast. Schau! Wir Nafris sind zu gut erzogen: diskriminiert und entschuldigen uns noch! :D Danke für Deine Arbeit, ich hoffe, wir können – im wahrsten historischen Sinne – Alliierte sein!« Selbst bei einer Sache, die mir persönlich so wichtig ist, dass ich mich vor Hunderten Menschen auf die Bühne stelle, meine Aufregung herunterschlucke und darüber spreche, selbst dann mache ich mir Gedanken um die Gefühle, den Beef, die Belange jener, die in ihren weißen Privilegien baden und es bis dahin nicht verstanden haben und verstehen wollen. Ich hielt letztendlich einen Vortrag zu einem anderen Thema und ging von der Bühne mit einem sehr schlechten Gewissen – mir selbst gegenüber.
Denn Jan Böhmermanns Bedürfnisse waren der Veranstalterin sehr wichtig, meine Gefühle – so schien es mir – waren ihr schlicht egal – obwohl ich auch ihr Gast war. Ich machte mir selbst ja von Anfang an auch Gedanken darüber, wie der Fernsehstar auf meine Kritik emotional reagieren würde, und vernachlässigte dabei meine eigene Gemütslage (siehe Kapitel 3). Die Veranstalterin, die sich selbst als progressiv und Ally beschreiben würde, hat die mögliche Reaktion von Jan Böhmermann auf meinen Vortrag antizipiert und ihn aufgrund ihrer Machtposition unterbunden. White Fragility sorgt dafür, dass sehr viele Debatten und Konfrontationen, die aus Minderheitensicht wichtig sind, gar nicht erst stattfinden. Denn es wird in Medien, Kultur oder Politik peinlichst darauf geachtet, welche Aussagen welche weiße, einflussreiche Person wie beleidigen könnten. Wie kann man da überhaupt auf Augenhöhe miteinander diskutieren?
Längst hat sich auch im Deutschen zur weißen Zerbrechlichkeit eine eigene Sprache entwickelt. Im urbanen Deutschwörterbuch werden fragile Weiße gerne als Schneeflocken bezeichnet. Wenn es wegen einer bestimmten Kritik zu heiß wird, schmelzen sie einfach dahin. Mit einem Pfützchen zu kommunizieren macht dann wenig Sinn. Man sagt auch, dass viele Weiße beim Thema Rassismus dazu tendieren, weiße Tränen zu vergießen. In Anlehnung an das englische White Tears. Ich kenne mehrere weiße Autoren, die in ihren Texten rücksichtslos gegen Minderheiten austeilen. Sie erwarten Jubel und Zustimmung. Immer öfter ernten sie aber (vor allem in den sozialen Medien) pointierte Kritik – die sie bis ins Mark trifft. Ein Autor beschwerte sich mal bei mir, dass er auf Twitter von einem User als »islamophob« bezeichnet wurde. Zuvor hatte er in einer auflagenstarken Zeitung pauschal behauptet, dass alle Muslime integrationsunwillige Menschen seien. Austeilen, aber nicht einstecken können: Die zarten Seelen einiger weißer Männer wundern mich schon ein wenig.
Ihre weiße Zerbrechlichkeit trifft auf eine noch relativ neue Sprechfähigkeit von Angehörigen verletzbarer Gruppen. Menschen, die vorher gar nicht am Diskurs beteiligt waren, melden sich nun zu Wort und reden über Dinge, die ihnen wichtig sind. Alte weiße Männer beschweren sich deswegen und sagen: In den Neunzigerjahren konnten wir noch sachlich miteinander reden, zum Beispiel über das Thema Dosenpfand (ja, dieses Beispiel hat ein alter weißer Mann tatsächlich in meiner Gegenwart gebracht). Heute seien alle so emotional und betroffen. Das nerve ihn, sagte er. Diese Nostalgie verkennt, dass Weiße wie gesagt auch Gefühle haben und dass People of Color in den Neunzigerjahren in Deutschland eine weniger hörbare Stimme hatten. Außerdem ist das Dosenpfand bestimmt ein wichtiges Sachthema, daneben gibt es aber auch andere Politikfelder, die an Relevanz zugenommen haben – weil nun mehr People of Color, Frauen oder Queers mitsprechen (wollen).
Wenn immer mehr Nichtweiße anfangen, im Journalismus, in den Sozialwissenschaften, in Kunst und Kultur, im Alltag auf Weiße zu schauen – weil Weiße in den vergangenen 500 Jahren ihren zum Teil degradierenden Blick konstant auf People of Color richteten –, dann kann ich mir vorstellen, dass dies für Weiße irritierend, verwirrend, gewöhnungsbedürftig oder schmerzvoll sein kann. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen: Man gewöhnt sich daran, erforscht und beschrieben zu werden. Und wie gesagt geht es hier nicht um die Stigmatisierung Einzelner, sondern um die Freilegung von sozial konstruierten Mechanismen, die unsere Welt steuern. Einigen Weißen ist aber auch diese eher abstrakte Ebene schon zu viel.
Manchmal versuche ich mich von den inneren Wollknäueln meiner weißen Gesprächspartner zu lösen, um freier nachdenken zu können. Und dann fällt mir wieder ein, dass White Fragility schnell in White Rage kippen kann. Es ist statistisch belegt, dass Weiße in Deutschland, in Europa und Nordamerika (und damit auch an vielen anderen Orten und in Räumen auf dieser Welt) am Drücker sitzen. Wenn davon nur eine Handvoll beleidigter weißer Menschen die Nerven verliert und ihre Macht nutzt, die Kritik an den herrschenden Machtstrukturen zu unterdrücken, haben Menschen wie ich ein großes Problem. Damit meine Texte erscheinen, bin ich zu einem wesentlichen Teil vom Wohlwollen und der Förderung durch weiße Chefredaktionen und weiße Verlagsleitungen abhängig. In der deutschen Medienlandschaft habe ich aber die weiße Wut in den vergangenen fünf Jahren in ihrer ganzen Wucht zu spüren bekommen.
Als mein erstes Buch Unter Weißen. Was es heißt, privilegiert zu sein im Jahr 2017 erschien, bekam ich sehr viel Zuspruch. Das gehört auch zur Wahrheit. In Unter Weißen beschreibe ich, wie weiße Privilegien überhaupt funktionieren, und sehr viele weiße Leser*innen sprachen mich darauf an oder schrieben mir, dass ihnen mein Buch geholfen habe, sich selbst besser zu reflektieren. Solche Rückmeldungen ehren mich natürlich jedes Mal. Es gab aber auch jene Weiße, die höchst beleidigt waren, dass ich einer der ersten Autoren in Deutschland war, die es überhaupt wagten, das Wort weiß auszusprechen. Ich rechne an dieser Stelle Trolle im Format verrückter Bismarck-Fans mal raus. Es waren gestandene weiße Journalist*innen und Autor*innen, die mir ins Gesicht sagten, dass ich nicht nur falschläge, sondern dass sie dafür sorgen könnten, dass ich nie wieder ein Buch oder einen Artikel veröffentlichen werde, falls ich mich entscheiden sollte, weiterzumachen. Mit den Scherben ihrer weißen Zerbrechlichkeit wollten sie mich als sprechfähigen Nichtweißen sprichwörtlich verletzen.
Ende der Leseprobe