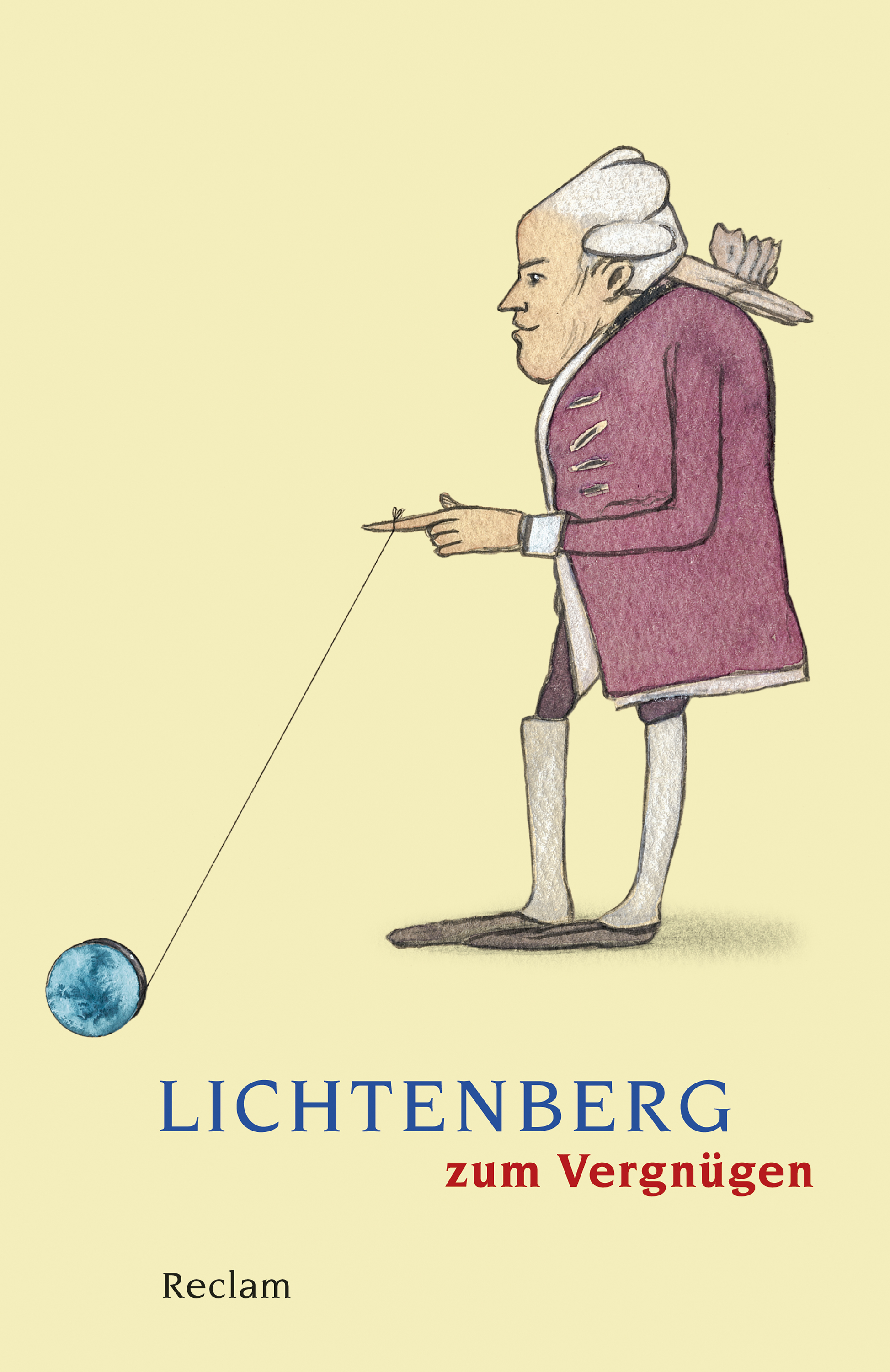
Lichtenberg zum Vergnügen E-Book
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Georg Christoph Lichtenberg war für Tucholsky ein Schriftsteller, »der einen Verstand gehabt hat wie ein scharf geschliffenes Rasiermesser, ein Herz wie ein Blumengarten, ein Maulwerk wie ein Dreschflegel, einen Geist wie ein Florett«. Seine ›Sudelbücher‹ sind bis heute unergründlich, unerschöpflich und hinreißend lesbar. Dieser Band versammelt eine vergnügliche wie repräsentative Auswahl der Lichtenberg'schen Bonmots und Aphorismen, ausgewählt von Alexander Kluy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Lichtenberg zum Vergnügen
Herausgegeben von Alexander Kluy Mit 7 Abbildungen
Reclam
2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Coverillustration: Nikolaus Heidelbach
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2020
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961728-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019651-9
www.reclam.de
Inhalt
Georg Christoph Lichtenberg
Porträt en face nach rechts von Johann Conrad Krüger, Kupferstich nach einem Gemälde von Johann Ludwig Strecker, 1781/82
Vorwort
Robert Gernhardts Wahl war eine vergnügliche. Auf die dem Zeichner, Reimvirtuosen und parodistischen Vokalakrobaten gestellte populäre Frage, mit welchem Buch er es denn am längsten auf einem einsamen Eiland aushalten würde, antwortete er im Jahr 2004 leichten Herzens wie schneller Feder: mit den Sudelbüchern Georg Christoph Lichtenbergs! Und er fügte noch hinzu: »Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Buch vor mir und das Meer um mich als Verwandte grüßen würden – sind doch beide unergründlich und unerschöpflich.«
Unergründlich, unerschöpflich, dabei hinreißend lesbar, durchgehend vergnüglich, und all dies bis heute. War ein solcher Autor wie Lichtenberg – der, wie Kurt Tucholsky 1931 preisend schrieb, »einen Verstand gehabt hat wie ein scharf geschliffenes Rasiermesser, ein Herz wie ein Blumengarten, ein Maulwerk wie ein Dreschflegel, einen Geist wie ein Florett« –, ein solcher Räsoneur und philosophischer Anthropologe jenseits geschlossener, hochgestapelter und monumentaler Denkarchitekturen denn jemals außer Mode?
Ja. Durchaus. Editionen der Sudelbücher erschienen lange als nicht übermäßig seriös anmutende Auswahlausgaben. Erst 230 Jahre nach dem Geburtsjahr des nahe Darmstadt das Licht der Welt erblickenden Lichtenberg (1742) lag eine wirklich solide, modernen literaturwissenschaftlichen Ansprüchen genügende kritische und kommentierte Werkausgabe vor. Diese zeigte umfänglich, was Tucholsky eine Generation zuvor so wortmächtig und bildstark gepriesen hatte. Dieser, wahrlich von der deutschen Sprache so zurückgeliebt, wie er sie seinerseits spielerisch amourös umgarnte, hatte recht behalten: Von dem, was in den Lichtenberg’schen Sudelbüchern »verschüttet liegt«, leben andere Leute ihr ganzes Leben. Tucholskys Schluss-Aufseufzen 1931 in dem bürgerlich-liberalen Berliner Großstadtblatt Vossische Zeitung gilt heute noch immer:
In Deutschland erscheinen alljährlich dreißigtausend neue Bücher.
Wo ist Lichtenberg –? Wo ist Lichtenberg –? Wo ist Lichtenberg –?
Lichtenberg war sogenannter Aphoristiker. Nun ist Aphorismus-Forschung, man verzeihe das Wortspiel, immer schon Stückwerk geblieben. Manche erinnert die Bestimmung dieses – ja was? Spruchs oder, im österreichischen Deutsch, Sagers? Gedankensplitters?, dieser Notiz oder philosophischen Illumination?, dieser »unfrisierten Gedanken« (Stanisław Jerzy Lec) oder »verärgerten Logik« (Gabriel Laub)? – an das ausdauernde Festhalten eines Aals mit bloßer Hand. Es ist schlechterdings unmöglich. Der jüngste, der sich darum mühte, ist ein in Singapur lehrender Geisteswissenschaftler, Andrew Hui, der seine Theorie des Aphorismus umstandslos von Konfuzius bis Twitter durch die schreibende beziehungsweise textende Menschheitsgeschichte spann. Auch dieser Interpret tut sich schwer. Und greift zu Bildern und Metaphern. So sei der Aphorismus »vor, gegen und nach Philosophischem«. Der Versuch der Ausdeutung öffne eine Vielzahl an Welten. Daher sei, so Hui, der Aphorismus »atomar«. Spalte man diese literarische Mikroform auf – bis heute, so Hui, die ausdauerndste Ausdrucksform und angesichts von Tweets, Memes und GIFs in der digitalen Kommunikation zugleich die aktuellste –, so fliege einem die Bedeutung um die Ohren.
Aus dem atomaren Lichtenberg’schen Kleinkosmos in Göttingen zwischen 1763 und seinem Todesjahr 1799 – der Schwelle zum neuen Jahrhundert verweigerte sich sein schwacher Körper – fliegen die Funken auf bis heute. Aus einer Zeit, die materiell so ganz anders war und doch ideell so stupend der unseren ähnelt. Besser gesagt: Wir stehen auf ihren Schultern, wie Zwerge auf denen von Riesen. Ohne das 18. Jahrhundert gäbe es heute kaum etwas von dem, was wir denken, worüber wir disputieren, wofür wir uns engagieren und was wir schützen wollen, angefangen bei den Menschenrechten über die Freiheit des Einzelnen bis hin zur Psychologie und einem anderen, tiefergehenden Naturverständnis.
Das Göttingen, in das Lichtenberg als Student kam, war vom Siebenjährigen Krieg heftig durchgerüttelt worden. Über eintausend Menschen ließen in der Hochschulstadt ihr Leben. Die Einwohnerzahl lag nach Kriegsende nur knapp über 6000. Die Oberschicht umfasste prozentual rund neun Prozent, der Mittelstand ungefähr 55 Prozent. Mehr als ein Drittel der Stadtbewohner hatte nicht genug zum Leben. Massenarmut war Alltagsphänomen. 1763 war jeder siebte Göttinger ohne jeden Besitz, Tendenz steigend. Um 1800 konnte jeder Dritte nicht mehr ohne städtische Almosenalimentierung sein in der Regel kurzes Leben fristen. Parallel dazu gab es ein System von Armen- und Werkhäusern sowie von Industrieschulen, die zu besuchen »Arbeitswilligen« oblag – eine Sozialkontrolle war damit garantiert –, während »Faulen«, die diese Institutionen aus welchen Gründen auch immer nicht frequentieren wollten oder konnten, keinerlei Unterstützung gewährt wurde. Sozialdarwinismus avant la lettre. In dieser Welt stellte Lichtenberg seine anthropologischen Gedanken an, wendete sie, drehte sie, examinierte, was ihm unterkam in seiner Zeit.
Nikolaus Zimmermann: Göttinger Straßenszene, Aquarell, 1793
Wie, ist zu fragen, ist das Fernrohr nun zu halten? Richtig oder falsch herum? Ist die Zeit zwischen später Früher Neuzeit, den Ausläufern des barocken Dreißigjährigen Kriegs, und erster Frühmoderne, bürgerlichem Biedermeier und einsetzender Industrialisierung uns fern, wenn wir mit einem Teleskop auf sie blicken? Oder ist sie erstaunlich nah? Ist sie eine des unaufhaltsamen Aufstiegs der Menschheit zum Glück? Oder sind die noch heute in Gesellschaftsdebatten, etwa der Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen, reklamierten philosophischen Grundlagen von Rousseau, Diderot und der Compagnie der Aufklärer weit in den Hintergrund dieser langen Epoche zu rücken, weil die Aufklärung ein Minderheitenprogramm für Kaffeehäuser in Paris und für Drucker in der Schweiz war, diese Jahrzehnte aber vielmehr von Adelspolitik und höfischen Intrigen zwischen Wien und Berlin, Paris und St. Petersburg, Kopenhagen, London und Warschau dominiert wurden?
Und weitab vom Fokus der Zentren, in der Provinz, lebte jenes klein gewachsene Männlein (1,41 m messend? 1,43 m?) namens Lichtenberg. Auf spillerigen Beinen stakste er mehr als dass er ging, wie Karikaturen überlieferten, war gelehrt, scharfäugig, spitzzüngig, geistreich. Ein konzentrierter Leser gelehrter Journale. Dabei keineswegs ein Verächter des Derben (»lieber sich einmal die Hochzeit zu Kanaan am Ofen auf den bloßen Arsch gebrennt, als lange so gesessen«, oder: »Come let us piss / on Mr. Twiss«). Wie alle Menschen des 18. Jahrhunderts begegnete er dem Tod auf Schritt und Tritt – als er neun war, starb sein Vater, bis dahin waren schon zwölf seiner Geschwister tot, später verschieden enge Freunde und die erste große Liebe, was ihm das Herz brach. In fortgeschrittenem Alter erlebte er die Liebe in eroticis, dafür wurde er schließlich achtfacher Vater.
Dieser Lichtenberg, das jüngste von siebzehn Kindern eines Pastors – er wie so viele andere auch also Hervorbringung des evangelischen Pfarrhauses, diesem seelisch-geistesgeschichtlich-kulturellen Fixpunkt der deutschen Geschichte (von Lessing über Nietzsche und Gottfried Benn bis Angela Merkel), in seinem Fall jedoch durch den Tod des Vaters abgekürzt –, war vieles: Als Professor der Mathematik und Experimentalphysik zu Göttingen ein angesehener wie bei den Studenten (die damals für jede einzelne Vorlesung Hörgeld zu entrichten hatten) beliebter Wissenschaftler. Ein Experimentator, der erste Blitzableiter-Installateur in der niedersächsischen Universitätsstadt und ein beflissener, jedoch zu seinem Leidwesen verhinderter Ballonfahrer. Mitglied nicht weniger europäischer Wissens- und Gelehrtenakademien. »Lichtenberg war zeitlebens zweierlei oder genauer dreierlei zugleich«, brachte Helmut Heißenbüttel es auf den Punkt. »Wissenschaftler und Literat waren nicht zu trennen, und in beiden kam immer auch der Philosoph zum Wort.«
Darüber hinaus war er vielleicht ein noch bedeutenderer Menschenseelenanalytiker, ein Psychologe, was schon der greise Sigmund Freud, ausnahmsweise einmal frei von jedem Neid, in einem Brief an Albert Einstein eingestand. Der Physiknobelpreisträger wiederum notierte ein Vierteljahrhundert später, 1955, er kenne keinen, »der mit solcher Deutlichkeit das Gras wachsen hört«.
Zudem war Lichtenberg Liebender. Und ein literarisch bewegend Trauernder – sein Brief, in dem er den Tod der jungen Stechardin, seiner ersten Herzens- und Bettgenossin, beschrieb, ist noch immer herzzerreißend.
Und er war im tintenklecksenden 18. Jahrhundert ein Aufzeichnungsweltmeister.
Zwischen 1766 und 1799 hat Lichtenberg geschätzt an die 10 000 Briefe geschrieben, von denen literaturwissenschaftlich-archivalisch rund 2500 belegt sind. (Hätte sich die Korrespondenz vollständig erhalten, würde sie, so wird geschätzt, 14 000 bis 15 000 Buchseiten füllen.) Der Lichtenberg-Forscher Ulrich Joost schlüsselte es einmal arithmetisch auf: »Wenn Lichtenberg über 10 000 Briefe in 30 Jahren geschrieben hätte, dann wären das also durchschnittlich in jedem Jahr über 330.« Anders gesagt: Jedes Jahr räumte er »500 Stunden der schriftlichen Kommunikation« ein, »oder an jedem Tag fast zwei Stunden«.
Und das war beileibe nicht alles. Geschrieben hat Lichtenberg in seinem knapp 57 Jahre umfassenden Leben neben der gewaltigen Korrespondenz noch: 2000 Druckseiten Notiz- und Sudelbücher; 1000 Seiten Tagebücher unterschiedlicher Gestalt; er füllte 7000 bis 8000 Seiten des von ihm fast ein Vierteljahrhundert lang betreuten und herausgegebenen GöttingerTaschen Calenders. Dazu gibt es 200 Seiten Abhandlungen und Streitschriften. 200 Seiten Aufsätze im Göttingischen Magazin. 500 Seiten Hogarth-Erklärungen. Und 1500 Seiten Vorlesungsaufzeichnungen, -entwürfe und -notizen.
Das Wohnzimmer der Familie Dieterich, Gouache von einem unbekannten Maler, um 1800
Wer allerdings meint, Lichtenberg sei ein Einsiedler gewesen, ein unablässig vor sich hin schreibender Eremit, der täuscht sich. Seine soziale Kompetenz war so ausgeprägt wie weitgefächert. Er muss ein geistreicher, umgänglicher Unterhalter gewesen sein, Freund vieler, die ihn für seine Gesellschaft schätzten. So wie Johann Christian Dieterich, Buchhändler und Verleger (damals gehörte zum einen auch das andere) zu Göttingen, der ihn in seinem Haus in der Gotmarstraße ab 1776 ohne Mietzahlung wohnen ließ; allerdings nicht ganz kostenfrei.
Im Gegenzug verpflichtete sich der Professor, Dieterichs Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügennebst Göttinger Taschen Calender als Herausgeber zu betreuen, und zwar für die nächsten 23 Jahre. Lichtenberg sollte zahlreiche Texte beisteuern, vor allem Erklärungen zu den Kupferstichen des englischen Künstlers William Hogarth. Im von Dieterich um Zukäufe erweiterten Anwesen wohnten zeitweilig drei englische Prinzen und weitere wohlhabende Studenten mit ihrer Entourage sowie mehrere Hausangestellte im Gartenhaus; zu gewissen Zeiten lebten rund fünfzig Menschen in dem Gebäude. Schreiben und Denken im 18. Jahrhundert war eine alles andere als stille Angelegenheit. Trubel, Gesellschaft, Gemeinschaft – allein schon die im eigenen Haushalt mit Bediensteten und Hilfen – verhinderten den kleinsten Anhauch von Intimität und abgeschirmter Privatsphäre.
Doch etwas schrieb Lichtenberg ganz für sich, seine Gedankenjournale, die der Allzeitspötter als »Sudelbücher« titulierte. Besser gesagt: Er schrieb sie für sein Selbst. Eben dieses Selbst ist der gar nicht so geheime Fluchtpunkt seines gesamten Nachdenkens. In Summa ergibt sich daraus »eine Art von Protokoll des Lichtenberg’schen Bewusstseins« (Rainer Baasner). Auf das Paradoxe hat schon vor mehr als einhundert Jahren der Wiener Kulturhistoriker Egon Friedell hingewiesen, der seinerseits schriftstellerisch eher zu monumentalen, Zivilisationen wie Jahrhunderte übergreifenden Gesamtdarstellungen tendierte. Die Sudelbücher würden, wie er es treffend nannte, »den Charakter unendlicher Ausdehnungsfähigkeit« in sich tragen.
»Spaß und verborgenes Problem, Heiterkeit auf dem Grunde depressiver Ängstlichkeit – einfache Erklärungen sind bei Lichtenberg gefährlich; die Sachen gehen nicht glatt auf bei ihm«, schrieb der lange in Göttingen lehrende Philosoph Günther Patzig. Wieso sollten sie auch? Zu viel interessierte ihn. Viel zu vieles löste Spott und Widerspruch und Kopfschütteln aus, Mokanterie hier, eine durchaus berechtigte pessimistisch grundierte Skepsis angesichts der Gattung Homo sapiens dort. Lichtenbergs Neugier war im Jahrhundert weltweiter Entdeckungen und Umwälzungen – vielleicht die reichste und geistig bewegteste, mit Sicherheit die intellektuell beweglichste Epoche, die Deutschland jemals erlebt hat, wie es der Polyhistor Friedell ausdrückte – buchstäblich global.
Er war Zeitgenosse von James Cook und von George Washington (wobei er die Revolte der überseeischen Kolonisten alles andere als guthieß), von Napoleon Bonaparte, Denis Diderot und Voltaire, von Mozart, Händel, Haydn und Gluck, von Goethe, Immanuel Kant und Carl von Linné, dem Schweden, der Flora und Fauna taxonomisch übersichtlich und bis heute gültig erfasste, von Kaiserin Maria Theresia und König Friedrich II. von Preußen und dem Weltreisenden Georg Forster (den Lichtenberg persönlich kannte) und von Elisabeth Vigée Le Brun, der Pariser Malerin, die im Herbst 1787 mit einem öffentlich gezeigten Porträt noch vor dem Sturm auf die Bastille eine Revolution in Paris und einen Proteststurm auslöste (man sah sie auf dem Bild, einem Doppelporträt von sich und ihrem Kind – lächeln; es war ein Lächeln, bei dem skandalöserweise die Zähne zu sehen waren). Das Rokoko blühte auf und ging wieder ein. Der Genfer Jean-Jacques Rousseau schrieb in einem Nebengebäude des Château de la Chevrette fünfzehn Kilometer nördlich von Paris mit Julie oder Die neue Heloise 1756 bis 1758 den Briefroman der Empfindsamkeit. Dreißig Jahre später reichte Dr. Joseph-Ignace Guillotin einen Antrag auf ein mechanisches Enthauptungsgerät ein, die nach ihm benannte Guillotine. Hegel, Hölderlin und Beethoven, der englische Romantiker William Wordsworth und der preußische Verwaltungsreformer Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein, die Berliner Salonière Rahel Varnhagen und der schottische Romancier Walter Scott waren alle Ende 20, als Lichtenberg im Februar 1799 starb, Franz Schubert war zwei, Heinrich Heine fünfzehn Monate jung.
Lichtenberg interessierte alles. Die Menschen. Die Welt; seine längsten Reisen führten ihn nach London. Sogar Osnabrück (weniger Jena, dem er ein etwas bösartiges Wortspiel widmete). Er war in einer, und zwar in seiner Person das ideale Welt-Publikum: regsam, beweglich, enorm aufgeschlossen, ausprobierend, geschäftig, universal interessiert. Lichtenbergs Neugier, beobachtete der selbst lebenslang Aphorismen schreibende Elias Canetti, war »durch nichts gebunden, sie springt von überall her, auf alles zu.« Denn: »Lichtenberg ist ein Floh mit dem Geist eines Menschen. Er hat diese unvergleichliche Kraft, von sich wegzuspringen.« Und der von Canetti enthusiastisch verehrte Karl Kraus (der mit seiner geologischen Metapher auf Goethes Sentenz anspielte, dass der Aphoristiker des 18. Jahrhunderts als »Wünschelrute« fungieren würde) meinte: »Lichtenberg gräbt tiefer als irgendeiner, aber er kommt nicht wieder hinauf. Er redet unter der Erde. Nur wer selbst tief gräbt, hört ihn.«
Lichtenberg stand nicht im Fokus. Er war ein Fokus, jedoch kein zerstörerisches, versengendes Brennglas. Friedell fand dafür ein geradezu zärtliches Bild – er nannte Lichtenberg ein »Prisma«, ein Prisma, »das das zuströmende Licht seiner Umgebung in die vielfältigsten Farbennuancen auseinanderlegt«. Die Welt in »tausend Heimlichkeiten, Abstrusitäten, Zacken und Zinken«. Sich selbst in tausend Heimlichkeiten, Abstrusitäten, Zacken und Zinken.





























