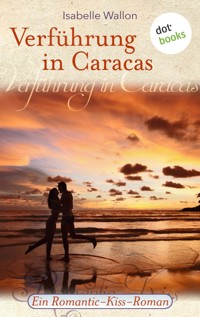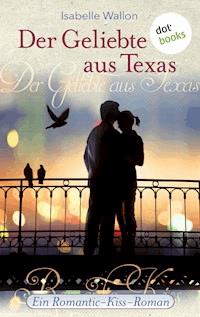Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Sehr romantisch, sehr süß und immer wieder prickelnd: Der Romance-Sammelband »Liebe ist wie Brausepulver« von Isabelle Wallon als eBook bei dotbooks. Fünf Romantik-Highlights in einem eBook – und fünf Männer, die alles daran setzen, die Frauen ihres Lebens zu erobern … Heiraten? Auf gar keinen Fall! Die attraktive Sandy ist entsetzt, als ihre Eltern von ihr verlangen, das Familienunternehmen zu retten, indem sie einem Unbekannten das Ja-Wort gibt. Hals über Kopf flieht sie aus ihrem Goldenen Käfig, um endlich ihre eigenen Träume zu leben. Doch dabei kreuzen ihre Wege die des charismatischen Jim Frazer. Kann er ihr helfen, eine bekannte Sängerin zu werden – oder verfolgt er ganz eigene Pläne? Eine ähnliche Frage muss sich Laura stellen, die eine Reportage über einen ebenso berühmten wie berüchtigten Rennfahrer schreiben soll. Vom ersten Moment an fühlt sie sich magisch zu Frank Kerrigan hingezogen … aber der hat den Ruf, ein skrupelloser Frauenheld zu sein. Meint er es diesmal ernst? Überzeugte Single-Männer, die zum ersten Mal wahre Liebe empfinden, starke Frauen, die es ihnen nicht zu leicht machen wollen, und das Chaos der Gefühle: Genießen Sie die romantischen Liebesromane in diesem Sammelband! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Romantik-Sammelband »Liebe ist wie Brausepulver« von Isabella Wallon für alle Romance-Fans enthält die fünf Liebesromane »Immer, wenn ich von dir träume«, »Der Geliebte aus Texas«, »Halt mich fest in deinen Armen«, »Ein total verrücktes Wochenende« und »Bleib heute Nacht bei mir«. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 865
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Fünf Romantik-Highlights in einem eBook – und fünf Männer, die alles daran setzen, die Frauen ihres Lebens zu erobern … Heiraten? Auf gar keinen Fall! Die attraktive Sandy ist entsetzt, als ihre Eltern von ihr verlangen, das Familienunternehmen zu retten, indem sie einem Unbekannten das Ja-Wort gibt. Hals über Kopf flieht sie aus ihrem Goldenen Käfig, um endlich ihre eigenen Träume zu leben. Doch dabei kreuzen ihre Wege die des charismatischen Jim Frazer. Kann er ihr helfen, eine bekannte Sängerin zu werden – oder verfolgt er ganz eigene Pläne? Eine ähnliche Frage muss sich Laura stellen, die eine Reportage über einen ebenso berühmten wie berüchtigten Rennfahrer schreiben soll. Vom ersten Moment an fühlt sie sich magisch zu Frank Kerrigan hingezogen … aber der hat den Ruf, ein skrupelloser Frauenheld zu sein. Meint er es diesmal ernst?
Überzeugte Single-Männer, die zum ersten Mal wahre Liebe empfinden, starke Frauen, die es ihnen nicht zu leicht machen wollen, und das Chaos der Gefühle: Genießen Sie die romantischen Liebesromane in diesem Sammelband!
Über die Autorin:
Isabelle Wallon, geboren 1957, schreibt seit 20 Jahren Romane in den unterschiedlichsten Genres.
Bei dotbooks veröffentlichte Isabelle Wallon bereits die Romane
»Zu viel Liebe, gibt es das«, »Mit dir in meiner Hängematte«, »Paris-New York mit Turbulenzen« und »Liebe, so stürmisch wie das Meer« – diese vier Romane sind auch als Sammelband mit dem Titel »Liebe ist wie Sommerwind« erhältlich –, »Urlaub – Liebe inbegriffen«, »Traumfrau ohne Trauschein«, »Verführung in Caracas« und »Ein Abenteurer zum Verlieben« – diese vier Romane sind auch als Sammelband mit dem Titel »Liebe ist wie Sonnenschein« erhältlich.
***
eBook-Sammelband-Originalausgabe Juni 2019
Einen Quellennachweis für die in diesem Band vorliegenden Romane finden Sie am Ende dieses eBooks.
Copyright © der Originalausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von Adobe Stock/karandaev
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-819-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Liebe ist wie Brausepulver an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Isabelle Wallon
Liebe ist wie Brausepulver
Fünf romantische Romane in einem eBook
dotbooks.
Immer wenn ich von dir träume
So eine Unverschämtheit! Die temperamentvolle Sandy Ferris ist außer sich vor Wut. Ihre Eltern verlangen, dass sie gegen ihren Willen einen vermögenden Mann heiratet, damit der mit seinem Geld das Familienunternehmen rettet. Auf gar keinen Fall! Hals über Kopf bricht die junge Frau auf, um ihren eigenen Traum zu leben: Sie will als Sängerin berühmt werden. Auf dem Weg nach Nashville lernt Sandy den charismatischen Jim Frazer kennen – und verliebt sich Hals über Kopf. Aber muss sie dafür ihre eigenen Pläne opfern? Oder werden ihre Eltern sie finden und wieder zurück nach Hause holen?
Kapitel 1
»Ich will nicht!«, sagte Sandy Ferris entschlossen und zog einen Flunsch. »Erst recht nicht diesen aufgeblasenen Geldsack Steve Whitcomb!«
»Kind, so darfst du doch von Steve nicht reden«, erwiderte Mrs. Ferris entsetzt und warf ihrem Mann einen hilfesuchenden Blick zu. »Er ist doch ein netter Mann, den wir alle sehr gernhaben.«
»Ihr vielleicht. Aber ich nicht«, antwortete Sandy und schüttelte sich vor Entsetzen, als sie sich vorstellte, Steve heiraten zu müssen. Dabei war er doch fast doppelt so alt wie sie.
»Sandy, jetzt sei bitte nicht so dickköpfig.« Ihr Vater versuchte es im Guten, weil er begriff, wie wenig Sandy der Gedanke gefiel, Steve Whitcomb als Ehemann zu haben. »Du und Steve – ihr beide wart doch schon ab und zu miteinander aus. Mutter und ich hatten den Eindruck, als ob ihr beiden euch ganz gut versteht …«
»Das ist aber nicht so!«, stieß Sandy aufgebracht hervor. »Steve ist nervtötend, altmodisch und überaus langweilig! Eher wandere ich aus auf eine einsame Insel, bevor ich den heirate!«
»Überleg dir das noch einmal, Sandy«, bat ihr Vater sie. »Du weißt doch, wie viel für uns alle davon abhängt. Denk doch auch einmal an Mutter und mich. Steve hat eine gutgehende Firma und würde nicht nur gut für dich sorgen, sondern auch mich finanziell ein wenig unterstützen. Du weißt doch, dass in letzter Zeit die Umsatzzahlen nicht gerade gestiegen sind. Eher das Gegenteil ist der Fall.«
»Du willst doch nicht etwa sagen, dass ich ihn nur deswegen heiraten soll, damit du deine Firma sanieren kannst?« Sandy war jetzt noch entsetzter als zuvor. »Weißt du, wie man ein solches Geschäft bezeichnet? Moderner Sklavenhandel ist das. Und ich bin die heißbegehrte Ware! Vater, schämst du dich eigentlich gar nicht, so etwas von mir zu verlangen? Weißt du nicht, dass du meine Gefühle mit Füßen trittst?«
»Manchmal muss man sich eben arrangieren«, kam Sandys Mutter ihrem Mann zu Hilfe. »Du und Steve – ihr beide habt doch alle Zeit der Welt, um euch in Ruhe kennenzulernen. Es muss ja nicht immer Liebe auf den ersten Blick sein. So etwas muss erst einmal wachsen. Du wirst sehen, dass er ein höflicher und zuvorkommender Mann sein kann …«
»Ich sagte bereits, ich will nicht«, wiederholte Sandy noch einmal. »Für mich ist dieses Thema beendet. Ihr könnt mich nicht zwingen, einen Mann zu heiraten, den ich überhaupt nicht liebe. Erst recht nicht, wenn das schon ein halber Greis ist.«
Ihre Mutter zuckte zusammen. Ihr Vater lag eine heftige Erwiderung auf der Zunge, aber äußern konnte er sie nicht mehr, weil Sandy fortfuhr: »Wenn ihr zu feige seid, um Steve zu sagen, was ich von ihm halte, dann überlasst mir das! Ich habe euch schon hundertmal gesagt, was ich für Zukunftspläne habe. Da ist für eine Ehe überhaupt keine Zeit.«
»Fängst du schon wieder an mit diesen Träumereien, Kind?«, stöhnte Mr. Ferris. »Schlag dir doch endlich diese Flausen aus dem Kopf, Sandy. Mädchen, die von einer Karriere als Sängerin träumen, gibt es wie Sand am Meer. Und du glaubst, dass ausgerechnet du es schaffen kannst?« Er lachte und schüttelte den Kopf. »Nein, Sandy. Das ist doch alles Unsinn.«
»Ein Mädchen wie du sollte heiraten und eine Familie haben«, unterstützte Mrs. Ferris ihren Mann. »Steve hat mir schon anvertraut, wie sehr er sich danach sehnt, mit dir eine Familie zu gründen …«
»Das kann ich mir gut vorstellen«, erwiderte Sandy ironisch. »So wie der mich jedes Mal angeschaut hat, würde der mich doch am liebsten auf der Stelle vernaschen, wenn er nur dürfte. Aber da hat er sich in den Finger geschnitten, und zwar ganz gehörig!«
»Jetzt reicht es aber!« Mr. Ferris schlug mit der Faust so hart auf die Platte des Mahagonitisches, dass die gläserne Karaffe mit dem Bourbon gefährlich ins Wanken geriet. »Sandy, solange du in diesem Haus wohnst, hast du dich gefälligst nach uns zu richten. Du bist noch viel zu jung, um den Ernst des Lebens zu begreifen. Deshalb muss man frühzeitig die Weichen stellen, um dir eine glückliche Zukunft aufzubauen. Hinterher wirst du es uns noch einmal danken, dass du Steve geheiratet hast!«
Sandy hatte genug von diesen Vorhaltungen, die nun schon seit gut zehn Minuten auf sie einprasselten. Sie war fest entschlossen, ihr eigenes Leben zu leben. Und zwar so, wie sie es wollte!
»Bleib hier, Kind!«, rief ihre Mutter, als sie sich zur Tür wandte. »Du kannst doch nicht einfach …«
Den Rest bekam Sandy schon gar nicht mehr mit. Ihr war hundeelend zumute, als sie das Zimmer verließ und die Tür mit einem heftigen Knall zuschlug. Jetzt liefen ihr Tränen die Wangen herunter, während sie unterdrückt aufschluchzte.
Sandy war froh, als sie ihr Zimmer erreicht hatte und die Tür hinter sich schließen konnte.
Unten hörte sie noch ganz schwach die wütende Stimme ihres Vaters, für den jetzt – wie schon so oft – wieder einmal eine Welt zusammengebrochen war. Nur weil etwas nicht nach seinen Vorstellungen ablief.
»Ich werde ihn nicht heiraten«, murmelte Sandy vor sich hin und wischte sich die Tränen ab, nachdem sie sich wieder etwas beruhigt hatte. »Nicht Steve Whitcomb …«
Ihre Blicke schweiften durch das Zimmer und blieben auf der Gitarre hängen, die neben dem Spiegel an der Wand lehnte. Darüber hing ein etwas verblichenes Poster von der Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee.
Sandy begann, mit offenen Augen zu träumen, wie es oft der Fall war, wenn sie sich allein in ihrem Zimmer aufhielt. Automatisch griff sie nach der Gitarre und begann, ein paar Akkorde anzuschlagen. Ihr Blick war auf das Poster gerichtet.
Die Grand Ole Opry in Nashville, das Zentrum der Country-Music … Wie oft hatte sich Sandy schon vorgestellt, dort einmal aufzutreten, zu spielen und zu singen! Es musste ein geradezu unbeschreibliches Gefühl sein, vor Hunderten
von Zuhörern zu stehen …
Sandys Gedanken brachen ab, als sie sich wieder an die hässliche Szene von eben erinnerte. Sie dachte an Steve Whitcomb, der zwar alles andere als gut aussah, dafür in der Geschäftswelt umso erfolgreicher war. Eine Gänsehaut lief über Sandys Rücken, als sie sich vorstellte, dass Steve mit ihr …
»Nein!«, sagte Sandy entschlossen und stellte die Gitarre beiseite. »Nie im Leben!«
Ein plötzlicher Gedanke schoss ihr durch den Kopf, der immer konkretere Formen annahm. Natürlich, das war die Lösung, um sich alldem zu entziehen! Warum hatte sie nicht früher schon an so etwas gedacht? Hatte es denn erst so weit kommen müssen, dass sie aus lauter Verzweiflung keinen anderen Weg mehr sah?
Schritte erklangen draußen auf dem Flur, die vor ihrer Zimmertür stoppten. Sandy sah, wie jemand die Türklinke herunterdrückte. Aber die Tür war verschlossen.
»Sandy, mach auf!«, vernahm sie nun die ungeduldige Stimme ihres Vaters. »Ich muss mit dir reden. Hörst du nicht?«
»Ich möchte allein sein!«, gab Sandy heftig zurück. »Begreife das doch endlich, Dad!«
Mr. Ferris schien aber dafür kein Verständnis zu haben. Im Gegenteil. Er rüttelte noch mehr an der Tür und klopfte jetzt noch einmal.
»Sandy, ich will unbedingt mit dir sprechen! Mit deinem Trotzkopf kommst du bei mir und deiner Mutter nicht durch, das sage ich dir. Von jetzt an werden wir andere Saiten aufziehen. Nur damit du es weißt – Mutter hat gerade Steve angerufen und ihn für morgen Mittag zum Essen eingeladen. Sie hat ihm gesagt, wie sehr du dich über seinen Besuch freust, weil du etwas Wichtiges mit ihm zu bereden hast. Weißt du, was Steve daraufhin geantwortet hat? Dass er sich glücklich schätzt, dich morgen sehen zu dürfen!«
Jedes der Worte ihres Vaters traf Sandy wie ein Hammerschlag. Sie war sprachlos vor Entsetzen, was man da gegen ihren Willen einfädelte. Hatten ihre Eltern denn wirklich kein Verständnis für sie? Ganz bestimmt nicht, sonst würden sie nicht darauf bestehen, dass sie Steve heiratete. Anscheinend hatte nur Sandy bisher bemerkt, welchen Charakter dieser Mann besaß!
Sandy atmete auf, als die Schritte ihres Vaters draußen auf dem Flur verklangen. Offensichtlich hatte er eingesehen, dass heute mit ihr nichts anzufangen war.
Und morgen ist es ohnehin zu spät, dachte Sandy verbittert. Dann bin ich nämlich längst auf und davon!
***
In den unteren Räumen des Hauses war es still geworden. Die Zeiger der Uhr standen auf kurz vor Mitternacht, als Sandy mit ihren Vorbereitungen fertig war. Nachdem sie noch einmal gründlich über alles nachgedacht hatte, war sie zu dem Schluss gekommen, dass es für sie wirklich nur den einen Weg gab, um dieser Misere zu entkommen – sie musste weg von hier, und zwar so schnell wie möglich!
Mit klopfendem Herzen hatte sie abgewartet, bis ihre Eltern zu Bett gegangen waren. Ihre Aufregung legte sich nicht im mindesten, während sie leise zwei Koffer vom Speicher holte. Sandy packte alles ein, was sie benötigte, um sich auf eigene Faust durchschlagen zu können. Noch gestern hätte sie der Gedanke vielleicht erschreckt, von daheim weggehen zu müssen. Aber da war die Situation auch noch nicht so schlimm wie jetzt gewesen.
Daran sind nur meine Eltern schuld, dachte Sandy. Ich lasse mir keinen Ehemann so einfach aufzwingen. So einen wie Steve ganz bestimmt nicht!
Sie atmete auf, als sie mit dem Kofferpacken fertig war. Natürlich durften auch das Poster der Grand Ole Opry und die Gitarre nicht fehlen.
Zum Glück war Sandy erst gestern auf der Bank gewesen und hatte sich Geld geholt, weil sie morgen eigentlich einen ausgedehnten Einkaufsbummel hatte unternehmen wollen. Das fiel nun flach, aber das Geld würde einen anderen guten Zweck erfüllen. Es würde ihr helfen, wenigstens die ersten Tage über die Runden zu kommen. Was dann geschah, würde sich schon irgendwie finden! Darüber machte sich Sandy zunächst überhaupt keine Gedanken.
Sie warf noch einen Blick auf die Uhr, bevor sie nach den beiden Koffern griff und leise das Zimmer verließ. Mit der Gitarre und dem schweren Gepäck war es nicht gerade leicht, unbemerkt aus dem Haus zu kommen. Aber der Gedanke an eine Heirat mit Steve war einfach so schrecklich, dass Sandy es tatsächlich schaffte, fast geräuschlos die Treppe hinunterzuschleichen.
Ihr Herz pochte wie wild, als sie endlich das Ende der Stufen erreicht hatte. Die Haustür lag greifbar nahe. In wenigen Augenblicken würde sie es hinter sich haben. Dann brauchte sie nur noch über das Grundstück zu gehen, hinüber zu den Garagen, die ein wenig abseits hinter einer Hecke lagen. Das war jetzt bestimmt von Vorteil. Denn auf diese Weise bekamen ihre Eltern nicht mit, wie sie in ihren Wagen stieg und davonfuhr. Die beiden hatten ohnehin einen tiefen und ruhigen Schlaf …
Als Sandy einen der Koffer absetzen und ihre Hand nach dem Griff der Haustür ausstrecken wollte, übersah sie die Blumenvase auf dem Tisch neben der Tür. Die Vase mitsamt den Blumen geriet ins Wanken und polterte auf den Boden. Zwar dämpfte der Teppich das Geräusch, aber in der Stille der Nacht kam es Sandy trotzdem vor wie eine Explosion. Sie wurde kreidebleich und blickte ängstlich zu dem Flur hinüber, der zum Schlafzimmer ihrer Eltern führte. Sie erwartete, dass jeden Augenblick das Licht anging und ihr Vater in der Tür stand.
Aber nichts geschah. Es blieb alles dunkel und still. Sandy atmete auf, als sie weiterging und schließlich die Haustür öffnete. Geräuschlos schloss sie die Tür hinter sich und lief zu den Garagen hinüber.
Sandy wischte sich den Schweiß von der Stirn, als sie endlich die schweren Koffer auf den Rücksitz ihres Wagens hieven und auch die Gitarre ablegen konnte. Alles Weitere war jetzt ein Kinderspiel.
Das Tor der Garage ließ Sandy offen, nachdem sie den Motor des kleinen Ford gestartet hatte und hinausgefahren war. Sie wollte nur noch eins: so schnell wie möglich weg von hier.
Als sie vom Grundstück fuhr, blickte sie noch ein letztes Mal zum Haus ihrer Eltern zurück, das auch jetzt noch im Dunkeln lag. Schon ein seltsames Gefühl, wenn man einfach über Nacht abhaut, dachte Sandy. Aber sie sind schuld daran, dass es so weit kommen musste, und nicht ich!
Sie beschloss, die düsteren Gedanken zu vertreiben, und konzentrierte sich auf das, was vor ihr lag.
Nashville, ich komme, dachte Sandy, als der Strahl der Autoscheinwerfer das graue Asphaltband der Landstraße erfasste.
Boston lag schon drei Stunden hinter Sandy, als hinter den Hügeln die erste matte Helligkeit der bevorstehenden Morgendämmerung auftauchte. Sandy hatte im Autoradio einen lokalen Sender eingestellt, der Country-Music brachte. Vergnügt summte sie Bobby Bares »Five hundred miles away from home« vor sich hin und dachte dabei an das entsetzte Gesicht von Steve Whitcomb, wenn er zu Besuch kam und Sandy nicht antraf.
Die letzten Schatten der Nacht wichen allmählich den Strahlen der aufgehenden Sonne. Sandy sah das graue Band des Highways 75 umso deutlicher, je heller es wurde. Auch zu dieser frühen Stunde herrschte schon ein ziemlicher Betrieb. Riesige Trucks mit bunten Aufliegern und chromblitzenden Stoßstangen zogen an ihr vorbei, immer weiter in Richtung Südosten.
Sandy steuerte geradewegs auf die Bundesgrenze von Philadelphia zu, die sie in zwei weiteren Stunden zu erreichen hoffte. Dort würde der Verkehr vermutlich wieder etwas nachlassen, so dass es zügiger voranging. Wenn alles klappte, dann konnte sie schon am Abend in Nashville sein, dem Ziel ihrer Träume.
Komisch, welche Wege manchmal das Schicksal geht, dachte Sandy und strich sich eine Strähne ihres blonden Haares aus der Stirn. Dass ich so schnell einmal dazu komme, Nashville zu sehen, hätte ich auch nicht gedacht.
Ab und zu warf sie einen Blick auf die Straßenkarte auf dem Beifahrersitz. Schließlich musste sie sich davon überzeugen, dass sie auch die Abzweigung nicht verpasste, wo der Highway 45 in den Highway 75 einmündete.
Genau in diesem Augenblick fing der Ford an, zu rucken und zu stottern. Sandy erschrak, weil ihr mit Schrecken einfiel, was der Mann in der Werkstatt erst letzte Woche zu ihr gesagt hatte, als sie den Wagen zur Reparatur gebracht hatte.
»Kaufen Sie sich lieber einen anderen Wagen, Miss«, hatte er gemeint. »Der hier macht es nicht mehr lange. Der Motor hat schon zu viel auf dem Buckel …«
Ausgerechnet jetzt schienen sich die Worte des Automechanikers zu bewahrheiten. Wo sie Pannen und Verzögerungen ganz gewiss nicht brauchen konnte! Schließlich wollte sie doch so schnell wie nur möglich nach Nashville!
Dem Ford schien Sandys Vorhaben aber vollkommen egal zu sein. Das Rucken und Stottern verstärkte sich sogar noch, und die Tachonadel sank. Sandy seufzte, als sie den Blinker betätigte und den Ford nach rechts an den Straßenrand manövrierte. Zum Glück war ein kleiner Parkplatz gut einhundert Yards weiter vorn, und Sandy betete, dass die Kiste es bis dahin schaffte.
Kurz vor dem Parkplatz gab der Wagen dann endgültig seinen Geist auf. Der Motor erstarb mit einem blubbernden Geräusch. Zum Glück hatte Sandy noch so viel Fahrt drauf, dass sie es schaffte, den Ford von der Straße zu lenken und auf dem Parkplatz zum Stehen zu bringen.
Nun war guter Rat aber wirklich teuer. Da stand sie nun etliche Meilen weit weg von zu Hause, mit einem Motorschaden. Wie sollte es jetzt weitergehen?
Sandy stieg aus. Vorsichtig öffnete sie die Motorhaube und stellte wieder einmal fest, was für eine Unmenge an Drähten, Kabeln und sonstigen Einzelteilen sich darunter befanden.
Jemand muss mir helfen, schoss es ihr durch den Kopf. Das ist doch eine gut befahrene Straße. Irgendeiner wird schon anhalten und mir sagen können, was die verflixte Kiste hat!
Das war leichter gesagt als getan. Von der sprichwörtlichen Freundlichkeit der Partner im Straßenverkehr bemerkte Sandy in diesen Minuten reichlich wenig. Jeder schien es eilig zu haben und brauste mit einem Affenzahn weiter.
Sandy hob zwar beide Hände und winkte heftig, aber das schien jeder zu übersehen. Resignierend kehrte Sandy schließlich zu ihrem Wagen zurück und nahm sich noch einmal die Straßenkarte vor. Sie wollte nachsehen, wie weit es zum nächsten Truck Stop war. Als sie jedoch feststellen musste, dass er gut vierzig Meilen entfernt war, stöhnte sie innerlich auf. Das dauerte ja einen ganzen Tag, wenn sie die Strecke zu Fuß zurücklegen sollte!
Sandy legte die Karte beiseite und wollte gerade wieder aussteigen, als ihr im Rückspiegel ein kleiner Bus auffiel, der den Blinker betätigte und nach rechts zum Parkplatz ausscherte. Gott sei Dank, dachte Sandy erleichtert. Wenigstens einer hält an, um zu helfen!
Sie schlug die Wagentür zu und blickte dem näher kommenden Bus entgegen. Erst jetzt fielen ihr die farbigen Schriftzüge auf der Seite des Busses auf. Sandy musste blinzeln, weil sie direkt in die Sonne schaute. Sie hob die Hand, um sich vor dem grellen Licht zu schützen, und erkannte jetzt die Schriftzüge: JIM FRAZER stand da.
Diesen Namen kannte sie doch! War das nicht der bekannte Country-Sänger, der seit gut einem Jahr in den Hitparaden von Nashville stand? Und jetzt führte ihn der Zufall hierher …
Sandy spürte, dass sie ein wenig unsicher wurde, denn sie kannte die ganzen Stars schließlich nur vom Radio und den CDs her. Und von diversen Clips bei YouTube. Dass sie einmal einem davon höchstpersönlich begegnen würde, das hatte sie sich nicht erträumt.
Der Bus kam zum Stehen. Die Türen öffneten sich, und Sandy hörte jetzt Gelächter von drinnen, gemischt mit dem Klimpern von Banjo und Gitarre. Dort herrschte wohl eine recht ausgelassene Stimmung.
Egal, dachte Sandy und fasste sich ein Herz. Selbst wenn der Präsident mit seinem kompletten Stab hier vorbeigekommen wäre, so hätte sie ihn um Hilfe gebeten. Schließlich war die nächste Ansiedlung meilenweit entfernt, und Sandy hatte keine Lust, hier Wurzeln zu schlagen.
Ein bärtiger Bursche mit einem zerknautschten Stetson tauchte in der Tür des Busses auf und musterte Sandy grinsend von Kopf bis Fuß.
»Gott sei Dank«, rief Sandy ihm erleichtert zu. »Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie sehnlich ich darauf gewartet habe, dass endlich mal jemand anhält. Können Sie vielleicht einmal nach meinem Wagen sehen? Er springt nicht mehr an, und …«
Statt Sandy zu antworten, drehte sich der Bärtige um. »Das Mädchen hat Probleme mit dem Wagen, Jim!«, rief er. »Ich seh mal kurz nach …«
Sandy bemühte sich, einen Blick in das Innere des Busses zu werfen, konnte aber nichts sehen. Die Scheiben waren rundum getönt und ließen keinen Einblick zu. Natürlich konnten die Insassen aber Sandy sehen und amüsierten sich wahrscheinlich über ihre Hilflosigkeit.
Hauptsache, er hilft mir, dachte sie seufzend und sah zu, wie der Bärtige aus dem Bus stieg. Hauptsache, es kam jemand und schaute mal nach ihrem Wagen.
»Es ist der Ford dort drüben«, sagte Sandy überflüssigerweise zu dem hünenhaften Burschen, der sie irgendwie an einen Wiederkäuer erinnerte. Er wälzte nämlich seinen Kaugummi von einem Mundwinkel in den anderen. »Der Motor fing ganz plötzlich an, zu stottern und zu rucken«, fuhr sie fort. »Und jetzt gibt er keinen Mucks mehr von sich …«
»Wollen mal sehen«, sagte der Bärtige und öffnete die Motorhaube. Sein Grinsen erlosch, als er sich den Motorblock anschaute und anschließend den Ölstand überprüfte.
»Meine Güte!«, stöhnte er dann. »Das ist ja noch schlimmer, als ich vermutet hatte.« Er schaute Sandy vorwurfsvoll an. »Wissen Sie eigentlich, dass da kein Tropfen Öl mehr drin ist? Lady, die Kolben haben sich festgefressen! Der Wagen ist schrottreif. Am besten lassen Sie ihn abschleppen.«
»Das darf doch nicht wahr sein!«, entfuhr es Sandy, die ihren Traum von einer baldigen Ankunft in Nashville zusammenfallen sah wie ein Kartenhaus. »Und wie komme ich jetzt weiter?«
Der Bärtige schlug die Motorhaube wieder zu und zuckte mit den Schultern.
»Kommt drauf an, wo Sie hinwollen, Lady.«
»Nach Nashville, Mister. Ich muss dringend nach Nashville, und das so schnell wie möglich. Können Sie nicht, ich meine …« Sie brach ab, weil sie nicht so recht wusste, wie sie ihre Bitte in Worte kleiden sollte. Aber der Bärtige hatte schon begriffen.
»Eigentlich sind wir ja keine öffentliche Buslinie«, meinte er grinsend. »Aber ich werd mal kurz mit Jim reden und ihn fragen, ob wir noch Platz für einen Fahrgast haben. Vielleicht sagt er ja …«
»Jim Frazer?«, hakte Sandy neugierig nach. »Ist das wirklich der Jim Frazer?«
»Na klar, Lady«, gab der Bärtige zurück. »Was ist nun? Soll ich Jim fragen oder nicht?«
»Natürlich«, sagte Sandy sofort und ging mit ihm zum Bus. Der Mann deutete ihr an, draußen stehen zu bleiben. Offensichtlich war es eine Art Privileg, diesen Bus betreten zu dürfen.
Na schön, wenn das so ist, warte ich eben geduldig hier draußen, sagte sich Sandy. Obwohl sie sehr gespannt darauf war, diesen Jim Frazer persönlich kennenzulernen.
Es dauerte einige Minuten, bis der Bärtige wieder in der Tür auftauchte.
»Jim sagt, Sie können mitkommen«, erklärte er zu Sandys großer Erleichterung. »Schnappen Sie sich Ihr Gepäck, und steigen Sie ein. Beeilen Sie sich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit!«
Rüpel, dachte Sandy im Stillen, rannte dann aber doch zu ihrem Wagen. In Windeseile schnappte sie sich die beiden Koffer samt der Gitarre und ging dann zum Bus zurück. Für einen Moment blieben ihre Blicke ein wenig wehmütig auf dem Ford haften, der ihr so lange treu gedient hatte. Nun war er wirklich schrottreif.
»Da bin ich!«, sagte Sandy, als sie wieder vor der Bustür stand und den Bärtigen ansah. »Wenn es Ihre Höflichkeit zulässt, Mister, wäre ich Ihnen überaus dankbar, wenn Sie mir helfen würden, die Koffer hochzuheben.«
»Nun hilf ihr schon, Bud!«, erklang eine sonore Stimme aus dem Bus.
Der Bärtige murmelte etwas vor sich hin, was Sandy nicht verstand, aber er half ihr dann doch mit den Koffern und schleppte sie in den Bus. Sandy folgte mit heftigem Herzklopfen.
Kapitel 2
»Hallo, schöne Frau!«
Sandy hob den Kopf und blickte in das braungebrannte Gesicht eines Mannes in einem kunstvoll bestickten Hemd. Er hielt eine Gibson-Gitarre in den Händen und hatte wohl gerade einige Akkorde gespielt, als Sandy hereingekommen war. Er hatte dunkelblonde Haare und sah phantastisch aus.
»Mr. Frazer?«, fragte Sandy mit etwas unsicherer Stimme, weil sie von den übrigen Leuten im Bus gemustert wurde.
»Ich bin Jim Frazer«, sagte der gutaussehende Mann. »Nun kommen Sie doch endlich, und setzen Sie sich irgendwohin, damit wir losfahren können. Sonst kommen wir zu spät nach Nashville …«
»Ich heiße Sandy Ferris, Mr. Frazer«, sagte sie. »Ich bin Ihnen wirklich überaus dankbar, dass Sie mich mitnehmen. Ich will nämlich auch nach Nashville.«
»Soso«, meinte Jim Frazer und schaute kurz auf die Gitarre, die Sandy bei sich hatte. »Lassen Sie mich doch mal raten, was Sie in Nashville wollen. Einen Job als Sekretärin suchen Sie bestimmt nicht, habe ich recht?«
Schmunzeln breitete sich auf den Gesichtern der Bandmitglieder aus. Sandy spürte, dass Frazer sie aufziehen wollte, beschloss jedoch, nicht darauf zu reagieren. Dieser Bursche glaubte wohl, dass er sie ärgern konnte!
»Wozu braucht eine Sekretärin eine Gitarre, Mr. Frazer?«, gab sie prompt zurück. »Ich benutze dieses Instrument nicht nur als Schmuckstück, sondern weiß sogar, wie man damit umgeht. Stellen Sie sich das mal vor!«
Für einen winzigen Moment weiteten sich Jim Frazers Augen, weil er mit einer solch kessen Antwort nicht gerechnet hatte. Die Bandmitglieder tuschelten untereinander, während Jim Frazer wieder Sandy anschaute.
»Okay, Miss«, sagte er. »Dann zeigen Sie uns doch mal, was Sie so alles können. Wir sind schon sehr gespannt darauf …«
Von euch lasse ich mich nicht unterkriegen, dachte Sandy und nahm ihre Gitarre zur Hand, während der Bus langsam den Parkplatz verließ und sich wieder in den Verkehr einfädelte. Das nahm Sandy jedoch alles nur am Rande wahr.
Wahrscheinlich glaubten Jim Frazer und seine Band, dass sie nur große Töne gespuckt hatte und gar nicht gut spielen konnte. Sandy wollte sie eines Besseren belehren!
»Was soll ich singen?«, fragte sie und blickte erwartungsvoll in die Runde. »Hat jemand einen bestimmten Wunsch?«
»Wie wär’s denn mit ›San Antonio Rose‹?«, schlug Jim Frazer vor, nachdem keiner geantwortet hatte. »Das kennen Sie doch, oder?«
Die letzte Frage war vollkommen unnötig, aber Sandy beschloss, sich jetzt ganz auf ihr Spiel zu konzentrieren, und antwortete nicht. Sekunden später legte sie los. Mit klarer, hübscher Stimme sang sie den bekannten Song, der viele Jahrzehnte früher von Bob Wills und seinen Texas Playboys aufgenommen worden war.
Das Stimmengemurmel im Bus erstarb. Jeder hörte ihr zu, und allmählich verschwanden die spöttischen Blicke und wandelten sich in lebhaftes Interesse. Einer der Männer griff sich jetzt seine Gitarre und begleitete Sandy spontan zu ihrem Song. Ihr Herz schlug unwillkürlich höher. Sie sang strahlend weiter, bis schließlich die ganze Band in das Lied einstimmte.
Sandy wiederholte den Refrain und beendete ihre Darbietung mit einem kurzen Nachspiel auf der Gitarre.
Ein paar Sekunden blieb es still im Bus, bis schließlich alle Beifall klatschten und anerkennend pfiffen.
»Verdammt!«, rief Jim Frazer. »Das hätte ich nicht erwartet. Die Lady ist ja wirklich gut, Jungs.«
Er drehte sich zu seinen Bandmitgliedern um und erntete Zustimmung. Anschließend wandte er sich wieder an Sandy.
»Herzlich willkommen bei der Jim-Frazer-Band, Sandy.« Er lächelte. »Machen Sie es sich irgendwo gemütlich. Es ist noch ein langer Weg bis nach Nashville …«
Täuschte sie sich, oder hatte Sandy für ein paar Sekunden wirklich so etwas wie ein sehr offensichtlich männliches Interesse in seinen Augen bemerkt?
Sie ließ sich auf einem der Sitze nieder, während ein Mann von der Band ihr eine Büchse Bier in die Hand drückte. Draußen war die Sonne allmählich höhergestiegen, aber im Bus merkte man nicht viel davon, denn er war vollklimatisiert.
Nur kurz dachte Sandy an ihre Eltern daheim. Aber alles, was ihr gestern noch das Herz schwergemacht hatte, gehörte für sie bereits der Vergangenheit an. Auf jeden Fall hatte sie erreicht, was sie wollte – sie war auf dem Weg nach Nashville.
***
»Warum ist Sandy noch nicht auf?«, erkundigte sich Mr. Ferris bei seiner Frau. »Was ist das überhaupt für eine Art! Ein so junges Mädchen – und schläft bis mittags. Sie weiß doch, dass Steve jeden Moment kommen wird. Patty, würdest du bitte nach oben gehen und sie wecken? Ich habe keine Lust, den Tag mit einem Streit zu beginnen …«
Mrs. Ferris nickte stumm und ging nach oben. Sonst war Sandy eigentlich immer recht früh auf den Beinen. Aber ihre Mutter konnte sich vorstellen, dass Sandy heute ihren Dickkopf durchsetzen wollte, weil Steve zum Essen kam.
»Sandy!« Ihre Mutter klopfte an die Zimmertür und lauschte. »Es ist Zeit zum Aufstehen! Komm, beeile dich. Steve muss jeden Moment eintreffen …«
Im Zimmer blieb es still. Mrs. Ferris runzelte die Stirn. Ob sie vielleicht nicht laut genug geklopft hatte? Sie verstärkte ihre Bemühungen, bekam aber immer noch keine Antwort. Alarmiert drückte Mrs. Ferris die Türklinke nach unten und entdeckte zu ihrem Erstaunen, dass die Tür überhaupt nicht verschlossen war.
»Sandy, nun aber raus aus dem Bett!«, rief sie. Dann erstarben ihr alle weiteren Worte, denn sie sah, dass das Bett leer, ja noch nicht einmal benutzt worden war.
Pat Ferris’ Blick schweifte zum Kleiderschrank hinüber, der weit offen stand. Mrs. Ferris brauchte nicht lange, um zu erkennen, was hier vorgefallen war. Es fehlten Kleider, T-Shirts und vieles andere auch, ebenso die Gitarre und das Poster.
»Das darf doch nicht wahr sein!«, entfuhr es der entsetzten Mrs. Ferris. »Bill!«, rief sie dann mit lauter Stimme. »Um Gottes willen, Bill, komm sofort herauf!«
Polternde Schritte erklangen auf der Treppe. Sandys Vater kam angelaufen.
»Sieh dir das an, Bill!«, sagte seine Frau und wies auf den halbleeren Kleiderschrank. »Bill, unsere Tochter ist weg! Mein Gott, was sollen wir denn jetzt nur tun?«
»Jetzt reg dich doch nicht gleich so auf«, versuchte Mr. Ferris, seine Frau zu beruhigen. »Vielleicht ist Sandy ja schon früher als wir aufgestanden. Sie ist vielleicht noch einmal kurz in die Stadt gefahren.«
»Bill, siehst du denn nicht, was hier alles fehlt? Der halbe Kleiderschrank ist ausgeräumt, und die Gitarre mit dem Poster ist auch nicht mehr da. Willst du mir einreden, dass Sandy das alles zum Einkaufen mitgenommen hat?«
»Aber wo, um Himmels willen, ist sie denn hin?«, meinte Mr. Ferris, auf dessen Gesicht sich totale Hilflosigkeit ausbreitete. »Patty, unsere Tochter kann doch nicht einfach davonlaufen? Hier hat sie doch alles, was sie …«
»Bill, was sagen wir nur Steve?«, unterbrach ihn Mrs. Ferris jammernd. »Mein Gott, ich bringe es einfach nicht übers Herz, ihm die Wahrheit zu gestehen.«
»Uns wird aber nichts anderes übrigbleiben«, antwortete Mr. Ferris, als er in der Ferne Motorengeräusch vernahm, das sich der Villa näherte. Augenblicke später fuhr ein schwarzer Mercedes auf das Grundstück, den Sandys Eltern nur zu gut kannten – er gehörte Steve Whitcomb.
»Überlasse das Reden jetzt mir«, sagte Bill Ferris zu seiner Frau, die ziemlich aufgelöst wirkte. »Alles Weitere wird sich dann schon finden …«
Das war aber leichter gesagt als getan. Schließlich kannte Bill Ferris Steve Whitcomb. In Steves Augen war die Ehe mit Sandy schon so gut wie perfekt gewesen. Und nun das!
Steve wird entsetzt sein, wenn er von Sandys Verschwinden erfährt, dachte Mr. Ferris und legte sich schon eine Erklärung zurecht, wie er das seinem zukünftigen Schwiegersohn begreiflich machen konnte. Auf jeden Fall so, dass dieser nicht gleich die Konsequenzen zog. Dann wäre nicht nur die Heirat in die Brüche gegangen, sondern auch die finanzielle Hilfe, die sich Sandys Vater für seine eigene Firma von Steve Whitcomb erhoffte!
Steve Whitcomb brachte seinen schwarzen Mercedes mit quietschenden Reifen direkt vor der Haustür der Villa zum Stehen. Dann stieg er aus und setzte sein freundlichstes Lächeln auf. Da Sandy auf ihn wartete, wollte er sich heute von seiner besten Seite zeigen.
Steve Whitcomb war das, was man landläufig einen alternden Playboy nennt. Trotz seiner 45 Jahre hatte er seine schlanke Figur behalten. Die Haare waren an den Schläfen bereits grau, was ihn für einige Damen sehr interessant machte. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass dies vor allen Dingen bei Sandy der Fall gewesen wäre. Denn irgendwie hatte Steve den Eindruck, dass sie ihm gegenüber immer ziemlich zurückhaltend war.
Wir werden sehen, dachte der erfolgreiche Geschäftsmann und sah, wie sich die Haustür öffnete. Bill Ferris kam ihm entgegen und schien vor Freude förmlich überzuquellen. Im Grunde genommen wirkte das ziemlich lächerlich auf Whitcomb, weil er natürlich wusste, warum sich Ferris so sehr um ihn bemühte. Hauptsächlich deswegen, weil es um Ferris’ Firma alles andere als gut bestellt war. Schlechtes Management und falsche Planung, wie es hieß.
Whitcomb gab nicht viel auf Gerüchte, sondern hielt sich lieber an Tatsachen. Wenn er Sandy heiratete und dafür in Kauf nehmen musste, dass die Firma seines zukünftigen Schwiegervaters eine kräftige Dollarspritze benötigte, dann würde er dazu bereit sein. Hauptsache, er bekam Sandy als Frau. Ihre blonden Haare, die unergründlich tiefen Augen und die Figur, die eine Sünde wert war – all das hatte Steve veranlasst, sich um sie zu bemühen. Und bis jetzt hatte er den Eindruck gehabt, dass er sich durchaus Hoffnungen machen konnte.
»Mein lieber Steve!« Die Stimme von Sandys Vater riss ihn aus seinen Gedanken. Mr. Ferris kam auf ihn zu, um ihm die Hand zu schütteln. »Wie schön, dass Sie die Zeit finden konnten, um unsere Einladung anzunehmen. Kommen Sie doch bitte herein!«
»Wo ist denn Sandy?«, fragte Whitcomb.
»Lassen Sie uns darüber im Haus reden«, wich Mr. Ferris aus und machte einen seltsam nervösen Eindruck, was Whitcomb natürlich nicht entging.
Da stimmt doch irgendetwas nicht, dachte er, fragte aber nichts. Er folgte Ferris ins Haus, wo er im Wohnzimmer höflich von Mrs. Ferris begrüßt wurde. Nur Sandy war nirgendwo zu sehen.
»Ist Sandy noch in ihrem Zimmer?«, fragte Whitcomb nun doch. »Ich würde sie gern sehen. Ich habe ihr nämlich eine kleine Aufmerksamkeit mitgebracht …«
Er griff in die Tasche seines Jacketts und holte eine kleine Schachtel heraus. Was darin war, konnten ihre Eltern ahnen. Sicherlich Schmuck!
»Ein Diamantencollier – gewissermaßen zu unserer Verlobung, die ja nun bald stattfinden wird«; erklärte Whitcomb Sandys Eltern. »Sandy soll gleich merken, dass mir für sie nichts zu teuer ist …«
Er brach ab, als er den verstörten Gesichtsausdruck von Bill Ferris bemerkte.
»Ist etwas, Mr. Ferris?«, fragte er.
»Nun ja …« Sandys Vater geriet ins Stottern. »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das klarmachen soll, Steve. Sandy ist … äh … sie ist nicht da.«
»Dann wird sie doch sicherlich bald wiederkommen, oder?«, hakte Whitcomb sofort nach und bemühte sich, sich seine Enttäuschung nicht ansehen zu lassen. »Schließlich weiß sie doch, dass ich heute zu Besuch komme?«
»Schon«, erwiderte Mr. Ferris. »Steve, ich fürchte, ich habe eine Nachricht für Sie, die Ihnen nicht ganz gefallen wird. Bitte glauben Sie mir, dass mir die Sache äußerst peinlich ist. Gern sage ich Ihnen das wahrhaftig nicht.«
»Nun reden Sie nicht um den heißen Brei herum«, forderte ihn Whitcomb ungeduldig auf. »Wo steckt Sandy?«
»Genau das wissen wir eben nicht«, entgegnete Mrs. Ferris, um ihrem Mann zu helfen. »Heute Morgen war sie nicht in ihrem Zimmer. Die Koffer sind auch weg. Steve, mir ist klar, wie entsetzt Sie jetzt sein müssen – aber Sandy ist davongelaufen. Wir wissen nicht, wo sie sich aufhält.«
»Das ist doch wohl ein schlechter Scherz?«, entfuhr es Whitcomb. »Sandy kann doch nicht einfach Hals über Kopf verschwinden? Warum denn nur?«
»Wir hatten gestern Abend ein etwas hitziges Streitgespräch«, berichtete Sandys Vater. »Sandy hat ja schon immer einen ziemlichen Dickkopf gehabt und begreift auch jetzt noch nicht den Ernst des Lebens. Steve, die Sache ist mir mehr als peinlich, aber wir nehmen an, dass sie davongelaufen ist, um nach Nashville zu gehen …«
»Nach Nashville?«, japste Whitcomb. »Jetzt sagen Sie nur noch, sie hat sich vorgenommen, das wahr zu machen, wovon sie schon so lange geredet hat?«
»Wahrscheinlich«, meldete sich Sandys Mutter wieder zu Wort. »Ihre Gitarre hat sie auch mitgenommen. Es tut mir sehr leid, dass es so weit gekommen ist, Steve. Wir persönlich haben nichts gegen Sie, und das wissen Sie auch. Wir sind bestrebt, die Sache zu bereinigen. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich Sandy im Augenblick aufhält. Wahrscheinlich irgendwo auf einem der zahlreichen Highways in Richtung Süden. Mein Gott, ich mache mir Sorgen um das Kind.«
»Sie können natürlich auf meine Hilfe zählen«, bot Whitcomb den besorgten Eltern an, nachdem er sich scheinbar wieder halbwegs beruhigt hatte. Innerlich aber kochte er vor Wut darüber, dass ein Mann wie er wohl offensichtlich nicht gut genug für Sandy war. Sonst wäre sie doch nie von daheim weggelaufen. Jede andere Frau wäre froh gewesen, wenn sie ihn hätte heiraten können.
Steve Whitcomb war ein Mann, der keine Niederlage hinnehmen wollte. Und da es schon mehr oder weniger bekannt war, dass er in absehbarer Zeit zu heiraten gedachte, würde er ziemlich blamiert dastehen, wenn sich erst herumsprach, dass seine zukünftige Frau verschwunden war. Dann würde man hinter seinem Rücken lachen und sich darüber großartig amüsieren.
»Was wollen Sie unternehmen, Steve?«, fragte Mr. Ferris.
»Geben Sie mir bitte das Kennzeichen von Sandys Wagen, und überlassen Sie den Rest mir«, schlug Whitcomb vor. »Ich habe so meine Methoden, die bis jetzt immer zum Erfolg geführt haben. Ich verspreche Ihnen, dass Sandy schon bald wieder zu Hause sein wird. Und wenn ich etwas verspreche, dann halte ich das auch!«
Das trug er so überzeugend vor, dass Mr. und Mrs. Ferris erleichtert aufatmeten. Steve Whitcomb war in ihren Augen ein dynamischer Unternehmer, der sicherlich gut für Sandy sorgen würde, wenn er erst mit ihr verheiratet war.
Das werde ich dir schon heimzahlen, Mädchen, dachte Whitcomb. Wir beide werden noch ein intensives Gespräch unter vier Augen führen, wenn ich dich erst einmal wiedergefunden habe. Und dann wirst du keine Dummheiten mehr machen.
»Wir sind Ihnen ja so dankbar«, sagte Mrs. Ferris und lächelte ihren zukünftigen Schwiegersohn an. »Hoffentlich wendet sich noch alles zum Guten.«
»Das wird es, ganz bestimmt sogar«, versprach Whitcomb.
***
»Sie sind ein Naturtalent, wussten Sie das eigentlich?«, fragte Jim Frazer aus ehrlicher Überzeugung. Er hatte sich nämlich ein zweites Mal davon überzeugen können, dass Sandy wirklich hervorragend singen und spielen konnte. »Wo haben Sie das eigentlich gelernt?«
Sandy musste unwillkürlich lächeln. »Ich habe mir das alles selbst beigebracht«, antwortete sie zu Jims großem Erstaunen. »Ich habe schon immer davon geträumt, einmal nach Nashville zu kommen und dort zu singen. Jetzt ist das endlich der Fall, wenn auch …« Sie brach ab, weil sie nicht darüber reden wollte, welche Umstände eigentlich zu ihrer Reise geführt hatten.
»Wen kennen Sie denn in Nashville?«, fragte Jim, dem aufgefallen war, dass es da etwas gab, über das Sandy offensichtlich nicht reden wollte. »Ich meine, an wen wollen Sie sich wenden, wenn wir erst dort sind?«
Sandy zuckte mit den Schultern, weil sie darauf keine Antwort wusste.
»Mädchen, können Sie sich denn nicht denken, wie es im Musikgeschäft zugeht?«, hakte Jim nach. »Glauben Sie wirklich daran, dass ausgerechnet Sie von einem einflussreichen Produzenten entdeckt werden? Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich das jetzt sage, aber hoffnungsvolle Talente gibt es …«
»… wie Sand am Meer«, vollendete Sandy seinen Satz. »Das weiß ich auch, Mr. Frazer. Mir ist klar, dass ohne Beziehungen so gut wie nichts läuft. Aber ich gehöre nicht zu den Mädchen, die ihre Karriere übers Bett machen wollen.«
»Nun regen Sie sich doch nicht gleich auf«, erwiderte Jim hastig. »Ich mache mir doch nur Sorgen um Sie. Wenn wir in Nashville sind, dann stehen Sie doch auf der Straße, oder?«
»Und wenn es so wäre?«, gab Sandy trotzig zurück, weil sie von ihm nicht bemitleidet werden wollte. »Ich werde mich schon irgendwie durchschlagen.«
»Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag«, meinte Jim. »Was halten Sie davon, wenn ich Sie für meine Truppe engagiere? Ich brauche immer jemanden, der sich ein wenig um den organisatorischen Kram kümmert. Und in der Zwischenzeit haben Sie jede Menge Gelegenheit, so oft zu spielen, wie Sie wollen. Vielleicht ergibt sich ja auch die Chance, ab und zu mal in der Band einzuspringen …«
»Unter welcher Bedingung?«, fragte Sandy misstrauisch, weil sie sich einfach nicht vorstellen konnte, dass so ein berühmter Star wie Jim Frazer ihr aus purer Uneigennützigkeit helfen wollte. »Mr. Frazer, ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich will nicht, dass Sie …«
»Jetzt aber mal langsam, Lady«, fiel Jim ihr ins Wort, weil er ahnte, worauf Sandy wieder hinauswollte. »Dieses Angebot können Sie sich in Ruhe überlegen, bis wir in Nashville sind. Ich stelle keine Bedingungen, sondern es war rein freundschaftlich gemeint. Sie müssen es nicht annehmen …«
Ein Blick in seine Augen zeigte Sandy, dass Jim Frazer keine zweideutigen Absichten mit seinem Vorschlag verfolgte. Und eigentlich war es ein sehr guter Vorschlag gewesen. Ein Mann wie Jim Frazer kannte sich in der Szene von Nashville bestimmt gut aus. Wenn Sandy also eine Zeitlang mit der Band und ihm auf Tournee ging, dann ergaben sich mit der Zeit ganz bestimmt gute Kontakte, die sie nutzen konnte.
»Ich zahle Ihnen zweihundert Dollar in der Woche«, fuhr Jim fort, als er merkte, dass Sandy an seinem Angebot interessiert war. »Na, was halten Sie davon?«
»Klingt akzeptabel«, antwortete Sandy. »Okay, ich bin mit von der Partie …«
»Habt ihr das mitbekommen, Jungs?«, rief Jim nach hinten. »Wir haben ein neues Mitglied in der Crew. Sandy geht von heute an mit auf Tournee.«
»Das ist wirklich ein Grund zum Feiern!«, rief der Bärtige, den Sandy schon kennengelernt hatte. »Darauf trinken wir einen, Leute!«
Bierdosen machten die Runde, und Sandy musste mit jedem anstoßen. Insgeheim zweifelte sie jedoch noch ein wenig an der ganzen Sache. Für ihren Geschmack war das alles etwas zu glattgegangen. Ob Jim Frazer ihr wirklich helfen wollte? Oder verfolgte er vielleicht doch ganz andere Absichten?
Schließlich las man in den einschlägigen Zeitungen so manches über das wilde Privatleben einiger Stars. Ob Jim Frazer vielleicht auch zu diesen Menschen gehörte? Dann musste sie sich gewaltig in Acht nehmen. In seinem Bett landen würde sie jedenfalls nicht – das hatte Sandy sich geschworen!
***
»Nur noch drei Meilen bis Nashville«, rief der Mann hinter dem Steuer dem Rest der Truppe zu.
Am rechten Straßenrand tauchten jetzt auch schon die ersten Hinweisschilder auf einige Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt der Country Music auf.
Sandy schaute aus dem Fenster und erhaschte einen Blick auf eine Anzeigentafel, die Reklame für die berühmte Grand Ole Opry machte. Sandys Herz schlug unwillkürlich schneller, als sie das las. Es war schon immer ihr Traum gewesen, dort auftreten zu dürfen. Vielleicht wurde dieser Wunsch noch eher Wirklichkeit, als sie je vermutet hätte.
Aufgeregt beobachtete Sandy, wie der Bus wenig später den Highway verließ und dann weiter in Richtung City fuhr. Eine gute Viertelstunde später hielt der Bus dann auf dem Parkplatz des Hyatt Regency Hotels.
»Da wären wir endlich«, sagte Jim zu Sandy, um sie ein wenig aufzumuntern. »Wird Zeit, dass wir endlich mal zur Ruhe kommen. Schließlich gibt es noch alle Hände voll zu tun bis zum Konzert morgen Abend … Kommen Sie.« Er griff nach ihrer Hand. »Steigen wir aus.«
In dem Augenblick, als Jims Fingerspitzen Sandys Haut berührten, fühlte sie, wie ein Stromschlag durch ihren ganzen Körper ging und sie zum Zittern brachte. Aber als er ihre Hand gleich darauf wieder losließ, war dieses Gefühl auch schon wieder vorbei.
Sandy schüttelte den Kopf. Wieso machte dieser Jim Frazer einen solch verwirrenden Eindruck auf sie? Eigentlich unbegreiflich …
Sandy fühlte, wie sie von einigen Hotelgästen neugierig gemustert wurde. Natürlich fiel es auf, wenn die ganze Truppe eines Sängers im Hotel abstieg, sogar an der Rezeption, wo der Angestellte große Augen machte, als er Jim auf sich zukommen sah.
»Willkommen im Hyatt Regency, Mr. Frazer!« Der Empfangschef überschlug sich beinahe vor Freundlichkeit. »Unser Hotel ist stolz darauf, Sie in unseren Räumen begrüßen zu können. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise.«
»Das war alles okay«, gab Jim zurück. »Unsere Zimmer sind reserviert? Wir brauchen zehn Zimmer!« Dann fiel ihm ein, dass Sandy ja auch noch da war. »Nein, elf Zimmer …«
Der Angestellte hatte schon in seinen Unterlagen nachgesehen und blickte jetzt überrascht hoch.
»Verzeihen Sie bitte, Mr. Frazer, aber mir liegt nur eine Vorausbuchung über zehn Zimmer vor. Von einem elften wurde mir überhaupt nichts mitgeteilt.«
»Das ist schon in Ordnung«, erklärte Jim und wies auf Sandy. »Unsere Truppe hat unterwegs noch Verstärkung bekommen in Gestalt dieser reizenden Lady hier. Es macht Ihnen doch nichts aus, ein weiteres Zimmer zur Verfügung zu stellen, oder?«
»Normalerweise nicht, Mr. Frazer«, antwortete der Hotelangestellte. »Aber unglücklicherweise sind wir für den Rest der Woche total ausgebucht. Sie wissen ja, wegen Ihres Konzerts.«
»Sie haben wirklich kein Zimmer mehr frei?«, versuchte es Jim noch einmal und zog einen Geldschein aus seiner Tasche. »Können Sie nicht noch einmal nachsehen?«
»Ich würde Ihnen gerne helfen, Sir«, antwortete der Mann an der Rezeption. »Aber wir sind wirklich voll bis unters Dach. Ich bedauere, Ihnen das mitteilen zu müssen. Es ist kein Zimmer mehr frei …«
Sandy blickte ein wenig enttäuscht drein, als sie das hörte. Jetzt war guter Rat wirklich teuer. Wahrscheinlich schien Jim ihre Gedanken zu ahnen, denn er wandte sich ihr zu.
»Nun ja, das war wirklich nicht eingeplant«, versuchte er, sie zu trösten. »Aber ich wüsste vielleicht eine Lösung, wie Sie trotzdem hier übernachten könnten …«
»Da bin ich aber gespannt«, meinte Sandy. »Wie sollte das denn möglich sein?«
»Ganz einfach.« Jim schmunzelte. »Man reserviert hier immer eine recht geräumige Suite für mich. Da könnte ich Sie ohne weiteres noch unterbringen. Sie werden sehen, dass …«
Weiter kam er nicht, denn Sandys Augen blitzten wütend auf. »Jetzt ist mir die Sache klar!«, erwiderte sie scharf. »Wenn Sie darauf aus sind, dann vergessen Sie das am besten gleich wieder. Ich glaube, ich hab Ihnen schon einmal klar und deutlich zu verstehen gegeben, was ich von solchen Abenteuern halte. Nämlich nicht so viel!« Sie schnippte mit den Fingern, um ihre Worte noch zu verdeutlichen.
»Sandy, nun explodieren Sie doch nicht gleich!«, bat Jim. »Lassen Sie mich doch erst einmal ausreden, und hören Sie mir genau zu, ja? Wenn ich mich falsch ausgedrückt haben sollte, dann tut mir das leid. Ich meinte nur, dass Platz genug für Sie in der Suite ist. Ich überlasse Ihnen sogar mein Bett und werde in einem anderen Raum auf der Couch schlafen, falls Sie das beruhigt. Na, was halten Sie davon?«
»Keine Tricks?«, fragte Sandy, immer noch ein wenig misstrauisch. »Kann ich mich darauf verlassen?«
»Großes Ehrenwort«, antwortete Jim und hob beide Hände. »Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie in meiner Suite ruhig und tief schlafen werden. An mir soll es jedenfalls nicht liegen.«
»Na gut«, willigte Sandy schließlich ein, nachdem sie mit einem kurzen Seitenblick festgestellt hatte, dass sich draußen am Himmel dunkle Wolken zusammenballten. Es sah ganz nach Regen aus. Die Sonne war von einem Augenblick zum anderen verschwunden. Bestimmt dauerte es nicht lange, bis der Himmel seine Schleusen öffnete. Und bei diesem Wetter Ausschau nach einer Bleibe zu halten, war nicht gerade verlockend.
»Gut, dann ist das ja geklärt«, meinte Jim und teilte dem Portier mit, dass er sich wegen der zusätzlichen Person keine Sorgen mehr zu machen brauchte. Anschließend wurden die üblichen Anmeldeformalitäten erledigt. Dann erschienen zwei Hotelboys, die sich um das Gepäck der Truppe kümmerten.
»Wenn ich also bitten darf …« Jim lächelte Sandy zu und wies zum Fahrstuhl. »Am besten inspizieren wir erst einmal das Zimmer, damit Sie beruhigt sind.«
In der Tat war das auch Sandys Wunsch. Trotzdem blieb dieses merkwürdige Gefühl der Unsicherheit, das sie jedes Mal ergriff, wenn sie Jim in die Augen schaute. Und ausgerechnet mit ihm musste sie das Zimmer teilen! Hoffentlich brachte das wirklich keine Probleme mit sich.
Kapitel 3
Jim und Sandy fuhren mit dem Lift zur siebten Etage. Ihr Gepäck hatte man schon hinaufgebracht; es wartete bereits im Zimmer auf sie.
»Bitte, treten Sie näher«, bat Jim lächelnd und deutete sogar eine kleine Verbeugung an. Er trat zur Seite, weil er wollte, dass Sandy zuerst die Suite betrat. Sie nickte und ging voran.
Gleich darauf konnte sie sich davon überzeugen, dass Jim mit seiner Schilderung nicht übertrieben hatte. Die Suite war nicht nur groß, sondern geradezu riesig für normale Verhältnisse. Es gab zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Sicherlich kostete dieser Luxus ein Heidengeld. Aber ein erfolgreicher Sänger wie Jim Frazer konnte sich so etwas leisten, ohne sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie viel das kostete. Seine Erfolge hatten ihn längst zu einem reichen Mann gemacht.
»Na, sind Sie zufrieden?«, fragte Jim und wies auf eines der beiden Schlafzimmer. »Jeder von uns hat doch hier genügend Platz, um ungestört die Nacht verbringen zu können.«
»Sie haben recht«, meinte Sandy und spürte, wie sich die Anspannung in ihr endlich legte. Denn mit einem so gutaussehenden Mann wie Jim die Nacht in einem Hotelzimmer zu verbringen – das konnte eine Menge Probleme mit sich bringen. Sandy war heilfroh, dass dies nun nicht der Fall sein würde.
»Die Jungs treffen sich nachher noch einmal unten in der Bar zu einem Drink«, sagte Jim. »Was halten Sie davon, wenn wir beide uns anschließen?«
»Keine schlechte Idee«, antwortete Sandy. »Aber zuerst möchte ich einmal eine Dusche nehmen. Die Fahrt hierher war ganz schön anstrengend.«
Sie blickte sich suchend um und hielt Ausschau nach dem Badezimmer. Jim wies lächelnd auf eine Tür neben dem Schlafzimmer.
»Geben Sie mir Ihr großes Ehrenwort, dass Sie nicht reinkommen, wenn ich unter der Dusche stehe?«, fragte Sandy, um noch einmal sicherzugehen.
»Ihr Wunsch ist mir Befehl«, sagte Jim. »Das Bad gehört Ihnen. In der Zwischenzeit mixe ich uns zwei Drinks, einverstanden?«
Sandy nickte und verschwand. Eigentlich war Jim ein Mann, dem man glauben konnte, was er sagte. Trotzdem, entschied Sandy. Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Deshalb schloss sie die Tür hinter sich ab, um ganz sicherzugehen. Erst jetzt wagte sie, Bluse und Jeans auszuziehen, gefolgt von BH und Slip, bis sie ganz nackt war.
Sie stellte sich unter die Dusche und drehte den Wasserhahn auf. Warmes Wasser prasselte auf ihren Körper. Es war eine Wohltat, sich endlich den Staub und Schweiß der langen Reise abspülen zu können. Sandy griff nach der Seife und duschte sich gründlich von Kopf bis Fuß.
In diesem Augenblick fiel ihr ein, dass sie vergessen hatte, das Shampoo mit ins Bad zu nehmen, weil sie sich eigentlich die Haare hatte waschen wollen. Nun war guter Rat teuer. Ihre Haare waren mittlerweile völlig nass, und sie brauchte das Shampoo dringend.
Was blieb ihr anderes übrig, als Jim um Hilfe zu bitten? Sandy drehte den Wasserhahn zu und stieg aus der Kabine. Wasser tropfte auf den Boden und bildete sofort eine kleine Lache, während sie nach dem Handtuch griff und es sich vor den Körper hielt.
»Mr. Frazer!«, rief sie so laut, dass er es eigentlich hören musste. »Können Sie mir vielleicht … ich meine … ach, verdammter Mist auch!«
»Was ist denn los, Sandy?«, hörte sie Jim rufen. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Das Shampoo!«, gab Sandy zurück. »Ich habe vergessen, es ins Bad mitzunehmen. Können Sie es mir bitte bringen? Es befindet sich in dem hellen Lederkoffer. Eine grüne Flasche!«
»Natürlich«, antwortete er von draußen. »Einen Augenblick. Bin schon unterwegs …«
Trotzdem vergingen einige Minuten, bis er vor der Tür zum Badezimmer stand.
»Sandy, Sie müssen schon aufmachen, wenn ich Ihnen das Shampoo geben soll. Unter der Tür durchschieben lässt sich die Flasche nicht.«
»Sofort!«, erwiderte Sandy und suchte krampfhaft nach einer Möglichkeit, das Handtuch so um ihren Körper zu schlingen, dass Jim möglichst wenig von ihr zu sehen bekam, wenn sie die Tür einen Spaltbreit öffnete und das Shampoo entgegennahm. Aber sie konnte sich drehen und wenden, wie sie wollte – das Handtuch war einfach zu kurz. Von Sandys langen schlanken Beinen war immer noch eine Menge zu sehen.
Sandy seufzte innerlich auf, als sie die Tür aufschloss und die Klinke herunterdrückte. Langsam und vorsichtig öffnete sie die Tür und streckte ihren Arm nach draußen.
»Keine Angst, ich beiße nicht«, vernahm sie Jims amüsierte Stimme. »Sandy, nun stellen Sie sich doch nicht so an!«
»Geben Sie mir das Shampoo, bitte!«, verlangte Sandy. »Und drehen Sie sich gefälligst um, Mr. Frazer!«
Sie öffnete die Tür noch weiter und schaffte es irgendwie, die Flasche mit dem Shampoo an sich zu nehmen. Allerdings machte sich gerade in diesem Augenblick das Handtuch selbständig, das Sandy notdürftig um den Körper geschlungen hatte.
Der Knoten löste sich, und das Tuch war schon halb über ihre Brüste gerutscht, als Sandy es bemerkte. Mit einem erschrockenen Schrei versuchte sie, das Missgeschick aufzuhalten, aber vergeblich.
Unglücklicherweise waren ihre Bewegungen so hastig, dass sie dadurch die Tür noch weiter aufstieß, so dass Jim nun all das sehen konnte, was Sandy eigentlich vor seinen Blicken hatte verbergen wollen.
Hastig trippelte sie zur Dusche zurück, um sich hinter dem Vorhang in Sicherheit zu bringen. Unglücklicherweise vergaß sie das Stück Seife, das ihr vorhin auf den Boden gefallen war. Sandy berührte es mit dem rechten Fuß und durfte sich eine Sekunde später davon überzeugen, dass ein Stück Seife manchmal zur reinsten Rutschbahn werden kann, wenn man nicht aufpasst.
»Hilfe!«, schrie Sandy und ruderte wild mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten. Trotzdem wäre ihr das nicht gelungen, wenn sie nicht im letzten Augenblick von starken Armen aufgefangen worden wäre.
Jim war es, der ihr rasch zu Hilfe gekommen war und nun die nackte und immer noch tropfnasse Sandy aufgefangen hatte und festhielt.
»Lassen Sie mich sofort los!«, rief Sandy entsetzt. »Hören Sie nicht? Sie sollen mich loslassen, Sie Rüpel!«
»Selbstverständlich, Lady«, antwortete Jim und tat abrupt, worum Sandy ihn gebeten hatte. Das hatte zur Folge, dass sie mit einem satten Plumpsen auf dem Boden der Duschkabine landete.
»Was fällt Ihnen ein, Sie unverschämter Kerl?«, schimpfte sie.
»Sie wollten doch losgelassen werden, oder?«, verteidigte sich Jim. »Und jetzt stehen Sie endlich auf, ich will Ihnen doch nur helfen …«
Bevor Sandy etwas erwidern konnte, hatte er sie hochgezogen und griff mit der anderen Hand nach dem Handtuch, das sich in der ganzen Hektik selbständig gemacht hatte. Sandy zitterte ein wenig, weil sie nackt und hilflos vor Jim stand und nicht wusste, wie sie sich nun verhalten sollte.
Gleichzeitig gewahrte sie das Leuchten in seinen Augen, das sie förmlich elektrisierte, während sie Jims Hand auf ihrer Haut spürte.
Um Himmels willen, nur das nicht, dachte Sandy verzweifelt und suchte fieberhaft nach einem Ausweg aus dieser heiklen Situation.
»Ganz ruhig, ich bin ja bei Ihnen«, flüsterte Jim dicht neben ihrem Ohr und legte ihr das Handtuch um die Schultern. Dann begann er, sanft ihren Rücken zu massieren.
Im ersten Augenblick wollte sich Sandy dagegen sträuben, spürte aber rasch, wie gut ihr diese Massage tat.
»Was soll das, Jim?«, fragte sie trotzdem nervös, als sie merkte, dass seine Finger allmählich tiefer glitten. »Hören Sie, ich …«
Sie brach ab, weil sie seine Hände plötzlich auf ihren Brüsten spürte, die sie sanft umschlossen.
»Du bist eine schöne Frau, Sandy«, flüsterte Jim. »Weißt du, dass du mich ganz verrückt machst?«
Sie spürte seine Lippen auf ihrem Hals, fühlte den Schauer, der ihren Körper erfasste und sie zittern ließ. Er verstärkte sich noch, als Jim sie küsste.
Nein, dachte Sandy. Das ist doch total verrückt! Ich will das nicht. Mein Gott, ich …
Sie schloss die Augen, drehte sich zu Jim um und erwiderte seinen Kuss voller Leidenschaft. Sie dachte nicht mehr daran, dass sie genau das eigentlich hatte um jeden Preis verhindern wollen. Aber in dem Augenblick, als Jims Hände sie berührt hatten, war es um sie geschehen gewesen!
Endlose Augenblicke vergingen, bis sich Jims Lippen wieder von Sandys lösten. Sie öffnete die Augen und spürte, wie heftig ihr Herz pochte.
»Oh, Jim«, murmelte sie. »Ich …«
»Sprich jetzt nicht«, flüsterte er und verschloss ihr den Mund mit einem zweiten Kuss, der all das beinhaltete, was er für sie empfand. Gleichzeitig spürte Sandy, wie Jim sie hochhob und aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer hinübertrug. Dort legte er sie aufs Bett, nackt und nass, wie sie war, und zog sich dann ebenfalls in Windeseile aus.
Sandy sah seine Erregung und das leidenschaftliche Feuer in seinen Augen, und ihr letzter Widerstand schmolz.
»Jim«, murmelte sie und blickte ihn sehnsüchtig an. Sie glühte förmlich, als sie ihm die Arme entgegenstreckte, um ihn zu sich aufs Bett zu ziehen.
Jim legte sich zu ihr und fuhr fort, sie zu streicheln, während er sie ununterbrochen küsste.
Sandy schloss die Augen und genoss es, wie seine Zungenspitze ihre Brüste umkreiste. Die Warzen richteten sich sofort steil auf. Gleichzeitig tasteten Sandys Hände nach seinem Körper, berührten ihn, erforschten ihn …
Jims Zunge glitt tiefer, hinunter zu der feuchten Wärme ihres Schoßes. Als er dort sein Liebesspiel fortsetzte, glaubte Sandy fast wahnsinnig zu werden. Ein Stöhnen entrang sich ihrer Kehle. Sandy spürte, wie die Wellen der Lust über ihr zusammenzuschlagen drohten, aber sie wollte dieses Gefühl noch so lange wie möglich auskosten. Deshalb schob sie Jim von sich und umfasste ihn gleich darauf mit ihren Armen wieder, um ihn zu sich hochzuziehen.
Jim begriff und beugte sich über sie. Ganz vorsichtig drang er in ihre feuchte Wärme ein, als habe er Angst, ihr weh zu tun. Sandy hob sich ihm entgegen, um ihn ganz tief in sich aufzunehmen. Sie schlang die Arme um seinen Nacken, zog ihn ganz eng an sich.
Jim steigerte allmählich seinen Rhythmus. Er bewegte sich immer schneller und heftiger in ihr. Sandy warf den Kopf hin und her und verkrallte die Hände in seinem Haar. Ein Zittern überlief ihren Körper.
»Ja«, keuchte sie. »Ja, ja …«
Sie drängte sich noch fester an ihn und ließ ihr Becken kreisen.
»Jetzt, Jim!«, rief sie, als sie spürte, dass sie sich nicht länger zurückhalten konnte. »Jetzt, ja …«
Sie brach ab, als der Höhepunkt kam und Jim sich gleichzeitig mit zuckenden Bewegungen in ihr verströmte. Sie schrie laut auf, als sie mit ihm kam, und zog ihn an sich.
Jim blieb in ihr, genoss die Wärme, die ihn vollkommen umschloss. Wieder suchte er ihre Lippen und küsste sie zärtlich.
»Ich liebe dich, Sandy«; hörte sie ihn flüstern. »Mein Gott, wie ich dich liebe …«
»Wir müssen verrückt sein«, murmelte Sandy nach einer endlosen Weile des Schweigens. Sie hatten sich angesehen, erkannten die Liebe in den Augen des anderen, hielten sich fest, um den Körper des Partners zu spüren. »Jim, ich weiß einfach nicht, was …«
»Bereust du es etwa?«, fragte Jim lächelnd und beugte sich über sie, um ihre Augen zu küssen. »Sandy, es hat einfach so kommen müssen. Es … ja, es war Schicksal.«
»Vielleicht hast du recht«, erwiderte sie. »Mein Gott, so schön wie mit dir habe ich es noch nie empfunden. Es ist, als wenn mein Leben von heute an neu beginnen würde. Lach nicht, ich meine das ernst …«
»Sandy, über so etwas lacht man nicht.« Jim strich ihr durch das wellige Haar. »Vor allen Dingen dann nicht, wenn es die Wahrheit ist. Darling, ich glaube, ich habe mich unsterblich in dich verliebt. Dem Himmel sei Dank, dass wir auf diesem Parkplatz angehalten haben. Sonst hätten wir uns nie kennengelernt.«