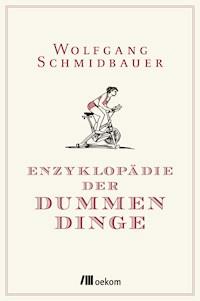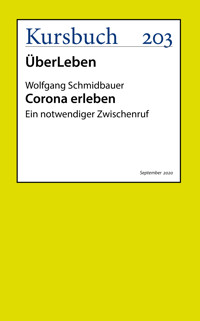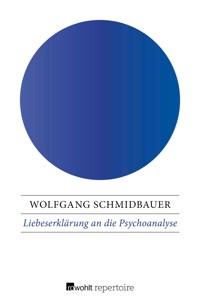
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Ein Wort wie ‹Liebeserklärung› nimmt sich merkwürdig aus im Titel eines Buches, das Vorgehensweise und Ergebnisse der Psychoanalyse darstellt. Aber die Psychoanalyse hat im Laufe ihrer Geschichte so viel gehässige Ablehnung auf sich gezogen, daß ich einmal herausstellen möchte, was an ihr anziehend und liebenswert ist ... Die amerikanische Forscherin Nancy Chodorow erkennt die ‹weiblichen› Qualitäten der Psychoanalyse, ‹den Anspruch ... Wissenschaft und Kunst zu sein, eine sozusagen sanfte Wissenschaft, die den provisorischen Charakter von Interpretationen betont, den Schwerpunkt auf Gefühle und eine zwischenmenschliche Interaktion› legt. Heute vielleicht noch mehr als zu Beginn meiner Tätigkeit zieht mich diese einzigartige Verbindung von Wissenschaft und Kunst so an, daß ich gerade wegen meiner langen Erfahrung in diesem Beruf eine Liebeserklärung an die Psychoanalyse geschrieben habe.» (Aus dem Vorwort)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Wolfgang Schmidbauer
Liebeserklärung an die Psychoanalyse
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Ein Wort wie ‹Liebeserklärung› nimmt sich merkwürdig aus im Titel eines Buches, das Vorgehensweise und Ergebnisse der Psychoanalyse darstellt. Aber die Psychoanalyse hat im Laufe ihrer Geschichte so viel gehässige Ablehnung auf sich gezogen, daß ich einmal herausstellen möchte, was an ihr anziehend und liebenswert ist ...
Die amerikanische Forscherin Nancy Chodorow erkennt die ‹weiblichen› Qualitäten der Psychoanalyse, ‹den Anspruch ... Wissenschaft und Kunst zu sein, eine sozusagen sanfte Wissenschaft, die den provisorischen Charakter von Interpretationen betont, den Schwerpunkt auf Gefühle und eine zwischenmenschliche Interaktion› legt.
Heute vielleicht noch mehr als zu Beginn meiner Tätigkeit zieht mich diese einzigartige Verbindung von Wissenschaft und Kunst so an, daß ich gerade wegen meiner langen Erfahrung in diesem Beruf eine Liebeserklärung an die Psychoanalyse geschrieben habe.»
Aus dem Vorwort
Über Wolfgang Schmidbauer
Wolfgang Schmidbauer, geboren 1941 in München, studierte Psychologie und promovierte 1968 über «Mythos und Psychologie». Tätigkeit als freier Schriftsteller in Deutschland und Italien. Ausbildung zum Psychoanalytiker. Gründung eines Instituts für analytische Gruppendynamik. 1985 Gastprofessor für Psychoanalyse an der Gesamthochschule Kassel; Psychotherapeut und Lehranalytiker in München.
Er ist außerdem Autor zahlreicher Bücher; im Rowohlt Verlag erschienen: «Die Kentaurin», «Wenn Helfer Fehler machen », «Eine Kindheit in Niederbayern», «Mit dem Moped nach Ravenna»,«Ein Haus in der Toscana», «Psychologie. Lexikon der Grundbegriffe», «Alles oder nichts», «Weniger ist manchmal mehr», «Helfen als Beruf», «Hilflose Helfer», «Kein Glück mit Männern», «Jetzt haben, später zahlen», «Die Angst vor Nähe», «Du verstehst mich nicht».
Inhaltsübersicht
Vorwort
Ein Wort wie «Liebeserklärung» nimmt sich merkwürdig aus im Titel eines Buches, das Vorgehensweise und Ergebnisse der Psychoanalyse darstellen soll. Wenn ich dennoch an diesem Titel festgehalten habe, gibt es dafür verschiedene Gründe. Einer ist gewiß die Suche nach Alternativen zum Wort-Einheitsgrau der Einführungen und Grundrisse, in das solche Texte oft gekleidet sind. In unserer Zeit werden «Sachbücher» und «wirkliche Literatur» auseinandergehalten. Die Darstellung von Inhalten und das Interesse für die poetische Metapher sind in verschiedenen Abteilungen der Buchfabriken zu Hause. Viele Kritiker und Verleger haben zur Sachliteratur dasselbe Verhältnis, wie es ein Rosenzüchter zu dem Kohlfeld haben mag, mit dessen Ertrag er sein feinsinniges Steckenpferd füttert.
Die Psychoanalyse hat im Lauf ihrer Geschichte so viel gehässige Ablehnung auf sich gezogen, daß es mir sinnvoll erschien, einmal darzustellen, was an ihr anziehend und liebenswert ist. Diese Haltung ist durchaus mit dem Auftrag vereinbar, möglichst genau und objektiv zu bleiben. Der 1985 verstorbene Ethnologe Georges Devereux[*] hat beschrieben, wie eng Forschungsergebnisse und Gefühlslage des Wissenschaftlers zusammenhängen. Verzerrungen lassen sich nicht dadurch vermeiden, daß man solche Einflüsse von Wunsch und Abwehr verleugnet. Sie verschwinden eher, sobald sie in eine Darstellung einbezogen und möglichst transparent gemacht werden.
Wir sind von einem wachsenden Zynismus umgeben. Sämtliche Autoritäten laufen Gefahr, ihren Kredit zu verlieren, politische, wissenschaftliche, Künstler und Philosophen. Diese Abnützungserscheinungen hängen mit dem Mißerfolg und dem Mißbrauch der Autorität zusammen. Zu lange und zu oft hat sich erwiesen, daß Technik und Wissenschaft den Menschen in kleinen Zusammenhängen ein wenig mehr Sicherheit und Glück gewähren, aber eine insgesamt gefährliche, zunehmend bedrohliche Entwicklung nicht beherrschen und nicht vermeiden können. Es scheint mir eine sinnvolle Anpassung an diese Situation, die persönliche Interessenlage als eine Gestalt des «subjektiven Faktors» aller Fachleute zu erfragen. Ein akademischer Titel garantiert heute allenfalls einen bestimmten Stil der Argumentation, aber keineswegs Objektivität, wenn es beispielsweise um Fragen der atomaren Energie oder der Umweltbelastung durch Chemikalien geht. Kritische Bürger haben inzwischen gelernt, daß ein Experte glaubwürdiger wird, wenn er seine persönliche Position einbezieht und darstellt. Wer sie verschleiert und sich den Anschein unantastbarer Objektivität, unbestechlicher Urteilskraft gibt, hat oft etwas zu verstecken. Die am lautesten ihre eigene Wissenschaftlichkeit beteuern und die Unwissenschaftlichkeit ihrer Gegner benennen, haben daran meist ein verborgenes Interesse.
So gibt es hinsichtlich der therapeutischen Wirkung einer Psychoanalyse wissenschaftliche Arbeiten, die sie beweisen und solche, die sie widerlegen. In dieser Situation kommt man um die Frage nicht mehr herum, was denn nun aus welchen Motiven heraus bewiesen werden soll. Roger Brown und Richard J. Herrnstein haben in ihrem 1984 übersetzten Lehrbuch[*] diesen Weg eingeschlagen. In einer auch heute noch oft zitierten Kritik der Psychoanalyse[*] hat Hans Jürgen Eysenck behauptet, sie erreiche trotz jahrelanger, kostspieliger Arbeit nicht einmal die Erfolgsquote der spontan auftretenden Heilungen. Kurzum: wer leidet, soll lieber warten, als sich auf die Couch zu legen. Ein anderer Forscher, A.E. Bergin, überprüfte die Studien, die Eysenck diesem Urteil zugrunde gelegt hatte. Neben schlichten Rechenfehlern fand Bergin vor allem, daß Eysenck systematisch die Urteile über den Erfolg von Psychoanalyse sehr streng definiert hatte, während er in der Tabellierung der Spontanheilung äußerst großzügig war. Die beiden Harvard-Forscher fassen zusammen:
«Insgesamt gelangt Bergin … zu einer Besserungsrate von 83 % für die psychoanalytischen Daten und von 65 % für die eklektische Psychotherapie. Hinsichtlich der Zahlen für die eklektische Psychotherapie gibt es zwischen Bergin und Eysenck also fast völlige Übereinstimmung, während nur bei den Zahlen für die Psychoanalyse eine starke Diskrepanz vorliegt. [Eysenck hatte nur 44 % der Psychoanalyse-Patienten als gebessert beurteilt. Beide Forscher, Bergin wie Eysenck, verarbeiteten Daten verschiedener klinischer Studien. W.S.] Das kann einen fast glauben machen, Eysenck habe sich durch eine besondere Feindseligkeit gegenüber der Psychoanalyse zur Unfairness verleiten lassen. Was uns zu der Annahme bringt, daß Bergin der Wahrheit näherkommt als Eysenck, ist vor allem seine Weigerung, irgendeine Polemik auszuspielen, auch weckt die vollständige Wiedergabe einiger Originaldaten und die explizite Darlegung seiner Annahmen Vertrauen.»
Wohlgemerkt: Bergin ist kein Psychoanalytiker, sondern Verhaltenstherapeut. Die Häufigkeit spontaner Genesungen schätzt er übrigens aufgrund eines weit reicheren Datenmaterials als Eysenck auf 30 Prozent, nicht auf rund 60 Prozent.
Die Frage «Wirkt Psychoanalyse oder wirkt sie nicht?» ist inzwischen überholt. Sie wirkt, aber es ist ungeheuer schwer, vergleichbare Daten zu finden. Eine «spontane» Erholung, die man ihren Einflüssen gegenüberstellen könnte, ist fiktiv. Neben den berufsmäßigen Helfern für seelische Schwierigkeiten gibt es zahlreiche, wirkungsvolle «private» Einflußnahmen – Freundschaften, Reisen, berufliche Veränderungen. Sinnvoller wäre eine Frage wie: Unter welchen Umständen kann dieser besondere Analytiker diesem Patienten nützen?
Ich hoffe, daß der Leser aus diesem Buch Ansätze gewinnen kann, solche Fragen für sich zu beantworten. Die Psychoanalyse ist keine Naturwissenschaft im üblichen Sinn. In ihr geht es nicht um Ereignisse, die unabhängig von den beteiligten Personen «objektiviert» werden können. Daß solche Forschungsansätze dort, wo es um Gefühlsbeziehungen und zwischenmenschlichen Kontakt geht, ihre Grenzen finden, gehört zu ihren Resultaten. Wir erleben andere innerseelische Prozesse, wenn wir einem Computer oder einem lebendigen Menschen gegenübersitzen. Teile einer Person, die für sich nicht lebensfähig sind, zum Beispiel die Zusammensetzung eines Blutstropfens oder die Struktur eines Gewebeschnitts, kann der Computer so gut analysieren wie ein menschlicher Forscher. Aber die ganze Person sprengt diesen Rahmen. Um sich zu öffnen, um sein Inneres der Forschung zugänglich zu machen, braucht ein Mensch Qualitäten wie Vertrauen und das Gefühl, ein interessiertes, engagiertes Gegenüber zu haben.
Die Psychoanalyse versucht, solche Tatsachen zu benennen und sie möglichst gründlich kennenzulernen, sie sozusagen nicht im Kleingedruckten zu verstecken.
Ein Buch über Psychoanalyse sollte von den menschlichen Bedürfnissen ausgehen, die in ihr Gestalt annehmen. Die Theorie ist wenig einheitlich, widerspruchsvoll, ein Gemisch aus Modellvorstellungen und Tatsachenbeschreibungen. Dennoch wird sie vielen praktischen Anforderungen in dem zwischenmenschlichen Unternehmen einer Psychoanalyse gerecht. Sie ist nicht vollkommen, aber unersetzlich. Auf die Differenzierungsmöglichkeiten der psychoanalytischen Forschung können wir nicht verzichten, wenn ein Phänomen wie die «Psychoszene» nicht abgewertet, sondern verstanden werden soll. Genaue Kenntnisse schützen wirksamer vor schädlichen Folgen einer Psychotherapie als undifferenzierte Ablehnung, verbunden mit offenen oder versteckten Hinweisen, die alten medizinischen und pastoralen Autoritäten seien doch die besseren gewesen.[*] Der Therapiekritiker (und das sollte jeder nachdenkliche Therapeut auch sein!) gerät rasch in Gefahr, Beifall von der falschen Seite zu erhalten. «Das haben wir früher auch nicht gebraucht! Verweichlichung!»
Die amerikanische Psychoanalytikerin Phyllis Greenacre beschreibt die Verbindung von Naturwissenschaft und Kunst, die sie in der psychoanalytischen Praxis findet. Die psychoanalytische Situation ist ein vielschichtiges Geschehen, in dem die Wahrnehmungen des Analytikers von allem mitbestimmt werden, was ihn während des Prozesses bewegt. Viel davon kann, etwa durch ein Tonbandprotokoll, nicht erfaßt werden. «In diesem Sinn kann der Analytiker mit dem Künstler verglichen werden, dessen Wahrnehmungen durch eine subtile ständige Interaktion zwischen der eigenen Person (körperliche Reaktionen eingeschlossen) und dem, was er in der äußeren Welt erlebt, bestimmt sind.»[*] Nancy Julia Chodorow sieht in solchen Äußerungen einen Hinweis auf «weibliche» Qualitäten der Psychoanalyse: «den Anspruch … Wissenschaft und Kunst zu sein, eine sozusagen sanfte Wissenschaft, die den provisorischen Charakter von Interpretationen betont; den Schwerpunkt auf Gefühlen und einer zwischenmenschlichen Interaktion; die Notwendigkeit, den Wissenschaftler in die Untersuchung mit einzubeziehen.»[*]
Warum sollte ein Mann einer solchen Wissenschaft nicht mit einer Liebeserklärung begegnen?
W.S.
Einleitung
Seit es die Psychoanalyse gibt, ist sie umstritten. Sie wird weder allgemein anerkannt, wie es ihre Freunde gelegentlich mit dem Hinweis auf Lehrstühle, Verträge mit Krankenkassen und gut besuchte Kongresse behaupten, noch läßt sie sich sinnvoll als sterbende Sekte, als vom wissenschaftlichen Fortschritt überholter Aberglaube beschreiben. Ich will hier nicht versuchen, die Frage zu beantworten, ob die Psychoanalyse «richtig» oder «falsch», gut oder verwerflich sei. Ich will eher zu einem Flirt, einer spielerischen Auseinandersetzung einladen. Das heißt, ich beziehe mich auf die Ambivalenz und Unsicherheit des sogenannten «Laien».
Wenn er die Psychoanalyse nur vom Hörensagen kennt, kann er jetzt erfahren, worum es eigentlich geht. Wenn er schon einmal ein Buch eines Analytikers gelesen hat, treffe ich mich mit ihm bei der zweifelnden Frage: «Ob das nun wirklich so ist – oder vielleicht ganz anders? Muß man an den Ödipuskomplex oder die anale Phase einfach glauben?» Wenn er Bekannte hat, die plötzlich nur noch von ihrer Analyse beziehungsweise ihrem Analytiker erzählen (oder umgekehrt Gespräche abbrechen, «weil das in die Analyse gehört»), schüttle ich zusammen mit ihm den Kopf und versuche ihn zu trösten, soweit Argumente und Einsicht in Zusammenhänge Trost bringen können. Wenn eine Leserin oder ein Leser gar daran denkt, selbst eine Analyse zu machen, mag dieses Buch als eine Art Reiseführer – einmal Unbewußtes und zurück – die Angst vor den ersten Schritten erleichtern. Bald wird sie oder er freilich die Angaben zu allgemein finden. Aber wo es keine Hotels mit festgelegtem Dienstleistungsangebot gibt, die ich in diesen Baedeker aufnehmen kann, sind Informationen über Sprache und Sitten der Eingeborenen nicht zu verachten.
In den letzten Jahren ist es fast eine Modeerscheinung unter Journalisten geworden, etwas polemisch zu verwerfen, was sie als Psychoanalyse ausgeben. Ihre Gewährsmänner sind in der Regel an einem unreflektierten Positivismus orientierte Psychologen. Man könnte gegen solche Polemiken einwenden, daß sie einen Popanz bekämpfen, der aus einzelnen Fetzen der Freudschen Schriften zusammengestückelt ist. Fortschritte und Differenzierungen der Psychoanalyse nehmen sie nicht zur Kenntnis.[*] Dieser Einwand läßt sich durch einen grundlegenderen ergänzen. Ob wir nun einen Flugapparat aus der Zeit der Brüder Wright oder einen modernen Jet nehmen, immer wird uns die chemische Analyse seiner Bestandteile keinen Aufschluß darüber geben, ob er sich in die Luft erheben kann. Sie mag allerdings genau aufzeigen, welche Materialien ungeeignet sind. Der Konstrukteur wird sich nicht über den Metallurgen hinwegsetzen; dieser sich hüten, Aussagen zu machen, die sich auf die ganzheitliche Funktion des Flugzeugs beziehen. Anders gesagt: an einem physikalisch-statistischen Modell orientierte Forschung und das wissenschaftliche Vorgehen der Psychoanalyse unterscheiden sich derart, daß die Ebene von «experimentell richtig beziehungsweise falsch» unbedingt durch die Dimension «übertragbar beziehungsweise nicht übertragbar» ergänzt werden muß. Sonst ist das Ergebnis keine Bereicherung unseres Wissens, sondern ein Rückschritt, ein Verlust – als wollte ein Chemiker dem Konstrukteur verbieten, seine Modelle zu entwerfen und zu erproben. Freilich rechne ich nicht damit, eingefleischte Gegner der Psychoanalyse zu überzeugen. Aber ich treffe mich mit ihren Hörern und Lesern, die sich vielleicht fragen: Wenn das alles Unsinn ist, wenn es das Unbewußte nicht gibt und wenn die Kindheit für unser späteres Leben nichts bedeutet – wieso nehmen so viele kritische und nachdenkliche Menschen diese Irrtümer und Illusionen so ernst?
Ich habe darüber nachgedacht, ob ich dieses Buch so aufbauen sollte, wie ein Patient die Analyse kennenlernen mag. Am Anfang stünde die Unsicherheit, ob Hilfe möglich ist, wie man sie finden kann, die vielen Zweifel und die quälenden Versuche, aus eigener Kraft oder durch Gespräche mit Freunden weiterzukommen. Endlich der Schritt in die Therapie, oft schon deshalb hilfreich, weil er ein tieferes Eingeständnis eigener Schwäche, eine Bereitschaft ausdrückt, das bisher zur Seite Geschobene ernst zu nehmen. Die Frustration, wenn die Therapeuten am Telefon ihre Wartezeiten ausbreiten wie das Gegenstück zum roten Teppich, der die Ehrengäste einlädt. Den Ärger, daß man die eigene Geschichte mehrere Male erzählen soll, wenn man einen der leichter erreichbaren Analyseplätze bei einem Ausbildungsteilnehmer bekommen will. Die Angst vor der ungewohnten Situation einer analytischen Grundregel, die zusichert, alles sagen zu dürfen, aber oft zunächst als neue, nur schwerer durchschaubare Leistung und Fleißaufgabe verstanden wird. Hoffnung auf den Therapeuten als Erlöser, Enttäuschung durch seine gewöhnliche Menschlichkeit, endlich Schritte zu einer herzlichen Arbeitsbeziehung, in der sich gegenseitige Rücksicht und Offenheit mischen. – Aber wer so weit gekommen ist, weiß bereits mehr über Psychoanalyse, als er aus Büchern erfahren kann.
Ich habe diesen Plan aufgegeben, weil es mir unmöglich schien, eine für mich überzeugende Geschichte über einen solchen typischen Verlauf zu finden. Zudem wird der interessierte Laie zunächst mit Bruchstücken psychoanalytischen Wissens konfrontiert, die er verarbeiten muß. Diese Fragmente sind oft ausgesprochen unglücklich gewählt, weil sie den sensationellen oder entlarvenden Aspekt der Psychoanalyse betonen. Es ist, als würde man einem Hungrigen Gewürze vorsetzen. Die Grundnahrungsmittel der Psychoanalyse sind viel schwerer zu verstehen. Sie hängen mit der Methode zusammen, mit dem Versuch, den inneren Monolog eines Menschen in die intime Öffentlichkeit der psychoanalytischen Situation zu übertragen. Das heißt, daß ein tieferes Eingehen auf Widerstand und Übertragung notwendiger sind als Inhalte wie der Ödipuskomplex oder die kindliche Sexualität.
Eine Popularisierung von Wissenschaft, in der Ergebnisse vorgestellt werden wie die Kaninchen, die der Zauberer aus seinem Zylinder holt, hat nur geringen Wert, um die Laien mündiger zu machen. Mein Anliegen ist eine Information über die Psychoanalyse, in der weder blinde Überzeugung noch feindselige Ablehnung gefördert werden, sondern Verständnis für eine geistige Leistung, deren Feinheiten heute oft nicht weiterentwickelt, sondern vergröbert und abgestumpft werden. Die Psychoanalyse als Forschungs- und Therapiemethode hat einen ausgesprochen handwerklich-künstlerischen Charakter. Sie läßt sich nicht technisieren und rationalisieren wie andere Zweige der angewandten Wissenschaft. Daher gibt es in der Welt der Psychotherapie auch viele Rückentwicklungen, die sich mit dem Ersatz handgefertigter Schuhe oder Möbel durch Preß- oder Spritzgußteile aus Plastik vergleichen lassen. Mit dem üblichen Fortschrittsglauben lassen sich solche Vorgänge vielleicht rechtfertigen, gewiß aber nicht verstehen.
1 Das Unbewußte
Die Psychoanalyse ist die Wissenschaft vom Unbewußten. Manchmal liest man «Unterbewußtes», ein Begriff, den Freud ausdrücklich abgelehnt hat, weil er unklar sei und räumliche Verhältnisse unterstelle, wo es sich um Erlebnisqualitäten handelt. Freud hat nicht entdeckt, daß es ein Unbewußtes gibt. Das ist ein Wissen, das sich weit zurückverfolgen läßt und bei Schopenhauer und Nietzsche bereits recht ausführlich beschrieben worden ist. Aber er hat Methoden weiterentwickelt und zum Teil neu gefunden, mit deren Hilfe das Unbewußte erforscht werden kann. Er hat den intuitiven und unsystematischen Zugang der Künstler und philosophischen Schriftsteller verändert, ihm die Macht und den Nachdruck der empirischen Wissenschaft verliehen. Das war nicht nur nützlich und fruchtbar, sondern auch gefährlich. Es enthielt ein wohl nicht einlösbares Versprechen, man könne auf diesem Weg die Gewalten des Unbewußten auch beherrschen.
Kritiker gehen oft so vor, daß sie den eigenständigen Charakter der Psychoanalyse leugnen und auf diese Weise zu dokumentieren glauben, daß sie nichts taugt. Handelte es sich um einen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand, würde allen die Absurdität dieses Vorgehens auffallen, wie bei einem Autotester, der – weil ihm eine bestimmte Marke nicht zusagt – beschließt, ihre Eignung als Motorboot zu prüfen, und schließlich zu dem Ergebnis kommt, das von ihm geprüfte Fahrzeug sei untauglich. Der besondere Charakter des psychoanalytischen Wissens wird allerdings manchmal von den Analytikern selbst nicht erkannt und nicht beherzigt. Psychoanalytische Aussagen dürfen nicht mit dem Bewältigungs- und Reduktionsanspruch der experimentellen Naturwissenschaft ausgerüstet werden. Das tut zum Beispiel ein Analytiker, der einem Politiker ohne dessen Einwilligung unbewußte Beweggründe oder Charakterstörungen unterstellt, die ihm zum Verhalten dieses prominenten Mannes zu passen scheinen. Das naturwissenschaftliche Prestige wird dadurch gewonnen, daß Naturvorgänge entdeckt und – sobald ihre Gesetzmäßigkeit erkannt ist – auch vorausgesagt werden können. Das würde erfordern, daß Typen oder Klassen von Menschen nach äußeren Merkmalen rasch erkannt und einander zugeordnet werden könnten.
Dies ist nach den Ergebnissen der psychoanalytischen Methode keineswegs der Fall. Leider wird häufig ein Mißbrauch der Psychoanalyse, der auf ungenügender Einsicht in ihre Eigenständigkeit beruht, von den Kritikern mit ihr identifiziert. «Psychoanalytiker werden weiterhin die fürchterlichsten Schnitzer machen, solange sie an ihrem unverschämten und intellektuell lähmenden Glauben kleben, sie besäßen einen ‹privilegierten Zugang zur Wahrheit›.»[*] Rein mengenmäßig werden sicher mehr Kranke mit «objektivierenden» chemischen und chirurgischen Mitteln geschädigt als mit den «subjektivierenden» der Psychoanalyse. Aber dennoch ist jeder Versuch problematisch, psichoanalytische Aussagen mit dem Machtanspruch auszurüsten, der in unserer naturwissenschaftlich geprägten Medizin steckt. In diesem Fall schmückt sich die Psychoanalyse, ihrer Identität unsicher, mit des Kaisers neuen Kleidem.
In solcher teils tatsächlicher, teils unterstellter Anmaßung wurzelt auch die Anmaßung der Kritik. Der Psychoanalytiker mit dem Röntgenblick, der jedem Menschen, unabhängig von der analytischen Situation und von einem therapeutischen Vertrag, Komplexe und Verdrängungen nachweisen kann, der schier allwissende Voyeur und Entlarver, ruft die Entlarver des Psychoanalytikers auf den Plan. Wie Hans Jürgen Eysenck schleudern sie ihm den Vorwurf ins Gesicht, seine Methode richte nur Schaden an, seine Theorie erlaube keinerlei Voraussagen.[*] In der Tat erlaubt die Psychoanalyse nur in der analytischen Situation Voraussagen. Warum ein Mikroskop zerschlagen, weil die Dinge, die es zeigt, nicht auch mit bloßem Auge sichtbar sind? Wieder hinkt der Vergleich, weil die wissenschaftliche Arbeit des Analytikers nicht sinnlich augenfällig ist, nicht technisch nachgeahmt, im Idealfall von einem Apparat übernommen werden kann. Die Macht der Psychoanalyse ist in Wirklichkeit sehr gering. Im Gegensatz zur Reflextheorie sind psychoanalytische Einsichten bisher noch nie von Diktaturen mißbraucht, als Mittel zu systematischer «Gehirnwäsche» verwendet worden. Die Reflexlehre bietet Instrumente an, die zumindest im Prinzip auch gegen das Einverständnis der Betroffenen funktionieren. Sie teilt die mit experimenteller Disziplin oft nur legitimierte, nicht wirklich in ihr wurzelnde Macht der technischen Naturwissenschaften. Die Psychoanalyse ist anders. Obwohl keineswegs alle Analytiker aus politischer Überzeugung den Faschismus oder Stalinismus abgelehnt haben, ist doch keiner von ihnen zu den machtvollen Positionen in der Behandlung von Nervenkranken (als die in Diktaturen nicht selten auch politische Gegner eingestuft werden) aufgestiegen, die «naturwissenschaftlich» orientierte Nervenärzte oder die Schüler Pawlows gewonnen haben.
Ich sehe darin gewiß keinen Ausdruck einer moralischen Überlegenheit der Psychoanalytiker. An Versuchen, sich bei den Nazis anzubiedern, hat es auch unter ihnen gewiß nicht gefehlt.[*] Aber die Tatsache, daß sich die Psychoanalyse schlecht dazu eignet, Macht zu stützen und zu rechtfertigen, sollte doch festgehalten werden. Solche historischen Überlegungen können die Unterstellung zurechtrücken, die Psychoanalyse sei nur deshalb erfolgreich, weil sie ihrem Adepten «den vollkommenen Durchblick oder die Illusion eines solchen» verschaffe; «wer mit einigen ihrer Begriffe zu hantieren weiß, signalisiert schon, daß er etwas bis auf den Grund durchschaut hat. Die einzigen Gedankengebäude, die ähnliches leisten, sind der Marxismus und die Religion.»[*] Es ist kurzsichtig, Omnipotenzgebaren und Machtmißbrauch durch akademisches Geschwätz einer und nur einer wissenschaftlichen Disziplin vorzuwerfen, sie gewissermaßen mit ihren Auswüchsen zu vermischen und zu verurteilen. Wer so spricht, macht aus einer bestimmten, ideologisch verhärteten Auffassung von Wissenschaft eine neue, ihrer selbst nicht bewußte und sich selbst nicht kritisierende Religion, die dann genau zu dem unschlagbaren Argument wird, dessen Besitz er seinen Gegnern vorwirft. Mir ist an der Psychoanalyse sympathisch, daß sie sich bisher als ungeeignet erwiesen hat, blutige Glaubenskämpfe oder Gulags zu rechtfertigen; vielleicht gelingt es ihr sogar einmal, sich von den ihr innewohnenden Verführungen zu einem dogmatischen Anspruch zu befreien.
In vielen populären Darstellungen der Psychoanalyse – vor allem in den Freud-Filmen – hat die Entdeckung des Unbewußten etwas Theatralisches. Plötzlich taucht die vergessene Kindheitserinnerung, die verdrängte Phantasie auf, alle Beteiligten sind erleuchtet und erleichtert, das Symptom verschwindet wie ein böser Spuk. Der Wissenschaftler tritt als Varieté-Zauberer auf, der bald die Neutronenbombe, bald die Herztransplantation, in diesem Fall eben den «Komplex» vorweisen kann.
Solange eine Gesellschaft von einer ganzheitlichen, mythisch oder religiös bestimmten Auffassung ihrer selbst bestimmt ist, wird niemand auf den Gedanken kommen, dem Begriff des Unbewußten allzuviel Aufmerksamkeit zu schenken. Erst zwei Umwälzungen, die sich in Europa vollzogen, schufen die Voraussetzungen dazu: die Aufklärung und die bürgerliche Revolution. Die Aufklärer setzten an die Stelle der überkommenen, traditionsgeleiteten und hierarchischen Strukturen die Autorität der persönlichen Vernunft. Ein Modell dafür ist das «ich denke, also bin ich» des René Descartes. Dadurch wurde die emotionale Seite des Menschen gespalten. Es gab erwünschte und unerwünschte, der Vernunft widersprechende Gefühle. Im Gegensatz zu den Bräuchen des Mittelalters wurde es zu einem medizinischen Problem, wenn jemand «unvernünftig» war. Ärzte sollten den Grad dieser Unvernunft beurteilen und Wege finden, mit ihr umzugehen. So wurde die wichtigste Vorstufe der Psychoanalyse entdeckt: die Erforschung der Macht unbewußter Vorstellungen durch Hypnose.
Charcot, der in Paris die wissenschaftliche Neurologie mitbegründet und sich später ausgiebig mit der Hysterie beschäftigt hatte, war aufgefallen, daß die Symptome der Neurose oft eine Art Gegenpersönlichkeit ausdrücken. Fromme Nonnen werden zu verführerischen Kurtisanen, wohlerzogene Knaben zu Gassenbuben.[*] Freud verwendete zwar zunächst Charcots Methoden, hypnotisierte seine Patienten und versuchte, sie durch eindringliches Zureden wieder gesund zu machen, was ihm in vielen Fällen auch gelang. Aber er war damit nicht zufrieden. Er wollte nicht nur etwas bewirken, sondern verstehen, was vorging. Und er war bereit, über seine eigene Rolle in diesem Erkenntnisprozeß nachzudenken. In seiner ersten «psychologischen» Arbeit aus dem Jahr 1892 teilt er nicht nur mit, wie er eine «hysterische» Symptomatik geheilt habe, sondern auch, was dabei in ihm selbst geschah.
Es ging um eine sonst seelisch gesunde Frau, die bereits vor einigen Jahren ein Kind geboren hatte, aber es trotz besten Willens nicht zustande brachte, dieses auch zu stillen. Nach der zweiten Geburt fand Freud die Wöchnerin hochgradig erregt vor. Sie konnte nichts essen, das Anlegen des Kindes gelang nicht, weil die Brust sie schmerzte, sie fürchtete, wieder zu versagen. Freud gelang es, sie durch «beständiges Einreden der Symptome des Schlafes» in einen hypnotischen Zustand zu versetzen. Dann sagte er ihr: «Haben Sie keine Angst, Sie werden eine ausgezeichnete Amme sein, bei der das Kind prächtig gedeihen wird. Ihr Magen ist ganz ruhig, Ihr Appetit ausgezeichnet, Sie sehnen sich nach einer Mahlzeit.»[*]
Die Suggestion hat Erfolg. Wenn es ihm nur darum ginge, eine wirksame Behandlung zu beschreiben, wäre Freud ein Arzt wie alle übrigen. Aber er beobachtet genauer. Er sieht sich selbst bei seiner Arbeit zu und macht sich Gedanken. Er beschreibt den Ehemann, der fürchtet, die Hypnose würde die Nerven seiner Frau ruinieren. Er teilt freimütig mit, wie es ihn verdrossen habe, daß weder die geheilte Mutter noch einer ihrer Angehörigen später jemals die hypnotische Behandlung erwähnte. Dieser Zug von Selbstreflexion schuf den Abstand, der Freud half, den Hintergrund der rätselhaften Symptome zu entdecken. Was im Alltag gehemmt wird, setzt sich in der hysterischen Erkrankung durch. Nicht Simulation, die den «eingebildeten Kranken» als willkürliches Sich-krank-Stellen immer wieder vorgeworfen wurde, ist die Ursache. Im Gegenteil: die Patienten erkranken, weil sie ein Lebensbild für sich und von sich entwerfen, das zu gut, zu tadellos ist.
Wäre Freud bei den Überlegungen stehengeblieben, die Kritiker der Psychoanalyse als einzig «wissenschaftlich» anerkennen, er hätte sich damit zufriedengegeben, daß seine Patientin gesund wurde, sobald er ihre verkehrte Einstellung zum Stillen durch seine psychische Operation korrigiert hatte. Aber ihn interessierte mehr, wie solche Störungen zustande kommen.
«Die Frage: Was wird aus den gehemmten Vorsätzen? scheint für das normale Vorstellungsleben sinnlos zu sein», schreibt er 1892. «Man möchte darauf antworten, sie kommen eben nicht zustande. Das Studium der Hysterie zeigt, daß sie dennoch zustande kommen, das heißt, daß die ihnen entsprechende materielle Veränderung erhalten bleibt, und daß sie aufbewahrt werden, in einer Art von Schattenreich eine ungeahnte Existenz fristen, bis sie als Spuk hervortreten und sich des Körpers bemächtigen, der sonst dem herrschenden Ich-Bewußtsein gedient hat.»[*]
Diese Entdeckung des «Gegenwillens» von 1892 ist die erste Ankündigung einer neuen Umgangsform mit den hysterisch Kranken. Eine von ihnen, Bertha von Pappenheim, in den Fallgeschichten «Anna O.» genannt, schenkte Joseph Breuer zum Dank die Entdeckung der Wirkung solcher «verdrängter» Vorstellungen. Dieser Beziehungsaspekt ist wichtig. Wer sich anmaßt, das Unbewußte deuten zu können wie Worte einer Fremdsprache, die man im Lexikon nachschlägt, wird zu keinen brauchbaren Ergebnissen kommen. Solange die Ärzte hysterisch Kranke wie Simulanten behandelten, konnte keiner den Sinn der Symptome finden. Breuer saß wochenlang jeden Abend am Bett seiner jungen Patientin, die an den verschiedensten Lähmungen, Seh- und Sprachstörungen erkrankt war und eine Zeitlang nicht mehr trinken konnte. Sie mußte saftiges Obst essen, um nicht zu verdursten. Breuer forderte sie auf, in Hypnose davon zu erzählen. Anna O. erinnerte sich an eine Szene, in der ihre Gouvernante einen kleinen Hund aus ihrem Glas trinken ließ – das widerliche Vieh! Damals hatte Anna O. die Gefühle von Ekel und Scham mitsamt der ganzen Szene vergessen. Jetzt erinnerte sie sich daran, drückte ihren Abscheu aus – und verlangte, noch in Hypnose, nach einem Glas Wasser, das sie ohne Schwierigkeiten austrank. Breuer beendete die Hypnose, als sie das Glas noch an den Lippen hatte. Sie litt von jetzt an nicht mehr an diesem Symptom.
Eine «technische» Betrachtung dieses Vorfalls ergäbe, daß Breuer etwas falsch gemacht hat. Er hat zuwenig Vorsicht und Distanz walten lassen, sich angesichts einer schweren Geisteskrankheit zuviel zugemutet. Freud betrachtete diese Situation anders. Breuer hatte nicht genügend verstanden, was vorgefallen war. Die Hypnose und die Erfolge kathartischer Auflösungen waren unbestritten. Aber woraus ergaben sich die Rückfälle, die launische Reaktion auf die ärztlichen Bemühungen? Freud besaß mehr Selbstdistanz und Selbstironie als Breuer. Er begriff, daß diese Form der ärztlichen Arbeit grundsätzlich anders war als alles, was man sonst in Klinik und Praxis lernen und anwenden mochte. «Das Verfahren ist mühselig und zeitraubend für den Arzt», sagte er. «Es setzt ein großes Interesse für psychologische Vorkommnisse und doch auch persönliche Teilnahme für den Kranken bei ihm voraus. Ich könnte mir nicht vorstellen, daß ich es zustande brächte, mich in den psychischen Mechanismus einer Hysterie bei einer Person zu vertiefen, die mir gemein und widerwärtig vorkäme, die nicht bei näherer Bekanntschaft imstande wäre, menschliche Sympathie zu erwecken, während ich doch die Behandlung eines Tabikers oder Rheumatikers unabhängig von solchem persönlichen Wohlgefallen halten kann.»[*]
Das ist die erste Erwähnung der seelischen Einstellung des Therapeuten zum Patienten, die später als «Gegenübertragung» beschrieben worden ist. Die Erforschung des Unbewußten ist nicht aus der kühlen Distanz des experimentellen Naturforschers heraus möglich. Gleichzeitig aber zeigt Breuers Schicksal, daß eine neue Art von Distanz notwendig ist, die nicht auf einer vorgefertigten, festlegbaren Technik beruht, sondern auf einem vertieften Verständnis der Beziehung zum Patienten. «Ein guter Teil der Kranken, die für solche Behandlung geeignet wären, entzieht sich dem Arzte, sobald ihnen die Ahnung aufdämmert, nach welcher Richtung sich dessen Forschung entwickeln wird. Für diese ist der Arzt ein Fremder geblieben.»[*]
Der Arzt darf also die übliche Vermeidung einer vertraulichen Beziehung nicht hinnehmen, wenn er den Kranken helfen will, die an ihrem «Gegenwillen», ihren der bewußten Anpassung feindlichen Neigungen leiden. Er wäre dann zu sehr Teil einer Gesellschaft, die eine Verdrängung dieser Vorstellungen und Gefühle erzwungen hat. Nur wenn die Beziehung zu ihm so eng wird wie zu einem vertrauten Familienangehörigen, vor dem man sich öffnen und frei aussprechen kann, weil er keine von der Öffentlichkeit geforderte Maske erwartet, kann das Unbewußte erforscht werden. «Bei anderen, die sich entschlossen haben, sich dem Arzte zu überliefern und ihm ein Vertrauen einzuräumen, wie es sonst nur freiwillig gewährt, aber nie gefordert wird, bei diesen anderen, sage ich, ist es kaum zu vermeiden, daß nicht die persönliche Beziehung zum Arzte sich wenigstens eine Zeitlang ungebührlich in den Vordergrund drängt; ja, es scheint, als ob eine solche Einwirkung des Arztes die Bedingung sei, unter welcher die Lösung des Problems allein gestattet ist.»[*]
Freud beschreibt hier noch in einer alltagsnäheren Sprache, was später «Widerstand» und «Übertragung» genannt werden wird. Ich halte es für eine seiner größten Entdeckungen, den Zusammenhang zwischen dem Enträtseln des Unbewußten und der persönlichen Beziehung zwischen Analytiker und Analysand gesehen und festgehalten zu haben. Was ihm, im Gegensatz zu Breuer, diese kritische Distanz ermöglicht hat, läßt sich schwer sagen. Es waren wohl mehrere Motive: seine wissenschaftliche Erziehung, sein literarisches Talent, das ihm die Fähigkeit gab, das von anderen Ärzten übersehene und mißachtete Umfeld ihrer Tätigkeit auf den Begriff zu bringen und damit systematisch in seine Arbeit einzubeziehen, endlich das Interesse des an Diskriminierung leidenden Juden für die ebenfalls an Diskriminierung gewöhnten hysterischen Patientinnen. Ich beschreibe diese Entdeckung Freuds deshalb so eingehend, weil sie hilft, die Eigenart der Psychoanalyse zu verstehen. Da es um Beziehung und Emanzipation geht, kann sie als Therapiemethode keine völlig rationale Technik (im Sinn eines Teils der Naturwissenschaften als einer auf Physik und Mathematik gegründeten «Einheitswissenschaft») sein. Eine der üblichen medizinischen Techniken, die Carl Lesche «Machiavellische Technik» nennt, weil ihr Prinzip sei: «Der Zweck heiligt die Mittel», ist sie ebenfalls nicht.[*]