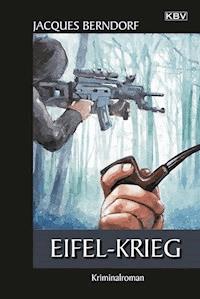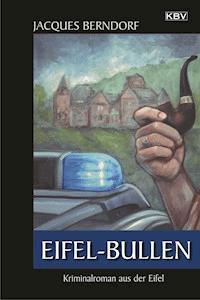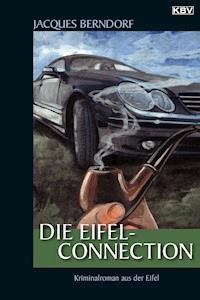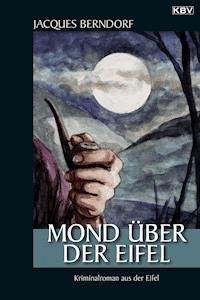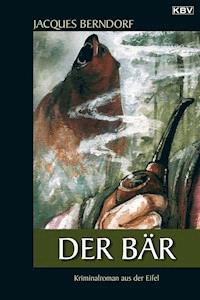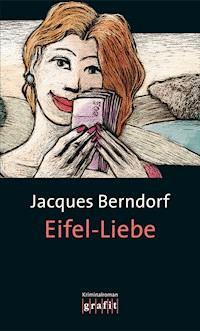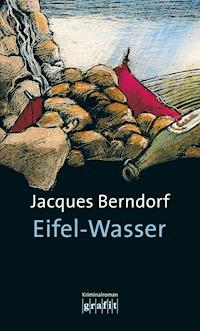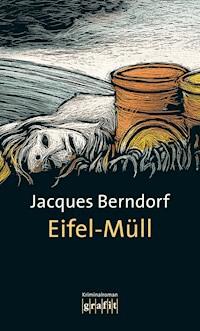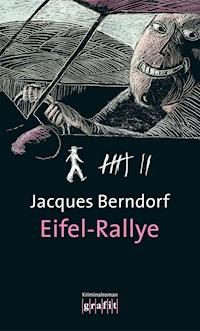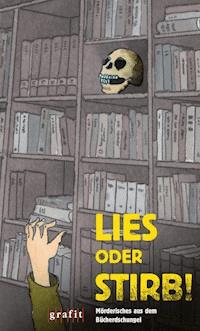
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
25 Jahre Grafit - Die Jubiläumsanthologie! Lesen, Schreiben, Bücher machen, mit Büchern handeln, über Bücher urteilen - das kann eine ganz schön emotionale und gefährliche Angelegenheit sein. Das wissen folgende Damen und Herren sehr gut, sorgen sie doch seit 25 Jahren für spannende Unterhaltung aus dem Hause Grafit: Leo P. Ard, Jacques Berndorf, Christiane Bogenstahl & Reinhard Junge, Wilfried Eggers, Lucie Flebbe, Ralph Gerstenberg, Christoph Güsken, Theo Pointner, Niklaus Schmid, Ilka Stitz, Ella Theiss, das Autorenduo Gabriella Wollenhaupt & Friedemann Grenz, Petra Würth und Jan Zweyer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Informationen der ›Randnotizen‹ entstammen verschiedenen Quellen, u.a. Buch und Buchhandel in Zahlen 2013 (hrsg. vom Börsenverein des deutschen Buchhandels), diversen Ausgaben der Zeitschrift Börsenblatt, Reinhard Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels,
Lies oder stirb!
Mörderisches aus dem Bücherdschungel
Kriminalstorys
© 2014 by den Autorinnen und Autoren und
by GRAFIT Verlag GmbH
Chemnitzer Str.31, D-44139 Dortmund
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Peter Bucker
eBook-Produktion: CPI books GmbH, Leck
RANDNOTIZ
1457 erfolgte die erste Datierung und Verlagsangabe in einem gedruckten Buch. 1671 wurde in Königsberg das erste bekannte Buchhändlerexamen abgelegt. Heute gibt es etwa 2.200Verlage und rund 4.000Einzelhändler, die Bücher verkaufen.
Ralph Gerstenberg
Peter Plus Pascal
Am Morgen des 28.Juli um fünf Uhr sechsunddreißig öffnete Gabor die Hintertür des Ladens in der Danziger Straße. Das Sicherheitsschloss der Firma ABUS hatte seinem Pickset nur fünfundfünfzig Sekunden standgehalten. Bevor er die Tür hinter sich zuzog, vergewisserte er sich, dass im Treppenhaus alles still war. Er atmete auf und ein – zum ersten Mal diesen Geruch aus Staub und Papier, Schimmel und Poesie. Ein kleiner Flur mit einer Garderobe, der zugleich als Lager genutzt wurde, ebenso wie die Küchennische, in der allein eine Espressomaschine sowie ein Plakat mit der Aufschrift Bücher sind Lebensmittel die Kistenstapel überragten. Gekocht wurde hier nicht, so viel stand mal fest.
Den Verkaufsraum hatte Gabor während seiner Recherche schon häufig betreten. Allerdings durch die Vordertür. Er kannte den Tisch mit der Stapelware, den Gummibaum neben der Antiquariatsecke, das Regal mit den Kinderbüchern, die alphabetisch geordneten Romane, die Drehständer mit den Krimis, die aufgereihten Biografien und Reiseführer, selbst den Bestand an Kochbüchern hatte er bereits erkundet, als er in den vergangenen Wochen ein wenig zu oft hier aufgekreuzt war, um unauffällig zu wirken, wie er befürchtete. Nur deshalb und weil er mit Peter Plus, dem Ladeninhaber, ins Gespräch kommen musste, hatte er sich einen Roman über zwei bescheuerte Teenager, die mit einem geklauten Lada Niva durch Ostdeutschland cruisten, aufschwatzen lassen, einen Stadtführer von Barcelona, wohin er Reiseabsichten zu haben vorgab, ein Kinderbuch für seine nicht vorhandene Tochter, das er auch beim dritten Durchblättern nicht verstanden hatte, sowie ein Buch über die Bepflanzung von schattigen Gärten, weil er, einer spontanen Eingebung folgend, den Anschein erweckt hatte, leider, ja, leider einen solchen zu besitzen. Letztere Behauptung bereute er umgehend, als er erfuhr, dass der gar nicht mal so opulente Bildband, den Peter Plus nicht bestellen musste, sondern von hinten, vielleicht aus der Küche, holte, neunundvierzig neunzig kostete – Geld, das Gabor nicht besaß, dessen Nichtbesitz ihn in diese Buchhandlung trieb, das er dennoch nun ausgeben musste, um weiterhin als geschätzter Kunde seine Recherchen betreiben zu können.
Das Schloss an der Ladentür war ein Witz. Gabor hatte es aufgebrochen, ausgebaut und durch ein neues ersetzt, bevor ein verpeilter Frühaufsteher oder Spätheimkehrer die Ladenfront passiert hatte. Die Gegend war ruhig geworden, seitdem sich Wohlstandserben, Parvenüs und Investoren aus aller Welt zunächst sämtliche Immobilien, die über Stuckdecken und Dielenböden verfügten, unter den Nagel gerissen hatten, danach alle anderen. Das Nachtleben war eingeschlafen. Der Berufsverkehr begann kaum vor sechs Uhr dreißig. Die Leute, die jetzt hier lebten, fuhren nicht zu Produktionsstätten, sondern in Büros oder Studios.
Gabor hatte sich seinen Thermoskannenkaffee eingeschenkt und beobachtete bei einem Klappbrot mit ungarischer Salami ein paar Hundehalter, die vor Arbeitsbeginn ihre werktagsüber in der Wohnung kasernierten Vierbeiner ausführten.
Die Morgensonne färbte bereits das Trottoir, als Gabor das Projekt, wie er es nach wie vor nannte, noch einmal infrage stellte. Bislang hatte er Urlaubsvertretungen bei einem Keramiker, in einem Schuhladen, bei einem Hutmacher und in einem Schnickschnacksouvenirgeschäft absolviert. Durchaus erfolgreich, wie er nicht ohne Stolz resümierte. Niemals hätte er sich auf eine Buchhandlung eingelassen, wenn nicht seine finanzielle Situation schnelles Handeln erforderlich gemacht hätte. Zudem waren die Konditionen einfach so gut, dass es beinahe sträflich gewesen wäre, eine solche Gelegenheit ungenutzt verstreichen zu lassen. Seit mittlerweile drei Jahren suchte sich Gabor in den Sommermonaten Geschäfte aus, die im Wesentlichen drei Bedingungen zu erfüllen hatten: Sie mussten sich an Orten befinden, an denen Gabor niemanden kannte, sie durften erst vor Kurzem eröffnet worden sein, sodass der Ladeninhaber wenig Gelegenheit gehabt haben konnte, persönliche Kontakte in der Nachbarschaft zu knüpfen, und die angekündigte Urlaubsfrist durfte nicht weniger als drei Wochen betragen, damit Gabor ausreichend Zeit hatte, möglichst viel von dem Warenbestand zu veräußern. Die Plus-Buchhandlung verfügte über all diese Merkmale auf vorbildlichste Weise. Peter Plus hatte seine Kundschaft bereits kurz nach der Eröffnung im Mai über seinen vierwöchigen Urlaub in Kenntnis gesetzt – gewiss aus Angst, die wenigen Stammkunden, die er in den zwei Monaten bis zu seinem Ferienbeginn gewinnen konnte, gleich wieder zu verlieren. Aus persönlichen Gesprächen mit dem Buchhändler wusste Gabor, dass dieser die Reise bereits im vergangenen Jahr gebucht hatte, als die Idee, sich mit einem eigenen Laden selbstständig zu machen, noch keineswegs spruchreif gewesen war. Neuseeland – ein Lebenstraum von Peter Plus, ebenso wie der Besitz einer eigenen Buchhandlung. Dank einer Erbschaft hatte er nun beide Träume verwirklichen können. Ein Glückspilz, dachte Gabor und spülte den letzten Rest vom Salamibrot mit etwas Kaffee herunter. Dann bereitete er sich auf seinen ersten Tag als Buchhändler vor.
Zunächst entfernte er das Urlaubsschild aus dem Schaufenster. Obwohl er den Warenbestand schon erkundet hatte, machten ihm die vielen Bücher nach wie vor Angst. Gabor war keine Leseratte. Das letzte Buch, das er innerhalb von wenigen Tagen verschlungen hatte, war eine Autobiografie von Reinhold Messner gewesen, die er in einer Skihütte hatte mitgehen lassen. In seinen Augen das Meisterwerk eines Weisen. Aber Gabor war nicht blöd, er wusste schon, dass andere das anders sahen.
Also beschäftigte er sich jetzt lieber mit der Markise, unter der Peter Plus antiquarische Angebote am Straßenrand präsentierte. Genau in diese Kerbe wollte Gabor mit seiner Verkaufsoffensive schlagen. Nachdem er die Kurbel für den Sonnenschutz gefunden hatte, brachte er zwei Klapptische nach draußen, die er hinter dem Herd entdeckt hatte, sowie Kisten mit Ramschware für zwei Euro, die Peter Plus vor Reiseantritt unter die Stapeltische mit den Neuerscheinungen geschoben hatte. Ergänzend holte Gabor einen Tapeziertisch aus dem alten Lieferwagen, den er um die Ecke geparkt hatte. In ein paar Obstkisten, die er ebenfalls mitgebracht hatte, packte er wahllos Bücher aus den Regalen und fertigte ein Schild mit der Aufschrift 5Euro an. Ab zehn Uhr begann die Warterei.
Der erste Kunde betrat gegen halb elf das Geschäft. Er suchte einen Roman über einen Mann, der irgendwoher kam, wo es kalt war. »Der aus der Kälte kam!«, brüllte der Mann immer wieder und immer lauter in den Raum hinein, als würde dieser wahrscheinlich völlig durchgefrorene Mensch irgendwo hinter den Drehständern lauern. Dabei waren es mittlerweile bestimmt schon über fünfundzwanzig Grad im Raum. Er bräuchte diesen Roman unbedingt, meinte der Kunde. Er habe davon geträumt und müsse der Sache auf den Grund gehen.
Gabor empfahl ihm die Biografie von Reinhold Messner. Die sei zwar, leider, leider augenblicklich nicht vorrätig, aber er könne sie natürlich bestellen. Der Mann wurde ruhig und verließ das Geschäft. Gabor war zufrieden. Er hatte zwar nichts verkauft, aber eine 1-a-Beratung mit einem schwierigen ersten Kunden hingelegt, eine Beratung, die vielleicht sogar einen therapeutischen Zweck erfüllte. Das war nicht nichts.
Zur Belohnung genehmigte er sich auf der Straße eine Zigarette und verschaffte sich einen Überblick über die gebrauchten Schmöker in den Zweieurokisten. In einem abgegriffenen Taschenbuch mit dem Titel Gedanken von einem gewissen Blaise Pascal fand er einen Satz, der ihm in den nächsten Wochen als Motto dienen sollte: Freundliche Worte kosten nichts, aber bringen viel ein. Eine simple Wahrheit, die man vor allem als Verkäufer beherzigen sollte. Während er weiter in dem vergilbten Reclam-Bändchen blätterte, tippte ihm eine junge Frau auf die Schulter.
»Das Buch habe ich dort in der Kiste gefunden. Kostet das wirklich nur fünf Euro?«
»Wenn es da lag«, antwortete Gabor und betrachtete den Umschlag des Werkes, das ihm die Frau entgegenstreckte. Unter dem Schwarz-Weiß-Foto eines jungen Mannes, der aussah, als hätte er für sein Alter ein bisschen zu viel gelesen, stand: Paul Auster Winterjournal.
»Ich dachte nur, weil es völlig neu und unbeschädigt aussieht.«
»Was dachten Sie?«
»Na, wegen der Buchpreisbindung«, sagte sie streng. »Muss es sich nicht wenigstens um ein Mängelexemplar handeln, damit man ein völlig neues Buch billiger verkaufen kann?«
Gabor, der von jeher eine rasche Auffassungsgabe besaß, fragte zurück: »Das heißt, Sie brauchen einen Mangel, um das Buch für fünf Euro reinen Gewissens kaufen zu können?«
»Eigentlich schon«, entgegnete die Frau, die Gabor an seine Deutschlehrerin erinnerte, jene Dame, die dafür gesorgt hatte, dass er noch heute Literatur als Bedrohung empfand.
»Gut«, sagte Gabor, nahm der Kundin das verlagsfrische Exemplar aus den Händen und riss die erste Seite zur Hälfte ein. »Ist nun alles in Ordnung?«
Mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Entsetzen verließ die Frau den Bücherstand vor der Plus-Buchhandlung.
Gabor packte das Buch zurück in die Kiste und stellte fest, dass freundliche Worte zwar nichts kosteten, aber schwer zu finden waren, angesichts einer unfreundlichen, mit Fallstricken ausgerüsteten Realität, die nicht nur das Handeln, sondern vor allem das Sein der Menschen bestimmte. Er schaute auf das unscheinbare Büchlein in seinen Händen. Mit diesem Pascal hätte er sich gerne mal etwas länger unterhalten. Der redete zwar, das war Gabor schon aufgefallen, nicht gerade wenig von Gott, aber zwischendurch hatte er ziemlich helle Momente, die ihn, Gabor, dazu brachten, über sich selbst nachzudenken. Ein Mensch, dem niemand gefällt, ist viel unglücklicher als einer, der niemandem gefällt. Ein Satz wie ein Hammer. Gabor war kritisch, oberkritisch, was die Auswahl der Leute betraf, die er an sich heranließ. Er war ein Einzelgänger, keine Frage, einer, der sein Ding durchzog, dem keiner was konnte, der von niemandem etwas wollte. Spürte er nicht zugleich eine gewisse Verachtung gegenüber all diesen überversicherten, überversorgten und doch unglücklichen Menschen um ihn herum? Fand er nicht immer ein Haar in der Suppe, einen Grund, jemanden nicht zu mögen? Und dann entdeckte er im Pascal, wie er das lieb gewonnene Büchlein mittlerweile nannte, einen Satz, der ihm den Rest gab: Allein ist der Mensch ein unvollkommenes Ding; er muss einen zweiten finden, um glücklich zu sein.
Er hatte noch kein Buch verkauft und machte Mittagspause. Das Geschäft schloss er nicht ab, die Bücherkisten ließ er unter der Markise stehen. Er ging einfach schräg über die Straße in ein Restaurant, das Tagesmenüs anbot, und sagte zu der Verkäuferin: »Ich habe dreißig Minuten Pause und will satt und glücklich an meinen Arbeitsplatz zurückkehren.«
Sie empfahl ihm das Veggie-Menü, er bestellte gratinierte Kalbslende, dazu ein Glas Rotwein, und in dem Augenblick, in dem er die viel zu teure Bestellung aufgab, wurde ihm klar, wie recht dieser Pascal hatte. Gabor war einfach ein verdammter Verächter. Und die Verachtung, die er der Welt entgegenbrachte, machte ihn einsam und unglücklich. Diese Kellnerin zum Beispiel war jung und schön. Jeder Typ hier im Raum schaute sich nach ihr um, wenn sie sich mit Tellern und Gläsern durch die Tischreihen bewegte, jeder gab ihr mehr Trinkgeld als nötig. Gabor hingegen verschwendete keinen Blick und ließ sich das Wechselgeld bis auf den letzten Cent herausgeben. Er hatte nichts zu verschenken, schon gar nicht an jemanden, der ihm Schwachmatenkost aufschwatzen wollte. Doch weil er so dachte, weil er so wenig Gefallen finden konnte an anderen, hatte er weniger Freude im Leben als jeder Einzelne dieser permanent flirtbereiten Familienväter aus den umliegenden Bürogemeinschaften, über die er die Nase rümpfte. Gabor legte ein Zweieurostück auf den Tresen, bevor er das Restaurant verließ.
Am Nachmittag verkaufte er einen Reiseführer über Portugal, ein paar Taschenbücher aus den Kisten und zwei, drei Krimis. Außerdem nahm er eine Bestellung entgegen, von der er nicht wusste, wie er damit umgehen sollte. Er versprach, das Buch bis Ende der Woche zu besorgen. Den Computer von Peter Plus rührte er nicht an. Er würde sich sowieso nicht einloggen können.
Am Abend in seiner Neuköllner Stammkneipe stellte er fest, dass er an seinem ersten Arbeitstag nicht mal genug verdient hatte, um sein Bauernfrühstück und die drei Biere zu bezahlen, die er dazu trank. Im Bett blätterte er im Pascal, dessentwegen er den ruinösen Buchhandel nicht verfluchte, sondern als Segen betrachtete, als unerwarteten Quell der Selbsterkenntnis. Er schlief ein über dem Satz: Der Mensch, der nur sich selber liebt, hasst nichts so sehr, als mit sich selbst allein zu sein.
Am nächsten Tag lief das Geschäft schon wesentlich besser. Der selbst gesetzte Mängelexemplarstempel, den er mitgebracht hatte, um die Fünfeurokistenbücher zu entwerten, wirkte Wunder. Nach und nach traf Gabor beim Zigarettenrauchen auf dem Gehsteig Geschäftsleute aus der unmittelbaren Nachbarschaft: den Eckladenbesitzer, der Armyoutfits und -accessoires verscherbelte, die polnische Fußpflegerin, die Gabor wirklich empfehlen konnte, die Literaten und freiberuflichen Lektoren, die sich aus Gründen der Dynamik und Synergie mit ihren dünnen MacBooks in einer engen Ladenwohnung drängelten, obwohl sie komfortabler, aber eben undynamisch und weniger synergetisch zu Hause arbeiten konnten.
Mittags aß Gabor ein Veggie-Menü im Restaurant gegenüber. Diesmal schenkte er der Kellnerin ein Lächeln. Du würdest mich nicht suchen, wenn du mich nicht gefunden hättest, las er im Pascal, während er Zucchininudeln mit Gemüse in Erdnusssoße verspeiste. Wieder legte er zwei Euro auf den Tresen und verließ den Raum, ohne sich umzudrehen.
Nach drei Tagen kannte er bereits einen Teil der Kundschaft: den Mann vom ersten Morgen, der immer ein Buch brauchte, von dem er geträumt hatte, den emeritierten Hochschullehrer, der Pascal für »einen kranken Asketen und Apologeten des Christentums« hielt, die alte Frau, die nur den Kopf hineinsteckte und sagte: »Ach stimmt ja, Peter ist im Urlaub«, die schwangere Mutter eines Zweijährigen, der Gabor Kinderbücher zum halben Preis verkaufte, die Ladenstromerer und Gelegenheitsdiebe, die einsamen Seelen, die nur ins Gespräch kommen wollten. Peter Plus hatte sich in der kurzen Zeit, in der er hier Bücher verkaufte, offenbar schon besser eingelebt, als Gabor vermutet hatte. Doch die Nummer mit der Urlaubsvertretung funktionierte – wie immer. Auch wenn das Geschäft nicht so gut lief wie die Vorgängerläden, gefiel Gabor die Buchhandlung. Er mochte es, dort zu sein. Jeden Morgen, wenn er die Tür öffnete und die bestellten Exemplare, die er am Abend zuvor bei einer Großbuchhandlung erstanden hatte, unter den Ladentisch legte, atmete er tief durch. Er liebte es, durch den Verkaufsraum zu streifen, hier und dort reinzulesen, sich einen Espresso zu genehmigen, mit einer Zigarette im Mundwinkel beim Sortieren der Bücherkisten das Treiben auf der Straße zu beobachten und mit diesem und jenem zu plaudern; vor allem liebte er es jedoch, im Pascal zu lesen: Die besten Bücher sind die, von denen jeder meint, er hätte sie selbst schreiben können.
Eines Abends, er war gerade dabei zuzuschließen, stand die Kellnerin von gegenüber vor ihm auf der Straße. Sie zog eine Plastiktüte aus der Handtasche, in der Zweieurostücke klimperten, und fragte, was er davon halten würde, mit ihr etwas trinken zu gehen. Gabor hatte noch nichts Vernünftiges gegessen und lud sie in ein Steakhaus ein. Sie hieß Rabea und aß ihr Entrecote blutig. Später zogen sie durch ein paar Bars. Die Kellnerei sei nur ein Job, sagte sie. Eigentlich studiere sie Romanistik. Gabor sei ihr aufgefallen, weil er Blaise Pascal las, über den sie eine Semesterarbeit geschrieben habe.
»Ehrlich?«, meinte Gabor und war erleichtert, dass er jemanden gefunden hatte, der ihm gefiel.
Später waren sie betrunken genug, um zu ihr zu gehen.
Am nächsten Morgen legte sie einen Schlüssel auf den Tisch.
»Der ist von Peter. Er hat mich gebeten, den Gummibaum zu gießen. Aber er passt nicht mehr in das Schloss der Buchhandlung.«
»Dem Baum geht’s gut«, meinte Gabor.
»Ich weiß«, sagte Rabea.
In den nächsten Tagen sahen sie sich nicht nur mittags. Gabor stellte seine Rabattaktion mit der gestempelten Neuware ein. In den Regalen gab es inzwischen erhebliche Lücken. Bei einem Vertreter, der einfach mal so vorbeischauen wollte, bestellte er nichts, auch nicht das Buch über die schönsten Wanderwege der Wanderhure, weil er ahnte, dass Peter Plus das weniger amüsant gefunden hätte.
Pascals Denken sei eine interessante Mischung aus Rationalität und Spiritualität, meinte Rabea. Damit vereine er den Widerspruch des menschlichen Geistes, der einerseits glauben, andererseits wissen und erkennen wolle. »Er versuchte sich an der Quadratur des Kreises, nachdem er bereits Überlegungen über die Winkelsumme von Dreiecken und einen Satz über die Kegelschnitte von Sechsecken entwickelt hatte.«
Gabor hatte keine Ahnung, wovon Rabea redete, aber er wollte, dass sie niemals damit aufhörte. Unter der Überschrift Beschreibung des Menschen notierte Pascal: Abhängigkeit, Verlangen nach Unabhängigkeit, Bedürfnisse.
Mit weniger Worten hätte man Gabors Situation nicht beschreiben können. Er spürte, dass er nicht mehr frei war in seinen Entscheidungen. Er hatte angefangen, an seinem temporären Arbeitsplatz Bedürfnisse zu entwickeln, etwas und jemanden zu lieben. Ja, er liebte es mittlerweile, Tag für Tag diesen Laden zu betreten, Bücher zu verkaufen, Espresso zu kochen, im Pascal zu lesen. Und er liebte die Frau, die im Restaurant gegenüber Geschäftsleuten, Müttern und Freelancern vegetarische Menüs servierte. Dennoch wollte er seine Unabhängigkeit nicht verlieren, sein selbstbestimmtes, stolzes Leben, das keine Halbherzigkeiten duldete.
»Morgen kommt Peter zurück«, sagte Rabea am Sonntag, dem 24.August, als sie im Freiluftkino einen Film über einen talentierten, aber erfolglosen Folksänger sahen, der in den frühen Sixties mit Katze und Gitarre durch New York gestreift war. Die Mücken tanzten im Lichtkegel des Projektors, als Gabor Rabeas Hand noch etwas fester drückte.
Am nächsten Tag erschien Gabor früher als sonst in der Buchhandlung. Er wischte den Boden, rückte die Bücher in den Regalen zurecht, goss den Gummibaum, reinigte die Espressomaschine. Dann wartete er.
Peter Plus kam gegen neun Uhr. Gabor hatte die Ladentür schon geöffnet, damit der Fußboden schneller trocknen konnte und der Buchhändler nicht vergeblich mit seinem Schlüssel in dem neu eingesetzten Schloss stocherte. Gabor erhob sich, als Peter Plus sein Geschäft betrat. Das war das Mindeste, fand er. Eine Weile standen sich die beiden Männer gegenüber.
Plus war braun gebrannt und unrasiert, trug zerrissene Jeans, Sonnenbrille und ein weißes Hemd. Das Klischee eines Weitgereisten. Seine Irritation ließ er sich nicht anmerken. »Oh«, sagte er irgendwann mit Blick auf die halb leeren Regale. »Du hast eine Menge umgesetzt, bist ein Talent, was?«
»War nicht so schwer. Sommerschlussverkauf.«
»Verstehe.«
Gabor hörte eine Polizeisirene. »Rabea«, sagte er. »Sie hat Ihnen von mir erzählt.«
Das Martinshorn wurde lauter, Gabor sah durch das Ladenfenster das Blaulicht und schaute hinüber zu dem Restaurant, das noch nicht geöffnet hatte. Bald werden sie hier sein, dachte er und zog einen Umschlag aus der Tasche.
Peter Plus nahm die Brille ab. »Als Student habe ich eine Menge Bücher geklaut«, erzählte er. »Gegenüber der Uni gab es ein Antiquariat. Eines Tages präsentierte mir der Besitzer eine Liste mit dem von mir entwendeten Lesestoff. Jedes einzelne Exemplar, das ich hatte mitgehen lassen, war darauf registriert. Der Mann lobte meinen Geschmack und meinte, es gebe genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich würde für ihn am Wochenende auf Flohmärkten arbeiten, darauf hätte er nämlich keine Lust mehr, oder ich dürfe seinen Laden nie wieder betreten. So bin ich Buchhändler geworden.«
Gabor reichte Peter Plus den Umschlag, in dem sich eine Abrechnung sowie der Rest des Geldes befanden, das er für die Bücher aus den Regalen erhalten hatte.
Das Polizeifahrzeug fuhr am Laden vorbei.
Plus schaute in das Kuvert und lächelte. »In Neuseeland bin ich auf den Geschmack gekommen. Ich habe vor, mich noch ein wenig in der Welt umzusehen. Also könnte ich jemanden gebrauchen, der sich in der Zeit, in der ich unterwegs bin, um das Geschäft kümmert. Und danach müssen wir mal sehen.«
Der Umschlag wechselte wieder den Besitzer. Gabor starrte ihn an wie ein Geschenk, das er nicht annehmen konnte. Entweder dieser Plus machte sich über ihn lustig oder er war völlig verrückt. Wer bot einem Bankräuber die Leitung einer Filiale an? Dann fiel ihm ein Satz von Pascal ein, über den er lange nachgedacht hatte, ohne ihn zu verstehen:
RANDNOTIZ
Ein Buch ist ein Spiegel. Wenn ein Affe hineinguckt, kann freilich kein Apostel heraussehen.
Georg Christoph Lichtenberg, 1777
Ella Theiss
Rauntzkys Erben
Der dreiblättrige Ausdruck seiner Buchbesprechung klatscht auf Roberts Schreibtisch, gefolgt vom Spuckesprühregen des lispelnden Feuilletonchefs. »Wads für Leute, glauben dSie, wollen dso wads ledsen?« Ganze Absätze sind durchgestrichen, am Korrekturrand knäulen sich die Anmerkungen.
Robert atmet tief ein, tief aus. Gelassen bleiben, wenigstens gelassen erscheinen. Der Chef ist Choleriker. Wissen doch alle, oder?
Das Klappern der Tastaturen ringsum verstummt, drei Sekunden, vier Sekunden … hinter dem halb kahlen Benjamini die Glupschaugen der Volontärin.
Robert ringt sich einen sachlichen Gesichtsausdruck ab. »Okay, ich sehe mir Ihre Korrekturvorschläge an und überarbeite den Text.« So viel Demut müsste reichen.
Reicht nicht. Eine Zeigefingerkuppe mit ausgefranstem Nagelbett hämmert aufs Manuskript. »Wir wollen Texdse mit Bidss. Merken dSie dsich dads!«
Der Chef zieht ab, Robert geht sein Gesicht waschen.
»Guck mal im Archiv – unter Rauntzky«, sagt die Volontärin.
Gute Idee, denkt Robert. Der Chef hat den berühmten und gleichfalls lispelnden Feuilletonisten von jeher vergöttert.
*
Irmas neue Brille hat trapezförmige Gläser und einen Kunststoffrand mit altrosa Schlierenmuster. Sie nimmt die alte Brille ab, setzt die neue auf, drückt sich die Bügel auf die Ohren und zuckt mit den Nasenflügeln, bis das Gestell am richtigen Platz sitzt. »Ich sehe … nicht viel.«
»Das ist eine Gleitsichtbrille«, sagt die Tochter, »man muss sich erst daran gewöhnen.«
Irma lässt die Pupillen wandern, die Tapete zieht konzentrische Kreise, die Eichenvitrine wankt, auf Irmas Handrücken wölbt sich ein Faltengebirge über wurmdicken Adern. »Mir gefällt meine alte Brille besser«, sagt Irma.
»Aber du kannst jetzt wieder gut sehen, sogar Zeitung lesen.« Die Tochter greift nach der Allgemeinen, die gestapelt auf der Anrichte liegt. »Lies mal das hier, die Überschriften.«
»Neun-zig-jähr-ige-Mut-ter-miss-hand-elt …«
»Hmm, nimm lieber den Kulturteil.« Die Tochter blättert um, streicht eine Zeitungsseite auf der Tischdecke glatt.
Irma äugt durch die Gläser. Schwarze Serifen wimmeln übers Papier, treten wie unter einer Lupe hervor und verblassen am kreisförmigen Rand. Irma zuckt zusammen. »Da steht Machwerk.«
»Siehst du, wie gut du jetzt wieder lesen kannst.«
Irma konzentriert sich, fixiert ein zappelndes Wort nach dem anderen. Ihr Herz pocht vor Entsetzen. »Das ist ja ein Schmähartikel.«
»Eine Buchrezension, nichts Ernstes.« Die Tochter packt ihre Sachen. »Deine alte Brille nehme ich mit. Damit du dich an die neue gewöhnst. Am Samstag kommt Stefan und richtet dir endlich den Fernseher ein.«
»Stefan?«
»Dein Enkel, Mama.«
»Ach ja, Stefan.«
Die Tochter zieht die Haustür hinter sich zu. Irma setzt die neue Brille ab und legt sie unter den Zeitungsstapel. Nun ist die Welt neblig, aber berechenbar. Es sind sieben Schritte geradeaus durch den Flur zur Wohnzimmerschwelle, es sind drei Schritte zum Teppichrand und fünf Schritte diagonal zum Sessel. Im zweiten Sessel sitzt Charly, nippt an seinem Pils und raucht, feine Schlieren steigen auf.
»Er ist zurück«, sagt Irma.
Charlys Miene verdüstert sich, die Zigarette zwischen seinen Fingern zittert. »Und?«
»Er schreibt Machwerk … und dilettantisches Geschwätz … und intellektuelle Armseligkeit … solche Sachen.«
Charly legt den Kopf in den Nacken, starrt zur Decke.
»Es geht nicht um dich. Um eine Frau geht es, Hella … Soundso.«
»Egal, ich will ihn sprechen. Er soll herkommen.«
Irma nickt, hebt sich aus dem Sessel. Tappt die fünf Schritte zurück zum Teppichrand, tappt die sieben Schritte über die Schwelle und den Flur entlang zur Wandhalterung mit dem Telefon, drückt die Kurzwahltaste zur Telefonvermittlung: »Die Allgemeine Zeitung, bitte …«
*
Eine gelbe Haftnotiz mit dem Aufdruck Serviceabteilung klebt am Monitor. Robert entziffert die krakelige Handschrift der Kollegin: Einladung zum Tee … Freitag, 16Uhr, Charly … Mozartweg … Zuletzt die Bemerkung, dass Privatkontakte gefälligst nicht über die Abo-Rufnummer zu laufen hätten. Drei Ausrufezeichen.
Charly? Das muss die Rothaarige sein, die Robert vor circa drei Wochen in der Disco kennengelernt hat. Charlotte … den Nachnamen hat er vergessen. Zweiundzwanzig, ampelgrüne Augen, freizügiges Shirt. Sie hatten sich nett unterhalten. Er erzählte ihr von seinem aktuellen Projekt: einer Abhandlung über regionale Krimis und deren Rezeption in Feuilletons überregionaler Tageszeitungen. Ein nach Dafürhalten seines Chefs äußerst ergiebiges Thema. Charlotte hörte lächelnd zu. Bis sie einem Dreitagebart-Beau auf die Tanzfläche folgte, später an die Bar und dann mit ihm verschwand.
Sieht so aus, als habe sich der Dreitagebart-Beau als Langweiler entpuppt. Worauf sich Charlotte an das anregende Gespräch mit Robert erinnert hat – na also! Freitag, sechzehn Uhr, zum Tee … bei ihr zu Hause? Das Mädel geht aufs Ganze. Robert googelt die Adresse und ist beeindruckt: ein Einfamilienhaus auf einem Riesengrundstück in nobler Lage.
*
Lichtstrahlen blinzeln durch die Jalousie ins Schlafzimmer. Was heute für ein Tag ist? Welcher Monat, welches Jahr? Um es zu wissen, müsste Irma wissen, welcher Tag gestern war und welcher vorgestern. Sie hat es vergessen, wie an jedem Morgen. Die Tochter war so lieb, ihr eine moderne Uhr zu besorgen, die – neben der genauen Uhrzeit – alles anzeigt: Wochentag, Datum und Jahr. Die Uhr steht auf dem Nachttisch. Um sie lesen zu können, müsste Irma ihre Brille aufsetzen, doch die Brille ist weg.
Macht nichts, Irma will nicht wissen, was für ein Tag heute ist. Ein so langes Leben, wie Irma es hinter sich hat, wird übersichtlicher, wenn man alles ein wenig komprimiert. Da gab es diese vielen, vielen Tage, diese wunderbaren Tage, die in der Erinnerung zu einigen wenigen zusammenschnurren. Und manchmal sind sie für Irma so gegenwärtig, dass sie glaubt, noch mitten darin zu leben. Das waren die Tage, als sie Tante Ediths Haus erbten, wo sie für immer mietfrei wohnen konnten, Charly, Irma und die Kinder. Das gepflegte Haus mit dem großen Garten, wo Irma Rosen-, Tulpen- und Gladiolenbeete anlegte. Der kleine Anbau mit dem Bunker, den die Tante aus Furcht vor sowjetischen Atombomben hatte bauen lassen und in dem Charly – ungestört von Kindergelächter und Vogelgezwitscher – an seinem Roman arbeiten konnte. Nach sieben Jahren erschien er, der Roman, bei einem angesehenen Verlag, in Leinen gebunden, mit einem Schutzumschlag und einem Lesebändchen versehen. »Ein ungewöhnliches, ein berührendes, ein brillant verfasstes Werk«, befand der Lektor und ermunterte Charly zu einer Fortsetzung.