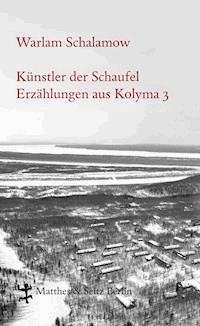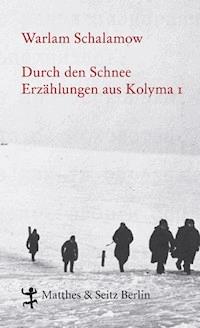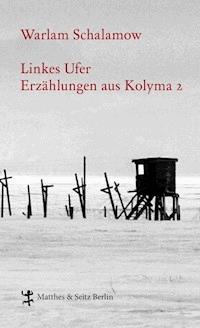
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schalamow - Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Erzählungen aus Kolyma - der 2. Zyklus "Warlam Schalamow ist die große Gegenfigur zu den literarischen Zeugen der nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Er gehört in eine Reihe mit Primo Levi, Jorge Semprún oder Imre Kertész." -Gregor Dotzauer, Tagesspiegel Mit Linkes Ufer wird die Werkausgabe von Warlam Schalamow fortgesetzt, deren erster Band Durch den Schnee seit seinem Erscheinen 2007 ungebrochen hohe Aufmerksamkeit genießt. Schalamow zieht den Leser in die Gegenwart des Lageralltags hinein und geht der Schlüsselfrage unserer Gegenwart nach: Wie können Menschen, die über Jahrhunderte in der Tradition des Humanismus erzogen wurden, Auschwitz oder Kolyma hervorbringen? Lange Jahre im Westen unbekannt, erfährt er in den letzten Jahren zunächst in Frankreich und Deutschland endlich die verdiente Anerkennung als einer der Großen der russischen Literatur. Die Erzählungen aus Kolyma, deren zweiter Zyklus in der Übersetzung von Gabriele Leupold hier veröffentlicht wird, sind Weltliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Warlam Schalamow
Linkes UferErzählungen aus Kolyma 2
Werke in EinzelbändenBand 2
Warlam Schalamow
Linkes UferErzählungen aus Kolyma 2
Aus dem Russischen von Gabriele LeupoldHerausgegeben von Franziska Thun-Hohenstein
Inhalt
Der Statthalter von Judäa
Die Aussätzigen
In der Aufnahme
Geologen
Bären
Das Kollier der Fürstin Gagarina
Iwan Fjodorowitsch
Das Akademiemitglied
Die Diamantenkarte
Der Unbekehrte
Das beste Lob
Der Nachkomme des Dekabristen
Die »Armenkomitees«
Magie
Lida
Das Aorten-Aneurysma
Ein Stück Fleisch
Mein Prozeß
Esperanto
Die Sonderbestellung
Das letzte Gefecht des Majors Pugatschow
Der Krankenhaus-Chef
Der Antiquar
Lend-Lease
Sentenz
Anmerkungen
Glossar
I. P. Sirotinskaja gewidmet
Für Ira – meine unendliche Erinnerung,angehalten im Buch »Linkes Ufer«
Der Statthalter von Judäa
Am fünften Dezember des Jahres neunzehnhundertsiebenundvierzig lief das Dampfschiff »KIM« mit menschlicher Fracht in die Bucht von Nagajewo ein. Die Fahrt war die letzte, die Schiffahrtssaison war zu Ende. Magadan empfing die Gäste mit Frösten von vierzig Grad. Übrigens brachte das Dampfschiff nicht Gäste, sondern die wahren Herren dieses Landes – Häftlinge.
Die gesamte Obrigkeit der Stadt, Militärs und Zivilisten, war im Hafen. Alle in der Stadt vorhandenen Lastwagen empfingen das Dampfschiff »KIM« im Hafen von Nagajewo. Soldaten, Kadertruppen standen an den Molen, und das Löschen begann.
Im Umkreis von fünfhundert Kilometern um die Bucht herum fuhren alle freien Grubenfahrzeuge leer nach Magadan, dem Ruf des Selekteurs folgend.
Die Toten ließ man am Ufer und brachte sie von dort zum Friedhof, ohne Holzplättchen am Fuß legte man sie in Massengräber und erstellte nur ein Protokoll über die Notwendigkeit einer künftigen Exhumierung.
Die Elendesten, aber noch Lebenden wurden in Häftlingskrankenhäuser in Magadan, Armani und Duktscha gefahren.
Kranke in mittelschwerem Zustand brachte man ins Zentrale Häftlingskrankenhaus, ans linke Ufer der Kolyma. Das Krankenhaus war erst kürzlich von Kilometer dreiundzwanzig dorthin umgezogen. Wäre der Dampfer »KIM« ein Jahr früher gekommen – man hätte nicht fünfhundert Kilometer weit fahren müssen.
Der Leiter der chirurgischen Abteilung Kubanzew, frisch von der Armee, von der Front, war erschüttert vom Anblick dieser Leute, dieser schrecklichen Wunden, die Kubanzew nie im Leben gekannt und nicht einmal im Traum gesehen hatte. In jedem Fahrzeug aus Magadan lagen Leichen von unterwegs Gestorbenen. Dem Chirurgen war klar, daß dies die leichten, transportablen Fälle waren, die weniger schlimmen – die schwersten läßt man am Ort.
Der Chirurg wiederholte die Worte General Ridgeways, die er gleich nach dem Krieg irgendwo hatte lesen können: »Die Fronterfahrung des Soldaten bereitet nicht auf den Anblick des Lagertodes vor.«
Kubanzew verlor die Kaltblütigkeit. Er wußte nicht, was befehlen, wo anfangen. Die Kolyma hatte eine zu schwere Bürde auf den Frontchirurgen gewälzt. Doch er mußte etwas tun. Die Sanitäter trugen die Kranken aus den Fahrzeugen und brachten sie auf Tragen in die chirurgische Abteilung. In der chirurgischen Abteilung standen die Tragen auf allen Korridoren dicht gedrängt. An Gerüche erinnern wir uns wie an Gedichte, wie an menschliche Gesichter. Der Geruch dieses ersten Lager-Eiters blieb für immer in Kubanzews Geschmacksgedächtnis. Sein Leben lang erinnerte er sich später an diesen Geruch. Es könnte scheinen, als rieche der Eiter überall gleich und sei der Tod überall gleich. So ist es nicht. Sein Leben lang schien es Kubanzew, als rieche er die Wunden dieser seiner ersten Kranken an der Kolyma.
Kubanzew rauchte, er rauchte und spürte, daß er die Fassung verliert, nicht weiß, was er den Sanitätern, Feldschern und Ärzten befehlen soll.
»Aleksej Aleksejewitsch«, hörte Kubanzew eine Stimme neben sich. Das war Braude, Chirurg und selbst Häftling, der ehemalige Chef dieser Abteilung, der seinen Posten auf Befehl der obersten Leitung nur deshalb verloren hatte, weil Braude ehemaliger Häftling war, noch dazu mit einem deutschen Namen. »Erlauben Sie mir, das Kommando zu übernehmen. Ich kenne das alles. Ich bin seit zehn Jahren hier.«
Der erschütterte Kubanzew trat das Kommando ab, und die Arbeit ging los. Drei Chirurgen begannen gleichzeitig zu operieren – die Feldscher wuschen sich die Hände, um zu assistieren. Andere Feldscher verabreichten Spritzen, flößten Herzmittel ein.
»Amputationen, alles Amputationen«, murmelte Braude. Er liebte die Chirurgie, und er litt, nach seinen eigenen Worten, wenn es in seinem Leben auch nur einen Tag ohne Operation gab, ohne Schnitt. »Jetzt brauche ich nicht Trübsal zu blasen«, freute sich Braude. »Kubanzew ist zwar kein übler Bursche, aber er wird konfus. Frontchirurg! Dort haben sie ihre Instruktionen, Pläne, Befehle, aber hier habt ihr das lebendige Leben, die Kolyma!«
Doch Braude war kein böser Mensch. Ohne jeden Anlaß seines Postens enthoben, war er seinem Nachfolger nicht gram, tat ihm nichts Niederträchtiges an. Im Gegenteil, Braude sah Kubanzews Konfusion und spürte seine tiefe Dankbarkeit. Immerhin hatte der Mann Familie, eine Frau, einen Sohn, der zur Schule ging. Die Offiziers-Polarration, ein hoher Lohnsatz, der schnelle Rubel. Und was hatte Braude? Zehn Jahre Haft auf dem Buckel und eine sehr zweifelhafte Zukunft. Braude kam aus Saratow, war Schüler des berühmten Krause und selbst sehr vielversprechend gewesen. Doch das Jahr siebenunddreißig hatte Braudes gesamtes Schicksal in Trümmer gelegt. Soll er sich also an Kubanzew rächen für sein Unglück ...
Und Braude kommandierte, operierte, fluchte. Braude lebte und vergaß sich selbst, und obwohl er sich in nachdenklichen Momenten oft verwünschte für diese verachtungswürdige Selbstvergessenheit – er konnte sich nicht ändern.
Heute beschoß er: »Ich verlasse das Krankenhaus. Ich fahre aufs Festland.«
... Am fünften Dezember des Jahres neunzehnhundertsiebenundvierzig lief das Dampfschiff »KIM« mit menschlicher Fracht – dreitausend Häftlingen – in die Bucht von Nagajewo ein. Unterwegs hatten die Häftlinge revoltiert, und die Leitung beschloß, alle Schiffsräume unter Wasser zu setzen. All das geschah bei vierzig Grad Frost. Was Erfrierungen dritten, vierten Grades sind, wie Braude sagte – oder Abfrierungen, wie Kubanzew sich ausdrückte –, konnte Kubanzew am allerersten Tag seines einträglichen Dienstes an der Kolyma erfahren.
Das alles mußte man vergessen, und Kubanzew, ein disziplinierter und willensstarker Mann, tat das auch. Er zwang sich zu vergessen.
Nach siebzehn Jahren erinnerte sich Kubanzew an den Namen und Vatersnamen jedes gefangenen Feldschers, an jede Krankenschwester, er erinnerte sich, wer von ihnen mit welchem Häftling »lebte«, gemeint sind damit Lager-Verhältnisse. Er erinnerte sich an den genauen Rang jedes der niederträchtigeren Chefs. Nur an eins erinnerte sich Kubanzew nicht – an den Dampfer »KIM« mit dreitausend Häftlingen und ihre Erfrierungen.
Bei Anatole France gibt es eine Erzählung »Der Statthalter von Judäa«. Dort kann sich Pontius Pilatus nach siebzehn Jahren nicht an Christus erinnern.
1965
Die Aussätzigen
Gleich nach dem Krieg wurde vor meinen Augen im Krankenhaus ein weiteres Drama gespielt – genauer gesagt, das Ende eines Dramas.
Der Krieg hatte Schichten, hatte Stücke des Lebens von seinem Grund nach oben und ans Licht gehoben, die sich immer und überall vor dem hellen Sonnenlicht versteckt hatten. Das sind nicht die Kriminellen, keine Untergrundzirkel. Das ist etwas vollkommen anderes.
Während der Kriegshandlungen waren die Leprastationen zerschlagen worden, und die Aussätzigen hatten sich unter die Bevölkerung gemischt. War das ein heimlicher oder ein offener Krieg? Ein chemischer oder bakteriologischer?
Die vom Aussatz Befallenen konnten sich leicht als Verwundete ausgeben, als Kriegskrüppel. Die Aussätzigen mischten sich unter die gen Osten Fliehenden und kehrten zurück ins wirkliche, wenn auch schreckliche Leben, wo man sie für Kriegsopfer hielt, vielleicht für Helden.
Die Aussätzigen lebten und arbeiteten. Der Krieg mußte zu Ende gehen, damit sich die Ärzte an die Aussätzigen erinnerten und die schrecklichen Karteikästen der Leprastationen sich wieder zu füllen begannen.
Die Aussätzigen hatten unter den Menschen gelebt und den Rückmarsch, den Vormarsch, die Freude oder Bitternis des Siegs geteilt. Die Aussätzigen hatten in Fabriken und auf dem Feld gearbeitet. Sie waren Chefs und Untergebene geworden. Nur Soldaten waren sie niemals geworden, daran hinderten sie die Fingerstümpfe, die den Kriegsverwundungen ähnlich, zum Verwechseln ähnlich waren. Die Aussätzigen gaben sich auch als Kriegskrüppel aus – Einzelne unter Millionen.
Sergej Fedorenko war Leiter des Lagerhauses. Als Kriegsinvalide kam er mit seinen widerspenstigen Fingerstümpfen geschickt zurecht und machte seine Sache gut. Ihn erwarteten Karriere und Parteibuch, doch kaum hatte Fedorenko Geld, begann er zu trinken, zu bummeln, er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und kam mit einem der Kolymaschiffe nach Magadan, zu zehn Jahren verurteilt nach einem Sozialparagraphen.
Hier änderte Fedorenko seine Diagnose. Obwohl es auch hier genug Krüppel, zum Beispiel Gliederabhacker, gab. Aber es war vorteilhafter, moderner, weniger auffällig, in der Flut der Erfrierungen unterzugehen.
Und so traf ich ihn auch im Krankenhaus an – Folgeerscheinungen von Erfrierungen dritten, vierten Grades, eine nicht verheilende Wunde, Fußstumpf, Fingerstümpfe an beiden Händen.
Fedorenko wurde behandelt. Die Behandlung brachte keine Ergebnisse. Aber jeder Kranke widersetzte sich ja der Behandlung, so gut er konnte und vermochte. Nach vielen Monaten mit trophischen Geschwüren wurde Fedorenko entlassen, und weil er im Krankenhaus bleiben wollte, wurde Fedorenko Sanitäter, er kam als Obersanitäter in die chirurgische Abteilung mit rund dreihundert Plätzen. Das Krankenhaus war ein Zentralkrankenhaus, mit tausend Betten allein für die Häftlinge. Im Anbau war auf einer der Etagen ein Krankenhaus für Freie.
Irgendwann wurde der Arzt krank, der Fedorenkos Krankengeschichte betreute, und an seiner Stelle begann Doktor Krasinskij »einzutragen«, ein alter Militärarzt und Verehrer Jules Vernes (warum?), ein Mann, dem das Leben an der Kolyma das Verlangen zu plaudern, sich zu unterhalten und Meinungen auszutauschen, nicht genommen hatte.
Als er Fedorenko untersuchte, war Krasinskij verblüfft – er wußte selbst nicht, wovon. Seit seiner Studienzeit befiel ihn diese Unruhe. Nein, das war kein trophisches Geschwür, kein Stumpf nach einer Explosion oder dem Beil. Das war langsam zerfallendes Gewebe. Krasinskijs Herz begann zu schlagen. Er rief Fedorenko noch einmal zu sich, zog ihn ans Fenster, ans Licht, und betrachtete gierig sein Gesicht, ungläubig. Das war Lepra! Das war die Löwenmaske! Ein menschliches Gesicht, das aussah wie das eines Löwen. Fieberhaft blätterte Krasinskij in den Lehrbüchern. Er nahm eine große Nadel und stach mehrmals in ein helles Fleckchen, von denen es auf Fedorenkos Haut viele gab. Keinerlei Schmerz! Schweißüberströmt schrieb Krasinskij einen Rapport an die Leitung. Der Kranke Fedorenko wurde in einem Einzelzimmer isoliert, Hautstückchen wurden zur Biopsie ins Zentrum, nach Magadan, und von dort – nach Moskau eingeschickt. Die Antwort kam nach etwa zwei Wochen. Lepra! Krasinskij war der Held des Tages. Natschalniks korrespondierten mit Natschalniks über das Ausstellen eines Marschbefehls ins Leprosorium der Kolyma. Dieses Leprosorium ist auf einer Insel gelegen, und an beiden Ufern stehen auf die Übersetzstelle gerichtete Maschinengewehre. Einen Marschbefehl, man brauchte einen Marschbefehl.
Fedorenko stritt nicht ab, daß er im Leprosorium war und daß die Aussätzigen, sich selbst überlassen, in die Freiheit geflohen waren. Die einen – um den Zurückweichenden nachzueilen, die anderen – um Hitlers Leute zu empfangen. So wie im normalen Leben. Fedorenko erwartete seinen Abtransport ruhig, aber das Krankenhaus tobte. Das gesamte Krankenhaus. Auch die, die bei Verhören geschlagen und deren Seelen in Tausenden Verhören zertrümmert worden waren, deren Körper von der die Kräfte übersteigenden Arbeit verkrüppelt, zerquält waren, bei Haftzeiten von fünfundzwanzig plus fünf – Haftzeiten, die man nicht erleben, überleben, am Leben bleiben konnte ... Alle zitterten, schrieen, verfluchten Fedorenko und fürchteten sich vor dem Aussatz.
Das ist dasselbe psychische Phänomen, das den Flüchtling nötigt, die wohlvorbereitete Flucht aufzuschieben, weil es an diesem Tag im Lager Tabak gibt – oder das »Lädchen«. So zahlreich die Lager sind, so zahlreich auch solche sonderbaren, aller Logik fernen Beispiele.
So etwa die menschliche Scham. Wo sind ihre Grenzen und ihr Maß? Menschen, deren Leben zerstört ist, deren Vergangenheit und Zukunft zertreten sind, unterwerfen sich plötzlich der Macht eines albernen Vorurteils, eines Unsinns, über den sie sich aus irgendeinem Grund nicht hinwegsetzen, den sie aus irgendeinem Grund nicht zurückweisen können. Und dieses plötzliche Bekunden von Scham tritt auf als das feinste menschliche Gefühl und wird später ein Leben lang als etwas Echtes, etwas unendlich Teures erinnert. Im Krankenhaus gab es einen Fall, wo ein Feldscher, der noch gar kein Feldscher war, sondern einfach half, den Auftrag bekam, Frauen zu rasieren, einen Frauentransport zu rasieren. Die Leitung amüsierte sich, indem sie Frauen befahl, die Männer zu rasieren, und Männern – die Frauen. Jeder amüsiert sich wie er kann. Aber der Friseur beschwor seine Bekannte, dieses Ritual der sanitären Versorgung selbst zu vollziehen und wollte nicht daran denken, daß das Leben ja zerstört war; daß all diese Amüsements der Lagerleitung nur der schmutzige Schaum auf diesem schrecklichen Kessel waren, in dem sein eigenes Leben zu Tode kochte.
Dieses Menschliche, Drollige, Zarte tritt in den Menschen unerwartet zutage.
Im Krankenhaus herrschte Panik. Fedorenko hatte ja einige Monate dort gearbeitet. Leider dauert die Inkubationszeit der Erkrankung, bis zum Auftreten äußerer Krankheitszeichen, bei Aussatz einige Jahre. Die Ängstlichen waren dazu verurteilt, die Angst auf ewig in der Seele zu bewahren, ob Freier oder Häftling – ganz gleich.
Es herrschte Panik im Krankenhaus. Die Ärzte suchten fieberhaft bei den Kranken und beim Personal nach den weißen, gefühllosen Fleckchen. Die Nadel wurde, zusammen mit Phon-Endoskop und Hämmerchen, zum unentbehrlichen Hilfsmittel des Arztes bei der Erstuntersuchung.
Der Kranke Fedorenko wurde gebracht und vor den Feldschern und Ärzten ausgezogen. Ein Aufseher mit Pistole stand in einiger Entfernung vom Kranken. Doktor Krasinskij, mit einem riesigen Zeigestock bewaffnet, sprach über die Lepra und wies mit dem Stock mal auf das Löwengesicht des ehemaligen Sanitäters, mal auf seine abfallenden Finger, mal auf die glänzenden weißen Flecken auf seinem Rücken.
Überprüft wurde buchstäblich die gesamte Population des Krankenhauses, Freie und Häftlinge, und plötzlich zeigte sich ein weißes Fleckchen, ein gefühlloses weißes Fleckchen, auf dem Rücken von Schura Leschtschinskaja, einer Frontschwester – jetzt Diensthabende in der Frauenabteilung. Leschtschinskaja war erst seit kurzem im Krankenhaus, ein paar Monate. Keinerlei Löwenmaske. In ihrem Auftreten war Leschtschinskaja nicht strikter und nicht nachsichtiger, nicht lauter und nicht ungenierter als jede andere gefangene Krankenschwester.
Leschtschinskaja wurde in eines der Zimmer der Frauenabteilung eingeschlossen und ein Stückchen ihrer Haut nach Magadan, nach Moskau zur Analyse geschickt. Und die Antwort kam: Lepra!
Desinfektion bei Aussatz ist eine schwierige Angelegenheit. Man soll die Hütte abbrennen, in der der Aussätzige gewohnt hat. So schreiben es die Lehrbücher vor. Aber einen Krankensaal in einem riesigen zweistöckigen Haus, in einem Hausgiganten abzubrennen, niederzubrennen! Dazu konnte sich niemand entschließen. Ebenso wie man bei der Desinfektion teurer Pelzsachen risikiert, daß die Infektion bestehen, dafür der Pelzreichtum bewahrt bleibt – indem man die wertvollen Pelze nur symbolisch einsprüht –, denn in der »Hitzekammer«, bei der hohen Temperatur, gehen nicht nur die Mikroben kaputt, sondern auch die Sachen selbst. Die Leitung hätte sogar bei Pest oder Cholera geschwiegen.
Jemand übernahm die Verantwortung dafür, auf das Abbrennen zu verzichten. Auch das Zimmer, in dem Fedorenko eingeschlossen war, als er auf den Abtransport in die Leprastation wartete, wurde nicht abgebrannt. Es wurde einfach alles mit Phenol, mit Karbolsäure übergossen und vielfach abgespritzt.
Und sofort kam eine neue schwerwiegende Unruhe auf. Fedorenko wie Leschtschinskaja belegten jeder einen großen Krankensaal mit mehreren Betten.
Antwort und Marschbefehl – der Marschbefehl für zwei Personen und die Begleitposten für zwei Personen waren noch immer nicht angekommen, angereist, wie sehr die Leitung in ihren tagtäglichen, vielmehr allnächtlichen Telegrammen nach Magadan auch mahnte.
Unten, im Keller, wurde ein Raum abgetrennt und zwei kleine Zellen für die aussätzigen Häftlinge eingerichtet. Dorthin wurden Fedorenko und Leschtschinskaja verlegt. Eingesperrt hinter einem schweren Schloß, mit Begleitposten, wurden die Aussätzigen dort gelassen, um auf den Befehl, den Marschbefehl ins Leprosorium und den Begleitposten zu warten.
Vierundzwanzig Stunden hatten Fedorenko und Leschtschinskaja in ihren Zellen verbracht, und nach vierundzwanzig Stunden fand die Wachablösung die Zellen leer.
Im Krankenhaus brach Panik aus. In den Zellen war alles, die Fenster und Türen, an seinem Platz.
Krasinskij kam als erster darauf. Sie waren durch den Fußboden entkommen.
Der athletische Fedorenko hatte die Deckenbalken auseinandergenommen, war in den Korridor gelangt, hatte den Brotschneideraum und den Operationssaal der chirurgischen Abteilung geplündert und, nachdem er den gesamten Alkohol, alle Tinkturen aus dem Schränkchen, alle »Kodeinchen« eingesammelt hatte, seine Beute in die unterirdische Höhle verschleppt.
Die Aussätzigen wählten einen Platz, trennten ein Lager ab, warfen Decken und Matratzen darauf, verbarrikadierten sich mit den Balken gegen die Welt, den Begleitposten, das Krankenhaus und das Leprosorium und lebten ein paar Tage, drei Tage wohl, als Mann und Frau zusammen.
Am dritten Tag fanden menschliche Suchtrupps und die Suchhunde der Wache die Aussätzigen. Auch ich lief in dieser Gruppe, ein wenig [gebeugt], durch den hohen Keller des Krankenhauses. Das Fundament war dort sehr hoch. Wir nahmen die Balken auseinander. Ganz hinten lagen – und rührten sich nicht – die beiden nackten Aussätzigen. Fedorenkos verstümmelte dunkle Hände hielten Leschtschinskajas weißen glänzenden Körper umfaßt. Beide waren betrunken.
Man deckte sie mit Decken zu und trug sie in eine Zelle, ohne sie wieder zu trennen.
Aber wer hat sie mit der Decke bedeckt, wer hat diese schrecklichen Körper berührt? Ein besonderer Sanitäter, den man im Krankenhaus für das Versorgungspersonal gefunden hatte und dem man (nach einer Erklärung der obersten Leitung) sieben Tage Anrechnung für einen Arbeitstag gab. Mehr also als beim Wolfram, beim Zinn, beim Uran. Sieben Tage für einen. Der Artikel hatte diesmal keine Bedeutung. Ein Frontkämpfer war gefunden, der für Vaterlandsverrat saß, der fünfundzwanzig plus fünf hatte und naiv annahm, mit seinem Heroismus könne er die Haftdauer verkürzen, den Tag der Rückkehr in die Freiheit näherbringen.
Der Häftling Korolkow, ein Leutnant aus dem Krieg, wachte rund um die Uhr vor der Zelle. Er schlief auch vor der Zellentür. Und als der Begleitposten von der Insel kam, wurde der Häftling Korolkow zur Versorgung der Aussätzigen mitgenommen. Danach habe ich weder von Korolkow noch von Fedorenko oder Leschtschinskaja jemals wieder etwas gehört.
1963
In der Aufnahme
»Eine Etappe aus dem Bergwerk Solotistyj!«
»Was für ein Bergwerk?«
»Ein suka-Bergwerk.«
»Bestell Soldaten zur Durchsuchung.«
»Die Soldaten lassen es durchgehen. Kadertruppen.«
»Lassen sie nicht. Ich werde in der Tür stehen.«
»Gut, dann vielleicht so.«
Die Etappe, schmutzig und staubig, stieg aus. Das war eine »bedeutsame« Etappe – zu viele Breitschultrige, zu viele Verbände, der Anteil der Chirurgiepatienten allzu groß für eine Etappe aus dem Bergwerk.
Die diensthabende Ärztin trat ein, Klawdija Iwanowna, eine Freie.
»Fangen wir an?«
»Warten wir, bis die Soldaten für die Durchsuchung da sind.«
»Ein neues Verfahren?«
»Ja. Ein neues Verfahren. Sie werden gleich sehen, was los ist, Klawdija Iwanowna.«
»Tritt in die Mitte – hier, mit den Krücken. Die Papiere!«
Der Arbeitsanweiser reichte die Papiere herüber – eine Einweisung ins Krankenhaus. Die Lagerakten behielt der Arbeitsanweiser bei sich, legte sie beiseite.
»Nimm den Verband ab. Gib die Binden, Grischa. Unsere Binden. Klawdija Iwanowna, bitte schauen Sie sich den Bruch an.«
Die weiße Schlangenlinie der Binde glitt zu Boden. Mit dem Fuß schleuderte der Feldscher die Binde zur Seite. An der Transportschiene befestigt war nicht ein Messer, sondern ein Spieß, ein großer Stift – die portabelste Waffe des »suka«-Kriegs. Beim Aufprall auf den Boden klirrte der Spieß, und Klawdija Iwanowna wurde blaß.
Die Soldaten schnappten sich den Spieß.
»Nehmen Sie alle Verbände ab.«
»Und der Gips?«
»Schneiden Sie alle Gipse auf. Morgen werden neue angelegt.«
Der Feldscher lauschte, ohne hinzuschauen, auf die gewohnten Klänge der Eisen, die auf den Steinboden schlagen. Unter jedem Gipsverband war eine Waffe. Hineingeschoben und eingegipst.
»Verstehen Sie, was das bedeutet, Klawdija Iwanowna?«
»Ich verstehe.«
»Ich auch. Einen Rapport an die Leitung werden wir nicht schreiben, aber mündlich sagen wir es dem Chef der Sanitätsabteilung des Bergwerks, nicht wahr, Klawdija Iwanowna?«
»Zwanzig Messer – melden Sie das dem Arzt, Aufseher, auf fünfzehn Mann von der Etappe.«
»Das nennen Sie Messer? Das sind eher Spieße.«
»Und jetzt, Klawdija Iwanowna, alle Gesunden – zurück. Und gehen Sie und schauen den Film zu Ende. Verstehen Sie, Klawdija Iwanowna, in diesem Bergwerk hat einmal ein Stümper von Arzt eine Diagnose geschrieben, als ein Kranker aus einem Fahrzeug gefallen war und sich verletzt hatte, ›prolapsus aus Auto‹ – wie ›prolapsus recti‹, Dickdarmvorfall. Aber Waffen einzugipsen hat er gelernt.«
Ein böses Auge ohne Hoffnung sah den Feldscher an.
»So, wer krank ist, wird ins Krankenhaus aufgenommen«, sagte Klawdija Iwanowna. »Treten Sie einzeln vor.«
Die Chirurgiepatienten, die den Rücktransport erwarteten, fluchten unflätig und ungeniert. Die verlorenen Hoffnungen lösten ihnen die Zunge. Die Ganoven beschimpften die diensthabende Ärztin, den Feldscher, die Wache, die Sanitäter.
»Dir stechen wir noch die Augen aus«, tönte ein Patient.
»Was kannst du mir tun, Dreckstück. Bloß im Schlaf abstechen. Siebenunddreißig habt ihr im Bergwerk auch nicht wenige Artikel Achtundfünfziger mit dem Stock totgeschlagen. Habt ihr die Alten und alle möglichen Iwan Iwanowitschs vergessen?«
Doch nicht nur auf die »chirurgischen« Ganoven mußte man ein Auge haben. Viel schmerzlicher war es, Versuche zu entlarven, in die Tuberkuloseabteilung zu kommen, wozu der Kranke in einem Stoffetzen Bazillen»rotz« mitbrachte – sichtlich hatte man den Tuberkulosekranken auf die ärztliche Untersuchung vorbereitet. Der Arzt sagte: »Spuck ins Schälchen«, es wurde eine Eilanalyse auf das Vorkommen des Kochbazillus gemacht. Vor der ärztlichen Untersuchung nahm der Kranke den bazillenverseuchten »Rotz« in den Mund und steckte sich natürlich mit Tuberkulose an. Dafür kam er ins Krankenhaus und entging dem Schlimmsten – der Arbeit im Goldbergwerk. Wenn auch nur für eine Stunde, nur für einen Tag, nur für einen Monat.
Schmerzlicher war es, jene zu entlarven, die in einem Fläschchen Blut mitbrachten oder sich den Finger ritzten und Blutstropfen in den eigenen Urin gaben, um mit Hämaturie ins Krankenhaus zu kommen, um auch nur bis morgen, auch nur eine Woche liegenzubleiben. Und dann – wie Gott will.
Diese Leute waren nicht wenige. Sie waren raffinierter. Den Tuberkulose»rotz« hätten sie für die Hospitalisierung nicht in den Mund genommen. Diese Leute hatten auch davon gehört, was Eiweiß ist und wozu man eine Urinanalyse macht. Welchen Nutzen der Kranke davon hat. Die Monate, die sie in Krankenhausbetten verbrachten, hatten sie vieles gelehrt. Es gab Kranke mit Kontrakturen, vorgetäuschten – unter Narkose, im Rausch bog man ihnen die Knie- und Ellbogengelenke gerade. Zweimal vielleicht war die Kontraktur, die Verwachsung echt gewesen, und der entlarvende Arzt, ein Athlet, zerriß beim Geradebiegen des Knies das lebendige Gewebe. Er hatte des Guten zuviel getan, die eigene Kraft falsch eingeschätzt.
Die meisten kamen mit »Selbstverletzungen«, trophischen Geschwüren – mittels einer kräftig mit Petroleum eingeschmierten Nadel wurde eine subkutane Entzündung herbeigeführt. Diese Kranken kann man aufnehmen oder auch nicht. Vitale Indikationen gibt es hier keine.
Besonders viele »Selbstverletzer« waren Frauen aus der Sowchose »Eigen«, und später, als das neue Frauen-Goldbergwerk Debna – mit Schubkarre, Schaufel und Hacke für die Frauen – eröffnet wurde, stieg die Zahl der Selbstverletzerinnen aus diesem Bergwerk heftig an. Das war auch das Bergwerk, wo eine Ärztin von Sanitäterinnen mit der Axt erschlagen wurde, die wunderbare weißhaarige Ärztin Schizel von der Krim. Früher hatte Schizel im Krankenhaus gearbeitet, doch ihre Personaldaten hatten sie ins Goldbergwerk und in den Tod geführt.
Klawdija Iwanowna geht und schaut sich die Aufführung der Kulturbrigade des Lagers zu Ende an, und der Feldscher legt sich schlafen. Doch nach einer Stunde wird er geweckt: »Eine Etappe. Eine Frauenetappe aus Elgen.«
In dieser Etappe wird es so einiges geben. Das ist Sache der Aufseher. Die Etappe ist klein, und Klawdija Iwanowna erbietet sich, die gesamte Etappe allein zu empfangen. Der Feldscher bedankt sich, schläft ein und wird sofort wieder aufgeweckt von einem Stoß und von Tränen, den bitteren Tränen Klawdija Iwanownas. Was ist denn dort geschehen?
»Ich kann hier nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr. Ich schmeiße den Dienst hin.«
Der Feldscher wirft sich eine Handvoll kaltes Wasser aus dem Hahn ins Gesicht, trocknet sich mit dem Ärmel ab und geht in die Aufnahme.
Alle lachen laut! Die Kranken, die angereiste Wache, die Aufseher. Für sich allein wälzt sich auf der Liege eine schöne, eine sehr schöne junge Frau von einer Seite auf die andere. Die junge Frau ist nicht zum ersten Mal im Krankenhaus.
»Guten Tag, Walja Gromowa.«
»Na, jetzt bekomme ich wenigstens einen Menschen zu sehen.«
»Was ist hier für ein Lärm?«
»Sie nehmen mich nicht ins Krankenhaus auf.«
»Und warum nimmt man sie denn nicht auf? Es geht schlecht mit ihrer Tuberkulose.«
»Das ist doch ein Kerl«, mischt sich grob der Arbeitsanweiser ein. »Es hat eine Anordnung gegeben zu ihr. Aufnahme verboten. Sie hat doch ohne mich geschlafen. Oder ohne ihren Mann ...«
»Die lügen alle«, schreit Walja Gromowa frech. »Sehen Sie, was ich für Finger habe. Was für Nägel ...«
Der Feldscher spuckt auf den Boden und geht ins andere Zimmer. Klawdija Iwanowna hat einen hysterischen Anfall.
1965
Geologen
In der Nacht wurde Krist geweckt, und der diensthabende Aufseher führte ihn durch die endlosen Korridore ins Kabinett des Krankenhaus-Chefs. Der Oberstleutnant des medizinischen Dienstes schlief noch nicht. Lwow, der Bevollmächtigte des Ministeriums für Innere Angelegenheiten, saß am Tisch des Chefs und zeichnete auf ein Blättchen Papier irgendwelche gleichgültigen Vögelchen.
»Feldscher Krist aus der Aufnahme ist da, auf Ihre Aufforderung, Bürger Natschalnik.«
Der Oberstleutnant machte ein Handzeichen, und der diensthabende Aufseher, der mit Krist gekommen war, verschwand.
»Hör zu, Krist«, sagte der Chef, »man bringt dir Gäste.«
»Es kommt eine Etappe«, sagte der Bevollmächtigte.
Krist schwieg erwartungsvoll.
»Du machst das Bad. Desinfektion und das übrige.«
»Zu Befehl.«
»Kein Mensch darf von diesen Leuten wissen. Keinerlei Kontakt.«
»Wir vertrauen dir«, erläuterte der Bevollmächtigte und bekam einen Hustenanfall.
»Mit dem Desinfektionsraum komme ich allein nicht zurecht, Bürger Natschalnik«, sagte Krist. »Die Steuerung und die Mischkammer mit dem heißen und kalten Wasser liegen weit auseinander. Dampf und Wasser sind getrennt.«
»Das heißt ...«
»Man braucht einen weiteren Sanitäter, Bürger Natschalnik.«
Die Chefs sahen einander an.
»Dann gibt es den Sanitäter«, sagte der Bevollmächtigte.
»Du hast also verstanden? Zu niemandem ein Wort.«
»Verstanden, Bürger Natschalnik.«
Krist und der Bevollmächtigte gingen. Der Chef stand auf, löschte das Oberlicht und zog seinen Mantel an.
»Woher so eine Etappe?«, fragte Krist den Bevollmächtigten leise, auf dem Weg durch den langen Vorraum des Kabinetts – eine Moskauer Mode, die man überall nachahmte, wo es Chefkabinette gab, zivile oder militärische, ganz gleich.
»Woher?«
Der Bevollmächtigte lachte laut.
»Ach, Krist, Krist, ich hätte gar nicht gedacht, daß du mir so eine Frage stellen könntest ...« Und er sagte kühl: »Mit dem Flugzeug aus Moskau.«
»Das heißt, sie kennen das Lager nicht. Gefängnis, Untersuchung und alles übrige. Der erste Spaltbreit freie Luft, wie es ihnen scheint – allen, die das Lager nicht kennen. Mit dem Flugzeug aus Moskau ...«
In der nächsten Nacht füllte sich das hallende, weiträumige, große Vestibül mit fremdem Volk – Offizieren, Offizieren, Offizieren. Majore, Oberstleutnants, Oberste. Selbst ein General war da, kleingewachsen, jung, schwarzäugig. Unter den Begleitposten – kein einziger Soldat.
Ein knochiger und hochgewachsener Greis, der Krankenhaus-Chef, beugte sich mühsam herab und meldete dem kleinen General:
»Alles bereit zum Empfang.«
»Hervorragend, hervorragend.«
»Das Badehaus!«
Der Chef machte Krist ein Handzeichen, und die Türen der Aufnahme öffneten sich.
Die Menge der Offiziersmäntel trat auseinander. Das goldene Sternenlicht der Schulterstücke verblaßte – alle Aufmerksamkeit der Ankömmlinge und der Empfangenden galt einer kleinen Gruppe schmutziger Leute in irgendwelchen abgetragenen Lumpen – aber keiner Staatskleidung, nein – der eigenen, zivilen, aus der Untersuchungshaft, von der Streu auf den Böden der Gefängniszelle verschlissenen.
Zwölf Männer und eine Frau.
»Anna Petrowna, bitte«, sagte ein Häftling und ließ der Frau den Vortritt.
»Aber nein, gehen Sie und waschen Sie sich. Ich bleibe erst einmal sitzen und ruhe mich aus.«
Die Tür der Aufnahme schloß sich.
Alle standen um mich herum und blickten mir gierig in die Augen, versuchten, etwas zu erraten, noch ehe sie fragten.
»Sind Sie schon lange an der Kolyma?«, fragte der mutigste, nachdem er in mir einen »Iwan Iwanowitsch« erkannt hatte.
»Seit siebenunddreißig.«
»Siebenunddreißig waren wir alle noch ...«
»Still«, mischte sich ein anderer, älterer ein.
Unser Aufseher erschien, der Sekretär der Krankenhaus-Parteiorganisation Chabibulin, ein besonderer Vertrauter des Chefs. Chabibulin überwachte sowohl die Ankömmlinge als auch mich.
»Und das Rasieren?«
»Der Friseur ist bestellt«, sagte Chabibulin. »Der Perser Jurka, ein Ganove.«
Der Perser Jurka, der Ganove, erschien bald mit seinem Instrument. Er war an der Wache instruiert worden und grunzte nur.
Die Aufmerksamkeit der Ankömmlinge wandte sich wieder Krist zu.
»Machen wir Ihnen keine Scherereien?«
»Wie könnten Sie mir Scherereien machen, meine Herren Ingenieure – das sind Sie, nicht wahr?«
»Geologen.«
»Meine Herren Geologen.«
»Und wo sind wir?«
»An der Kolyma. Fünfhundert Kilometer von Magadan.«
»Nun, leben Sie wohl. Eine gute Sache – das Badehaus.«
Die Geologen kamen – alle! – von auswärtigen Arbeitseinsätzen, aus dem Ausland. Sie hatten Haftstrafen bekommen – von 15 bis 25. Und über ihr Schicksal verfügte eine besondere Verwaltung, in der es so wenige Soldaten gab und so viele Offiziere und Generäle.
Mit der Kolyma und dem Dalstroj hatten diese Generäle nichts zu tun. Von der Kolyma kam nur die Bergluft durch die vergitterten Fenster, eine große Ration, das Badehaus dreimal im Monat, ein Bett und Wäsche ohne Läuse und ein Dach. Von Spaziergängen und Kino war noch keine Rede. Moskau hatte für die Geologen ihre Polardatscha ausgesucht.
Eine große Arbeit auf ihrem Fachgebiet hatten die Geologen der Leitung vorgeschlagen – eine weitere Version des Ramsinschen Durchlaufkessels.
Einen Funken schöpferischen Feuers kann man mit einem gewöhnlichen Stock schlagen – das weiß man nach der »Umschmiedung« und den zahlreichen Weißmeerkanälen. Der flexible Einsatz von Nahrungsanreizen und -strafen, die Anrechnung von Arbeitstagen und eine Hoffnung – schon wird Sklavenarbeit zu segensreicher Arbeit.
Nach einem Monat kam der kleine General angereist. Die Geologen wünschten ins Kino zu gehen, ins Kino für Häftlinge und Freie. Der kleine General stimmte die Frage mit Moskau ab und erlaubte den Geologen das Kino. Der Balkon – die Loge, in der früher die Leitung gesessen hatte, wurde abgeteilt, mit Gefängnisgittern gesichert. Neben der Leitung saßen nun in den Kinovorführungen die Geologen.
Bücher aus der Lagerbibliothek gab man den Geologen nicht. Nur technische Literatur.
Der Sekretär der Parteiorganisation, der kranke Dalstroj-Veteran Chabibulin, schleppte zum ersten Mal in seinem Aufseherleben eigenhändig die Bündel mit der Wäsche der Geologen in die Wäscherei. Das bedrückte den Aufseher mehr als alles auf der Welt.
Nach einem weiteren Monat kam der kleine General angereist, und die Geologen baten um Vorhänge an den Fenstern.
»Vorhänge«, sagte Chabibulin traurig, »Vorhänge brauchen sie.«
Der kleine General war zufrieden. Die Arbeit der Geologen schritt voran. Einmal in zehn Tagen wurde nachts die Aufnahme aufgeschlossen, und die Geologen wuschen sich im Badehaus.
Krist unterhielt sich wenig mit ihnen. Und was konnten ihm auch Geologen im Untersuchungsverfahren sagen, was Krist nicht aus dem eigenen Lagerleben wußte?
Da wandte sich die Aufmerksamkeit der Geologen dem persischen Friseur zu.
»Du solltest mit ihnen nicht viel reden, Jurka«, sagte Krist irgendwann.
»Jeder frajer wird mich noch belehren.« Und der Perser fluchte unflätig.
Ein weiteres Bad hatte stattgefunden; der Perser kam sichtlich betrunken, vielleicht hatte er auch »tschifir getankt« oder »ein Kodeinchen«. Aber er benahm sich zu forsch, wollte schnell nach Hause, sprang aus der Wache auf die Straße, ohne auf einen Begleiter zu warten, und durchs offene Fenster hörte Krist den trockenen Knall eines Revolverschusses. Der Perser war vom Aufseher erschossen worden, von dem, den er gerade rasiert hatte. Der zusammengekrümmte Körper lag an der Vortreppe. Der diensthabende Arzt fühlte den Puls und unterschrieb das Protokoll. Es kam ein anderer Friseur, Aschot, ein armenischer Terrorist aus derselben Kampfgruppe armenischer Sozialrevolutionäre, die 1926 drei türkische Minister umgebracht hatte, – mit ihrem Führer Talaat Pascha, dem Urheber des Armenischen Blutbads von 1915, bei dem eine Million Armenier vernichtet wurden ... Die Ermittlungsabteilung prüfte Aschots Lagerakte, und die Geologen hat er nicht mehr rasiert. Man fand einen Ganoven, und man änderte auch das ganze Prinzip – jedes Mal rasierte ein neuer Friseur. Das galt als sicherer – es werden keine Verbindungen hergestellt. Im Butyrka-Gefängnis löst man so die Posten ab, im gleitenden Postensystem.
Die Geologen erfuhren nichts vom Perser und nichts von Aschot. Ihre Arbeit schritt erfolgreich voran, und der angereiste kleine General erlaubte den Geologen einen halbstündigen Spaziergang. Das war ebenfalls eine echte Erniedrigung für den alten Aufseher Chabibulin. In einem Lager voller ergebener, feiger, rechtloser Menschen ist der Aufseher ein großer Chef. Und der hiesige Aufseherdienst in seiner reinen Form gefiel Chabibulin nicht.
Immer trauriger wurden seine Augen, immer röter die Nase – Chabibulin fing schwer zu trinken an. Und einmal fiel er von der Brücke mit dem Kopf voraus in die Kolyma, doch er wurde gerettet und gab seinen wichtigen Aufseherdienst nicht ab. Ergeben schleppte er Wäschebündel in die Wäscherei, ergeben fegte er das Zimmer und wechselte die Vorhänge an den Fenstern.
»Na, wie ist das Leben?«, fragte Krist Chabibulin – immerhin taten sie hier seit mehr als einem Jahr gemeinsam Dienst.
»Schlecht ist das Leben«, seufzte Chabibulin.
Der kleine General reiste an. Die Arbeit der Geologen lief vorzüglich. Froh und lächelnd machte der General seine Runde durch das Gefängnis der Geologen. Der General erhielt für ihre Arbeit eine Auszeichnung.
Chabibulin stand an der Schwelle stramm und verabschiedete den General.
»Nun, gut, gut. Ich sehe, sie haben keine Scherereien gemacht«, sagte fröhlich der kleine General. »Und ihr«, der General wandte den Blick den an der Schwelle stehenden Aufsehern zu, »ihr geht höflicher mit ihnen um. Sonst hau ich euch kurz und klein, Kanaillen!«
Und der General entfernte sich.
Chabibulin erreichte schwankend die Aufnahme, nahm bei Krist eine doppelte Portion Baldrian und schrieb einen Rapport über seine sofortige Versetzung auf eine beliebige andere Arbeit. Er zeigte Krist den Rapport und suchte Mitgefühl. Krist versuchte dem Aufseher zu erklären, daß diese Geologen dem General wichtiger sind als Hunderte Chabibulins, doch der in seinen Gefühlen verletzte Oberaufseher wollte diese einfache Wahrheit nicht verstehen.
Die Geologen waren eines Nachts verschwunden.
1965
Bären
Das Katzenjunge kam unter dem Liegebett hervor und konnte gerade noch rechtzeitig zurückspringen – der Geologe Filatow hatte einen Stiefel nach ihm geworfen.
»Was wütest du so?«, sagte ich und legte einen speckigen Band »Monte Christo« zur Seite.
»Ich mag keine Katzen. Das hier ist etwas anderes.« Filatow zog einen grauen, wuscheligen Welpen an sich und klopfte seinen Hals. »Ein reiner Schäferhund. Beiß es, Kasbek, beiß«, der Geologe stachelte den Welpen gegen das Katzenjunge auf. Doch auf der Welpennase waren zwei frische Kratzer von Katzenkrallen, und Kasbek knurrte nur dumpf, aber rührte sich nicht.
Das Kätzchen hatte bei uns kein Leben. Fünf unbeschäftigte Männer ließen an ihm ihre Langeweile aus – das Flußhochwasser verzögerte unsere Abreise. Jushikow und Kotschubej, die Zimmerleute, spielten schon die zweite Woche Sechsundsechzig um ihren künftigen Lohn. Das Glück war wechselhaft. Der Koch machte die Tür auf und brüllte:
»Bären!« Alle stürzten Hals über Kopf zur Tür.
Also, wir waren fünf, und ein Gewehr hatte nur einer – der Geologe. Beile gab es nicht für alle, und der Koch steckte ein Küchenmesser ein, scharf wie ein Rasiermesser.
Die Bären liefen den Bergbach entlang – Männchen und Weibchen. Sie rüttelten und knickten junge Lärchen, rissen sie mitsamt den Wurzeln aus und schleuderten sie in den Bach. Sie waren allein auf der Welt in diesem Tajga-Mai, und die Menschen kamen von der Windschattenseite sehr dicht an sie heran – auf zweihundert Schritt. Der Bär war braun mit rötlichem Schimmer und doppelt so groß wie die Bärin, schon ein Alter, die großen gelben Eckzähne waren gut zu sehen.
Filatow, unser bester Schütze, hockte sich hin und stützte das Gewehr auf den Stamm einer umgestürzten Lärche, um aufgelegt und sicher zu schießen. Er bewegte den Lauf hin und her und suchte einen Weg für die Kugel zwischen den Blättern der gelb werdenden Büsche.
»Schieß«, knurrte der Koch mit vor Eifer bleichem Gesicht, »schieß!«
Die Bären hörten ein Geräusch. Sie reagierten sofort, wie ein Fußballer im Spiel. Die Bärin hetzte den Berghang hinauf, auf die andere Seite des Passes. Der alte Bär floh nicht. Die Schnauze der Gefahr zugewandt und die Eckzähne fletschend, lief er langsam über den Berg, zum Gestrüpp der Krummholzbüsche. Er nahm sichtlich die Gefahr auf sich, er, das Männchen, opferte sein Leben, um die Freundin zu retten, er lenkte den Tod von ihr ab, er deckte ihre Flucht.
Filatow schoß. Er war, wie ich schon sagte, ein guter Schütze – der Bär stürzte und rollte den Abhang hinab in die Schlucht, bis eine Lärche, die er vor einer halben Stunde im Spiel geknickt hatte, seinen schweren Körper aufhielt. Die Bärin war längst verschwunden.
Alles war so riesig – der Himmel, die Felsen –, daß der Bär wie ein Spielzeug aussah. Er war auf der Stelle tot. Wir banden ihm die Tatzen zusammen, schoben eine Stange zwischen ihnen durch und stiegen, unter dem Gewicht des schweren Tierkörpers schwankend, auf den Grund der Schlucht, auf das glatte zwei Meter dicke Eis, das noch nicht getaut war. Wir schleiften den Bären bis an die Schwelle unserer Hütte.
Der zwei Monate alte Welpe, der in seinem kurzen Leben noch keine Bären gesehen hatte, verzog sich unters Bett, wahnsinnig vor Angst. Das Katzenjunge verhielt sich anders. Wie toll stürzte es sich auf den Bärenkörper, dem wir zu fünft das Fell abzogen. Das Kätzchen riß Stücke des warmen Fleischs heraus, langte nach Tropfen geronnenen Bluts, tanzte auf den knotigen roten Muskeln des Tiers ...
Das Fell maß vier Quadratmeter.
»Das sind bestimmt zwölf Pud Fleisch«, sagte der Koch zu jedem.
Die Beute war reich, doch weil wir sie nicht abtransportieren und verkaufen konnten, wurde sie sofort zu gleichen Teilen geteilt. Kessel und Pfannen des Geologen Filatow brodelten Tag und Nacht, bis er sich den Magen verdarb. Jushikow und Kotschubej, die sich überzeugt hatten, daß Bärenfleisch zum Einsatz im Kartenspiel nicht taugt, salzten jeder sein Teil in mit Stein ausgelegten Gruben ein und gingen täglich hin und prüften seine Unversehrtheit. Der Koch versteckte das Fleisch an einem unbekannten Ort – er kannte ein Geheimnis des Einsalzens, aber weihte niemanden darin ein. Und ich fütterte das Kätzchen und den Welpen, und wir drei wurden mit dem Bärenfleisch am besten fertig. Die Erinnerungen an die erfolgreiche Jagd hielten für zwei Tage vor. Zu streiten begannen sie erst am dritten Tag, gegen Abend.
‹1956›
Das Kollier der Fürstin Gagarina
Die Zeit im Untersuchungsgefängnis rutscht durchs Gedächtnis und hinterläßt keine merklichen und markanten Spuren. Für alle sind das Untersuchungsgefängnis, die Begegnungen, die Menschen dort nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, das, wofür man im Gefängnis alle seelischen, alle Geistes- und Nervenkräfte verausgabt, ist der Kampf mit dem Untersuchungsführer. Was in den Kabinetten des Verhörblocks stattfindet, prägt sich stärker ein als das Gefängnisleben. Kein einziges Buch, das du im Gefängnis liest, bleibt dir im Gedächtnis – nur die »Dauer«-Gefängnisse waren eine Universität, aus der Sterndeuter, Romanciers und Memoirenschreiber hervorgingen. Die Bücher, die du im Untersuchungsgefängnis liest, bleiben dir nicht im Gedächtnis. Für Krist spielte nicht das Duell mit dem Untersuchungsführer die wichtigste Rolle. Krist verstand, daß er verloren war, daß die Verhaftung Verurteilung, Geopfertwerden bedeutet. Und Krist war ruhig. Er hatte sich die Fähigkeit zu beobachten bewahrt, die Fähigkeit bewahrt, gegen den einschläfernden Rhythmus des Gefängnisregimes zu handeln. Krist war oftmals einer unheilvollen menschlichen Gewohnheit begegnet: das Wichtigste von sich zu erzählen, dem Nachbarn – dem Zellennachbarn, dem Bettnachbarn, dem Mitreisenden in der Eisenbahn – sein ganzes Ich zu erzählen. Diese Geheimnisse, auf dem Grund der menschlichen Seele bewahrt, waren manchmal erschütternd und unglaublich.
Krists Nachbar zur Rechten, ein Mechaniker aus einer Fabrik in Wolokolamsk, erklärte auf die Bitte, sich an das herausragendste Ereignis in seinem Leben zu erinnern, an das Beste, was in seinem Leben passiert war – und dabei strahlte er von der durchlebten Erinnerung – er habe 1933 auf Lebensmittelkarten zwanzig Dosen Gemüsekonserven erhalten, und als er sie zu Hause aufmachte, war in allen Dosen Fleisch und in keiner einzigen Gemüse. Im Gefängnis lacht man nicht über solche Erinnerungen. Krists Nachbar zur Linken, der Generalsekretär der Vereinigung der politischen katorga-Häftlinge, Aleksandr Georgijewitsch Andrejew, zog die silbernen Brauen über der Nasenwurzel zusammen. Seine schwarzen Augen blitzten.
»Ja, so einen Tag gibt es in meinem Leben – der 12. März 1917. Ich bin ein Lebenslänglicher der zaristischen katorga. Und das Schicksal wollte es, daß ich den zwanzigsten Jahrestag dieses Ereignisses hier im Gefängnis begangen habe, mit Ihnen.«
Von der Pritsche gegenüber stieg ein wohlgestalteter und rundgesichtiger Mann.
»Erlauben Sie mir, mich an Ihrem Spiel zu beteiligen. Ich bin Doktor Miroljubow, Walerij Andrejewitsch.« Der Doktor lächelte schwach und kläglich.
»Setzen Sie sich«, sagte Krist und machte Platz. Das war sehr einfach – man mußte nur die Beine unterschlagen. Anders konnte man keinen Platz machen. Miroljubow kletterte sofort auf die Pritsche. Die Füße des Doktors steckten in Hausschuhen. Krist hob erstaunt die Brauen.
»Nein, nicht von zu Hause, aber in der Taganka, wo ich zwei Monate gesessen habe, geht es einfacher zu.«
»Die Taganka ist doch ein Strafgefängnis?«
»Ja, natürlich, ein Strafgefängnis«, bestätigte Doktor Miroljubow zerstreut. »Als Sie in die Zelle gekommen sind«, sagte Miroljubow und sah zu Krist auf, »hat sich das Leben verändert. Die Spiele bekamen mehr Sinn. Nicht wie dieses schreckliche ›Käferchen‹, für das sich alle begeisterten. Sie warteten sogar auf die Latrine, um auf dem Abort nach Herzenslust ›Käferchen‹ zu spielen. Wahrscheinlich haben Sie Erfahrung ...«
»Ja«, sagte Krist traurig und fest.
Miroljubow sah Krist an mit seinen gewölbten, guten, kurzsichtigen Augen.
»Die Brille haben mir die Ganoven abgenommen. In der Taganka.«
Krist schossen rasch und gewohnheitsmäßig Fragen, Annahmen, Ahnungen durchs Hirn ... Er sucht einen Rat. Er weiß nicht, wofür er verhaftet wurde. Übrigens ...
»Und warum wurden Sie von der Taganka hierher verlegt?«
»Ich weiß es nicht. Kein einziges Verhör in zwei Monaten. Und in der Taganka ... Ich war ja als Zeuge in einem Verfahren über Wohnungsdiebstahl vorgeladen. In unserer Wohnung wurde einem Nachbarn ein Mantel gestohlen. Ich wurde verhört und erhielt einen Haftbefehl ... Abrakadabra. Kein Wort – jetzt schon den dritten Monat. Und man hat mich in die Butyrka verlegt.«
»Tja«, sagte Krist. »Fassen Sie sich in Geduld. Bereiten Sie sich auf Überraschungen vor. Das ist gar kein solches Abrakadabra. Planmäßige Verwirrung, wie das der Kritiker Ijuda Grossman-Roschtschin nannte! Erinnern Sie sich an ihn? Den Kampfgefährten Machnos?«
»Nein, ich erinnere mich nicht«, sagte der Doktor. Miroljubows Hoffnung auf Krists Allwissenheit war versiegt, und der Glanz in seinen Augen erlosch.
Die kunstvollen Webmuster des Drehbuchs der Untersuchung waren sehr, sehr vielfältig. Das war Krist bekannt. Die Hinzuziehung in einem Verfahren um einen Wohnungsdiebstahl – selbst als Zeuge – erinnerte an die berühmten »Amalgame«. Jedenfalls waren Doktor Miroljubows Taganka-Abenteuer eine Ermittler-Tarnung, die die Poeten vom NKWD weiß Gott wozu brauchten.
»Reden wir, Walerij Andrejewitsch, von etwas anderem. Vom schönsten Tag im Leben. Vom aller-, allerherausragendsten Ereignis in Ihrem Leben.«
»Ja, ich habe es gehört, habe Ihr Gespräch gehört. Bei mir gab es so ein Ereignis, das mein gesamtes Leben verändert hat. Aber alles, was mir geschehen ist, gleicht weder der Geschichte Aleksandr Georgijewitschs«, Miroljubow neigte sich nach links zum Generalsekretär der Vereinigung der politischen katorga-Häftlinge, »noch der Geschichte dieses Genossen«, Miroljubow neigte sich nach rechts, zum Mechaniker aus Wolokolamsk ... »1901 war ich Medizinstudent im ersten Jahr, an der Moskauer Universität. Ich war jung. Voller erhabener Gedanken. Dumm. Einfältig.«
»Ein ›loch‹, wie die Ganoven sagen«, soufflierte ihm Krist.
»Nein, kein ›loch‹. Seit der Taganka verstehe ich ein bißchen Gaunersprache. Und woher haben Sie sie?«
»Im Selbstunterricht gelernt«, sagte Krist.
»Nein, kein ›loch‹, sondern so ein ... ›gaudeamus‹. Verstehen Sie? Das war ich.«