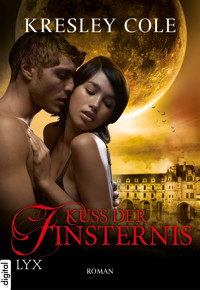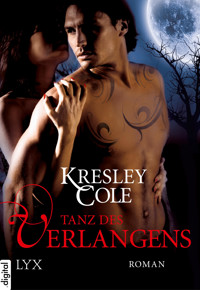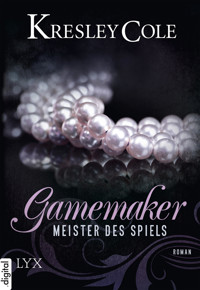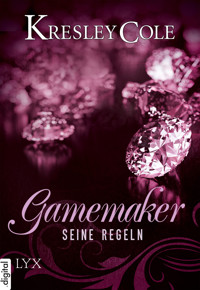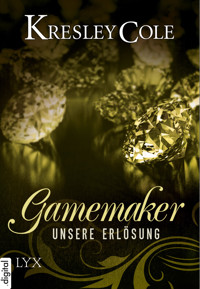9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Immortals After Dark
- Sprache: Deutsch
Getrieben von Rachedurst will der Vampir Lothaire die schöne Sterbliche Elizabeth Peirce töten. Doch nachdem er sie entführt hat, fühlt er sich schon bald unwiderstehlich zu ihr hingezogen. Kann er seine dunkle Vergangenheit vergessen, um mit Elizabeth eine gemeinsame Zukunft zu finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
KRESLEY COLE
Lothaire
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Bettina Oder
Zu diesem Buch
Elizabeth Peirce ist intelligent, bildhübsch – und leider besessen. In ihr wohnt seit Kurzem Saroya, die Göttin des Todes. Ellie wehrt sich nach Kräften gegen die feindliche Übernahme, und beide ringen erbittert um die Vorherrschaft über den Körper der jungen Frau. Denn jedes Mal, wenn die Göttin die Kontrolle übernimmt, steht am Ende ein entsetzliches Blutbad – und Ellie muss die Konsequenzen tragen! Der Versuch der jungen Frau, dem grausamen Treiben Einhalt zu gebieten, scheitert allerdings kläglich: Als sie sich in einem Schusswechsel mit der Polizei töten lassen will, um Saroya zur Hölle zurückzuschicken, schreitet der mächtige Vampir Lothaire ein. Saroya ist seine Braut – und Ellies Körper soll unversehrt bleiben. Aber die eigensinnige Frau hat nicht vor, sich in ihr Schicksal zu fügen. Sie setzt Leib und Leben aufs Spiel, um die unsterbliche Nervensäge endlich loszuwerden. Ellies letzte Chance ist es, die Todesstrafe an sich vollstrecken zu lassen, die ihr für die Morde, die Saroya begangen hat, auferlegt wurde. Als nun Ellies letzte Minute fast geschlagen hat, erhebt sich Lothaire, um sie zu seiner Gefangenen zu machen, damit dem Körper, in dem seine Auserwählte wohnt, kein Schaden zugefügt wird. Doch je mehr Zeit der rotäugige Vampir mit der frechen Sterblichen verbringt, desto größer werden seine Zweifel, ob die Göttin des Todes wirklich die richtige Braut für ihn ist …
Für Swede – einen tollen Freund, einen Pfundskerl und einen wunderbaren Ehemann. Ich schreibe dies um vier Uhr morgens – Abgabetermin-Standardzeit –, und du sitzt immer noch am Schreibtisch neben mir. Wie kann ich dich mit einer Widmung überraschen, wenn du dich weigerst, die Kommandozentrale zu verlassen?
Prolog
Burg Helvita, die Festung der Horde
Russischer Winter, in einem längst vergangenen Zeitalter
»Welch neue Schmach der Tag heute wohl bringen mag?«, fragte Iwana die Kühne ihren Sohn Lothaire, als die Wachen sie zu dem Vampir geleiteten, der unter dem Namen Stefanowitsch bekannt war. Er war der König der Vampirhorde.
Und Lothaires Vater.
Obwohl er erst neun Jahre zählte, bemerkte Lothaire den draufgängerischen Unterton in der Stimme seiner Mutter.
»Und warum ließ er dich wecken?«, fragte sie ihn mit herrischer Stimme, als ob er die Launen seines Vaters erklären könnte.
Der Ruf war zur Mittagszeit erfolgt, einer Zeit also, zu der er längst im Bett lag. »Ich weiß es nicht, Mutter«, murmelte er, während er an seiner Kleidung herumzupfte. Ihm waren nur Sekunden geblieben, um sich anzukleiden.
»Ich bin dieser Behandlung überdrüssig. Eines Tages wird er es zu weit treiben und es bitterlich bereuen.«
Lothaire hatte zufällig mitbekommen, wie sie sich bei seinem Onkel Fjodor über die »Tiraden und Tändeleien« des Königs und »sein zunehmend bizarres Verhalten« beklagt hatte. Mit leiser Stimme hatte sie ihm gestanden: »Ich habe meine Liebe an deinen Bruder verschwendet. Ich bin in diesem Reich nichts als eine schlecht behandelte Geliebte, wenngleich ich doch die Erbin des Throns von Dakien war.«
Fjodor hatte versucht, sie zu trösten, doch sie hatte nur gesagt: »Ich wusste, dass mir nur eine gewisse Zeit mit ihm bleiben würde, bis sein Herz aufhören würde zu schlagen. Doch jetzt stellt sich mir die Frage, ob er überhaupt ein Herz besitzt.«
Heute loderte ein gefährliches Feuer in ihren eisblauen Augen. »Ich war für Besseres bestimmt als dies hier.« Bei jedem ihrer Schritte schwangen die Pelze, die ihre Schultern in verschwenderischer Pracht bedeckten, hin und her. Die Röcke ihrer scharlachroten Robe raschelten; ein angenehmer Klang, den er stets mit ihr in Verbindung brachte. »So wie auch du, mein Prinz.«
Sie nannte ihn »Prinz«, obwohl Lothaire keiner war. Zumindest nicht in diesem Königreich. Er war nur Stefanowitschs Bastard, einer in einer langen Reihe von Bastarden.
Sie folgten den beiden Wachen über gewundene Treppen bis zu den Privatgemächern des Königs hinauf. Die Wände waren vergoldet und feucht vor Kälte. Vor den Mauern der Burg tobte ein Schneesturm.
Wandleuchter erhellten den Weg, doch nichts vermochte die Düsternis dieser widerhallenden Gänge zu erhellen.
Lothaire erschauderte. Er sehnte sich in sein warmes Bett zurück, wo sein neuer Welpe auf seinen Beinen liegen und sie gemeinsam dösen könnten.
Sobald sie das Vorzimmer von Stefanowitschs Gemächern erreicht hatten und die Wachen die ächzenden goldenen Türen öffneten, strich sich Iwana noch einmal über ihre kunstreich geflochtenen weißblonden Zöpfe und hob das Kinn. Nicht zum ersten Mal dachte Lothaire, dass sie wie ein Engel aus uralten Zeiten aussah.
In Stefanowitschs Gemach nahm ein gewaltiges Fenster die gesamte hintere Wand ein, das mit Symbolen der dunklen Künste verziert war. Das Glas hielt das schwache Sonnenlicht ab, das noch durch den Sturm hindurchdrang, und bildete einen Furcht einflößenden Hintergrund für den Thron des Königs.
Dabei benötigte der hoch aufragende Vampir keinerlei Effekthascherei, um Furcht einflößend zu wirken. Sein Körperbau entsprach eher dem eines Dämons, seine Schultern waren breiter als Dachbalken, seine Fäuste groß wie Ambosse.
»Ah. Iwana Dakiano lässt sich dazu herab, meinem Ruf zu folgen«, rief Stefanowitsch vom oberen Ende seines langen Esstisches. Mit jeder Nacht schienen seine Augen ein noch tieferes Rot anzunehmen. Das karminrote Glühen bot einen starken Kontrast zu seinem sandfarbenen Haar, das ihm in die Stirn fiel.
In seiner Gesellschaft saß ein Dutzend Höflinge, die Iwana mit unverhohlenem Groll anstarrten. Sie wiederum zog die Lippen zurück, sodass ihre Fänge aufblitzten. Sie machte kein Geheimnis daraus, dass sie diese Schleimer für unter ihrer Würde hielt.
Zur Linken des Königs saß Lothaires Onkel Fjodor, der verlegen zu sein schien.
Lothaire folgte Iwanas Blick zu dem Sitz an Stefanowitschs rechter Seite – einem Ehrenplatz, der gewöhnlich für sie reserviert war. Der Tisch davor war mit Tellern übersät, auf denen die Überreste einer Mahlzeit lagen.
Gelegentlich nahmen junge Vampire Nahrung der Erde zu sich – zusätzlich zum Blut. Vielleicht war ein anderer von Stefanowitschs Bastarden nach Helvita gekommen, um unter ihnen zu leben?
Lothaires Herz machte einen Satz. Ich könnte mich mit ihm anfreunden, könnte endlich einen Gefährten haben. Als Bastard des Königs hatte er keine Freunde. Seine Mutter war alles für ihn.
»Es ist spät«, sagte Iwana. »Zu dieser verhassten Stunde sollten längst alle zu Bett sein.«
Fjodor schien zu versuchen, Iwana eine wortlose Warnung zukommen zu lassen, doch sie schenkte ihm keinerlei Beachtung und fragte mit gebieterischer Stimme: »Was willst du, Stefanowitsch?«
Nachdem er einige tiefe Schlucke aus einem Krug voller mit Met versetztem Blut genommen hatte, wischte sich Stefanowitsch mit dem Ärmel über den Mund. »Ich wollte meine hochmütige Mätresse und ihren schwächlichen Bastard sehen.« Der König starrte auf Lothaire hinab. »Komm.«
»Tu es nicht, Sohn«, befahl ihm Iwana auf Dakianisch.
Lothaire antwortete ihr in derselben Sprache. »Ich werde es tun, damit du verschont wirst.« Wie immer tat er alles, was er konnte, um sie zu beschützen, auch wenn ihm seine eigene Schwäche nur allzu bewusst war.
In ihrer Miene kämpfte ihre Angst um ihn mit Stolz. »Ich hätte wissen müssen, dass Lothaire Dakiano sich niemals hinter den Röcken seiner Mutter verstecken würde, nicht einmal angesichts eines rotäugigen Tyrannen.«
Als Lothaire zu dem König hinüberging und sich vor dessen Stuhl aufstellte, schüttelte Stefanowitsch angewidert den Kopf. »Du kannst dich also immer noch nicht translozieren?«
Lothaires Gesicht war unbewegt, als er antwortete. »Noch nicht, mein König.« Ganz egal, wie sehr er sich auch darum bemühte, sich zu teleportieren, er hatte es bislang nicht geschafft. Iwana hatte ihn damit getröstet, dass die Dakier die Fähigkeit, sich zu translozieren, erst spät entwickelten, da sie in ihrem abgeschotteten Königreich nur wenig Verwendung dafür hatten. Ihrer Ansicht nach war Lothaires Unfähigkeit lediglich ein weiteres Anzeichen dafür, dass er mehr nach ihr als nach einem einfachen Vampir der Horde kam.
Stefanowitsch packte Lothaires dünnes Ärmchen und drückte es. »Zu schwächlich, wie ich sehe.«
Lothaire wünschte sich sehnlichst, zu wachsen und ebenso eindrucksvoll zu werden wie sein Vater, der große Krieger, und wenn auch aus keinem anderen Grund als dem, seine Mutter beschützen zu können. Nicht, dass Prinzessin Iwana eines anderen Schutz bedurft hätte.
»Bei allen Göttern, du beschämst mich, Junge. Ich hätte dir deinen kümmerlichen Hals schon bei der Geburt umdrehen sollen.«
Lothaire hörte solche Kritik immer wieder, er war daran gewöhnt.
Seine Mutter hingegen nicht.
Mit einem Schrei schnappte sich Iwana eine Karaffe mit Blut und schleuderte sie auf Stefanowitsch. Sie zerschmetterte einen Teil der schwarzen Scheibe hinter ihm, sodass ein Strahl gedämpften Lichts hineinströmte.
Die Höflinge zischten und verteilten sich hastig im ganzen Raum. Der Lichtstrahl traf nur wenige Zentimeter von Stefanowitschs regungslosem Ellenbogen auf, ehe ein Tagdiener herbeieilte, um das Loch mit einem gefütterten Stück Stoff zu verschließen.
»Mein Sohn ist perfekt.« Iwana fletschte ihre Fänge, ihre blauen Augen hatten sich in ihrer Erregung schwarz verfärbt. »Bis auf die Tatsache, dass sein Gesicht deinen Stempel trägt. Glücklicherweise hat er den scharfen Verstand meiner königlichen Linie geerbt. Er ist schlau und gerissen, eine Zierde der Dakier.«
Auch Stefanowitsch entblößte jetzt seine rasiermesserscharfen Fänge, und seine Augen leuchteten in einem noch tieferen Rot auf. »Du forderst meinen Zorn heraus, Frau!«
»So wie du den meinen.« Iwana gab ihm gegenüber niemals nach. Wann auch immer Stefanowitsch ihr einen Schlag versetzte, versetzte sie ihm zwei.
Iwana hatte Lothaire erzählt, dass die Dakier sich nur von kalter Logik und ihrem Verstand leiten ließen. Offensichtlich war Iwana die Kühne die Ausnahme.
Wild und grimmig wie der Schneesturm, der draußen tobte, provozierte sie sogar Stefanowitsch, nur um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, und peitschte ihn mit ihrer spitzen Zunge, wann immer er in die Nacht hinausstarrte. Sie hatte Lothaire gegenüber einmal zugegeben, dass sein Vater davon träumte, die Vampirbraut zu finden, die einmal die Seine sein würde. Stefanowitschs Braut wäre die Einzige, die sein Herz dazu bringen würde, bis in alle Ewigkeit zu schlagen. Sie wäre die gesetzmäßige Königin, die ihm seine rechtmäßigen Erben gebären würde.
Wieder strich Iwana über ihre Flechten, offensichtlich kämpfte sie gegen ihren Jähzorn an. »Wenn du dich über deinen Sohn lustig machst, dann unter Einsatz deines Lebens, Stefanowitsch.«
»Sohn? Ich akzeptiere ihn nicht als solchen. Dieser Junge wird sich niemals mit meinem wahren Nachfolger messen können!« Er nahm einen weiteren Schluck aus seinem Krug. »Dessen bin ich sicher.«
»Ich ebenso. Lothaire wird jedem anderen Mann auf jede nur erdenkliche Weise überlegen sein. Er ist ein Dakier!«
Lothaire verfolgte diesen Wortwechsel mit zunehmendem Unbehagen. Nur zu gut erinnerte er sich an die Warnung, die sein Onkel Fjodor Iwana gegenüber einmal ausgesprochen hatte: »Selbst Stefanowitsch kann auf dein Wissen und deine Stärke neidisch werden. Du musst dich beugen, ehe seine Liebe zu dir sich in Hass verwandelt.«
Lothaire wusste, dass sich die Befürchtungen seines Onkels bewahrheitet hatten, denn Stefanowitsch sah wahrhaft mörderisch aus. »Du hältst deine Art für so viel besser als meine …«
Eine betrunkene Frau kam aus Stefanowitschs Privatkammer hereingetaumelt. Eine sterbliche Frau.
Lothaire sackte die Kinnlade hinunter, und Iwana presste sich den Handrücken auf den Mund.
Die Frau war wie eine Königin gekleidet. Ihre Gewänder waren so kostbar wie Iwanas eigene. Sie war diejenige, die zur Rechten des Königs gespeist hatte?
»Ein Mensch?« Iwanas Schock verwandelte sich bald in Zorn. »Du wagst es, eines dieser kranken Tiere in mein Heim zu bringen? In die Nähe meines einzigen Sohnes?« Sie trat vor, um Lothaire hinter sich zu schieben.
Auch wenn erwachsene Vampire unsterblich waren, war Lothaire immer noch anfällig für Krankheiten.
»Dieser Mensch ist Olya, meine neue Mätresse.«
»Mätresse!«, rief Iwana aus. »Wohl eher Schoßhündchen. Ihre Art lebt in dreckigen Hütten, schläft mitten unter ihrem Vieh!«
Stefanowitsch winkte der Frau zu, die daraufhin in gespielter Schüchternheit zu ihm hinübergewankt kam. »Aber dafür schmeckt sie nach Wein und Honig.« Er wandte sich an seinen Bruder. »Oder etwa nicht, Fjodor?«
Fjodor warf Iwana einen schuldbewussten Blick zu.
Stefanowitsch zog sein neuestes Spielzeug auf den Schoß. »Du solltest mal von ihr kosten, Iwana«, höhnte er und entblößte den bleichen Arm der Sterblichen.
Iwanas Augen wurden groß. »Du trinkst ihr Blut direkt aus ihrem Körper? Ich könnte meine Fänge genauso wenig in einen Menschen wie in irgendein anderes Tier versenken. Soll ich dir vielleicht auch noch ein Schwein bringen, damit du deine Zähne hineinschlagen kannst?«
Sie starrten einander mit vielsagenden Blicken unerbittlich an, aber Lothaire konnte nicht deuten, was genau zwischen ihnen vorging.
Schließlich ergriff Iwana das Wort. »Stefanowitsch, du weißt, dass dies Konsequenzen nach sich zieht, besonders für jemanden wie dich …«
»Meine Art verehrt den Heiligen Durst«, erwiderte Stefanowitsch, »verehrt das Bluttrinken.«
»Dann verehrt ihr den Wahnsinn, denn das ist es, was mit Gewissheit folgen wird.«
Er ignorierte Iwanas Warnung und biss in das Handgelenk der Frau, die aufstöhnte.
»Du bist widerlich!« Iwana versperrte Lothaire die Sicht, doch er war von dem Anblick so fasziniert, dass er um ihre Röcke herumspähte. Warum hatte sie ihn nie gelehrt, einem anderen die Fänge in die Haut zu schlagen?
Nachdem er sich genährt hatte, ließ Stefanowitsch den Arm der Sterblichen los und küsste sie auf den Mund, was einen empörten Schrei Iwanas hervorrief. »Dass du von ihr trinkst, ist schon abstoßend genug, aber du vereinigst dich auch noch mit ihrem Körper? Hast du denn gar kein Schamgefühl?«
Er unterbrach den Kuss. »Nicht das geringste.« Er leckte sich über die Lippen. Die Sterbliche kicherte und wickelte eine Strähne von Stefanowitschs Haar um ihren Finger.
»Dies ist zu schändlich, um den Anblick länger zu ertragen. Ich jedenfalls weigere mich.«
»Und was willst du dagegen tun?«
»Ich werde diesen Ort für alle Zeit verlassen«, verkündete sie. »Und jetzt schlachte auf der Stelle dein kleines Spielzeug, oder ich kehre nach Dakien zurück.«
»Hüte dich vor Ultimaten, Iwana, denn du wirst an den Folgen keinen Gefallen finden. Vor allem, da du nicht einmal in der Lage bist, deine Heimat zu finden.«
Iwana hatte Lothaire erklärt, warum das Königreich Dakien seit so langer Zeit ein Geheimnis war. Die geheimnisvollen Dakier reisten stets in einem sie verhüllenden Nebel. Wenn einer von ihnen den Nebel verließ, war er nicht länger fähig, sich aus eigener Kraft nach Hause zu translozieren, und seine Erinnerungen an die Heimat verblassten.
Als sie Stefanowitsch zum ersten Mal erblickte, hatte Iwana ihr Herz verloren und war ihm nach Helvita gefolgt. Sie hatte ihren eigenen Nebel, ihre Familie und den Thron, den sie einmal besteigen würde, hinter sich gelassen.
»Ich werde es finden«, beteuerte sie jetzt. »Und wenn es mich umbringt, ich werde Lothaire in das Reich aus Blut und Nebel bringen, ein Land, in dem zivilisierte Unsterbliche regieren.«
»Zivilisiert?« Stefanowitsch brach in lautes Gelächter aus, und die Höflinge folgten sogleich seinem Beispiel. »Diese Ungeheuer sind brutaler als ich!«
»Du ignoranter Mann! Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst! Du kannst unsere Sitten nicht begreifen. Das weiß ich nur zu gut, denn ich habe versucht, sie dich zu lehren.«
»Mich zu lehren?« Seine fleischige Faust donnerte auf den Tisch herab. »Deine Arroganz wird dein Ruin sein, Iwana! Stets bist du davon überzeugt, dass du besser bist als ich.«
»Weil – ich – es – bin!«
Die Höflinge verstummten auf der Stelle.
Stefanowitsch brachte zwischen zusammengebissenen Zähnen einen Befehl heraus: »Nimm deine leichtsinnigen Worte zurück, sonst lasse ich dich und deinen Bastard bei Sonnenuntergang hinauswerfen in die Kälte.«
Lothaire schluckte. Er dachte an das Feuer in seinem Zimmer, seine geliebten Geduldspiele auf dem Schreibtisch, seine Spielsachen, die auf den warmen Fellen auf dem Boden verstreut lagen. Das Leben auf Helvita konnte schrecklich sein, aber es war das einzige, das er kannte.
Bitte um Verzeihung, Mutter, beschwor er sie stumm.
Doch stattdessen straffte sie die Schultern. »Wähle, Stefanowitsch. Diesen stinkenden Menschen oder mich.«
»Du wirst mich um Vergebung anflehen und meiner neuen Mätresse Respekt erweisen.«
»Flehen?« Iwana schnaubte spöttisch. »Niemals. Ich bin eine Prinzessin der Dakier!«
»Und ich bin ein König!«
»Ach, lass Iwana doch, Bruder«, murmelte Fjodor. »Das wird langsam ermüdend.«
»Sie muss lernen, wo ihr Platz ist.« An Iwana gewandt befahl er: »Bitte Olya um Verzeihung!«
Als die Sterbliche Iwana ebenso siegesgewiss wie spöttisch angrinste, wusste Lothaire, dass seine Mutter und er verloren waren.
Einen Monat später …
»Schüre diesen Hass, Sohn. Lass ihn lodern wie ein Schmiedefeuer.«
»Ja, Mutter«, krächzte Lothaire, dessen Atem kleine Wolken vor seinem Mund bildete, als sie sich durch knietiefe Schneewehen schleppten.
»Er ist das Einzige, was uns warm halten wird.« In Iwanas Augen leuchtete Verbitterung seit jenem Tag, an dem Stefanowitsch ihnen befohlen hatte, Helvita zu verlassen.
In jener Nacht hatte Lothaire gehört, dass Iwana einen winzigen Augenblick lang der Atem gestockt hatte, und er hatte kurz ihre Überraschung aufblitzen sehen. Ihr war bewusst geworden, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Doch sie war zu stolz gewesen, um ihn ungeschehen zu machen, um vor einem Menschen zu Kreuze zu kriechen.
Nicht einmal um meinetwillen.
Der ganze Hof hatte sich am Eingang zur Burg versammelt, um zu sehen, wie Lothaire und die arrogante Iwana mit nichts als ihren Kleidern am Leib aus der Burg vertrieben wurden – um in der Kälte zu sterben. Sie wären sicherlich schon längst einen jämmerlichen Tod gestorben, wenn Fjodor Lothaire nicht einige wenige Münzen zugesteckt hätte.
Lothaires Welpe war ihm gefolgt, hatte sich mit großen Augen und über die eigenen Pfoten stolpernd voller Angst bemüht, ihn einzuholen. Doch unter Lothaires ungläubigem Blick hatte Stefanowitsch den Hund beim Nackenfell gepackt und ihm das Rückgrat gebrochen.
Unter dem Gelächter sämtlicher Vampirhöflinge hatte der König das sterbende Tierchen Lothaire vor die Füße geschleudert. »Heute wird nur eines unserer Schoßhündchen krepieren.«
Lothaire waren Tränen in die Augen gestiegen, doch Iwana hatte ihm »Keine Tränen, Lothaire!« zugezischt. »Nutze deinen Hass auf ihn. Vergiss niemals die Schmähung dieser Nacht!« Zuletzt hatte sie Stefanowitsch noch zugeschrien: »Bald wirst du erkennen, was du hattest, doch dann wird es zu spät sein.«
Jetzt murmelte sie geistesabwesend: »Bis wir Dakien erreichen, werde ich dafür gesorgt haben, dass deine Seele so bitter ist wie diese Kälte, die uns zu töten versucht.«
»Wie lange dauert es denn noch?« Seine Füße hatten jedes Gefühl verloren, sein Bauch war leer.
»Ich weiß es nicht. Ich kann nur meiner Sehnsucht nach Dakien folgen.«
Wie sie Lothaire erzählt hatte, regierte ihr Vater, König Sergei, über dieses Reich, ein Land, in dem Überfluss und Frieden herrschten. Es war von Stein umschlossen und lag im Herzen einer Bergkette.
In einer Höhle von ungeheurer Höhe – tausendmal größer als Helvita – stand eine majestätische schwarze Burg, die von einzigartigen Brunnen umgeben war, aus denen Blut sprudelte. Die Untertanen des Königs füllten dort jeden Morgen ihre Krüge.
Lothaire konnte sich einen solchen Ort kaum vorstellen.
»Nach unserer langen Wanderschaft fühle ich, dass wir schon ganz nahe sind, Sohn.«
In jener ersten Nacht, als sie sich durch den grauenerregenden Blutwurzelwald gekämpft hatten, der Helvita umgab, hatte sie befürchtet, dass Lothaire die eisige Nacht nicht überstehen würde. Wieder und wieder hatte sie versucht, sie beide nach Dakien zu teleportieren, nur um immer wieder zu derselben Stelle zurückzukehren.
Er hatte überlebt und sie sich bis zur Erschöpfung verausgabt. Jetzt war sie zu schwach, um sich zu translozieren, darum schleppten sie sich zu Fuß auf das nächste Dorf zu, in der Hoffnung, dort eine Scheune zu finden, die sie vor dem Sonnenlicht des kommenden Tages schützen würde.
Unglücklicherweise wimmelte es in diesen Dörfern nur so von dreckigen Sterblichen. Immer wieder starrten sie Iwanas Schönheit und den fremdartigen Schnitt ihrer Kleider voller Ehrfurcht, aber auch voller Argwohn an. Lothaire erregte wegen seiner durchdringenden eisblauen Augen und des weißblonden Haars, das unter seiner Mütze hervorlugte, ebenfalls einige Aufmerksamkeit.
Iwana wiederum verhöhnte ihre ungewaschenen, verlausten Körper und ihre simple Sprache. Ihre Abscheu vor Sterblichen wuchs immer weiter an und nährte die seine.
Jede Nacht kurz vor der Morgendämmerung ließ sie Lothaire in ihrem Versteck zurück und ging auf die Jagd. Manchmal waren ihre Wangen vom Blut gerötet, und er sah den Triumph, der sich in ihren Augen spiegelte. Nach einem Schnitt ins Handgelenk füllte sie auch für ihn eine Tasse.
Zugleich war sie häufig bleich und mürrisch. Dann verfluchte sie Stefanowitschs Verrat und beklagte ihre Notlage. Eines Sonnenaufgangs, als er gerade dem Schlaf entgegendämmerte, hörte er sie murmeln: »Jetzt sind wir es, die mitten unter dem Vieh schlafen, und ich bin gezwungen, aus lebenden Körpern zu trinken …«
Iwana verlangsamte ihre Schritte, ihr Kopf fuhr herum.
»Verfolgen sie uns, Mutter?« Die Menschen im letzten Dorf waren feindlicher als in jedem anderen Dorf gewesen und waren ihnen gefolgt, sogar bis in die Wildnis hinein.
»Ich glaube nicht. Der Schnee bedeckt unsere Spuren rasch.« Sie stapfte weiter. »Es ist Zeit für deine Lektionen.«
Während ihrer nächtlichen Wanderungen lehrte sie ihn alles, was er wissen musste. Vom Überleben unter Menschen: »Trink nur dann von ihnen, wenn du kurz vor dem Verhungern stehst, doch niemals, bis sie tot sind«, bis hin zur dakischen Etikette: »Gefühlsausbrüche gelten als extrem unhöflich, was natürlich bedeutet, dass ich nicht selten jemandem zu nahegetreten bin.«
Und jedes Mal forderte sie dann von ihm, Eide für die Zukunft abzulegen, so als ob sie glaubte, bald sterben zu müssen.
»Was musst du tun, wenn du erwachsen bist, mein Prinz?«
»Den Verrat an uns rächen. Ich werde Stefanowitsch vernichten und seinen Thron einnehmen.«
»Wann?«
»Ehe er seine Braut findet.«
»Warum?«
Lothaire antwortete pflichtgemäß: »Sobald seine ihm vom Schicksal bestimmte Braut sein Herz wieder schlagen lässt, wird er noch mächtiger und sogar noch schwerer zu töten sein. Und er wird mit ihr einen legitimen Erben zeugen. Die Vampirhorde wird niemals Stefanowitschs Bastard gehorchen, solange sein wahrer Nachfolger am Leben ist.«
»Du musst vollkommen sicher sein, dass die Horde dir die Treue schwören wird. Sollte deine Anstrengung, die Krone an dich zu reißen, fehlschlagen, werden sie dich auslöschen. Warte, bis du auf dem Höhepunkt deiner Macht stehst.«
»Muss ich rote Augen haben, um ihn zu bekämpfen?«
Sie blieb stehen und sah ihn mit zur Seite gelegtem Kopf an. »Was weißt du darüber?«
»Wenn ein Vampir seine Beute tötet, während er trinkt, wird er mächtiger, doch das Blut verfärbt seine Augen.«
»Ja, denn in diesem Fall trinkt er bis zur Neige, bis zum Grund der Seele. Dies bringt Kraft, führt aber auch zu Blutgier. Stefanowitsch ist ein Gefallener geworden.« Dann fügte sie eine vage Andeutung hinzu: »Umso qualvoller wird es werden. Insbesondere für ihn.«
»Warum?«
Sie warf Lothaire einen abschätzenden Blick zu, als müsste sie seinethalben zu einer Entscheidung gelangen. »Denk nicht an diese Dinge«, sagte sie schließlich mit gewollt unbeschwerter Stimme. »Töte niemals, während du trinkst, dann wirst du dir auch niemals Sorgen machen müssen.«
»Aber wie soll ich dann …?« Er errötete vor Scham. »Wie soll ich jemals stark genug werden, um Stefanowitsch zu töten?«
Iwana streckte die eiskalten Hände aus, drückte sie an seine Wangen und hob sein Gesicht an. »Vergiss alles, was du von deinem Vater gehört hast. Wenn du älter bist, werden unsterbliche Männer in Angst vor dir erzittern, während ihre Frauen bei deinem Anblick in Ohnmacht fallen.«
»Wirklich, Mutter?«
»Deine Gestalt ist perfekt, und du wirst einmal ein herausragender Dakier sein, ein Vampir, der von allen gefürchtet wird – vor allem wenn du erst erweckt worden bist.« Sie spähte in den wolkenbedeckten Himmel hinauf, sodass Schneeflocken auf ihrem Gesicht landeten. »Und deine Braut?« Iwana sah ihm wieder in die Augen. »Sie wird unvergleichlich sein. Eine Königin, vor der sogar ich mich neigen würde.«
Er blickte sie aus zusammengekniffenen Augen an, um zu erkunden, ob sie sich einen Spaß mit ihm erlaubte, aber ihre Miene war ernst.
Lothaire hoffte, er würde diese Frau rasch finden. Er wusste, dass sein Herz langsam aufhören würde zu schlagen und seine Lungen aufhören würden zu atmen, sobald er vollkommen ausgewachsen war. Als Vampir, ein wandelnder Toter, würde er kein Verlangen nach Frauen verspüren.
Sein Onkel hatte einmal seine Wange getätschelt und gesagt: »Gerade wenn du vergessen hast, wie sehr du die weichen Schenkel einer Frau vermisst, wirst du deine Braut finden, und sie wird dich ins Leben zurückbringen.«
Lothaire konnte sich nicht vorstellen, sich je dafür zu interessieren, mit Frauen ins Bett zu gehen, aber die Vorstellung, wie sein Herz aufhörte zu schlagen, erschreckte ihn.
»Wie lange wird es dauern, bis ich sie finde?«, fragte er Iwana.
Sie blickte fort. »Ich weiß nicht«, sagte sie in seltsamem Tonfall. »Es könnte Jahrhunderte dauern. Außerhalb von Dakien werden weibliche Vampire zunehmend seltener. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du ihr ein guter und treuer König sein wirst.« Dann fragte sie: »Und was wirst du tun, wenn du den Thron der Horde in Besitz genommen hast?«
»Mich mit deinem Vater verbünden und die Dakier und die Horde unter einem Familienwappen vereinen.«
Sie nickte. »Sergei ist der Einzige, dem du trauen kannst, im Gegensatz zu meinen Brüdern und Schwestern mit ihren Intrigen und Verschwörungen. Ausschließlich meinem Vater. Und selbstverständlich kannst du deiner Braut trauen. Aber was ist mit allen anderen?«
»Ich werde sie benutzen und dann vergessen. Kein anderer wird mich je interessieren, denn sie sind alle bedeutungslos.«
Sie legte ihm den gekrümmten Zeigefinger unters Kinn. »Ganz genau, mein schlauer Sohn.«
Auf diese Weise verbrachten sie die nächsten Meilen. Sie lehrte ihn die komplizierten Bräuche der Dakier, während sie beide sich bemühten, die Kälte zu ignorieren. Der Himmel schien immer tiefer zu hängen und drohte, noch mehr Schnee zu bringen. In wenigen Stunden würde die Morgendämmerung die Dunkelheit mit ihren Klauen zerfetzen.
Lothaire zitterte so entsetzlich, dass seine Zähne und Babyfänge klapperten.
»Still!«, zischte Iwana. »Die Menschen sind uns gefolgt.« Sie witterte ihren Duft. »Bei den Göttern, wie ihr Geruch mich quält.«
»Was wollen sie?«
»Uns jagen«, murmelte sie.
»Wo können wir uns verstecken?« Sie befanden sich in einem breiten Tal, in dessen Westen und Osten sich Hochebenen befanden. Die Sterblichen kamen von Norden. Weit im Süden ragten Berge auf.
Sie blickte sich verzweifelt um. »Wir müssen es bis zu diesen Bergen schaffen. Ich glaube, dort werden wir den Pass finden, der nach Dakien führt.« Sie versetzte ihm einen Stoß. »Und jetzt lauf!«
Er rannte, so schnell er konnte, aber der Schnee lag zu hoch auf der Erde und rieselte ihm in die Augen, sodass er sie immer wieder zukneifen musste. »Wir werden es niemals schaffen, Mutter!«
Sie packte seinen Arm und versuchte, sie zu translozieren. Ihre Gestalten verblassten kurz, aber es funktionierte nicht. Sie biss die Zähne zusammen und versuchte es noch einmal. Ohne Erfolg.
Sie ließ ihn los, drehte sich auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit einmal um sich selbst, um gleich darauf wieder still zu stehen und zu lauschen. Plötzlich riss sie die Augen auf.
»Vater!«, schrie sie, dass der Klang durch das ganze Tal hallte. »Ich bin hier! Deine Iwana ist hier!«
Niemand antwortete.
»Vater!«
Aus der Ferne waren die Schreie der Sterblichen zu hören, die sich ihnen näherten.
»Papa?« Sie schwankte, wirkte … verloren. »Ich weiß, dass ich ihn und andere gespürt habe.«
Genau wie Lothaire. Unsterbliche von großer Macht waren in der Nähe gewesen. Warum retteten sie ihre Prinzessin nicht?
Dunkelrote Tränen rannen über ihr schönes Gesicht, als sie auf die Knie fiel. »Wir waren so nahe.« Die stolze Iwana grub im Schnee, benutzte ihre Klauen, um durch die Schichten ewigen Eises zu dringen.
Selbst als ihre Klauen abrissen und ihre Finger zu bluten begannen, grub sie weiter. »Wie tief ich gesunken bin, Lothaire. Wenn du meiner gedenkst, dann erinnere dich nicht an dies hier.«
Mit jeder Handvoll Eis wuchs das Loch. »Du bist der Sohn eines Königs, der Enkelsohn eines Königs. Vergiss das niemals!« Als sich die Haut von ihren Fingerspitzen löste, wollte er ihr helfen, aber sie schlug seine Hände beiseite, anscheinend dem Wahnsinn nahe. Schließlich drückte sie ihn in die kleine Kuhle, die sie gegraben hatte. »Komm, versteck dich hier.«
»Ich muss sie noch tiefer machen, Mutter. Sonst ist nicht genug Platz.«
»Es ist Platz genug«, flüsterte sie. »Ich werde dafür sorgen, dass du in Sicherheit bist.«
Seine Augen wurden groß. Wollte sie mit den Verfolgern kämpfen? »Transloziere dich doch allein von hier fort«, sagte er, obwohl er wusste, dass sie vermutlich auch dafür zu schwach war.
»Niemals! Also, was hast du mir geschworen?«
»Mutter, ich …«
Sie ließ die Fangzähne zuschnappen, und ihre Augen färbten sich schwarz. »Was hast du geschworen?«
»Ich werde Stefanowitsch töten und seinen Thron besteigen.«
»Wem wirst du trauen?«
»Niemandem außer deinem Vater und meiner Königin.«
Weitere Tränen fielen. »Nein, traue nur deiner Königin allein, Lothaire. Sergei und die Dakier haben uns am heutigen Tage im Stich gelassen.«
»Wieso?«
»Ich habe diese Sterblichen zu nahe an sie herangeführt.« Sie schluchzte auf. »Ihm war die kostbare Geheimhaltung des Königreichs wichtiger als unser Leben. Ich muss für meine Unverfrorenheit, meine mangelnde Gerissenheit bezahlen. Sie werden ein Exempel an mir statuieren.«
Lothaire wurde von Panik erfasst. »Wie werde ich dich finden? Was soll ich tun?«
»Sobald die Menschen fort sind, wird meine Familie kommen und dich holen. Wenn nicht, wirst du tun, was nötig ist, um zu überleben. Denk an alles, was ich dich lehrte.« Sie schob den Ärmel hinauf. »Trink, Lothaire.«
»Jetzt?« Verwirrt schüttelte er den Kopf. »Du darfst doch kein Blut verlieren.«
»Gehorche mir!« Sie biss sich ins Handgelenk. »Leg den Kopf zurück und öffne den Mund.«
Widerwillig folgte er ihrem Befehl, und sie hob den Arm über sein nach oben gewandtes Gesicht, über seinen Mund. Ihr Blut war gehaltvoll und vertrieb schon bald die Kälte.
Sie ließ ihn trinken, bis aus dem Strom ein Tröpfeln wurde und sich an der Wunde Eis bildete. »Jetzt hör gut zu. Ich werde sie von dir fortführen, sie ablenken. Sie werden mich ergreifen …«
»Neiiin!«, heulte er auf.
»Lothaire, hör mir zu! Wenn sie mich gefangen nehmen, wirst du das Verlangen verspüren, mich zu beschützen. Doch du musst es ignorieren und hierbleiben. Ignoriere deinen Instinkt und verlasse dich nur auf die kalte Vernunft. Tu, was mir bei Stefanowitsch nicht gelungen ist, was mir Tausende Male nicht gelungen ist. Schwöre es!«
»Du willst, dass ich mich verstecke? Ich soll dich nicht gegen diese Kreaturen verteidigen?« Zu seiner Schande stiegen ihm erneut die Tränen in die Augen.
»Ja, genau das ist es, was ich will. Dein Verstand ist der hellste, dem ich je begegnet bin, Sohn. Benutze ihn. Wiederhole nicht meine Fehler!« Sie packte sein Kinn. »Du musst mir noch ein Letztes versprechen. Schwöre beim Mythos, dass du diesen Ort erst verlassen wirst, wenn die Sterblichen gegangen sind.«
Beim Mythos? Das war ein Eid, den niemand zu brechen vermochte! Am liebsten hätte er sich ihr fluchend widersetzt. Wie könnte er sie nicht verteidigen?
Sie hob das Kinn. »Lothaire, ich … flehe dich an.«
Eine stolze Prinzessin der Dakier fleht jemanden wie mich an? Seine Lippen öffneten sich vor Schreck, die Worte purzelten hinaus. »Ich schwöre es beim Mythos.«
»Sehr gut.« Sie drückte ihm einen kalten Kuss auf die Stirn. »Ich will, dass du nie, nie wieder so tief sinkst.« Seinen verzweifelten Protesten zum Trotz begann sie, ihn unter dem Schnee zu vergraben. »Werde König, wie es dir von Geburt an zustand.«
»Mutter, bitte! Wie kannst du das nur tun?«
»Weil du mein Sohn bist. Mein Herz. Ich werde alles tun, was nötig ist, um dich zu beschützen.« Ihre Blicke trafen aufeinander. »Lothaire, erst seit es dich gibt, bin ich von Wert.«
Er weigerte sich zu glauben, dass dies das letzte Mal sein würde, dass er sie sah, weigerte sich, seiner Mutter zu sagen, wie sehr er sie liebte …
»Ich weiß«, flüsterte sie und bedeckte ihn mit Schnee.
Durch ihr Blut gewärmt, kauerte er in seinem Loch und bebte vor Angst um sie. Seine Augen zuckten hin und her und sahen doch nichts.
War sie aufgesprungen und in die Richtung der Sterblichen zurückgelaufen? Nach einer Weile hörte er aus der Ferne ihren Kampf, konnte die Vibrationen zahlreicher Schritte fühlen. Sie musste von mindestens einem Dutzend Menschen umzingelt sein. Er ballte die Fäuste und kämpfte gegen das fieberhafte Verlangen an, sie zu retten.
Doch Lothaire war machtlos – gebunden durch seinen Eid und sabotiert durch seine eigene Schwäche.
Sein ersticktes Stöhnen vor ohnmächtiger Wut verwandelten sich in heiße Tränen, als er das Klirren von Ketten und ihre gedämpften Schreie hörte.
Die kehligen Laute der Männer.
Er war in Helvita unter der grausamen Herrschaft von Stefanowitsch aufgewachsen. Lothaire wusste nur zu gut, was diese Sterblichen ihr antaten.
Während er sich mit aller Kraft abmühte, das kostbare Blut nicht zu erbrechen, das sie ihm geschenkt hatte, fasste er den Beschluss, ebenfalls einer dieser Gefallenen zu werden und anderen Kreaturen ihre Kraft zu rauben.
Sollte er doch vor Blutgier wahnsinnig werden – zumindest würde er nie wieder hilflos sein.
Es schien Stunden zu dauern, ehe ihre Schreie verstummten. Wieder zuckten seine Augen hin und her. Er glaubte, Rauch zu riechen, dann den Geruch brennenden Fleisches.
Die Morgendämmerung. Sie begann erneut zu schreien.
Während sie brannte, schrie sie: »Vergiss niemals, mein Prinz! Räche mich!« Es folgten noch weitere Worte, aber er konnte sie nicht verstehen. Dann nur noch unverständliche Laute … gequälte Schreie ihres Todeskampfes.
Schluchzend wiederholte er immer und immer wieder seine Schwüre und fügte noch einen weiteren hinzu: »Den König der Dakier … bei lebendigem Leib verbrennen …«
»Mein Verstand wird lange vor meinem Willen zerbrechen. Glücklicherweise ist nur ein unerbittlicher Mann noch interessanter als ein wahnsinniger Mann.«
– Lothaire Konstantin Dakiano, der Erzfeind
»Ich – eine Magnolie aus Stahl? So’n Scheiß!« [Sie lacht, um gleich darauf schlagartig wieder ernst zu werden.] »Titan trifft es wohl eher.«
– Elizabeth »Ellie« Peirce, Expertin für Jungs, umgekehrte Psychologie und Flucht vor den Gesetzeshütern
»Der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass meine Handlungen keinerlei Konsequenzen für mich haben. Das ist es, was mich zur Göttin macht.«
– Saroya, die Seelenschnitterin, Gottheit des Blutes und des Göttlichen Todes, heilige Beschützerin der Vampire
1
Slateville, Virginia
Vor fünf Jahren
»Ihr dachtet also, ihr könntet mich exorzieren?«, fragte Saroya die Seelenschnitterin den verwundeten Mann, den sie im Schein des Feuers verfolgte. »Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Tatsache, dass ihr mich für eine Dämonin hieltet …« Sie wirbelte das blutverschmierte Hackebeil in der Hand herum – sie liebte es, zu sehen, wie der Mann jeder Drehung mit weit aufgerissenen Augen folgte. »… oder dass ihr euch eingebildet habt, ihr könntet mich von meinem menschlichen Wirtskörper trennen.«
Abgesehen vom Tod gab es nichts, was Saroya hätte vertreiben können. Jedenfalls würde das gewiss keinem sterblichen Diakon gelingen. Er gehörte zu einer Gruppe von fünfen, die den weiten Weg bis zu diesem abgewrackten Wohnwagen in den Appalachen auf sich genommen hatten, um einen Exorzismus auszuführen.
Während er vor ihrem gleichmäßigen Vorrücken hastig rückwärts flüchtete, stolperte er über eine der zerbrochenen Lampen auf dem Boden. Er fiel auf den Rücken, wobei er kurz den Stumpf losließ, der einmal sein rechter Arm gewesen war und aus dem jetzt das Blut spritzte.
Sie stieß einen Seufzer puren Entzückens aus. Vor Jahrhunderten, als sie noch eine Göttin des Todes gewesen war, hätte sie sich auf diesen Menschen gestürzt, ihm die Fänge in die Halsschlagader gerammt und so lange gesaugt, bis nichts als die leere Hülle mehr übrig geblieben wäre, und dann hätte sie seine Seele verschlungen. Doch heute war sie dazu verflucht, einen machtlosen Menschen nach dem anderen in Besitz zu nehmen und ein ums andere Mal ihren eigenen Tod zu durchleben.
Ihre neueste Wirtin war Elizabeth Peirce, eine junge Frau von neunzehn Jahren, so hübsch, wie sie arm war.
Als der Diakon auf die zerstückelte Leiche eines seiner Glaubensbrüder traf, stieß er einen entsetzten Schrei aus und wandte den Blick von ihr ab. Wie der Blitz stürzte sich Saroya auf ihn, schwang das Beil und versenkte das Metall tief in seinem dicken Hals.
Blut spritzte, als sie die Klinge herauszog, um noch einmal zuzuschlagen. Dann noch einmal. Und ein letztes Mal.
Sie wischte sich mit dem Arm über ihr blutbespritztes Gesicht und wurde nachdenklich. Sterbliche hielten sich für so etwas Besonderes, Erhabenes, aber einen von ihnen zu enthaupten hörte sich genauso an, wie wenn ein Fischverkäufer einem besonders fetten Fang den Kopf abschlug.
Nachdem sie nun den letzten der fünf Diakone erledigt hatte, wandte sich Saroya der einzigen Überlebenden in dem Wohnwagen zu: Ruth, Elizabeths Mutter. Sie kauerte in einer Ecke und betete leise vor sich hin, während sie mit einem Schürhaken herumfuchtelte.
»Ich habe den Geist deiner Tochter bezwungen, Frau. Sie wird niemals zurückkehren«, log Saroya, wohl wissend, dass Elizabeth bald schon einen Weg finden würde, sich aus der Bewusstlosigkeit herauszukämpfen und wieder die Kontrolle über ihren Körper an sich zu reißen.
Von allen Sterblichen, von denen Saroya je Besitz ergriffen hatte, war Elizabeth die Hübscheste, die Jüngste – und die Stärkste. Es fiel Saroya schwer, die Kontrolle zu übernehmen, es sei denn, das Mädchen schlief oder war auf irgendeine andere Weise geschwächt.
So was hatte es noch nie gegeben. Saroya stieß einen Seufzer aus. Elizabeth sollte es als Ehre betrachten, das Gefäß für Saroyas Essenz zu sein, der Tempel aus Fleisch und Blut, der ihren göttlichen Vampirgeist beherbergen durfte.
Saroya blickte an ihrem gestohlenen Körper hinab. Stattdessen musste sie ständig mit Elizabeth um die Herrschaft über diesen Körper kämpfen, sogar jetzt, in diesem Augenblick.
Egal. Nachdem sie sich jahrhundertelang immer wieder mit gebeugten alten Männern und pferdegesichtigen Frauen herumplagen musste, hatte sie mit Elizabeth endlich die ideale Gestalt gefunden. Am Ende würde Saroya doch als Siegerin hervorgehen. Sie besaß die Weisheit einer längst vergangenen Zeit und der Gegenwart, heilige Talente – und einen Verbündeten.
Lothaire den Erzfeind.
Er war ein Vampir, berüchtigt für seine Bösartigkeit, viele Jahrtausende alt und der Sohn eines Königs. Vor einem Jahr hatte ein Orakel ihn zu ihr geführt. Auch wenn Saroya und Lothaire nur eine einzige gemeinsame Nacht im nahe gelegenen Wald verbracht hatten, hatte er sich verpflichtet, sie aus ihrer elenden Existenz zu erlösen.
Auch wenn er nicht über die Fähigkeit verfügte, Saroya ihre göttliche Gestalt zurückzugeben, würde er irgendwie Elizabeths Seele auslöschen und Saroya dann in einen unsterblichen Vampir verwandeln – und damit den Fluch umgehen.
Saroya wusste, dass Lothaire unermüdlich nach Antworten suchen würde.
Weil ich seine Braut bin.
Sie blickte an Elizabeths Mutter vorbei durch ein kleines Fenster. Doch die Winterlandschaft vor dem Wohnwagen war unberührt. Hatte sie gehofft, ein solches Massaker könnte Lothaire anlocken?
Wie lange soll ich denn noch in dieser gottverlassenen Einöde auf ihn warten? Ohne ein Wort?
Er hatte von den unzähligen Widersachern gesprochen, die es auf ihn abgesehen hatten, von uralten Fehden: »Wenn ein Vampir am Format seiner Feinde gemessen werden kann, Göttin, magst du mich als furchterregend betrachten. Und wenn es nach ihrer Anzahl geht? So findest du nicht meinesgleichen.«
Vielleicht hatten seine Feinde obsiegt?
Sie würde nicht länger hierbleiben. Die Familie Peirce hatte angefangen, Elizabeth nachts an ihr Bett anzuketten, und hinderte Saroya auf diese Weise am Töten – ihrem einzigen Lebensinhalt.
Als sie daran dachte, wie sie behandelt worden war, wandte sie sich der Mutter zu. »Ja, deine Tochter gehört nun für alle Zeit mir. Und nachdem ich dich getötet habe, werde ich deinem kleinen Sohn den Bauch aufschlitzen und wie eine Seuche über deine ganze Familie herfallen.« Sie hob das Beil über ihren Kopf, trat einen Schritt vor …
Mit einem Mal erschienen schwarze Punkte vor ihren Augen. Wurde ihr etwa schwindelig?
Nein, nein! Elizabeth kehrte mit der Wucht eines rasenden Güterzugs in ihr Bewusstsein zurück. Jedes Mal tauchte sie auf wie eine ertrinkende Frau, die man unter Wasser festgehalten hatte, und überwältigte Saroya.
Das kleine Miststück mochte vielleicht die Herrschaft über ihren Körper zurückgewinnen, aber wie üblich würde sie in einem Albtraum erwachen. »Viel Spaß, Elizabeth …«
Ihre Beine gaben nach, ihr Rücken schlug auf den Teppich auf. Und dann war alles schwarz.
Herzschlag, Herzschlag, Herzschlag, Herzschlag …
Als Ellie Peirce erwachte, dröhnte ein wahnsinniges Trommeln in ihren Ohren. Sie lag auf dem Boden des Trailers ihrer Familie, die Augen fest geschlossen, sie fühlte etwas Warmes, Klebriges auf ihrem Körper.
Um sie herum herrschte völliges Schweigen. Die einzigen Laute waren das prasselnde Feuer im Wohnzimmer, ihre flachen Atemzüge und die jaulenden Hunde draußen. Sie konnte sich nicht erinnern, wie sie dorthin gekommen oder wie lange sie ohnmächtig gewesen war.
»Hat es funktioniert, Mama?«, flüsterte sie, während sie vorsichtig die Augen öffnete. Vielleicht hatten die Diakone ja Erfolg gehabt.
Bitte, Gott, mach, dass der Exorzismus funktioniert hat … meine letzte Hoffnung.
Als ihre Augen sich an das dämmrige Licht in dem nur vom Feuer erleuchteten Zimmer gewöhnt hatten, hob sie den Kopf und sah an ihrem Körper herab. Ihre verschlissene Jeans, das T-Shirt und die Secondhandstiefel waren klatschnass.
Von Blut. Sie schluckte. Das ist nicht mein eigenes.
Oh Gott. Ihre Finger umklammerten den Griff eines tropfenden Hackbeils.
Ich habe ihnen doch gesagt, sie sollten mich nicht losketten, ehe mein Onkel und meine Cousins hier sind!
Aber Reverend Slocumb und seine Glaubensbrüder vom »Notfallteam« seiner Kirche hatten sich wohl eingebildet, sie könnten allein mit ihr fertig …
Sie bemerkte eine Bewegung und hob den Blick. Ein Schürhaken?
In den Händen ihrer Mutter.
»Warte!« Ellie warf sich genau in dem Moment zur Seite, in dem der Schürhaken auf den Boden aufschlug, wo gerade noch ihr Kopf gelegen hatte. Blut spritzte vom Teppich empor, als ob jemand in eine Pfütze getreten wäre.
»Fort mit dir, du widerliches Ding!«, kreischte Mama, die erneut mit dem Eisen ausholte. »Mein Mädchen hast du schon, aber meinen Jungen kriegst du nicht!«
»Warte doch mal!« Ellie sprang eilig auf die Füße und ließ das Beil fallen. »Ich bin’s!« Sie hob die Hände mit nach außen gewandten Handflächen.
Doch Mama ließ das Schüreisen nicht sinken. Ihr langes kastanienbraunes Haar hing ihr offen und zerzaust um das faltenlose Gesicht. Mit der Schulter strich sie sich umständlich einige Strähnen aus den Augen.
»Das hast du vorhin auch gesagt, bevor du angefangen hast, in dieser scheußlichen Dämonensprache zu reden und um dich zu schlagen!« Ihre Mascara lief ihr über die Wangen, und von ihrem pfirsichfarbenen Lippenstift waren nur noch verschmierte Spuren auf dem Kinn übrig. »Bevor du alle Diakone umgebracht hast!«
»Umgebracht?« Ellie fuhr herum und starrte sprachlos auf den grauenerregenden Anblick, der sich ihr bot.
Fünf Leichen lagen in Stücke gehackt im Wohnzimmer verstreut.
Diese Männer waren von den flehentlichen Briefen ihrer Mutter und durch die Beweise für Ellies Besessenheit – Aufnahmen, auf denen sie tote Sprachen sprach, die sie gar nicht kennen konnte, und Fotos von Botschaften in Blut, von denen sie nicht wusste, dass sie sie geschrieben hatte – den weiten Weg bis hierher gelockt worden. Anscheinend hatte Ellie einmal auf Sumerisch die Worte Ergib dich mir geschrieben.
Und jetzt war Slocumbs Kopf abgetrennt und lag ein ganzes Stück von seinen übrigen Überresten entfernt. Seine toten Augen blickten sie glasig an, seine Zunge quoll zwischen den geöffneten Lippen hervor. Ein Arm schien zu fehlen. Ihr war dunkel bewusst, dass es sich wohl um den handeln musste, der unter dem Esszimmertisch lag – neben dem Stück Kopfhaut samt Haaren und einem Haufen abgetrennter Finger.
Ellie hielt sich die Hände vor den Mund und unterdrückte den Würgereiz. Diese fünf hatten geschworen, sie könnten den Dämon austreiben. Stattdessen hatte er sie allesamt abgeschlachtet. »D-Das hab … ich getan?«
»Als ob du das nicht wüsstest, Dämon!« Mama drohte Ellie mit ihrem Schüreisen. »Deine Spielchen kannst du mit jemand anders treiben.«
Ellie kratzte sich die Brust. Sie hatte das Gefühl, irgendetwas krabble über ihre Haut – das musste von der Kreatur in ihrem Inneren kommen. Ich hasse sie so sehr, hasse sie, hasse sie, HASSE sie. Auch wenn sie ihre Gedanken nicht wahrnahm, konnte sie die hämische Freude des Wesens in diesem Moment regelrecht spüren.
In der Ferne ertönten Sirenen, was die Hunde draußen dazu veranlasste, noch lauter zu bellen. »Oh Gott, Mama, du hast doch nicht etwa diesen Taugenichts von Sheriff angerufen?« Ellie und ihre Familie lebten seit jeher in den Bergen, und Gesetzesvertreter aller Art waren ihnen grundsätzlich suspekt.
Als sie das hörte, ließ ihre Mutter das Schüreisen fallen. »Du bist ja wirklich Ellie. Der Dämon hat mir gesagt, dass du diesmal nicht zurückkommen würdest! Er hat gesagt, du würdest überhaupt nie mehr zu uns zurückkommen.«
Kein Wunder, dass Mama sie angegriffen hatte.
»Ich bin’s«, sagte Ellie über die Schulter hinweg, während sie zum Fenster hastete. Ihre Stiefel verursachten schmatzende Geräusche auf dem Teppich. Sie zog die von Zigarettenqualm verfärbte Gardine beiseite und spähte in die Nacht hinaus.
Unten am Fuß des Berghangs blitzten die blauen Lichter des Sheriffs auf, dessen Wagen sich im Eiltempo die kurvenreiche Straße hinaufschlängelte. Hinter ihm befand sich ein weiterer Streifenwagen.
»Ich musste die doch anrufen, Ellie! Ich musste den Dämon aufhalten. Und als der Mann in der Notrufzentrale die Diakone schreien hörte …«
Was soll ich nur machen … was kann ich machen? Neunzehn war zu jung, um ins Gefängnis zu gehen! Da würde Ellie lieber sterben. Sie hatte Selbstmord schon in Erwägung gezogen, für den Fall, dass der Exorzismus nicht funktionieren würde.
Denn diese fünf Priester waren nicht die ersten Opfer des Dämons.
Es hatte wenigstens zwei andere Männer getroffen, seit dieses Geschöpf Ellies Körper vor einem Jahr in Besitz genommen hatte. Gleich zu Beginn hatte sie einmal beim Aufwachen einen Mann mittleren Alters in ihrem Bett gefunden, dessen erkaltende Haut sich an ihre geschmiegt und dessen aufgeschlitzte Kehle sie wie ein blutiges Lächeln begrüßt hatte.
Niemand innerhalb der großen Peirce-Familie hatte gewusst, was davon zu halten war. Hatte ein rivalisierender Clan ihnen die Leiche untergeschoben? Aber warum hatten sie ausgerechnet Ellie ausgesucht? Und warum hatte sie Blut an den Händen gehabt?
Ihre Cousins hatten den Mann draußen hinter der Scheune begraben. Sie hatten geschwiegen und sich eingeredet, dass er selbst schuld gewesen sei.
Erst als der Dämon die verstümmelte Leiche eines Vertreters der Minengesellschaft zwischen Ellies alten Stofftieren drapiert und dann ihre Leute auf eine Weise beschimpft hatte, wie es ein Mädchen wie Ellie sicher nie wagen würde, war der Familie der Verdacht gekommen, sie könnte besessen sein.
Danach hatten ihre Mutter und Onkel Ephraim sie nachts angekettet, als ob Ellie einer der Hunde draußen wäre. Auch wenn sie die Ketten hasste und die Schlösser mit Leichtigkeit hätte knacken können, hatte sie sie geduldig ertragen.
Aber für einige war es schon zu spät gewesen.
Wanderer hatten einen gruseligen Altar im Wald entdeckt, der von menschlichen Knochen umgeben war.
»Glaubst du, dass Ellie das war?«, hatte Mama Ephraim zugeflüstert.
Ich war das nicht! Dieses verdammte Ding in ihr schien zu gewinnen, es übernahm immer öfter und mit immer größerer Leichtigkeit die Kontrolle.
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich ganz verschwunden bin.
Während die blauen Lichter langsam immer näher kamen, erschreckend grell sogar im hellen Schein des Mondes, verspürte Ellie den verrückten Impuls, sich zu waschen, dem Sheriff draußen aufzulauern, ihn wegen eines Haftbefehls zu nerven und schließlich vielleicht zuzugeben, dass es sich nur um einen Telefonstreich gehandelt hatte. Schließlich hatte nicht sie diese Morde begangen.
Oder vielleicht sollte sie fliehen.
Aber ihr war klar, dass die Gesetzeshüter sie mit Hunden jagen würden. Sie würde es nicht mal bis ins nächste Tal schaffen, nicht im Winter.
Und das würde auch das Problem mit dem Dämon in ihr nicht lösen …
Als sie einen dumpfen Aufprall hinter sich hörte, fuhr sie herum. Ihre Mutter, die so leicht nichts umhaute, war mit verzweifelter Miene auf die Knie gefallen. »Es hat gesagt, es würde mich auch töten, und dann den Rest der Familie, sogar den kleinen Josh.«
Joshua, Ellies geliebter kleiner Bruder. Sie dachte an ihn, wie er in seinem Schlafanzug auf sie zutapste und wie seine Pausbacken sich rot färbten, wenn er lachte. Im Moment passte eine Tante am Fuß des Berges auf ihn auf.
Bei dem Gedanken, ihm könnte etwas zustoßen, liefen Ellie unkontrolliert die Tränen hinunter. »W-Was soll ich denn nur tun?«
Jetzt weinte auch Mama. »Wenn der Reverend – Gott sei seiner Seele gnädig – und seine Gebete diesen Teufel nicht austreiben konnten … dann wird es überhaupt niemandem gelingen, Ellie. Vielleicht solltest du mit dem Sheriff gehen.«
»Du willst, dass ich in den Knast wandere?«
»Wir haben alles getan, was wir konnten.« Mama stand auf und trat vorsichtig einen Schritt näher an Ellie heran. »Vielleicht können die Leute da im Gefängnis oder die Psychiater oder so dich davon abhalten, noch einmal zu töten.«
Gefängnis? Oder Tod? Ellie schluckte. Sie wusste, dass sie nichts mehr von ihrem Entschluss würde abbringen können, sobald sie ihn erst einmal gefasst hatte. Ihre Mutter war schon stur, aber Ellie war noch dreimal sturer, so unverrückbar wie die Berge um sie herum.
Das Echo der Sirenen begleitete die Streifenwagen, die sich über die lange Straße hinaufkämpften, bis sie mit rutschenden Reifen vor dem Wohnwagen zum Stehen kamen.
Ellie wischte sich die Tränen ab. »Ich glaub, mir ist was Besseres eingefallen als der Knast.« Ich könnte den Dämon mit mir nehmen. Wenn sie jetzt blutbefleckt und mit einer Waffe in der Hand hinausrennen würde …
Mama schüttelte streng den Kopf. »Elizabeth Ann Peirce, wag es ja nicht, auch nur daran zu denken!«
»Wenn dieses Ding«, Ellie schlug sich die Hand auf die Brust, »glaubt, es könnte meinen Leuten wehtun, dann kennt es mich aber nicht sehr gut.«
Auch wenn sie Ellie ihr eigenes Gewehr und die Munition abgenommen hatten, stand immer noch die Remington ihres Vaters im Schrank. Der Sheriff wusste ja nicht, dass sie nicht geladen war.
»Das lässt du schön bleiben, Ellie! Wir können immer noch hoffen, vielleicht gibt es irgendeine neumodische Behandlungsmethode.«
»Willst du wirklich, dass ich in so eine winzige Zelle eingesperrt werde und nicht mehr frei durch die Berge streifen kann?« Sie erinnerte ihre Mutter nicht daran, dass sie vermutlich sowieso die Todesstrafe bekommen würde.
Fünf abgeschlachtete Diakone in den Appalachen? Ellie war erledigt.
»Ich werd das nicht zulassen.« Mama streckte ihr Kinn vor.
»Wir haben doch beide geahnt, dass es mal so weit kommen würde.« Der Dämon bringt mich nur etwas langsamer um. »Ich hab mich entschieden.«
Als sie das hörte, wurde Mama sogar noch blasser, denn sie wusste, dass jetzt niemand mehr Ellie umstimmen konnte.
»Sieh es doch mal so: Wenn ich diesen Dämon töte, dann komme ich in den Himmel und kann bei Daddy sein«, sagte Ellie in der Hoffnung, dass sie auch wirklich dort landen würde. Sie streckte die Arme aus, und ihre Mutter warf sich schluchzend hinein. »Und jetzt hör auf so zu tun, als ob du nicht wüsstest, dass das passieren muss. Du siehst es doch schon seit Monaten kommen.«
»Ach, Gott, mein Liebling. Ich wollte doch nur …« Sie schluchzte erneut. »Willst du vielleicht beten?«
Ellie stellte sich auf die Zehenspitzen und drückte ihrer Mutter einen Kuss auf die glatte Stirn. »Keine Zeit. Es kommt womöglich zurück.«
Außerdem hatten die Hilfssheriffs bereits den Wohnwagen umzingelt. Ihre Stiefel knirschten im Schnee, während der aufgeblasene Sheriff lautstark verlangte, dass Mrs Peirce auf der Stelle die Tür aufmachen solle. Ihm war klar, dass er auf diesem Berg nicht einfach so einen Haushalt stürmen konnte.
Ellie atmete tief durch, um sich zu beruhigen, und wandte sich dem Schlafzimmer ihrer Mutter zu. Sie zwang sich, die Leichen anzusehen. Diese Männer hatten Familien gehabt. Wie viele Kinder mochten jetzt wohl vaterlos sein, nur wegen dieses Dämons?
Weil ich mich so verdammt verbissen an die Hoffnung geklammert habe?
Ellie ging an ihrem eigenen Zimmer vorbei. Sie erschauerte beim Anblick der Ketten an beiden Enden des Bettes, die wie zusammengerollte Klapperschlangen dalagen.
Dann schaute sie mit bitterer Miene auf die Wimpel der Middle State University, die sie an den Wänden ihres Zimmers aufgehängt hatte, kurz bevor dies alles begonnen hatte. Wie aufgeregt sie gewesen war, weil sie aufs College gehen würde! Sie hatte jahrelang jeden Tag nach der Highschool im Laden ihres Onkels und während der Ferien als Führerin gearbeitet, um sich das Schuldgeld und das Studentenwohnheim leisten zu können.
Ellie hatte die Kurse nun gerade lange genug besucht, um voller Staunen zu begreifen: Heilige Scheiße, ich kann das tatsächlich schaffen! Das Lernen war ihr überraschend leichtgefallen.
Doch dann war sie plötzlich immer wieder an ihr unbekannten Orten aufgewacht und hatte nicht mehr gewusst, was sie in den letzten Stunden getan hatte. Sie hatten sie nach Hause geschickt, noch ehe das Semester vorbei war.
Sie wäre die Erste in der Familie mit einem Collegeabschluss gewesen.
Als sie das hintere Schlafzimmer erreichte, erblickte sie ihr Spiegelbild an der Schranktür. Sie war von oben bis unten mit Blut besudelt, ihr langes braunes Haar nass und dunkelrot. Ihre Augen waren so grau wie Feuerstein und so hart wie der Peirce Mountain.
Auf ihrem durchnässten T-Shirt stand: EPHRAIM’S OUTFITTERS: Ausrüstung & Führer für Floßfahrten, Fischen und Jagen.
Was würde Onkel Eph bloß zu alldem sagen?
Sie stellte sich sein wettergegerbtes Gesicht und seine ernste Miene vor. Er ähnelte ihrem verstorbenen Vater so sehr. Kümmre dich einfach nur um deine Angelegenheiten, Ellie. Denn das nimmt dir keiner ab.
Sie schob die Schranktür auf und streckte die Hand aus, vorbei an der alten Arbeitsausrüstung ihres Vaters – einem Grubenhelm, Schlosserwerkzeug, einem Handwerkergürtel. Ehe er in der Mine ums Leben gekommen war, hatte ihr geliebter Vater nie weniger als drei Jobs gleichzeitig gehabt.
Mit einem dicken Kloß im Hals nahm sie seine Lieblingsflinte heraus: eine doppelläufige Remington, Kaliber zwölf. Sie war leer, und es gab auch keine Patronen dafür. Onkel Ephraim war schon vor einiger Zeit vorbeigekommen und hatte sämtliche Munition eingesackt, nur für den Fall, dass der Dämon auf die Idee käme, mit der Schrotflinte zu spielen.
Das vertraute Gewicht der Waffe wirkte tröstlich. Schon bald würde alles für immer vorbei sein. Bei diesem Gedanken verspürte sie ein merkwürdiges Gefühl der Erleichterung.
Als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, kam ihr Mama entgegengeeilt. »Bitte, Schatz, könntest du es nicht wenigstens mit dem Gefängnis versuchen?«
Ich bin so oder so tot. Entweder eine Injektion später oder eine Kugel jetzt.
Ellie würde zu ihren eigenen Bedingungen sterben: Sie würde im Schnee verbluten, auf ihrem geliebten Berg.
»Nein, das Gefängnis kommt gar nicht infrage. Und du musst jetzt an Josh denken. An die Familie.« Ellie zwang sich zu lächeln. »Ich liebe dich, Mama. Sag Josh, dass ich ihn auch sehr geliebt habe. Du weißt ja, dass ich von oben runtergucken und auf euch aufpassen werde.«
Als ihre Mutter in lautes Weinen ausbrach und unverständliche Worte murmelte, zeigte Ellie auf das hintere Zimmer.
»Du gehst jetzt nach hinten und bleibst da! Hast du gehört? Komm nicht raus, bevor sie dich zwingen, ganz egal, was passiert. Versprich mir das!«
Schließlich nickte Mama. Ellie gab ihr einen Schubs, und Mama setzte sich mit schweren Schritten in Bewegung und schloss die Schlafzimmertür leise hinter sich.
Ehe Ellie noch die Nerven verlor, trat sie mit der Remington in der Hand an die Eingangstür. Sie streckte die Hand nach ihrem abgetragenen Mantel aus, um sie gleich darauf zur Faust zu ballen. Dumme Kuh. Du wirst nicht lange frieren.
Also bei drei. Ellie holte ein paarmal tief Atem, ihre Gedanken überschlugen sich. Ich bin doch erst neunzehn – viel zu jung.
Eins.
Ich hab keine Wahl. Bald wird nichts mehr von mir übrig sein.
Zwei.
Stell dir nur vor, du wachst auf, und Mama und Josh sind tot, mit glasigen, blinden Augen.
Auf keinen Fall! Mit einem Schrei warf sie die Tür auf und riss die Flinte hoch.
»Achtung, Waffe!«, brüllte der Sheriff. Dann flogen die Kugeln.
Aber sie spürte keine einzige von ihnen. Ein hochgewachsener Mann war wie aus dem Nichts aufgetaucht und stand nun zwischen ihr und den Polizisten.
Mit einem wütenden Knurren warf er sie zu Boden und schlug ihr das Gewehr aus den Händen, während die Kugeln in seinen Rücken einschlugen. Sie starrte ungläubig zu ihm empor. Seine Augen waren … rot. Wenigstens fünf Kugeln hatten ihn getroffen, aber seine grässlichen Augen starrten unverwandt in ihre.
»Feuer einstellen!«
»Wo kommt der denn her?«
»Was zum Teufel ist hier los?«
Die Haut dieses Mannes sah wie perfekter Marmor aus und hob sich krass von dem schwarzen Hemd und dem Trenchcoat ab, das er trug. Sein Haar war hellblond, seine Züge wie gemeißelt. Und diese Augen … wie von einer anderen Welt.
»Noch ein Dämon!« Blindlings tastete ihre Hand im Schnee, auf der Suche nach der Schrotflinte, doch er stellte einen Fuß auf ihr Handgelenk.
Als sie einen Schmerzensschrei ausstieß, trat er sogar noch fester zu und zog die Lippen zurück, sodass … Fangzähne sichtbar wurden.
»Du wagst es, das Leben meiner Frau aufs Spiel zu setzen?« Seine Stimme war tief, sein Tonfall verächtlich, und er sprach mit Akzent. Bei seinen Worten hörten die Hunde augenblicklich auf zu bellen.
»Wovon reden Sie denn da?«
»Von deinem Versuch, in Glanz und Gloria abzutreten, Elizabeth. Und all das nur wegen einiger Morde?« Er warf ihr einen angewiderten Blick zu, als ob er sagen wollte: Werd endlich erwachsen.
»Heben Sie Ihre Hände dahin, wo ich sie sehen kann«, befahl der Sheriff.
Stattdessen hockte sich der Dämon mit dem hellen Haar neben sie, legte ihr die eine Hand in den Nacken und zog sie näher an sich. Mit der anderen Hand warf er ihre Waffe fort.
Als ihn eine weitere Kugel in den Rücken traf, wandte er den Kopf um. Er stieß ein Zischen aus und fletschte seine Fänge. »Einen – Augenblick!«, fuhr er die Polizisten an.
Ellie erhaschte einen Blick auf die Polizisten. Sie wirkten zu verstört, um reagieren zu können.
Hinter ihnen kamen Ephraim und einige ihrer Cousins mit Gewehren in den Händen den Berg hinaufgestürmt. Als sie den Dämon erblickten, verlangsamten sie entsetzt ihre Schritte.
Das Gesicht des Mannes verzog sich zu einer höhnischen Grimasse. »Sterbliche.« Dann wandte er sich wieder ihr zu. »Hör mir jetzt sehr gut zu, Elizabeth. Ich bin Lothaire der Erzfeind, und du gehörst mir. Nachdem ich über meine Optionen nachgedacht habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dir zu erlauben, heute Abend ins Gefängnis zu gehen.«
»Sie … Sie haben das falsche Mädchen! Ich kenne Sie doch gar nicht …«
Er fuhr fort, ohne ihr Gestammel zu beachten. »In eurem menschlichen Gefängnis wirst du vor meiner Art verborgen sein, was bedeutet, dass du dich in relativer Sicherheit befindest, während ich meine Suche fortsetze. Ich werde zurückkehren und dich holen – in zwei Jahren oder so.« Er schüttelte sie heftig. »Aber wenn du noch ein einziges Mal versuchst, dir – und damit meiner Frau – Schaden zuzufügen, werde ich dich auf unvorstellbare Weise bestrafen. Hast du mich verstanden?«
»Ihre Frau? Ich bin nicht Ihre Frau!«
»Dich will ich ja auch gar nicht haben.« Er kniff seine roten Augen zu Schlitzen zusammen. »Das wunderbare Wesen, das in dir lebt, hingegen …«
»Ich versteh das nicht. Was ist denn in mir?«
Er streckte die freie Hand aus, sodass sie seine schwarzen Klauen im Mondlicht glänzen sah. Anstatt ihre Frage zu beantworten, murmelte er mit heiserer Stimme: »Ich werde sie besitzen, meine Königin, für alle Zeit.«
Als er ihr eine Strähne aus dem Gesicht strich, zuckte sie zusammen. »Fass mich nicht an, Dämon!«
Er starrte auf sie hinab, während er mit seiner tiefen, hypnotischen Stimme das Wort an eine andere richtete. »Saroya, wenn du mich hören kannst: Schlafe, bis ich zurückkehre. Wenn all meine Pläne und all meine Mühen endlich Früchte tragen.«
Saroya? Es hat einen Namen?
Er erhob sich mit übermenschlicher Geschwindigkeit, bis er hoch über Ellie aufragte. Es folgten einige Worte in einer anderen Sprache, und dann löste er sich in Luft auf.
Die entsetzten Hilfssheriffs näherten sich Ellie mit offenen Mündern. Von ihren Stirnen rann der Schweiß, während ihre Atemzüge in weißen Wolken vor ihren Gesichtern schwebten. Einer legte ihr schweigend Handschellen an, während die anderen mit ihren Pistolen in alle erdenklichen Richtungen zielten – sogar nach oben.
Ephraim und ihre Cousins wirkten tief erschüttert. Sie konnten nichts tun, um sie zu retten, es sei denn, sie würden kaltblütig vier Cops abknallen.
Völlig fassungslos erkannte sie schließlich, dass sie sie lebendig gefasst hatten.
Der rotäugige Dämon hatte ihren Tod verhindert. Und Ellie brannte darauf, ihn dafür umzubringen.
2
Justizvollzugsanstalt für Frauen, Ridgevale, Virginia
Gegenwart
»Hat die Verurteilte noch etwas zu sagen?«, fragte der Gefängnisdirektor in feierlichem Ton.
»Nein!« Ellie wand sich in ihren Fesseln auf der Liege und zerrte an den Elektroden, die auf ihrer Brust klebten. Bei jedem ihrer hektischen Herzschläge schlug die Linie auf dem EKG-Monitor neben ihr weit nach oben aus. Die Infusionsschläuche, die in beide Arme führten, schaukelten hin und her. »Nein, ich bin bereit!«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!