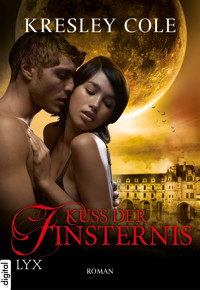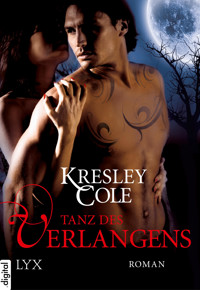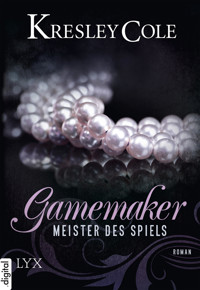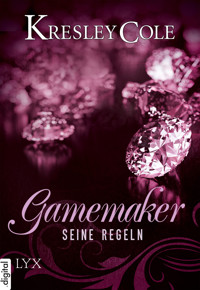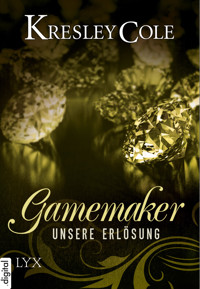9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Immortals After Dark
- Sprache: Deutsch
Der Dämonenkönig Rydstrom wird von seiner Erzfeindin, der mächtigen Zauberin Sabine, entführt. Sabine will den Dämon dazu zwingen, einen Erben mit ihr zu zeugen. Doch noch während Rydstrom seine Flucht plant, muss er feststellen, dass er unerwartet tiefe Gefühle für Sabine entwickelt. Schon bald finden sich die Zauberin und der Dämon in einem Sturm der Leidenschaft wieder, der sie ihre alte Feindschaft beinahe vergessen lässt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
Zitat
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Epilog
Aus dem Lebendigen Buch des Mythos
Impressum
Kresley Cole
Roman
Ins Deutsche übertragen von Bettina Oder
Für Gena Showalter, Licht meines Lebens – außergewöhnliche Autorin, geschätzte Mentorin und teuerste Freundin.
»Bei mir ist nichts so, wie es scheint. Für gewöhnlich ist es viel, viel schlimmer. Und außerdem … Was soll das heißen, dass mir nur ein Zitat zustehe? Ich kann so viele haben, wie ich will. Normalerweise reiße ich Leuten, die Ähnliches zu mir sagen, die Gedärme heraus.«
Sabine von den Sorceri, Königin der Illusionen, gesalbte Prinzessin von Rothkalina
»Diese Zauberin mag ein bösartiges Weib sein, aber sie ist mein bösartiges Weib. Und ich will keine andere.«
Rydstrom Woede, gestürzter Dämonenkönig von Rothkalina
Prolog
Gray Waters Irrenanstalt, London
Herbst 1872
»Einer Sache kannst du dir sicher sein: Wann auch immer du einen Hexenmeister zwischen die Schenkel nimmst, läufst du Gefahr, deine Fähigkeiten zu verlieren«, belehrte Sabine ihre Schwester, während sie die Gesichter der eingesperrten Wahnsinnigen musterte. »Das ist nun einmal eine Tatsache.«
»Früher einmal vielleicht«, sagte Lanthe und ließ den bewusstlosen Wachmann fallen, den sie an seinem Gürtel hinter sich hergezogen hatte. »Bei dem hier wird es jedenfalls vollkommen anders sein.« Geschäftig fesselte sie dem Mann die Hände auf den Rücken – sie hätte ihm auch die Arme brechen können, was zum selben Ergebnis geführt hätte, ohne jedoch ein Seil zu vergeuden. »Du hast sie immer noch nicht entdeckt?«
Sie – die Zauberin, die sie aus diesem Ort befreien wollten, falls sie zustimmte, ihre Macht im Austausch gegen ihre Freiheit an Lanthe zu übertragen.
Sabine schlich über den düsteren Korridor. »Ich kann es einfach nicht sagen, wenn sie so aufeinanderhocken.« Sie riss eine Zellentür aus den Angeln und warf sie zur Seite, ihre Absätze klackten über den Boden, als sie den Käfig betrat. Aus der Nähe konnte sie deutlich erkennen, dass alle Insassen überaus … sterblich aussahen. Sie wichen ängstlich vor ihr zurück, wie nicht anders zu erwarten war. Sabine wusste, welch exotischen Anblick sie mit ihrer Kleidung und der Gesichtsbemalung bot.
Ihre Augen waren mit einem breiten schwarzen Streifen umrandet, der sich von der Seite ihrer Nase bis hin zu ihren Schläfen zog. Es wirkte, als trüge sie eine Maske.
Ihre Kleidungsstücke bestanden aus Lederstreifen und Metallketten statt aus Stoff und Faden. Sie trug ein metallenes Bustier, Netzhandschuhe bedeckten ihre Arme und endeten in schmiedeeisernen Krallen an ihren Fingerspitzen. Inmitten der zügellosen Strähnen ihres Haars steckte ein kunstvoller Kopfschmuck – die typische Gewandung der Sorceri-Frauen. Genau genommen galt man als underdressed, wenn das Outfit nicht mehr wog als seine Trägerin.
Als Sabine aus der nächsten Zelle trat, war Lanthe endlich mit den Knoten fertig. »Und, Glück gehabt?«
Sabine riss eine weitere Käfigtür aus den Angeln, starrte in die bleichen Gesichter und schüttelte den Kopf.
»Bleibt mir noch die Zeit, um die kleineren Zellen im Keller zu überprüfen?«, fragte Lanthe.
»Solange wir in zwanzig Minuten wieder am Portal sind, sollte das eigentlich kein Problem sein.« Ihr Portal, das sie nach Hause – nach Rothkalina – zurückbringen würde, lag etwa zehn Minuten entfernt, irgendwo in den nasskalten Straßen Londons.
Lanthe pustete sich eine pechschwarze Strähne aus der Stirn. »Pass du auf die Wache auf und sorg dafür, dass die freigelassenen Insassen in diesem Gewölbe sich ruhig verhalten.«
Sabines Blick wanderte zu dem bewusstlosen Mann, der auf dem dreckigen Boden lag, und sie verzog verächtlich die Lippen. Sie konnte die Gedanken der Menschen lesen, selbst wenn sie ohnmächtig waren, und der Inhalt seines Kopfes gab sogar Sabine zu denken.
»Von mir aus. Aber beeil dich«, sagte Sabine. »Sonst locken wir noch unsere Feinde an.«
Aus purer Gewohnheit schweiften Lanthes blaue Augen nach oben. »Sie könnten jede Sekunde hier sein.« Sie eilte zurück zur Treppe.
Ihr Leben folgte mittlerweile einem monotonen Kreislauf: Sie stahl eine neue Fähigkeit und floh vor ihren Feinden, dann wurde ihr die Fähigkeit von irgendeinem Süßholz raspelnden Sorceri-Mann geklaut, und sie musste eine neue Fähigkeit stehlen … Sabine ließ dieses sich ewig wiederholende Spiel zu.
Denn sie war es, die Lanthes angeborene Fähigkeit zerstört hatte.
Als ihre Schwester fort war, murmelte Sabine: »Auf die Wache aufpassen … von mir aus …«
Sie hob den Mann an Kragen und Gürtel hoch und warf ihn vor die Ausgangstüren. Angesichts dieses Gewaltakts gerieten einige der Insassen ganz außer sich, sie heulten auf und rissen sich an den Haaren. Diejenigen, die den Weg nach draußen anvisiert hatten, krabbelten eilig zurück.
Dafür sorgen, dass sich die Menschen ruhig verhalten, ist ja so leicht.
Sie schlenderte zu dem Wachmann hinüber, trat auf seinen Rücken und breitete die Arme aus. »Kommt her und sammelt euch um mich, ihr verrückten menschlichen Wesen. Kommt her! Ich, eine Zauberin der schrecklichen und schwarzen Mächte, werde es euch mit einer Geschichte lohnen.« Einige verstummten offensichtlich aus reiner Neugier, andere hingegen vor Entsetzen. »Schweigt still, ihr Sterblichen, und vielleicht zeige ich euch sogar eine Geschichte, wenn ihr schön brav seid.« Das Brüllen und Kreischen, das sie hervorgerufen hatte, verstummte allmählich. »Also, setzt euch, setzt euch alle hin. Ja, setzt euch hier zu mir. Näher. Aber du nicht, du stinkst nach Urin und Haferbrei. Du da – sitz!«
Sobald sie sich alle vor ihr versammelt hatten, hockte Sabine sich auf den Rücken des Wachmanns. Sie blickte in die Runde, und langsam breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus, während sie sich vorbereitete. Sie zog ihren Rock hoch und fummelte an ihren Strumpfbändern herum, dann rückte sie ihr unerlässliches Halsband zurecht.
»Also, ihr habt heute Abend die Wahl. Ihr könnt die Geschichte eines mächtigen Dämonenkönigs hören, mit Hörnern und Augen so schwarz wie Obsidian. Er lebte in einem längst vergangenen Zeitalter, so ehrenhaft und aufrecht, dass er seine Krone an eine hinterlistige böse Macht verlor. Oder ihr entscheidet euch für Sabines Geschichte. Sie war ein unschuldiges junges Mädchen, das immer und immer wieder bis in alle Ewigkeit ermordet wurde.« Und das eines Tages die Braut jenes Dämons sein würde …
»D-das Mädchen, bitte«, flüsterte einer der Insassen. Sein Gesicht war hinter dem Vorhang seiner verfilzten Haare nicht zu erkennen.
»Eine ausgezeichnete Wahl, haariger Sterblicher.« Sie begann ihre Erzählung mit dramatischer Stimme. »Unsere Geschichte handelt von der furchtlosen Heldin Sabine, der Königin der Illusionen …«
»Und wo leben diese Illusionen?«, fragte eine junge Frau, die dafür kurz aufhörte, an ihrem eigenen Unterarm zu nagen.
Ausgezeichnet, sie würde ständig unterbrochen werden. »Illusionen sind keine Menschen. Eine ›Königin‹ ist in diesem Fall jemand, der eine bestimmte mystische Fähigkeit besser beherrscht als jeder andere.«
Sabine vermochte Fantasiegebilde hervorzurufen, die von der Wirklichkeit nicht zu unterscheiden waren, und alles zu manipulieren, was man sehen, hören oder sich vorstellen konnte. Sie vermochte in die Gedanken eines Lebewesens einzudringen und ihm Szenen aus seinen kühnsten Träumen – oder schlimmsten Albträumen – einzupflanzen. Darin konnte ihr niemand das Wasser reichen.
»Also, die unglaublich schöne und kluge Sabine hatte soeben ihr zwölftes Lebensjahr vollendet und vergötterte ihre Schwester Melanthe, ein neunjähriges Mädchen, das sich zu einer leichtfertigen jungen Frau entwickeln sollte, die später einmal nur allzu bereitwillig den Rock für so ziemlich jeden Mann heben würde. Sabine hatte die kleine Lanthe von ganzem Herzen geliebt, seit diese zum ersten Mal ihren Namen gerufen und damit ihre Schwester ihrer eigenen Mutter vorgezogen hatte. Die beiden Schwestern waren in die Septe der Sorceri hineingeboren worden, eine dahinschwindende und vergessene Rasse. Kein besonders spannendes Material für eine Geschichte, könnte man meinen. Im Vergleich zu einem Vampir oder sogar einer Walküre.« Sie rümpfte die Nase. »Doch hört mir zu und seht selbst …«
Sie hob die Hand, um eine Illusion zu schaffen, aus sich selbst heraus und aus ihrer Umgebung – aus der Energie der vom Wahnsinn gebeutelten Insassen und der von Blitzen zerrissenen Nacht außerhalb des Irrenhauses.
Als sie in ihre geöffnete Handfläche blies, wurde eine Szene auf die Mauer neben ihr projiziert. Die Menschen vor ihr schnappten hörbar nach Luft, vereinzelt war leises Wimmern zu hören.
»Das erste Mal starb Sabine an einem Abend wie diesem, in einem heruntergekommenen Gebäude, das unter der Wucht des Donners erbebte. Nur dass es sich nicht um ein rattenverseuchtes Irrenhaus, sondern um eine Abtei handelte, die hoch oben auf einem Berggipfel in den Alpen errichtet worden war. Es herrschte tiefster Winter im Land.«
In der nächsten Szene sah man Sabine und Lanthe in Nachthemden und Umhängen eine düstere Treppe hinuntereilen. Selbst im Laufen zogen sie jedes Mal den Kopf ein, wenn von draußen das Schlagen mächtiger Schwingen ertönte. Lanthe weinte stumm.
»Sabine war von Wut auf sich selbst erfüllt, da sie nicht auf ihren Instinkt gehört und Melanthe von ihren Eltern ferngehalten hatte, und damit von der Gefahr, die diese mit ihrer verbotenen Zauberkunst anzogen. Aber Sabine war davor zurückgeschreckt, weil die beiden Mädchen, auch wenn sie von unsterblichen Eltern abstammten und beide über große Macht verfügten, immer noch Kinder waren. Als solche konnten sie ebenso einfach wie Sterbliche verwundet und getötet werden, ihre Verletzungen wären genauso langwierig. Doch nun blieb Sabine keine andere Wahl, als zu verschwinden. Sie spürte, dass ihre Eltern bereits tot waren, und hegte den Verdacht, dass die Mörder sich irgendwo in der düsteren Abtei aufhielten. Die Vrekener waren gekommen, um sie zu …«
»Was ist ein Vrekener?«
Sabine holte tief Luft und starrte an die Decke. Ich darf das Publikum nicht umbringen, ich darf das Publikum nicht umbringen …
»Das sind uralte geflügelte Rächer. Dämonische Engel«, antwortete sie schließlich. »Ebenfalls eine aussterbende Rasse. Doch solange wir uns in unserer kleinen Ecke der Mythenwelt zurückerinnern können, schlachten sie böse Sorceri ab, wo sie sie nur finden können, und Sabines Familie jagten sie schon ihr ganzes Leben lang. Aus keinem anderen Grund als dem, dass ihre Eltern in der Tat sehr böse waren.«
Mit einer Handbewegung beschwor Sabine die nächste Szene herauf, die zeigte, wie die beiden Mädchen in das Zimmer ihrer Eltern stolperten. Die Blitze, die die gewaltigen Buntglasfenster erleuchteten, warfen ein unheimliches Licht auf die Körper ihrer Eltern, die sich im Schlaf zusammengerollt hatten.
Die kopflosen Körper, soeben enthauptet.
In dem Bild wandte sich Sabine ab und übergab sich. Lanthe brach mit einem erstickten Schrei zusammen.
Eine weitere Illusion zeigte einige Vrekener und wie sie aus den Schatten des Gemachs heraustraten, angeführt von einem der ihren, der eine Sense schwang, die nicht aus Metall, sondern aus schwarzem Feuer geschmiedet war.
Bei jedem Blitz tauchten ihre gewaltigen, gespenstischen Schwingen kurz aus dem Dunkel auf, und zwei parallele Reihen von Hörnern glänzten auf ihren Köpfen. Sie ragten so hoch empor, dass Sabine den Kopf in den Nacken legen musste, um ihnen in die Augen zu sehen, obwohl sie sich auf der anderen Seite des Raumes befand. Alle waren sie riesig, bis auf einen. Er war noch ein Junge, jünger als Sabine sogar. Er ließ die kleine Lanthe nicht einen Moment aus den Augen, die ohnmächtig auf dem Boden lag, zusammengerollt wie ein Kätzchen. Einer der Erwachsenen musste ihn mit Gewalt von ihr fernhalten.
Jetzt wurde Sabine klar, in welcher Lage sie und Lanthe sich befanden. Diese Gruppe von Vrekenern hatte ihnen nicht nur nachgestellt, um sie zu bestrafen.
»Der Anführer versuchte Sabine zu überreden, sie ohne Gegenwehr zu begleiten«, berichtete sie ihrem Publikum. »Er behauptete, er werde die Schwestern auf den Pfad des Guten bringen. Aber Sabine wusste, was die Vrekener Sorceri-Mädchen antaten, und das war ein Schicksal, das weit schlimmer als der Tod war. Also bekämpfte sie sie.«
Sabine zeigte die letzte Illusion, die die Geschichte zu einem Ende brachte …
Sie bebte am ganzen Körper, als sie langsam ein machtvolles Netz aus Illusionen um ihre Feinde spann. Sie ließ die Vrekener-Soldaten glauben, dass sie in einer Höhle gefangen säßen, tief unter der Erde, aus der es kein Entkommen gab – dies war ihre größte Furcht.
Sie streckte ihre Handflächen dem Anführer entgegen, eine Geste der Unterwerfung, und richtete sie auf seinen Geist. Sobald sie die Verbindung aufgenommen hatte, zerrte sie gierig seine Albträume heraus, konfrontierte ihn sogleich damit und zwang ihn auf diese Weise, noch einmal zu durchleben, was ihn am meisten verletzte.
Diese Szenen ließen ihn auf die Knie sinken. Als er dann seine Sense fallen ließ, um sich die Augen zu reiben, schnappte sie sich seine Waffe. Sabine zögerte nicht, sie einzusetzen.
Heißes Blut spritzte ihr ins Gesicht, als sein Kopf vor ihren Füßen zu Boden fiel. Sobald sie sich mit dem Ärmel ihres Umhangs über die Augen gewischt hatte, erkannte sie, dass ihre Illusionen verblassten und die Vrekener wieder in der Lage waren zu erkennen, wo sie sich tatsächlich befanden. Lanthe war erwacht und schrie, Sabine solle sich in Acht nehmen.
Und dann … hielt die Zeit an.
Jedenfalls schien es so. Der Lärm wurde leiser, und die Bewegungen aller im Raum Anwesenden verlangsamten sich. Alle starrten auf Sabine, auf das Blut, das aus ihrer Halsschlagader spritzte, als sie zusammenbrach. Einer dieser Männer hatte ihr von hinten die Kehle durchgeschnitten, und die ganze Welt färbte sich rot.
»Abie?«, kreischte Lanthe. Sie rannte auf ihre Schwester zu und fiel neben ihr auf die Knie. »Nein, nein, nein, Abie, stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht!«
Die Luft um sie herum wurde heiß, und alles verschwamm.
Während Sabine ihre Macht über die Illusionen hatte, besaß Lanthe von Geburt an eine Zauberkraft, die Überzeugungskunst genannt wurde. Sie konnte jedem Lebewesen befehlen zu tun, was auch immer sie wollte, allerdings nutzte sie ihre Gabe nur sehr selten, da ihre Befehle nur allzu oft in einer Tragödie endeten.
Doch als diese Männer sie nun einkreisten, begannen Lanthes Augen zu funkeln, sie glitzerten wie Metall. Ohne jede Gnade setzte sie ihre grauenhafte Macht gegen ihre Feinde ein, die zu benutzen sie immer gefürchtet hatte. »Bewegt euch nicht … Erstecht euch selbst … Kämpft gegeneinander, bis alle tot sind.«
Der Raum war mit Magie erfüllt, und die Abtei begann um sie herum zu ächzen. Eines der Buntglasfenster zersprang. Lanthe befahl dem Jungen hindurchzuspringen – und auf dem Weg nach unten seine Schwingen nicht zu benutzen. Er gehorchte, die Augen vor Bestürzung dem Wahnsinn nah, als das dicke Glas ihm die Haut aufschlitzte. Es war kein Laut von ihm zu hören, als er in die Tiefe stürzte.
Als alle tot waren, kniete sich Lanthe erneut neben Abie.
»Lebe, Abie! Werde gesund!« Bei den Göttern, Lanthe drängte sie, versuchte, es ihr zu befehlen. Aber es war zu spät. Sabines Herz schlug nicht mehr. Ihre toten Augen starrten ins Leere.
»Verlass mich nicht!«, schrie Lanthe. Sie drängte ihre Schwester stärker, immer stärker … Die Möbel begannen zu zittern, das Bett ihrer Eltern wurde durchgeschüttelt … alles verschob sich … mit einem dumpfen Knall fiel ein Kopf zu Boden. Dann ein zweiter.
Die Macht war unvorstellbar groß. Und irgendwie spürte Sabine, wie sich ihr Körper regenerierte. Sie blinzelte. Als sie die Augen öffnete, war sie am Leben und stärker als je zuvor.
»Sie flohen von diesem Ort, liefen in die Welt hinaus und blickten niemals zurück«, erzählte sie ihrem gebannten Publikum. »Alles, was Sabine von dieser Nacht zurückbehielt, war die Narbe an ihrem Hals, eine Geschichte zum Erzählen und die Blutrache eines Vrekener-Jungen, dem es irgendwie gelungen war, seinen Sturz zu überleben …«
Tief in Gedanken verloren, bemerkte Sabine kaum, dass der Wächter inzwischen erwacht war und sich unter ihrem Stiefel wand. Sie bückte sich und brach ihm das Genick, bevor ihre Geschichte sie so mitnahm, dass sie vergaß, dies zu erledigen.
Eine der Frauen klatschte entzückt in die Hände. Eine andere flüsterte: »Möge Gott Sie segnen und es Ihnen vergelten, Miss.«
Sabine könnte an diesem Abend durchaus eine Erfüllungsgehilfin des Schicksals sein, ihr Handeln weder gut noch böse, nur eine Laune des Schicksals, das beides sein konnte.
Schließlich war es denkbar, dass die nächste Wache sie weitaus schlechter behandeln würde.
»Was ist denn beim zweiten Mal als sie gestorben ist, passiert?«, fragte eine dreiste Frau, deren Kopf kahl rasiert war.
»Sie kämpfte, um Melanthe und sich selbst vor einer weiteren Vrekener-Attacke zu schützen. Sie nahmen Sabine gefangen, flogen mit ihr weit in den Himmel hinauf und ließen sie aufs Kopfsteinpflaster der Straße fallen. Doch wieder war ihre Schwester da, um ihren zerschlagenen Körper zu heilen, sie dem Tod ein weiteres Mal aus den Armen zu reißen.«
Sabine konnte sich immer noch an das Geräusch erinnern, mit dem ihr Kopf zerbarst, als wäre es erst gestern geschehen. Das war verdammt knapp gewesen …
»Beim dritten Mal jagten sie sie in einen reißenden Fluss. Das arme Mädchen konnte nicht schwimmen und ertrank …«
»Dann nimm sie dir doch, du Miststück!« Die kreischende Stimme einer Frau im Geschoss unter ihnen unterbrach den Fluss der Erzählung noch einmal.
Ah, die Königin der Schweigenden Zungen gab nach und ließ sich auf Lanthes Vorschlag ein.
Sabines Haut prickelte, als die Luft um sie herum vor Energie zu knistern begann. Die dort unten eingesperrte Zauberin gab in diesem Augenblick ihre Radixmacht auf. Ab sofort war Lanthe in der Lage, innerhalb gewisser Grenzen mit jedem telepathisch in Kontakt zu treten, den sie auf diese Weise ansprach.
»Nein, sorgt euch nicht«, sagte Sabine zu den verängstigten Menschen. »Habt ihr schon mal einen dieser Groschenromane gelesen? Einen von der Sorte, in denen ein Banküberfall vorkommt? Das ist alles, was meine Komplizin jetzt gerade macht. Abgesehen davon, dass sie etwas stiehlt, das genauso viel wert ist wie« – sie sprach mit dramatischer Stimme weiter – »eure Seele!«
Eine der Frauen begann zu weinen, als sie das hörte. Es erinnerte Sabine daran, warum unter ihren Haustieren so selten Menschen waren.
»Wer hat sie das nächste Mal getötet?«, fragte die dreiste Menschenfrau. »Vrekener?«
»Nein. Es waren andere Sorceri, die es auf ihre gottgleiche Macht abgesehen hatten. Sie haben sie vergiftet.« Wie sehr die Sorceri doch ihre Gifte verehren, dachte sie bitter. Dann verzog sie die Stirn angesichts ihrer Erinnerungen. »Dieses wiederholte Sterben hat dem Geist des jungen Mädchens übel mitgespielt. Wie eine Pfeilspitze, die im Feuer geschmiedet wird, wurde sie durch den ständigen Druck und die Schläge zu einer scharfen und tödlichen Waffe. Zudem entwickelte sie eine Gier auf das Leben wie noch niemand vor ihr. Wenn sie spürte, dass es in Gefahr war, wurde sie von blindwütiger Raserei erfasst, dem Verlangen, unerbittlich um sich zu schlagen.«
Als einige ihrer Zuhörer die Augen aufrissen, wurde Sabine bewusst, dass sich der Raum mit dichtem Nebel gefüllt zu haben schien, während sie in ihren Gedanken versunken war. Es kam häufiger vor, dass sie Illusionen hervorrief, die ihre Gedanken und Gefühle widerspiegelten, sogar wenn sie träumte.
Während sie sich beeilte, den Nebel verschwinden zu lassen, sagte ein anderer Patient: »Gute Frau, w-was ist denn nach der Vergiftung passiert?«
»Die Schwestern wünschten sich nur, zu überleben, in Ruhe gelassen zu werden und mithilfe von ein klein wenig Zauberei ein Vermögen in Gold anzuhäufen. War das etwa zu viel verlangt?« Sie warf ihnen einen »Also, ehrlich!«-Blick zu.
»Aber die Vrekener waren unerbittlich und verfolgten die Spur, die die Zauberei der Mädchen hinterließ. Besonders der Junge. Da er zu der Zeit, als er zu dem Sprung aus dem Fenster gezwungen worden war, noch nicht den Zustand der Unsterblichkeit erreicht hatte, regenerierte sich sein Körper nicht. Aufgrund seiner Verletzungen war er für alle Zeit gebrochen und vernarbt.«
Sie hatten inzwischen erfahren, dass sein Name Thronos war und dass er der Sohn des Vrekeners war, dem Sabine vor all diesen Jahren den Kopf abgeschlagen hatte.
»Da sie es nicht länger wagten, Zauberei zu verwenden, standen die Mädchen bald vor dem Hungertod. Sabine war jetzt sechzehn und alt genug, um das zu tun, was jedes Mädchen in ihrer Situation nun tun würde.«
Die dreiste Menschenfrau verschränkte die Arme über der Brust und sagte wissend: »Prostitution.«
»Falsch. Kommerzieller Fischfang.«
»Tatsächlich?«
»Natürlich nicht!«, sagte Sabine. »Wahrsagerei. Was ihr prompt die Todesstrafe wegen Hexerei einbrachte.« Sie betastete die weiße Strähne in ihrem roten Haar, die sie vor anderen durch eine Illusion verbarg. »Hexen wurden durchaus nicht immer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist ein Irrtum. Nein, manchmal hatte ein Dorf schon zu viele verbrannt, und darum töteten sie sie heimlich, indem sie gleich mehrere gemeinsam bei lebendigem Leib begruben.« Ihre Stimme wurde weich. »Könnt ihr euch vorstellen, wie es für das Mädchen gewesen sein muss, Erde einzuatmen? Zu fühlen, wie die Erde sich in ihren Lungen ausbreitete?«
Sie blickte auf ihre stummen Zuhörer. Alle Augen waren weit aufgerissen. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können.
»Die Menschen hauchten rasch ihr Leben aus, doch nicht Sabine«, fuhr sie fort. »Das Mädchen widerstand dem Ruf des Todes, solange es konnte, aber es fühlte, wie es langsam sein Leben aushauchte. Doch dann hörte sie eine eindringliche Stimme von oben, die ihr befahl, zu leben und sich aus dem Grab zu erheben. Und Sabine gehorchte, ohne nachzudenken. Sie grub sich durch die toten Körper der anderen, reckte die Arme blindlings nach oben und bemühte sich verzweifelt, der Oberfläche Zentimeter um Zentimeter näher zu kommen.«
Da erklang hinter ihnen Lanthes Stimme. »Schließlich schoss Sabines Hand aus dem schlammigen Grund, bleich und zur Faust geballt. Endlich konnte Melanthe ihre Schwester finden. Während sie Sabine aus ihrem Grab zog, schlug um sie herum ein Blitz nach dem anderen ein, und Hagel prasselte auf sie herab, als ob die Erde wütend wäre, ihre Beute zu verlieren. Seit jener schicksalhaften Nacht schert sich Sabine um gar nichts mehr.«
Sabine seufzte. »Es stimmt nicht, dass sie sich für gar nichts interessiert. Sie interessiert sich wirklich sehr für nichts.«
Lanthe warf ihr einen ärgerlichen Blick zu, ihre Augen schimmerten immer noch metallisch blau von der jüngsten Infusion der Macht.
»Wie amüsant, Sabine«, sagte sie, wobei sie ihre Worte direkt an Sabines Verstand richtete.
Sabine zuckte zusammen. »Telepathie. Wahnsinn. Versuch, sie diesmal zu behalten.«
Bei den Göttern – sie war erleichtert, dass Lanthe eine weitere Kraft erlangt hatte. Die Überredungskünste ihrer Schwester schienen nahezu erschöpft zu sein nach all ihren Bemühungen, Sabine am Leben zu erhalten. Es hatte den Anschein, als ob all diese Tode Sabine noch mächtiger gemacht hatten, während sie Lanthe geschwächt hatten, sowohl was ihre Fähigkeit als auch ihre Widerstandskraft anging.
»Diese Zauberin besaß außerdem noch die Gabe, mit Tieren reden zu können«, fuhr Lanthe fort. »Rate mal, was du zum Geburtstag bekommst!«
»Na toll.« Diese Fähigkeit gehörte zu denen, die die Sorceri am wenigsten begehrten. Das Problem bei der Kommunikation mit Tieren lag darin, dass nur selten genug welche von ihnen in Hörweite waren, um sich als nützlich zu erweisen. »Dann kann ich nur hoffen, dass gerade eine Heuschreckenplage die Nachbarschaft heimsucht, wenn ich mal eine brauche.« An ihr Publikum gewandt, sagte Sabine: »Wir sind hier fertig.«
Der langhaarige Mann fragte: »Wartet, was ist denn nach der Beerdigung passiert?«
»Alles wurde noch viel, viel schlimmer«, sagte Sabine wegwerfend.
Die weinende Frau heulte noch lauter. »W-wie konnte es denn noch viel schlimmer werden als all diese Tode?«
»Sie trafen Omort den Unsterblichen«, erwiderte Sabine trocken. »Er war ein Hexenmeister, der niemals den Kuss des Todes verspüren würde. Aus diesem Grund war er auf der Stelle von dem Mädchen bezaubert, das sich so gut mit dem Sterben auskannte.«
Lanthe sah ihr in die Augen. »Er wird sich fragen, wo wir bleiben.«
»Aber er weiß, dass wir immer wiederkommen.« Omort hatte die Schwestern unter Kontrolle. Sabine stieß ein bitteres Lachen aus. Hatten sie tatsächlich einmal geglaubt, sie wären bei ihm sicher?
In diesem Augenblick hörte Sabine von draußen das Schlagen von Schwingen.
»Sie sind da.« Lanthes Blick huschte zu dem riesigen Fenster des Raums. »Lass uns zu den Tunneln unter der Stadt laufen, und dann versuchen wir, unser Portal zu finden.«
»Ich bin nicht in der Stimmung zu laufen.« Das ganze Gebäude begann angesichts von Sabines Zorn zu beben, oder zumindest schien es so.
»Wann bist du das schon? Aber wir müssen.«
Auch wenn Sabine und Lanthe über feengleiche Schnelligkeit verfügten und für ihre schmutzige Kampftaktik berühmt-berüchtigt waren, waren die Vrekener schon aufgrund ihrer Anzahl unaufhaltbar. Außerdem besaßen die Schwestern keinerlei Kampfmagie.
Lanthes Blick glitt durch den Saal, auf der Suche nach einem Fluchtweg. »Sie werden uns kriegen, selbst wenn du uns unsichtbar machst.«
Mit einer einzigen Handbewegung schuf Sabine eine Illusion. Auf einmal sahen Lanthe und Sabine wie Patienten aus. »Wir sorgen für eine Massenpanik unter den Menschen und laufen mit ihnen zusammen in die Nacht hinaus.«
Lanthe schüttelte den Kopf. »Die Vrekener werden uns wittern.«
Sabine blinzelte ihr zu. »Lanthe, hast du etwa noch nicht an meinen Menschen gerochen?«
1
Gegenwart
Tongue & Groove Stripclub
im Süden von Louisiana
»Ein Lapdance für den sexy Dämon?«
Mit einem entschiedenen Kopfschütteln erteilte Rydstrom Woede der spärlich bekleideten Frau eine Absage.
»Auf einem Schoß wie dem deinen könnte ich mich zu Hause fühlen«, sprach eine andere ihn an. »Kostenlos.« Sie umfasste eine ihrer Brüste, hob sie an und umfuhr mit der Zunge ihre Brustwarze.
Das brachte ihn dazu, eine Augenbraue zu heben, trotzdem erwiderte er: »Kein Interesse.«
Dies war einer der Tiefpunkte in seinem Leben, umgeben von Stripperinnen in einem von Neonlicht erhellten Mythenweltclub. Er fühlte sich unwohl an diesem lächerlichen Ort, wie der letzte Heuchler. Wenn sein nichtsnutziger Bruder herausfände, wo er gewesen war, würde er sich das bis ans Ende seiner Tage anhören müssen.
Aber Rydstroms Kontaktperson hatte darauf bestanden, ihn hier zu treffen.
Als sich eine hübsche Nymphe von hinten an ihn ranmachte, um ihm die Schultern zu massieren, packte er ihre Hände und drehte sich zu ihr um. »Ich habe Nein gesagt.«
Die Frauen hier ließen ihn kalt, was ihn ganz schön irritierte, nachdem er so dringend eine Frau unter sich spüren wollte. Seine Augen mussten sich verdunkelt haben, da die Nymphe jetzt hastig den Rückzug antrat. Jetzt raste ich schon wegen einer Nymphe aus? In Zorn zu geraten, weil eine ihrer Art ihn anfasste, war, als ob man einen Hund dafür schalt, dass er beim Anblick eines Knochens mit dem Schwanz wedelte.
In letzter Zeit stand Rydstrom ständig unmittelbar davor, sich seiner Wut zu ergeben. Der gefallene König, der für seine Besonnenheit und Vernunft bekannt war, für seine Geduld im Umgang mit anderen, fühlte sich wie eine Bombe kurz vor der Explosion.
Seit geraumer Zeit schon beschäftigte ihn eine unerklärliche Vorahnung, das Gefühl, dass sich etwas zusammenbraute und nur allzu bald etwas Gewaltiges passieren würde.
Doch da dieses Gefühl der Dringlichkeit keinen erkennbaren Grund hatte, staute sich Frust in ihm auf. Er aß nicht und schlief keine Nacht durch. In den letzten paar Wochen war er immer wieder davon aufgewacht, dass er gegen das Kissen, die Matratze oder sogar in seine eigene Faust schlug, um die erstickende Frustration wegen seiner unerfüllten Sehnsucht nach einer Frau herauszulassen. Oh ihr Götter, ich brauche eine Frau.
Doch ihm blieb keine Zeit, um einem anständigen Geschöpf den Hof zu machen. Ein weiterer Konflikt, der in ihm tobte.
Die Bedürfnisse des Königreiches kommen stets vor denen des Königs.
Es stand zu viel auf dem Spiel in diesem Kampf um die Wiedererlangung seiner Krone – gegen Omort den Unsterblichen, ein Feind, den zu töten unmöglich war.
Rydstrom hatte ihm schon einmal gegenübergestanden und wusste aus bitterer Erfahrung, dass der Hexenmeister unzerstörbar war. Obwohl er Omort geköpft hatte, war es Rydstrom gewesen, der sich vor neunhundert Jahren nur mit knapper Not aus ihrer Konfrontation hatte retten können.
Jetzt war Rydstrom auf der Suche nach einem Weg, wie er Omort für immer töten konnte. Mit der Unterstützung seines Bruders Cadeon und dessen Söldnertrupp verfolgte Rydstrom hartnäckig eine Spur nach der anderen.
Der Bote, den er an diesem Abend treffen sollte – ein zwei Meter großer Eiterdämon namens Pogerth –, würde ihnen helfen können.
Er war von einem Hexer mit Namen Groot der Metallurge geschickt worden, Omorts Halbbruder, ein Mann, der Omorts Tod fast genauso sehr wollte wie Rydstrom. Groot war kaum besser als Omort, aber ein Feind meines Feindes …
In diesem Moment warf eine Dämonin in schwarzem Leder und mit billigem Make-up an den Hörnern Rydstrom einen abschätzenden Blick zu, während sie an ihm vorbeiging, aber er wandte sich ab.
Verruchte Frauen übten eine merkwürdige Anziehungskraft auf ihn aus. Das war schon immer so gewesen, obwohl sie gar nicht sein Typ waren, ganz gleich, was ihm Cadeon während ihrer Auseinandersetzungen auch immer vorwarf.
Nein, Rydstrom sehnte sich nach seiner Königin, der ihm vom Schicksal bestimmten Frau, einer tugendhaften Dämonin, die ihm zur Seite stehen und sein Bett schmücken würde. Bei einem Dämon, so hieß es, war der Sex mit der ihm bestimmten Frau im Vergleich zu einem normalen Fick umwerfend. Nach fünfzehn Jahrhunderten hatte er doch wohl verdammt noch mal lange genug darauf gewartet, endlich einmal den Unterschied zu erfahren.
Er stieß den Atem aus. Aber jetzt war keine Zeit für so was. Zu viel steht auf dem Spiel. Er wusste, dass sein Königreich und seine Burg für immer verloren wären, wenn er seinen Feind diesmal nicht schlug.
Meine verlorene Heimat. Er ballte die Hände, bis seine kurzen schwarzen Klauen sich in seine Handflächen bohrten. Omort und seine Gefolgsleute hatten Burg Tornin geschändet. Der Hexer hatte sich selbst zum König ernannt, Rydstroms Feinde willkommen geheißen und ihnen dort Asyl gewährt. Seine Wachen waren Wiedergänger, wandelnde Leichen, Tote, die zu neuem Leben erweckt worden waren und die nur zerstört werden konnten, wenn ihr Herr und Meister tot war.
Es gab unzählige Berichte von Orgien, Opferungen und Inzest in Tornins einstmals geheiligten Hallen.
Rydstrom würde eher sterben, als die Heimstatt seiner Vorfahren Geschöpfen zu überlassen, die dermaßen verkommen und so abartig waren, dass er in ihnen nicht weniger als die abstoßendsten Geschöpfe sah, die jemals über die Erde gewandelt waren.
Gott stehe jedem bei, der mir heute Abend in die Quere kommt. Eine tickende Zeitbombe …
Endlich traf Pogerth ein, er teleportierte sich in die Bar. Die Haut des Eiterdämons sah wie geschmolzenes Wachs aus und stank nach Verwesung. Die Gaze, die er unter seiner Kleidung trug, schaute aus dem Kragen und den Ärmeln seines Hemdes hervor. Er trug Gummistiefel, die er in regelmäßigen Abständen draußen leeren würde, wie es der Anstand gebot.
Als er sich zu Rydstrom an den Tisch setzte, war ein schmatzendes Geräusch zu hören. »Mein Herr und Meister ist auf der Suche nach einem Preis, der so selten ist, dass man ihn legendär nennen könnte«, begann er ohne Vorrede. »Im Austausch bietet er etwas ebenso Fantastisches an.« Er wechselte in die Dämonensprache. »Was würdest du für eine Waffe tun, die den Unsterblichen garantiert tötet?«
Burg Tornin
Königreich von Rothkalina
Als ein abgetrennter Kopf blutend die Stufen vor Omorts Thron bis auf den schwarzen Läufer davor herunterpurzelte, wich Sabine ihm beiläufig aus und setzte ihren Weg fort. Der Kopf gehörte Orakel dreihundertsechsundfünfzig – das war die Anzahl von Hellseherinnen, die dieses Amt bekleidet hatten, seit Sabine nach Tornin gekommen war.
Ihr stieg der widerliche Geruch von Blut in die Nase, während hirnlose Wiedergänger ohne Verstand oder eigene Gedanken den kopflosen Körper beseitigten.
Omort, ihr Halbbruder und König der Ebene von Rothkalina, wischte sich die blutverschmierten Hände ab, was bedeutete, dass er dem Orakel höchstpersönlich in einem Wutanfall den Kopf abgerissen hatte, zweifellos ungehalten über etwas, das es ihm geweissagt hatte.
Stolz und hoch aufgerichtet stand er vor seinem kunstvoll verzierten goldenen Thron. Seine linke Schulter bedeckte ein Schutzpanzer, während er auf der rechten einen schneidigen Umhang trug. An seiner Hüfte hing eine Schwertscheide, und auf seinem hellen Haar saß die kunstvolle Kopfbedeckung, die sowohl als Krone als auch als Helm diente. Er wirkte charmant und kultiviert und absolut unfähig, einer Frau den Kopf abzureißen.
Omort hatte so viele Kräfte geraubt – Pyrokinese, Levitation, Teleportation –, allesamt seinen anderen Halbgeschwistern gestohlen, bevor er sie umgebracht hatte. Nur eines konnte er nicht: in die Zukunft sehen. Diese Unfähigkeit versetzte ihn oft in rasende Wut.
»Willst du was dazu sagen, Sabine? Wirst du etwa weich?«
Sie war die Einzige, die ihm in irgendeiner Weise die Stirn zu bieten wagte, und die anderen Geschöpfe bei Hofe wurden mucksmäuschenstill. An den Seiten des Raumes und in den Gängen wimmelte es nur so von Mitgliedern der zahlreichen Faktionen, die sich mit dem Pravus, Omorts neuer Armee, verbündet hatten. Zu ihnen zählten die Zentauren, die Invidia – weibliche Verkörperungen der Zwietracht –, Oger, bösartige Phantome, gefallene Vampire, Feuerdämonen mit glühenden Handflächen … viel mehr Wesen, als man aufzählen könnte. Und fast jedes von ihnen würde sie am liebsten tot sehen.
»Es ist heutzutage aber auch wirklich nicht einfach, gutes Personal zu finden«, seufzte sie. Niemand konnte von Sabine erwarten, für andere Mitgefühl zu entwickeln. Dafür hatte sie sich schon zu oft aus einer Lache ihres eigenen Blutes hochgerappelt. »Und das ist eine Schande, Bruder, weil wir ohne sie so gut wie blind sind.«
»Sorge dich nicht, ich werde umgehend eine andere Seherin finden.«
»Ich wünsche dir bei deinem Vorhaben alles Glück der Erde.« Wahrsagerinnen wuchsen nicht gerade auf Bäumen, und der Vorrat an Bewerberinnen war nahezu erschöpft. »Hast du mich wegen dieser Enthauptung zu dir gerufen?«, fragte Sabine gelangweilt, während sie sich umblickte und es dabei vermied, den geheimnisvollen Seelenbrunnen in der Mitte anzusehen.
Sie konzentrierte sich vollkommen auf andere Details des opulenten Thronsaals, den ihr Bruder drastisch verändert hatte, seit er den großen Rydstrom entmachtet hatte. Er hatte den nüchternen Thron des Dämons durch einen aus hell strahlendem Gold ersetzt. An diesem Abend verunzierten Blutspritzer aus der Schlagader des Orakels das gleißende Metall.
Nichts Neues …
An den Wänden hatte Omort seine Farben und seine Banner aufgehängt, die sein Symboltier zeigten: einen Ouroboros, eine Schlange, die sich in ihren eigenen Schwanz beißt und Unsterblichkeit symbolisiert. Was zuvor einfach gehalten gewesen war, hatte er verschwenderisch ausgestattet. Dennoch passte dieser Ort nicht zu dem äußerlich so kultivierten Omort.
Einer Legende zufolge war die vormittelalterliche Burg Tornin von göttlicher Hand geschaffen worden, um den Brunnen zu beschützen, mit einem zentralen Burghof und von sechs kühnen Türmen umgeben. Auch wenn die Steine, aus der die Festung gebaut war, nur grob behauen waren, passten sie perfekt ineinander. Tornin war die Unvollkommenheit in ihrer perfektesten Form. Genauso ungehobelt, wie man es seinem früheren König nachsagte.
Omort warf den Umhang zurück, bevor er sich setzte. »Es ist eine halbe Stunde her, dass ich dich rufen ließ.«
»Ach richtig. Jetzt erinnere ich mich wieder.« Lanthe und sie hatten in Lanthes mit Solarenergie ausgestattetem Zimmer DVDs angeschaut. Die Schwestern verbrachten ungefähr ein Viertel des Tages damit, Filme anzuschauen. Leider Gottes sah es nicht so aus, als ob sie in nächster Zeit Kabelfernsehen bekommen würden.
Als sie am Vizekönig, einem Zentaur, vorbeikam, sah sie nach unten und fragte ihn: »Na, alles fit im Schritt? Wie ich sehe, hängt’s tief und eher links. Von dir aus links, von mir aus rechts.«
Obwohl seine Wut unverkennbar war, würde er es nie wagen, sie herauszufordern. Dazu hatte sie hier viel zu viel Macht.
Sie zwinkerte ihm zu, um ihn genau daran zu erinnern, und trat dann vor zu Omort. »Ich hatte vor, pünktlich hier zu sein, aber ich musste mich noch um etwas sehr Dringendes kümmern.«
»Ach wirklich?«
»Nein.« Und das war alles, was sie zu diesem Thema sagen würde.
Omort starrte sie fasziniert an, seine gelben Augen glühten. Aber als sie ihren eigenen Umhang ablegte, schien er sich wachzurütteln und ihr Outfit missbilligend zu mustern. Sie trug ein knappes trägerloses Top aus goldenem Stoff, einen ledernen Mikrorock, der kaum ihren Hintern bedeckte, gepanzerte Handschuhe mit Klauen an den Fingerspitzen und schenkelhohe Stiefel.
Nachdem er ihren Körper von oben bis unten gemustert hatte, blickte Omort ihr ins Gesicht. Sie hatte sich die Augenpartie leuchtend scharlachrot geschminkt, und zwar in der Form von Schwingen, die sich von ihren Wimpern über die Brauen bis hin zur Haarlinie zogen.
Vor langer Zeit hatte Omort einmal versucht, per Gesetz festzulegen, dass anständige Frauen ihre Gesichter mit einer traditionellen Sorceri-Maske aus Seide zu verbergen hätten, statt diese bloß mit Farbe zu imitieren. Außerdem wollte er, dass sie ihre Körper vollkommen verhüllten. Er hatte sehr rasch herausgefunden, was Sabine von diesem Vorschlag hielt.
»Eigentlich bin ich nur gekommen, um meine Medizin zu mir zu nehmen, Omort.«
»Du wirst deine Dosis später erhalten«, entgegnete Omort abwinkend.
Wie leicht es ihm fiel, sie abzuweisen. Aber er war ja auch nicht derjenige, der die Medizin brauchte, um keinen grauenhaften Tod zu sterben.
»Im Augenblick gibt es etwas wesentlich Bedeutsameres zu besprechen …«
In diesem Moment kam Hettiah, Omorts Halbschwester und Sabines Erzfeindin, herein, hastete die Stufen des Podiums empor und stellte sich neben Omorts Thron auf – ihrem rechtmäßigen Platz, da sie nicht nur mit ihm verwandt, sondern auch seine Konkubine war. Sie musste auf der Stelle herbeigeeilt sein, sobald sie gehört hatte, dass Sabine eingetroffen war – voller Panik, Sabine könnte ihr Omort wegnehmen.
Hettiah schien bedauerlicherweise zwei Dinge nicht zu kapieren: Erstens könnte Sabine Omort jederzeit haben, und zweitens würde sie ihn niemals haben wollen.
Omort ignorierte Hettiah vollkommen und hielt seinen Blick weiterhin auf Sabine gerichtet.
»Etwas Bedeutsameres zu besprechen …?«, erinnerte sie ihn.
»Meine Spione suchen schon seit Langem nach Groot dem Metallurgen und überwachen die Aktivitäten seiner engsten Gefolgsleute.«
Groot war untergetaucht und versteckte sich vor Omort. Er war einer von nur zwei Halbgeschwistern außerhalb von Tornin, die immer noch am Leben waren.
»Wie ich soeben erfahren habe, hat er einen Gesandten ausgeschickt, um sich mit niemand anders als Rydstrom Woede zu treffen.«
Endlich eine Intrige! »Rydstrom und Groot, unsere beiden gefährlichsten Gegner, verbünden sich. Das sind in der Tat schlechte Neuigkeiten.«
»Wir müssen etwas unternehmen. Einer der Spione hörte, dass der Abgesandte ihm ein Schwert versprach, das geschmiedet wurde, um mich zu töten.«
Jedermann bei Hofe erstarrte – Sabine eingeschlossen.
Omort stieß resigniert den Atem aus. »Natürlich wird es das nicht. Es kann es nicht.« Fast meinte man, Bedauern mitschwingen zu hören. »Weißt du, wie viele Bomben, Zaubersprüche, Speere, Dolche und Gifte mir schon den Garaus hätten machen sollen?«
In der Tat hatte Sabine schon mitangesehen, wie Omort mitten ins Herz gestochen, wie er geköpft und wie er zu kalter Asche verbrannt worden war. Und immer wieder war er aus einem schmutzigen Nebel wiederauferstanden wie ein Phoenix, stärker denn je. Sein Name sagte es ja schon: Omort – ohne Tod.
»Aber Rydstrom muss glauben, dass es funktionieren wird«, sagte er. »Dieser für seine Besonnenheit berühmte Dämon wurde gesehen, wie er das Treffen in aller Eile verließ und seinen Bruder anrief, während er noch in seinen Wagen stieg, um in Richtung New Orleans zu eilen.«
»Rydstrom wird sich dort mit ihm treffen wollen.« Cadeon der Königsmacher, ein erbarmungsloser Söldner. Es hieß, er sei imstande, jedem König zu einem Thron zu verhelfen – außer seinem Bruder. Seit Jahrhunderten arbeiteten die beiden nun schon gemeinsam daran, Tornin zurückzuerobern, das inzwischen ihre Heimat war. Findet euch endlich damit ab, Dämonen. Ich zieh hier nicht weg.
Hettiah räusperte sich. »Mein Herr, wenn das Schwert Euch nicht zu töten vermag, warum sorgt Ihr Euch dann seinetwegen?«
»Weil der Glaube fast ebenso gefährlich ist«, erwiderte Sabine ungeduldig. »Das Schwert könnte zu einem Werkzeug der Propaganda werden, ein Symbol für den Widerstand.« Schon jetzt brachen überall im Land immer wieder kleinere Rebellionen aus. Die Dämonen hörten einfach nicht auf, lautstark ihren abgesetzten König zu fordern.
Und das nach neun Jahrhunderten.
Sabine fragte sich oft, womit er sich diese leidenschaftliche Loyalität verdient haben mochte. »Es steht also fest, dass ich ein Treffen der Brüder nicht zulassen kann«, sagte sie. »Ich werde Rydstrom abfangen, noch bevor er die Stadt erreicht.«
»Und dann?«, fragte Omort ruhig. »Was wirst du mit ihm anstellen?«
»Dann werde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen«, gab sie zurück. »Dies ist der Beginn der Prophezeiung.« Gerade rechtzeitig zur Akzession.
Dieser gewaltige Krieg unter den Unsterblichen fand alle fünfhundert Jahre statt, und er stand kurz bevor.
Ihr Blick zuckte kurz über den mysteriösen Brunnen in der Mitte des Thronsaals, der von Opfergaben – blutigen, unidentifizierbaren Körperteilen – übersät war. Ihre Zukunft hing davon ab, seine Macht freizusetzen. Und der Dämon war der Schlüssel dazu.
Als sie sich wieder Omort zuwandte, waren seine Brauen zusammengezogen, als ob er erwartet hätte, dass sie davor zurückschrecken würde, mit einem Dämon ins Bett zu steigen. Eigentlich wollte sie es einfach nur hinter sich bringen – und dann die Macht an sich reißen, die nur darauf wartete, ergriffen zu werden. Endlich etwas, das sie begehrte, das sie brauchte.
»Und was, wenn sich der Dämon dir widersetzt?«, fragte Hettiah.
Sabines Lippen öffneten sich. »Hast du in letzter Zeit schon mal einen Blick auf mich geworfen, Hettiah?« Sie drehte sich einmal um sich selbst – eine Bewegung, die Omort dazu veranlasste, sich auf seinem Thron weit nach vorne zu beugen, und Hettiah dazu, ihr mörderische Blicke zuzuwerfen.
Hettiah war nicht machtlos. Ihre Fähigkeit bestand sogar gerade darin, die Kräfte anderer zu neutralisieren. Sie konnte Illusionen ebenso leicht zerstören, wie Sabine sie erschuf. Lanthe hatte ihr den Spitznamen Hettiah die Spaßbremse gegeben.
»Unterschätze den Dämon nicht«, sagte Omort schließlich. »Er ist einer der willensstärksten Männer, die ich je kennengelernt habe. Vergiss nicht: Ich habe mich mit ihm gemessen – und doch ist er am Leben.«
Sabine atmete langsam aus, bemüht, ihr berüchtigtes Temperament zu zügeln. »Sicher, aber ich verfüge über einige ganz einzigartige Attribute, die garantieren, dass dieser Dämon schon so gut wie verführt ist.«
»Du verfügst aber auch über einen Makel«, sagte Hettiah höhnisch. »Du bist ein Freak in der Mythenwelt.«
Es stimmte, sie war einzigartig – eine jungfräuliche Verführerin. Sabine tat Hettiahs Aussage mit einem Lachen ab, doch gleich darauf war ihre Miene wieder eisig, als sie sich ihrem Bruder zuwandte. »Leg deinem Spielzeug lieber einen Maulkorb an, Omort, sonst bastel ich einen aus ihren eigenen Eingeweiden.« Sie schlug ihre spitzen Silberklauen aneinander, sodass das Geräusch durch die ganze Halle tönte.
Hettiah hob das Kinn, wurde aber sichtlich blass. Sabine hatte ihr in der Tat schon einmal ein Organ entrissen, beziehungsweise mehrere bei verschiedenen Anlässen. Sie bewahrte sie in Gläsern auf ihrem Nachttisch auf.
Allerdings hielt sich Sabine wenn möglich zurück, denn es schien Omort allzu sehr aufzuregen, wenn sie Hettiah anfeindete.
»Außerdem … sollte der Dämon dem hier« – sie deutete mit beiden Händen auf ihren Körper – »wider Erwarten widerstehen, habe ich noch einen Ersatzplan.« Sie hatte immer einen Plan B.
»Den wirst du brauchen.« Hettiah grinste höhnisch.
Sabine warf ihr eine Kusshand zu – die schlimmste Beleidigung unter den Sorceri, die in ihren Ringen Gift aufbewahrten, um es in Getränke zu mischen oder dem Feind in die Augen zu pusten.
»Nimm ihn noch heute Abend gefangen. Und dann … beginne.« Schon der Gedanke schien Omort krank zu machen. Nicht nur, dass Rydstrom ein Dämon und somit in den Augen der Sorceri nur wenig besser als ein Tier war, der gefallene König war vor allem Omorts Todfeind.
Und jetzt war endlich die Zeit gekommen, da Sabine ihren jungfräulichen – zumindest was den tatsächlichen Akt anging – Körper und ihren Schoß dieser Kreatur opfern würde. Kein Wunder, dass Omort sich dermaßen über das Orakel erzürnt hatte. Ein Teil von ihm gierte nach der Macht, die Sabine erlangen konnte. Und ein anderer Teil gierte nach ihr selbst – oder nach Frauen, die ihr ähnelten, wie die rothaarige Hettiah.
Dann erhob er sich und ging die Stufen hinab, bis er direkt vor Sabine stand. Er ignorierte Hettiahs Ausruf der Bestürzung – sowie die Warnung in Sabines Augen – und hob langsam die Hand an ihr Gesicht.
Seine blutverkrusteten Fingernägel waren lang, trüb und dick. Als er ihr Kinn fasste, sagte sie in schneidendem Ton: »Du weißt doch, Bruder, dass ich es nicht ausstehen kann, wenn ein Mann mein Gesicht berührt.«
Wenn sie wütend war – so wie in diesem Augenblick –, schien Sabines ganze Umgebung zu beben und zu schwanken, wie bei einem Erdbeben, während gleichzeitig stürmische Winde tobten. Omort zog langsam seine Hand zurück, während die Höflinge nervös mit den Füßen scharrten.
»Ich habe die Koordinaten für die Straße, die Rydstrom nehmen wird«, sagte Omort. »Lanthe kann direkt vom Verlies aus ein Portal zu diesem Ort öffnen, und du hältst ihn dort auf. Das wird die perfekte Falle sein. Es sei denn, sie hat ihre Fähigkeit schon wieder verloren.«
Lanthe konnte immer noch Portale erschaffen, aber ihre Fähigkeit wurde jedes Mal vorübergehend schwächer, sodass sie nur ungefähr alle sechs Tage dazu in der Lage war. Sabine hoffte, dass sie bereit war.
»Warum rufst du Lanthe nicht einfach herbei und fragst sie selbst?«, sagte Sabine.
Er zog eine finstere Miene. Aus irgendeinem Grund hatte Omort schon immer Lanthes Nähe gemieden und angeordnet, dass die beiden Schwester niemals zusammen in seiner Gegenwart sein durften.
»Wie viel Zeit bleibt mir, um diese Falle zu arrangieren?«, fragte sie.
»Du musst ihn innerhalb der nächsten beiden Stunden abfangen.«
»Dann mach ich mich gleich auf den Weg.« Ihr blieb nur wenig Zeit, um alles vorzubereiten, und das ärgerte sie. Sie liebte es, Pläne und Unterpläne und Pläne für alle Eventualitäten auszuhecken, und der halbe Spaß bestand doch in der gespannten Erwartung, bevor die Falle zuschnappte. Sie konnte Monate damit zubringen, sich Szenarien auszudenken, und nun blieben ihr nur Stunden.
Bevor sie gehen konnte, beugte sich Omort hinunter und flüsterte ihr etwas ins Ohr. »Wenn es eine andere Möglichkeit für dich gäbe, als mit diesem Ungeheuer zu schlafen, dann hätte ich sie gefunden.«
»Ich weiß, Bruder.«
Zumindest das glaubte sie ihm. Omort würde sie niemals freiwillig aufgeben, da er Sabine ganz für sich allein wollte, und das seit ihrer allerersten Begegnung. Er hatte gesagt, es liege etwas in ihren Augen, das er noch nie zuvor gesehen habe – das dunkle Wissen, wie es sei zu sterben. Etwas, das er niemals kennen würde.
Er legte seine klamme Hand auf ihre bloße Schulter, und es schien fast so, als ob er aufgrund dieser Berührung ein Stöhnen unterdrücken musste.
»Fass – mich – nicht – an, Omort.« Sie stieß die Worte zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und ließ ihre Haare wie angreifende Vipern erscheinen, bis er seine Hand zurückzog. Manchmal musste sie ihn daran erinnern, dass sie genauso heimtückisch war wie die Schlangen, die er verehrte.
Sie drehte sich auf der Stelle um und präsentierte ihm ihren Rücken, statt sich zuerst die drei geforderten Schritte zu entfernen, und marschierte auf den Ausgang zu. Als sie am Brunnen vorbeikam, zuckte ihr Blick kurz dorthin.
Bald …
»Du wirst mich nicht enttäuschen?«, rief er hinter ihr her. »Rydstrom darf seinen Bruder nicht treffen.«
»Ist schon so gut wie erledigt«, rief sie im Brustton der Überzeugung zurück. Wie schwer konnte es schon sein, einen Dämon gefangen zu nehmen?
2
Ein Preis, der so selten ist, dass man ihn legendär nennen könnte …
Rydstrom raste mit seinem McLaren über eine verlassene Deichstraße hinweg. Seine Scheinwerfer zerteilten den Nebel, der aus den Sümpfen aufstieg. Diese rasende Energie in ihm, diese unerklärliche Anspannung, hatte einen neuen Höhepunkt erreicht.
Es war möglich, Omort zu töten.
Hundert Meilen pro Stunde. Hundertzehn …
Mit einem Schwert, das Groot der Metallurge geschmiedet hatte.
Rydstrom hatte schon so lange darauf gewartet, dass er es jetzt kaum fassen konnte. Wenn er auch dem Dämon Pogerth nicht vertraute, so vertraute Rydstrom doch seiner Verbündeten, Nïx, der Walküre und Hellseherin, die ihr Treffen ausgemacht hatte.
Nïx hatte gesagt, dass dieser Kampf eine Chance sei, Omort zu töten – Rydstroms letzte Chance. Entweder würde es ihm gelingen, den Hexer zu vernichten, oder aber dies bliebe ihm für alle Zeit versagt.
Bei allen Göttern, es war möglich. Aber als Bezahlung hatte Groot das Unmögliche verlangt. So schien es zumindest.
Hundertvierzig Meilen pro Stunde. Obwohl Rydstrom das Telefonat mit seinem Bruder schon vor einigen Minuten beendet hatte, stand sein Mund noch immer vor Verwunderung offen. Cadeon, das unzuverlässigste und unglaubwürdigste Geschöpf, das Rydstrom kannte, hatte ihm mitgeteilt, dass er sich bereits im Besitz des Preises befand, den Groot im Austausch für das Schwert verlangt hatte.
Widerwillig hatte Cadeon eingewilligt, sich mit Rydstrom an ihrem üblichen Treffpunkt nördlich von New Orleans zu treffen. Er würde den Preis dabeihaben, doch Rydstrom hatte noch eine halbe Stunde Fahrtzeit vor sich. Mehr als genug Zeit für Cadeon, sich die Sache anders zu überlegen. Falls er das nicht bereits getan hatte.
Bei diesem Gedanken trat Rydstrom das Gaspedal durch, sodass der Wagen auf hundertsechzig beschleunigte. Nicht schnell genug. Er würde seine rechte Hand dafür geben, sich wieder translozieren zu können. Aber Omort hatte die Kraft der Teleportation in ihm und Cadeon gebannt. Noch nie zuvor war Rydstroms Frustration über diesen Fluch so groß gewesen wie just in diesem Moment. Es steht zu viel auf dem Spiel.
Sicher, Cadeon hatte den Preis bereits aufgespürt, aber er würde ihn sicherlich nicht so leicht aufgeben.
Er wird sich aus dem Staub machen. Rydstrom musste ihn unbedingt erreichen, bevor er abhauen konnte.
Es vergingen einige lange Augenblicke, in denen er über seinen Bruder nachgrübelte. Im Bewusstsein, dass Cadeon ihn im Stich lassen würde, beschleunigte er noch weiter. Hundertsiebzig …
Rydstrom würde für sein Volk sterben. Warum konnte Cadeon nicht …?
Im Licht der Scheinwerfer starrte ihn ein Paar Augen an. Kein Tier – eine Frau.
Er trat das Bremspedal durch. Der Wagen scherte seitlich aus, geriet ins Schleudern und schließlich völlig außer Kontrolle.
Das Quietschen von Autoreifen durchschnitt die Nacht, als sich der Sportwagen des Dämons um sich selbst drehte. Doch irgendwie gelang es ihm, ihn wieder unter Kontrolle zu bringen.
»Er kriegt es hin.« Lanthe klang beeindruckt.
Sabine hob die Hände und murmelte: »Ich denke nicht, Dämon.« Gerade als es so schien, als hätte er die Kontrolle über den Wagen wiedererlangt, veränderte sie die Vision der Straße und verschleierte ihm die Sicht auf den Brückenpfeiler vor ihm.
Er raste direkt darauf zu.
Und dann krachte es mit der Wucht einer Explosion – das Stöhnen von Metall, das Zersplittern von Glas. Rauchsäulen stiegen in die Luft, und Dichtungen zischten. Der einstmals blitzende schwarze Wagen erlitt einen Totalschaden.
»Musstest du ihn denn mit diesem Tempo da reinknallen lassen?«, fragte Lanthe. Sie spitzte die Lippen und blies sich eine schwarze Strähne aus dem Gesicht. »Jetzt ist er bestimmt nicht mehr in romantischer Stimmung.«
»Du hast mir doch ins Ohr gebrüllt, dass er entkommt.«
Sobald Sabine aus der Ferne das sanfte Schnurren eines Motors vernommen hatte, hatte sie Lanthe unsichtbar gemacht und die Illusion eines Wagens geschaffen, der mit geöffneter Motorhaube am Straßenrand stand.
Die holde Maid in Not. Unfähig, ihren Wagen zu reparieren. Was für ein lächerliches Klischee. Aber notwendig.
Als er sein Tempo nicht verringert hatte, hatte sie mit den Armen gewunken, doch er war kein bisschen langsamer geworden. Sie konnte auf gar keinen Fall zulassen, dass er ihr entkam, also schuf sie eine Illusion von sich selbst mitten auf der Straße direkt vor dem Wagen. Da war er dann ausgewichen, um ihr Abbild nicht zu überfahren.
»Außerdem ist er ein Dämon«, fuhr Sabine fort. »Dämonen sind hart im Nehmen – und stark.« Seine Tür wurde aufgestoßen. »Siehst du?« Aber noch war er nicht ausgestiegen.
»Wieso braucht er denn so lange?«, fragte Lanthe, indem sie auf telepathische Kommunikation umstieg. Sie knabberte an ihren Fingernägeln, während sie stumme Zwiesprache mit ihrer Schwester hielt. »Was, wenn die Vrekener auf uns aufmerksam werden?« Auch nach all den Jahren verfolgten diese Unholde noch immer die Spuren, die die Magie der Schwestern hinterließ.
»Wir haben noch Zeit«, sagte Sabine, obwohl sie ungeduldig darauf wartete, endlich den Mann zu sehen, dem sie sich hingeben würde. Nicht zuletzt war sie gespannt, einen Blick auf einen der am meisten respektierten Anführer der Mythenwelt zu erhaschen.
Selbstverständlich hatte Sabine alles über Rydstrom gelesen und kannte jedes Detail seiner Vergangenheit. Er war fünfzehnhundert Jahre alt. Er hatte einst fünf Geschwister gehabt, von denen noch zwei Schwestern und ein Bruder am Leben waren. Er war ein Krieger gewesen, lange schon bevor er unerwartet die Krone von Rothkalina geerbt hatte.
Und sie kannte einige Details über sein Aussehen: Er war ein groß gewachsener Mann mit einer auffälligen Narbe im Gesicht und eindringlichen grünen Augen, die im Zorn – oder vor Verlangen – schwarz wurden. Da er ein Wutdämon war, waren seine Hörner nach hinten über seinen Kopf hinweg gebogen und ragten nicht nach vorne. Eines davon war beschädigt worden, noch bevor er den Zustand der Unsterblichkeit erreicht hatte.
Hörner. Und sie würde diesen Dämon in wenigen Augenblicken in ihren Körper eindringen lassen, falls ihr Plan funktionierte.
Wenn nicht, hatte sie immer noch ihren Giftring. Unter dem Rubin war ein Schlafpulver verborgen, das von der alten Hexe im Keller zubereitet worden war, der hauseigenen Gift- und Zaubertrankmischerin. Dämonen reagierten auf beides äußerst empfindlich.
Rydstrom zu vergiften war allerdings nicht Sabines bevorzugter Plan, aber wenn es sein musste, würde sie alles Nötige tun, um ihn in die Zelle im Burgverlies zu schaffen, die sie für ihn vorbereitet hatten – eine, aus der er trotz seiner dämonischen Stärke nicht entkommen konnte.
Sie befand sich nur wenige Meter von ihnen entfernt.
Lanthe hatte gleich in der Zelle ein übergangsloses Portal geschaffen, das auf die Straße führte. Um es zu verbergen, hatte Sabine eine der kompliziertesten Illusionen ihres Lebens gewirkt, sodass der Kerker aussah, als ob er einfach nur ein Teil der Landschaft neben der Straße wäre.
Es schien eine Ewigkeit zu vergehen, ehe Rydstrom endlich aus dem rauchenden Wrack taumelte. Sie hatte nicht bemerkt, dass sie die Luft angehalten hatte, doch nun stieß sie einen tiefen Atemzug aus.
Da war er endlich.
Groß war er auf jeden Fall – sicherlich an die zwei Meter, mit breiten Schultern. Sein Haar war so schwarz wie die Nacht. Seine Hörner wuchsen ihm aus den Schläfen, krümmten sich nach hinten und schmiegten sich zu beiden Seiten an seinen Kopf. Ihr Perlmuttglanz war ein krasser Gegensatz zu seinem dichten Haar. Tatsächlich, eines von ihnen war beschädigt, die Spitze war abgebrochen.
Auch wenn seine ersten Schritte noch unsicher waren, schien er doch nicht allzu stark verletzt zu sein. Es war kein Blut zu sehen.
Sabine hob eine Augenbraue, während Lanthe ihr einen stummen Kommentar übermittelte: »Dein Dämon sieht wirklich … furchterregend aus.«
Sie wollte Lanthe schon berichtigen und sagen: »Nicht mein Dämon.« Aber der Mann dort vor ihnen würde tatsächlich bald ihrer sein. Zumindest für eine gewisse Zeit. »Ja, in der Tat ein Mann zum Fürchten, nicht wahr?«
Aufgrund seiner äußeren Erscheinung hätte Sabine vermutet, er wäre ein Auftragsmörder oder irgendein einfacher Halsabschneider. Wie merkwürdig – galt er doch als ein Bollwerk der Vernunft, ein weiser Anführer, der gerne Streitigkeiten beilegte und Lösungen für komplizierte Rätsel austüftelte.
Ein Gerücht in der Mythenwelt besagte, dass noch nie eine Lüge seinen Mund verlassen habe. Was an sich schon eine Lüge sein musste.
»Wirst du erst mal versuchen, ihn zu verführen, oder ihn einfach in die Falle locken?«
»Ich will ihn erst verführen, sonst rastet sein dämonisches Wesen noch aus, wenn er gefangen genommen wird.« Sie strich mit den Händen über ihr blassblaues Kleid.
»Du siehst fantastisch aus«, sagte Lanthe. »Süß. Es geht doch nichts über Pastellfarben, um ›Nimm mich!‹ zu sagen.«
»Das war jetzt völlig überflüssig, Lanthe.«
Da Sabine nicht wollte, dass er sie als Zauberin erkannte, hatte sie ein elegantes, wenn auch biederes, langweiliges Kleid angezogen. Sie dachte, es könnte nichts schaden, tugendhaft zu erscheinen, da sie annahm, dass ein guter Dämonenkönig dies bevorzugen würde. Sie hoffte nur, dass ihm ihr gruseliger neuer Look auch tatsächlich gefallen würde. Bis auf ihren Ring schmückte nicht eine einzige Unze Gold ihren Körper. Make-up hatte sie auch nicht aufgelegt. Ihr Haar, das sie ausnahmsweise offen trug, reichte fast bis zu ihrer Taille – ohne jede Kopfbedeckung. Und das fühlte sich so falsch an.
»Bist du sicher, dass du das durchziehen willst?«, fragte Lanthe. »Hast du dir das wirklich gut überlegt, die Drecksarbeit für die Bösen zu übernehmen?«
Den Blick unverwandt auf ihre Beute gerichtet, murmelte Sabine: »Oh ja, absolut.«
Ein Ziel, ein Plan, eine Möglichkeit … alles lag vor ihr.
Nachdem er ein paar Schritte über Glasscherben und andere Trümmer zurückgestolpert war, um sich den Schaden an seinem Wagen genauer anzusehen, sog der Dämon bei dem Anblick, der sich ihm bot, zischend die Luft ein. Doch dann wandte er sich wieder von dem Wrack ab.
»Ist hier jemand?«, rief er. Mit jeder Sekunde ließ er den Unfallort ein Stück weiter hinter sich. Seine Schultern strafften sich, sein Kinn hob sich, sein ganzes Auftreten war unmissverständlich königlich. »Sind Sie verletzt?«
Sabine konzentrierte sich ganz auf seine Stimme, statt zu antworten. Sie lag in einem angenehmen tiefen Bereich, dazu kam der britisch klingende Akzent, der adlige Wutdämonen für gewöhnlich auszeichnete.
Während er sich auf sie zubewegte, zog er ein Handy aus der Tasche und starrte auf den kleinen Bildschirm. Sie hörte, wie er »Verdammter Mist!« sagte. Hier draußen hatte er keinen Empfang.
Er trug eine dunkle Jacke über einem dünnen schwarzen Pullover, der sich eng an seine breite Brust schmiegte. Seine Kleidung war schlicht, wirkte allerdings teuer. Maßgeschneidert, selbstverständlich. Bei seiner gewaltigen Statur und diesen breiten Schultern würde ihm sowieso nichts passen, was von der Stange kam.
Die Narbe in seinem Gesicht, die von einem Kampf stammte, zog sich in einer Kurve über seine Stirn, um in einer schartigen Linie auf seiner Wange zu enden. Er musste diese Verletzung erlitten haben, bevor die Unsterblichkeit seinen Körper »eingefroren« hatte – ihrer Schätzung zufolge im Alter von vier- oder fünfunddreißig Jahren –, denn sonst wäre sie spurlos verheilt.
Diese Narbe verlieh ihm eine gefährliche Ausstrahlung, die so gar nicht zu seinem königlichen Auftreten und der teuer wirkenden Kleidung passte; genau wie seine Hörner, seine Fangzähne, seine schwarzen Klauen …
»Ich würd’s mit ihm machen«, sagte Lanthe.
»Da du es mit jedem machen würdest, ist dein Kommentar definitiv bedeutungslos.«
»Du bist doch nur eifersüchtig.«
Ja. Ja, das war sie.
Als er wieder aufblickte, sah er Sabine direkt in die Augen. Sie leuchteten in dem erstaunlichsten Grün, das sie je gesehen hatte.
»Geh jetzt«, wies sie Lanthe an. »Halte dich bereit, das Portal direkt hinter uns zu schließen. Sobald ich ihn gefangen genommen habe, berichtest du Omort von meinem Erfolg. Und zwar laut – vor all den Idioten bei Hof.«
»Mach ich. Los, schnapp ihn dir, Tigerin!«
Nachdem Lanthe gegangen war, widmete Sabine ihm ihre volle Aufmerksamkeit. Er kniff die Augen zusammen, als sie die Nacht wie einen Traum erscheinen ließ. Die Sterne leuchteten strahlender für ihn, der Mond schien noch voller am Himmelszelt zu hängen. Er ging auf sie zu, die Augenbrauen vor Verwirrung zusammengezogen.
Sie konnte sehen, wie er sie musterte. Sein Blick zuckte über ihr langes Haar und über das schlichte Kleid, das zum Glück in der dunstigen Nacht feucht geworden war und sich an ihre Brüste schmiegte. Als er auf den Umriss ihrer harten Brustwarzen starrte, fuhr er sich mit der Hand über den Mund.
Zeit, ihn durchs Portal zu führen.
Als sie sich von ihm entfernte, indem sie die Straße entlangschlenderte, sagte er: »Nein, warte! Geht es dir gut?«
Sie drehte sich zu ihm um, ging aber gleichzeitig rückwärts weiter auf das Portal zu.
»Ich tu dir nichts.« Der Dämon beeilte sich, ihr zu folgen. »Steht dein Wagen hier irgendwo?«
»Ich brauche deine Hilfe«, erwiderte sie und fuhr damit fort, die schöne Maid in Bedrängnis zu spielen.
»Selbstverständlich. Wohnst du hier in der Nähe?« Endlich näherten sie sich dem Rand des Portals.
»Ich brauche deine Hilfe«, sagte sie noch einmal und duckte sich hinter etwas, was wie eine Weide am Rande des Wassers aussah, aber in Wirklichkeit eine Illusion innerhalb des Kerkers war.
Er folgte ihr, und Sabine spürte, dass sich das Portal schloss. Die Falle war zugeschnappt und er hatte nicht das kleinste bisschen gemerkt.
»Ich muss jetzt in die Stadt zurück«, sagte er, »aber dann kann ich wiederkommen und dir helfen.«
Bevor sie etwas dagegen tun konnte, fiel ihr Blick auf die tiefe Narbe in seinem Gesicht. Sie sah sie nun zum ersten Mal aus der Nähe.
Ihr Blick entging ihm nicht, und er schien auf ihre Reaktion zu warten.
Die Narbe störte sie nicht ansatzweise so sehr, wie sie ihn störte. Das konnte sie gegen ihn einsetzen. Alles in allem war er völlig anders, als sie ihn sich vorgestellt hatte. Er war … besser. Und wenn sie nur lange genug in diese ernsthaften Augen sähe, könnte sie beinahe vergessen, was er war. Als sie sich zu ihm vorbeugte, wich er mit argwöhnischer Miene zurück.