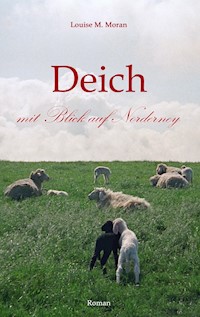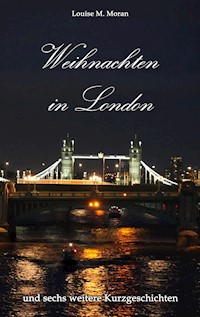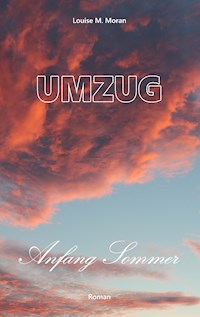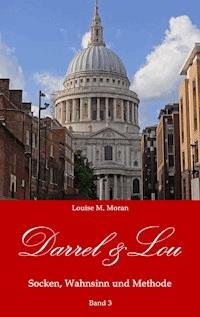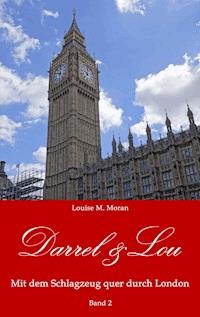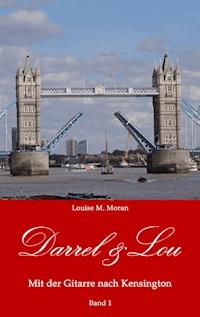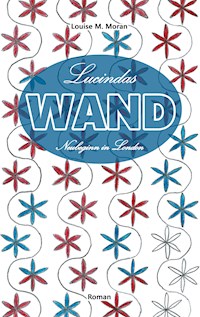
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Anfang 2019 in London: Imogen verlässt kurz nach ihrem achtzehnten Geburtstag ihr Elternhaus und kommt bei Lucinda unter, die Zimmer an Studenten vermietet und täglich eine rote oder eine blaue Blume an die Wand malt. Die ungewohnte Freiheit in der fremden Umgebung bringt allerdings auch einige Pflichten mit sich. Zudem sorgen die Mitbewohner gern für Überraschungen. Die lautlos durchs Treppenhaus streifende Dotty ist dabei noch die Harmloseste von allen. Ein humorvoller Roman über Freundschaft, Gefühle und losen Tee, der sich nicht von selbst in Tüten füllt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Brücken
Wandbesichtigung
Weltenwechsel
Daddy
Eingeseift
Partygeplauder
Korridorkuscheln
1. Brücken
D u springst jetzt aber nicht!«, hörte ich eine vertraute Stimme atemlos rufen.
Unwillkürlich ließ ich das Brückengeländer los und blickte erstaunt der Tochter unserer Nachbarn entgegen.
»Nein«, flüsterte ich, als sie Sekunden später keuchend neben mir stand.
»Okay!« Molly wirkte verschämt. »Tut mir leid! Manchmal geht die Fantasie mit mir durch. – Was machst du hier?«
»Ich schaue aufs Wasser und freue mich, dass einem kaum etwas passieren kann, wenn man hier springt. Man wird höchstens nass.«
»Wer dumm fragt, bekommt eine dumme Antwort. Wie geht es dir?«
»Ich werde morgen achtzehn«, erzählte ich das Nächstbeste, das mir einfiel. Mir ging es beschissen. Wie jeden Tag. So abwegig war die Idee mit dem Springen nämlich gar nicht. Allerdings hätte ich mir dafür eine der Themsebrücken ausgesucht. Momentan war mein Mitleid mit den Leuten, die mich herausfischen müssten, jedoch stärker als meine trüben Gedanken. Ein gutes Zeichen!
Molly strahlte. »Wow! Genial!«
»Mmh«, bestätigte ich ihre Einschätzung und blickte wieder auf das Wasser des Regent’s Canal, das so langweilig wie mein Leben dahinfloss.
»Meine Oma sagt immer, dass man an den Kindern sieht, wie alt man selbst ist«, plauderte Molly munter. »Ich weiß noch, wie ich dich in meinen Puppenwagen gesetzt habe, um dich spazieren zu fahren. Der ist natürlich bei deinem Gewicht in die Knie gegangen. Deine Mum hat schrecklich mit mir geschimpft und mir den Kontakt zu dir verboten. Du hast nur bedröppelt geguckt und dich wohl gewundert, was die ulkigen Leute jetzt schon wieder mit dir anstellen.« Molly lachte.
»Ich würde dich selbstverständlich einladen, wenn ich feiern könnte.« Verlegen blickte ich aufs Wasser.
Molly hatte früher auf mich aufgepasst, wenn meine Eltern ausgehen wollten. Meist hatte sie mir etwas vorgelesen oder etwas mit mir gebastelt. Manchmal hatte ich es kaum erwarten können, mit ihr allein zu sein, was meine Mutter stets schwer gekränkt hatte.
Ja, meine frühere Babysitterin hätte ich auf jeden Fall eingeladen, wenn ich eine Party gegeben hätte. Doch die kam aus zwei Gründen keineswegs infrage. Meine Mutter hatte Angst um ihr geheiligtes Parkett. Ich hatte keine Ahnung, wen ich sonst noch hätte einladen können.
In der Schule war ich zwar als unermüdliche Zuhörerin, Bewunderin und Trösterin wohlwollend geduldet, aber seine Freizeit verbrachte man lieber ohne mich, was leider auch daran lag, dass ich abends niemals ausgehen und am Wochenende höchst selten tagsüber etwas allein unternehmen durfte. Entweder musste ich auf Sebastian aufpassen oder für die Schule lernen, da aus unerfindlichen Gründen Bestnoten von mir erwartet wurden. Dass das im krassen Gegensatz zu meiner Rolle als Dummchen der Familie stand, fiel offenbar ausschließlich mir auf.
Molly nagte schweigend an ihrer Unterlippe. Sie kannte meine Mutter lange genug, sodass sich jeglicher Kommentar erübrigte.
»Was machst du hier?«, fragte ich, als die Stille immer peinlicher wurde.
»Meine Eltern besuchen. Du siehst: Sonderlich eilig habe ich es nicht.«
Ich lachte. »Dann haben wir denselben Weg. Ich muss auch nach Hause. Mum hat heute Chorprobe.«
»Du passt auf Sebastian auf?«
»Mmh.« Ich nickte.
»Was macht dein Stiefvater?«
»Der geht mit Freunden was trinken.«
»Ja, das habe ich gehört, dass er das häufig tut«, murmelte Molly.
Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden. Warum schämte ich mich so entsetzlich? Schließlich kam nicht ich nachts angetrunken nach Hause, sondern beaufsichtigte stocknüchtern den Satansbraten, der dieser heimischen Hölle vor sechseinhalb Jahren entsprungen war und seither ein strenges Regiment führte.
Wir schlenderten den Treidelpfad entlang und bogen an der nächsten Ecke links ab.
»Ich bin nach der Schule daheim ausgezogen«, riss mich Molly aus meinen trüben Gedanken. »Mach das doch auch.«
»Stimmt. Hübsche Hauseingänge, in denen man schlafen kann, gibt es hier genug«, antwortete ich sarkastisch.
»Bei uns ist seit Dezember ein Zimmer frei. Dein Dad zahlt schließlich für dich Unterhalt und nicht für deine Mum. Eröffne ein eigenes Konto und teile ihm deine Bankverbindung mit.«
Erstaunt blickte ich Molly an. Daran hatte ich noch nie gedacht. Zwar hatte ich kaum Kontakt zu meinem Vater, seit er nach der Trennung in seine Heimat zurückgekehrt war und in Dublin als Geschäftsführer einen Nachtclub leitete, aber nach der chaotischen Scheidung würde er mit Sicherheit lieber heute als morgen das Geld mir statt meiner Mutter überweisen.
Doch das, was Molly mit bei uns bezeichnete, jagte mir ein wenig Angst ein. Mum nannte es Mollys Sekte und machte sich gern stundenlang darüber lustig, dass die Tochter der Nachbarn mit achtzehn Hals über Kopf ausgezogen war, um unter dubiosen Umständen in einer Hippie-Kommune zu hausen.
»Wohnst du noch immer bei der …« Fast hätte ich Sekte gesagt. Verzweifelt suchte ich nach Worten.
»In Lucindas WG, meinst du? Ja, was Besseres kann ich mir leider nicht leisten. Ich stolpere weiterhin von einem Praktikum ins nächste. Es ist unheimlich schwer, etwas Seriöses zu finden. Um als freie Journalistin zu arbeiten, fehlen mir die nötigen Beziehungen. Noch bin ich nicht so tief gesunken, bei einem Revolverblatt anzuheuern.« Sie erzählte munter aus ihrem facettenreichen Arbeitsleben.
Bald schweiften meine Gedanken ab. Vermutlich war dieses alberne Gelaber von Sekten und Kommunen der farbenfrohen Fantasie meiner durchgeknallten Mutter entsprungen. Es handelte sich offensichtlich um eine stinknormale Wohngemeinschaft.
Das Zimmer war mit Sicherheit nicht freigeworden, weil der Bewohner in einer satanischen Zeremonie geopfert und verspeist worden war, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach war er schlichtweg ausgezogen. Genauso wie Molly es vorhatte, sobald sie beruflich Fuß fasste.
Genüsslich stellte ich mir das Gesicht meiner Mutter vor, die von heute auf morgen all ihre wichtigen gesellschaftlichen Abendverpflichtungen absagen und sich selbst um ihren Liebling kümmern müsste. Denn mit dem verhätschelten, verlogenen Höllenkind hielt es kein Babysitter auf Dauer aus. Gratis erst recht nicht.
Molly riss mich aus meinen Gedanken. »Wir könnten eigentlich am Samstagabend ausgehen, um deinen Geburtstag nachzufeiern. Was meinst du?«
Verzweifelt blickte ich sie an.
»Du findest die Idee gut, aber?«, fragte sie.
»Ich habe kein Geld«, flüsterte ich kaum hörbar.
Molly betrachtete mich mitleidig. »Das ist kein Elternhaus, sondern ein Knast. Meine Exemplare waren ja schon nervenzerfetzend. Doch dein Dasein grenzt an Sklaverei. Wenn das selbst mein Vater so sieht, muss es wirklich stimmen. Der hat früher ein gigantisches Theater gemacht, wenn ich nur mal fünf Minuten zu spät nach Hause kam. Deine Mutter lässt dich gar nicht erst heraus! Weißt du was? Gib mir deine Telefonnummer! Ich denke mir etwas für Samstag aus und rufe dich morgen an.«
Inzwischen waren wir an unserer Außentreppe angekommen. Wir tauschten schnell unsere Nummern aus, bevor wir uns verabschiedeten.
Strahlend drehte ich mich in der Haustür um. Es machte mich unheimlich glücklich, dass sie mir von drüben zuwinkte wie einem kleinen Kind. Plötzlich war ich wieder acht und freute mich auf den Samstagabend, den ich mit meiner sieben Jahre älteren Ex-Babysitterin verbringen durfte. Wie damals hatte sie versprochen, sich etwas Schönes einfallen zu lassen. Hurra!
***
Norman stand grübelnd vor dem offenen Kühlschrank. Milch oder Joghurt? Joghurt oder Milch? Außerdem: Wer bin ich? Darf sich jemand wie ich überhaupt ein Urteil über Milchprodukte erlauben?
»Tür zu! Hier zieht’s!«, nörgelte Gabriel.
»Ich frage mich, wann endlich mal einer auf die Idee kommt, Kühlschränke mit Glastüren herzustellen«, murmelte Norman. Joghurt? Milch? »Im Supermarkt ist das echt praktisch. Man schaut sich alles an, öffnet pfeilschnell die Tür und nimmt das heraus, was man sich in Ruhe ausgesucht hat.«
»Mir würde es vorerst reichen, wenn du die Tür pfeilschnell zumachen würdest«, kommentierte Gabriel und zwinkerte der lachenden Lucinda zu. »Bei dem Chaos, das in unserem Exemplar herrscht, finde ich die undurchsichtige Tür unheimlich praktisch.«
»Milch!«, entschied Norman, schloss den Kühlschrank, drehte sich elegant auf dem Absatz um und hielt die Flasche verkehrt herum über Gabriels Kopf. »Gibt es von deiner Seite noch weitere Beanstandungen?« Er tat so, als wolle er den Verschluss aufdrehen.
»Wie lange hast du gebraucht, um diese Flasche zu finden, die seit Jahren ihren festen Platz in der Kühlschranktür hat?« Gabriel blickte grinsend auf sein Handgelenk, an dem er gar keine Uhr trug. »Sieben Minuten und einundzwanzig Sekunden. Neuer Rekord!«, log er.
»Echt? So lange?«, fragte Esme. »Was für eine Energievergeudung!« In ihrer Stimme schien die ganze Empörung ihres neunzehnjährigen Lebens mitzuschwingen.
Norman ignorierte sie. »Ich hoffe doch sehr, dass diese Flasche nicht schon seit Jahren in der Tür steht.« Er schnupperte theatralisch am Inhalt und tat so, als sei er bezüglich Genießbarkeit unschlüssig.
»Die habe ich gestern erst geöffnet!«, protestierte Esme.
»Neunundzwanzigster Februar 2017«, las Norman mit ernstem Gesicht vor. »Mann, die räumen nie die älteren Sachen nach vorn, sondern stellen ständig die neue Ware davor.«
Esme riss die Augen auf. »Gestern war sie noch gut«, stammelte sie und blickte angewidert auf ihren Käsetoast.
Norman drehte die Flasche zu, hielt sie verkehrt herum über seine gut gefüllte Müslischüssel und meinte: »Ups! Ich glaube, die ist über Nacht dick geworden. Da hätte ich mir gleich den Joghurt nehmen können.« In Gedanken notierte er: Test Nummer 142. Studienobjekt zeigt weiterhin keine messbaren Spuren von Humor, sondern signalisiert Anzeichen von Übelkeit. Versuch abbrechen. Testreihe fortsetzen.
»Ihr seid gemein!«, rief Esme empört, stellte ihr Abendessen auf ein Tablett und verzog sich nach oben.
»Was heißt hier ihr?«, fragte Gabriel mit Unschuldsmiene. »Ich habe kein inexistentes Datum vorgelesen, das Jahre zurückliegt.«
Norman goss sich Milch über das Müsli und schob sich eine Löffelfüllung in den Mund. Angewidert verzog er das Gesicht.
»Ist sie zu guter Letzt wirklich sauer?«, erkundigte sich Lucinda.
Norman kaute genüsslich, schluckte und murmelte. »Ich habe das falsche Müsli erwischt. Da sind Rosinen drin. Donnerstags esse ich abends traditionell das mit den Erdbeerstückchen.«
»Das Schlimme ist«, flüsterte Gabriel grinsend, »dass der Spinner das zur Abwechslung tatsächlich ernst meinen könnte.«
***
»Ich will Kakao!« Sebastian zappelte auf der Couch herum.
Diesem verbalen Holzfäller die Wörter bitte und danke beizubringen, hatte ich vor Jahren aufgegeben. Doch ich stand vor der Wahl: jetzt Wutgeheul ignorieren oder später Kotze wegwischen. Denn sein persönliches Limit lag erfahrungsgemäß bei zwei Bechern. Ein dritter hätte fatale Folgen haben können. Ich entschied mich fürs Geheul und stellte mich taub.
»Kakaaaao!«
»Wir haben keinen Kakaaaao!«, behauptete ich und versuchte, mich auf mein Schulbuch zu konzentrieren.
»Du lügst! Die Packung ist voll!«, schrie der kleine Despot. Zornig funkelte er mich an.
»Ach, du meinst Kakao? Sag das doch gleich!« Ich tat erstaunt. »Die Packung ist aber gar nicht voll. Es fehlen die geschätzt zwanzig Löffel, die ich in deine Milch kippen musste, damit dir die Plörre endlich süß genug wurde.«
Natürlich war es hundsgemein von mir, den Altersunterschied so gnadenlos auszuspielen. Doch seit meinem elften Lebensjahr musste ich mich mit diesem verzogenen Balg herumärgern. Langsam verlor ich die Geduld. Egal, ob ich widersprach oder nachgab, am Ende bekam ich Mums Vorwürfe zu hören: Warum hast du ihn drei Becher trinken lassen? Du weißt, dass ihm davon schlecht wird! Das schöne Parkett ist dir egal! Warum hast du ihm keinen dritten Becher gemacht? Willst du den armen Jungen verhungern lassen? Du gönnst deinem kleinen Bruder nicht einmal das Schwarze unterm Fingernagel!
Sebastians lauernder Blick verriet mir, dass er gerade ernsthaft überlegte, ob seine Schwester tatsächlich so dumm war.
»Iss einen Apfel!«, schlug ich vor. »In jedem siebten steckt eine lustige Plastikfigur. Vielleicht hast du ja Glück.« Ohne eine Miene zu verziehen, blickte ich in mein Schulbuch und stellte mir vor, wie in seinem herrschsüchtigen Hirn die Rädchen gingen.
Mum hielt Sebastian für hochbegabt und legte sich ständig mit seinen Lehrern an, die das ganz und gar anders sahen. Ich hätte in seinem Alter diese plumpe Lüge durchschaut, weil ich wie die Mehrheit der Kinder den Unterschied zwischen Obst und Süßigkeiten gekannt hatte. In seinem Kopf war jedoch nur für Informationen Platz, die mit ihm und seinen vielfältigen Bedürfnissen zu tun hatten.
»Ich will Apfel!«, gab er kurze Zeit später das Ergebnis seiner umfangreichen Überlegungen bekannt. Dass sich so mancher Dreijährige gewählter ausdrücken konnte als er, schien ihn keinesfalls zu stören.
Während ich in der Küche einen Apfel abwusch, lauschte ich auf alle Geräusche. Bei solchen Gelegenheiten ging der Miniaturtyrann nämlich gern mal stiften. Zum Glück hatte der kleine Trampel es nie nötig, seine Füße wie ein Mensch zu benutzen, und war auf Mums geheiligtem Parkett gut zu hören. Dennoch beeilte ich mich sehr.
Beim Anblick seiner vorgeschobenen Unterlippe, der Zornesfalte zwischen den Augenbrauen und den verschränkten Armen konnte ich mir sehr gut ausmalen, wie Sebastian eines Tages als Greis aussehen würde. Ich stellte die Untertasse mit dem Apfel vor ihm auf den Couchtisch.
Aus alter Gewohnheit tröstete ich mich mit der Vorstellung, dass spätestens die Pfleger im Seniorenheim alles rächen würden, was er mir angetan hatte. Eine neue Überlegung schlich sich in meine Gedankenwelt. Was würde der kleine Diktator zu meinem Auszug sagen? Ich will neue Sklavin?
Der alberne Trickfilm, den er bis jetzt auf DVD angesehen hatte, war zu Ende. Sebastian begann, durch die Fernsehkanäle zu zappen. Dabei musste ihm inzwischen bekannt sein, dass es Zeit fürs Badezimmer war.
Ich stand auf und schaltete den Fernseher aus. Obwohl ich mit dem folgenden Wutgeheul gerechnet hatte, fiel es dennoch erstaunlich heftig aus.
»Du weißt, dass du das nicht sehen darfst, weil das Filme für Erwachsene sind. Außerdem musst du bald ins Bett«, erklärte ich so ruhig, dass er mich bei dem Radau, den er veranstaltete, vermutlich kaum verstehen konnte. »Was ist mit deinem Apfel? Willst du ihn noch essen?«
Mit tränenüberströmtem Gesicht jammerte er etwas, das ich beim besten Willen nicht verstehen konnte.
»Wie bitte?«, erkundigte ich mich gelassen.
»Ich hasse dich!«, schrie er laut und deutlich.
Das beruht auf Gegenseitigkeit, dachte ich. Genüsslich biss ich in den verschmähten Apfel.
Das brachte ihn nur noch mehr in Rage. Sebastian schleuderte die leere Untertasse gegen die Wand.
Mir war klar, wem das später vorgeworfen werden würde. Verträumt blickte ich auf die über das Parkett verstreuten Porzellansplitter, die im Licht der Deckenleuchte glitzerten. Wie viele Umzugskartons würde ich für meine wenigen Habseligkeiten brauchen? Was kostete eine Isomatte, auf der ich in der Anfangszeit schlafen wollte? Gehörte das Bettzeug mir oder meiner Mutter? Und die Bettwäsche? In meinem Kopf hörte ich Mum sagen: Schließ die Augen! Dann siehst du, was dir gehört!
***
»Bäh! Das riecht wie eine brennende Bonbonfabrik!« Norman blickte angeekelt auf die E-Zigarette, an der einer seiner Kommilitonen genüsslich zog. »Der Rauch weht grundsätzlich vom Raucher zum Nichtraucher. Das ist ein physikalisches Gesetz!«
»Blödsinn! Außerdem rauche ich überhaupt nicht! Ich dampfe!«, lautete die Antwort.
»Ist mir wurscht, ob du rauchst, dampfst, gast, plätscherst, sprudelst oder gluckerst. Das Zeug stinkt abartig! Kannst du das bitte woanders blubbern? Zum Beispiel in einer Raucherecke. Oder nennt man die neuerdings Dampferhafen?«
»Geh doch weg, wenn’s dich stört!«
Norman stand auf und ließ die anderen auf der Außentreppe der Mensa allein. Die zaghaften Rufe, die ihn zum Bleiben aufforderten, ignorierte er. Eigentlich mochte er ganz gern etwas Gesellschaft, aber er gehörte nicht zu denen, die alles still ertrugen und Nachgeben für Kompromissbereitschaft hielten, nur um dazuzugehören und niemals aufzufallen.
Wenn die anderen der Gestank nicht störte, war es besser, wenn ein Einzelgänger wie Norman sich zurückzog. Wenn der Dampf sie störte, waren sie selbst schuld, wenn sie die Chance verstreichen ließen, den Dampfer um Rücksichtnahme zu bitten.
Noch dreizehn Minuten bis zur nächsten Vorlesung. Norman blickte gedankenverloren aus dem Fenster. Aus den Augenwinkeln sah er, wie die anderen nachkamen. Er hatte mal wieder gewonnen, ohne es gezielt darauf angelegt zu haben. Die Welt war ein merkwürdiger Ort, stellte Norman erstaunt fest.
***
Mein Mobiltelefon klingelte.
»Nein, ich habe keinerlei Ambitionen, jetzt zu singen«, begrüßte mich Molly lachend, »sondern wünsche dir nur ganz normal und unmelodisch alles Gute zum Geburtstag.«
»Herzlichen Dank!« Mir traten tatsächlich Tränen in die Augen.
»Störe ich?«, fragte sie vorsichtig.
»Nein, wie kommst du darauf?«
»Weil du doch heute Geburtstag hast.«
»Ach so. Nein, ich hänge hier herum. Wie jeden Abend.«
»Allein?« Molly klang erstaunt, obwohl sie im Grunde genommen seit Jahren wusste, wie die Sache bei uns lief.
»Mit Sebastian.«
»Aha.«
»Er sieht sich einen Film an, und ich lerne.«
»Schöne Grüße von Lucinda. Sie lädt dich für morgen Abend zu uns ein. Wir sitzen manchmal samstags ein bisschen zusammen. Nichts Besonderes. Nur so. Wenn wir zu arm zum Ausgehen sind.« Sie lachte.
»Oh! Danke! Ich kann was zu trinken mitbringen. Dad hat für mich Geld überwiesen, das Mum diesmal herausrücken muss, weil ich jetzt achtzehn bin«, erzählte ich fröhlich und schielte zu Sebastian, der mir einen wütenden Blick schenkte.
Offenbar konnte er die dämlichen Dialoge seines hirnverbrannten Kinderfilms schlecht in ihrer ganzen Sinnentleertheit verstehen, wenn ich leise telefonierte. Dass seine Hörprobleme auch daran liegen konnten, dass er beim Herumzappeln seine Waden gegen die Ledercouch schlug, war selbstverständlich völlig ausgeschlossen.
»Heißt das, sie hat dir das Geld bisher vorenthalten?«, fragte Molly erstaunt.
»Sie hatte es jedes Jahr auf meinen Namen angelegt«, meinte ich verlegen.
»Wie auch immer. Du brauchst nichts mitzubringen. Aufgrund gewisser Vorkommnisse mit früheren Mietern herrscht im Haus ein Alkoholverbot.« Molly lachte. »Lucinda kontrolliert natürlich niemals unsere Taschen oder Zimmer, aber wenn wir bei ihr zusammensitzen, gibt es aus alter Tradition Heißgetränke.«
Ein durchdringender Schrei ließ mich zusammenzucken. »Ich rufe dich gleich zurück. Sebastian hat sich verletzt.« Hastig beendete ich unser Gespräch.
Mein kleiner Bruder hielt seinen rechten Fuß fest umklammert und brüllte wie am Spieß.
»Was ist denn passiert?«, fragte ich erschrocken und setzte mich neben ihn auf die Couch.
»Du blöde Kuh hast mich abgelenkt!«, schrie er und trat mit dem linken Bein nach mir. Offenbar war er beim Herumzappeln aus dem Takt gekommen und mit dem Couchtisch kollidiert.
»Okay. Die Schuldfrage ist damit geklärt. Bleibt nur noch die Beseitigung des Problems übrig. Darf ich mir deinen Fuß mal ansehen?« Während ich seinen Tritten auswich, fragte ich mich zum gefühlt zweitausendsten Mal, womit ich diesen aggressiven Verwandten verdient hatte. Karma? War ich in meinem letzten Leben etwa eine Massenmörderin gewesen?
»Du tust mir weh!«, behauptete Sebastian.
»Ich habe deinen Fuß gar nicht berührt!« War mein Blick etwa so stechend, dass selbst ein unsensibler Trampel wie mein Bruder ihn spüren konnte?
»Das wird wehtun!«
»Okay. Zumindest die Grammatik stimmt jetzt. Zieh bitte deine Socke aus und zeig mir den Fuß. Ich will nur schauen. Nichts weiter!«
Der kleine Grobmotoriker packte den Strumpf vorn bei den Zehen und zog wie ein Gestörter daran. »Au!«, heulte er. »Das tut weh! Das sag’ ich Mum!«
Dass ein ausführlicher Bericht der Geschehnisse an unsere gemeinsame Verwandte weitergeleitet werden würde, war mir von Anfang an bewusst gewesen. Vielleicht hätte ich diese Geschichten in all den Jahren aufschreiben und als Märchenbuch veröffentlichen sollen. Die besten Ideen hatte man leider stets hinterher.
»Jetzt warte mal bitte. Lass mich das bitte machen! Ich bin ganz vorsichtig. Ehrenwort!«, schlug ich vor.
»Du hast eben versprochen, den Fuß nicht anzufassen. Du lügst doch, wenn du nur den Mund aufmachst!« Wo er recht hatte, hatte er recht. Zumindest den Lieblingsspruch unserer Mutter konnte er schon prima auswendig, wenn er auch sonst kaum etwas auf die Reihe bekam.
»Tja, dann kann ich dir leider nicht helfen. Ich rufe jetzt Mum an und bitte sie, sofort nach Hause zu kommen. Sie fährt dich zur Ambulanz, wo die Ärzte dir eine Betäubungsspritze geben und die Socke mit einem scharfen Skalpell aufschneiden werden. Kleiner Tipp: Dabei solltest du besser auf keinen Fall so herumhampeln wie vorhin.«
Nun durfte ich ihm plötzlich den Strumpf ausziehen, um den Fuß begutachten zu können. Alle Zehen sahen normal aus. Ich bewegte sie ganz vorsichtig, während Sebastian herzzerreißend weinte. Als ich am großen Zeh ankam, begann das arme Opfer, laut zu brüllen, und boxte mich gegen die Brust. Happy birthday! Ja, du kleiner Satan, ich habe dich auch lieb!