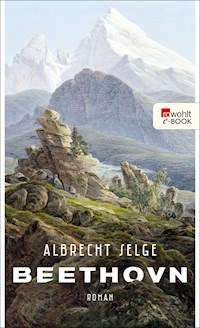9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Jolantha ist im Bergurlaub von ihrer dauerwandernden Familie ebenso genervt wie diese von ihrer anstrengenden Tochter. Doch wer piepst da eigentlich ständig nach ihr? Äußerst merkwürdige Boten! Sie führen das Mädchen in eine faszinierende fremde Gegend, wo sie auf einmal Luyánta heißt und verzweifelt erwartet wird: Denn in der Unselben Welt herrscht Krieg zwischen den Fanesleuten und dem grausamen Adlerprinzen. Weit und gefährlich ist die Reise, aber ihr Doppelwesen als Prinzessin und Weißes Murmeltier macht Luyánta zu einer einzigartigen Kriegerin, und in Laleh findet sie eine treue Gefährtin. Zugleich droht ein verhängnisvoller Fluch sie von innen zu verbrennen. Und was hat es mit den verschwundenen unfehlbaren Pfeilen auf sich? Der entscheidende Kampf um das Schicksal der Unselben Welt wird auch einer um zwei höchst gefährdete Seelen: die eines geliebten Menschen und ihre eigene. Ob man mit Bastian in die «Unendliche Geschichte» eintauchte, mit Bilbo im «Hobbit» aus dem Auenland aufbrach – das Überschreiten der Schwelle zum Erwachsenwerden war schon immer Stoff für große Leseerlebnisse. Albrecht Selge entführt uns mit «Luyánta» in eine fantastische Welt. Die Geschichte eines besonderen Mädchens – und ein außergewöhnliches Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1132
Sammlungen
Ähnliche
Albrecht Selge
Luyánta
Das Jahr in der Unselben Welt
Roman
Über dieses Buch
Jolantha ist im Bergurlaub von ihrer dauerwandernden Familie ebenso genervt wie diese von ihrer anstrengenden Tochter. Doch wer piepst da eigentlich ständig nach ihr? Äußerst merkwürdige und schwatzhafte Boten! Sie führen das Mädchen in eine faszinierende fremde Gegend, wo sie auf einmal Luyánta heißt und verzweifelt erwartet wird: Denn in der Unselben Welt herrscht Krieg zwischen den Fanesleuten und dem Heer des grausamen Adlerprinzen.
Weit und gefährlich ist die Reise, aber in der so selbstbewussten wie gewitzten Laleh findet Luyánta unerwartet eine treue Gefährtin. Und ihr Doppelwesen als Prinzessin und Weißes Murmeltier macht sie zu einer einzigartigen Kriegerin. So muss sie abenteuerliche Kämpfe mit einem Feind bestehen, der im Bund mit bizarren dämonischen Kräften ist. Zugleich droht ein verhängnisvoller Fluch Luyánta von innen zu verbrennen. Und was hat es mit den verschwundenen unfehlbaren Pfeilen und dem Weißen Schwert auf sich?
Unendlich scheint der Weg bis zum entscheidenden Kampf um das Schicksal der Unselben Welt und um zwei höchst gefährdete Seelen: die eines geliebten Menschen und ihre eigene. «Luyánta» erzählt die Geschichte eines ungewöhnlichen Mädchens auf der Suche nach sich selbst. Sie entführt den Leser in eine phantastische Welt – ein Epos zwischen Manga und Trojanischem Krieg.
Vita
Albrecht Selge, geboren 1975 in Heidelberg, studierte Germanistik und Philosophie in Berlin und Wien. Sein begeistert aufgenommenes Debüt «Wach» (2011) wurde für den Alfred-Döblin-Preis nominiert und mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis des Harbour Front Literaturfestivals Hamburg ausgezeichnet. Zuletzt erschienen die vielgelobten Romane «Fliegen» und «Beethovn». Albrecht Selge, der familiäre Verbindungen nach Südtirol hat, lebt als freier Autor mit seiner Familie in Berlin.
Erster Teil: Die Rufe
Der Drache
Der Drache war los, und er war verdammt gut drauf. Und das bedeutete, dass es fürchterlich war. Raserei. Spuckte giftiges Feuer. Als wäre Gift oder Feuer allein nicht schlimm genug, es musste beides zugleich sein. Er hätte am liebsten die ganze Welt vernichtet.
Und das alles auf diesem schotterigen Bergwanderweg im Nieselregen. In Gott weiß welcher Höhe. Hunderttausend Meter oder so. Dort vorn piksten die Berge ja schon in die Wolken. Sie aber (zwölf Jahre alt und sah aus, als wäre sie vierzehn oder fünfzehn) fühlte sich in diesen klobigen Bergschuhen wie ein Elefant. Trotz atmungsaktiver Wandersocken. Als würde jeder Fuß eine Tonne wiegen.
Dabei mochte sie Regen sogar lieber als Sonne (diese verrückte Sonnensucht der Erwachsenen und überhaupt aller Menschen). Wenn sie schon rausging, dann immer noch lieber im Regen. Sonne ist das Normale heutzutage, Regen das Besondere. Und das Beste ist Hagel. Aber am allerbesten trotzdem, wenn man irgendwo drin ist. Im eigenen Zimmer. Wütend kickte sie einen Stein.
Verdammte Wanderung, verschissene Sommerferien.
«Man darf nicht verschissen sagen!», hätte ihr kleiner Bruder jetzt gekräht (ihr sehr kleiner Bruder), wenn er ihre Gedanken gehört hätte. Aber erstens kann man Gedanken nicht hören. Und zweitens war der sehr kleine Bruder ihr ja schon weit voraus. «Selbst unser Zwerg hier wandert tüchtiger als du», hatte ihr Vater gestern gesagt, «ist dir das nicht peinlich, junge Frau?»
«Ja, ja.» Ah, wie sie das hasste, wenn er junge Frau sagte … abgrundtief!
«Sogar ein Ast läuft schneller den Berg rauf als du!»
«Ja, ja.»
«Jaja heißt Leck mich am Arsch», hätte der Vater dann entgegnen können, wenn er’s gehört hätte. Den räudigen Spruch hatte er aus der Bundeswehr, wo er irgendwann mal gewesen war. Gedient hatte. Als Papa noch knackig war wie eine Gurke, wie die Mutter sagte. (Die Redensart hatte sie aus ihrem Lieblingsbuch, das von einem Russen handelte, der sein ganzes Leben lang im Bett liegt. Wie auch die Mutter es am liebsten getan hätte – und zwar die ganze Zeit lesend …)
Dabei wurde der sehr kleine Bruder ja jedes Mal getragen, wenn ihm das Wandern zu anstrengend wurde. Mal setzte ihr Vater ihn auf seine starken Schultern, mal die Mutter auf ihre noch stärkeren, mal ihr großer Bruder (ihr etwas großer Bruder) auf seine, die vielleicht bald die stärksten waren. Obwohl er, wenn sie nicht wanderten, die ganze Zeit am Handy klebte, wie die Mücke im Spinnennetz. Sie durfte ja noch keins haben, nur ein lächerliches altes Tastenhandy hatten sie ihr mal erlaubt. («Ein Smartphone frühestens ab vierzehn», sagten die Eltern, obwohl alle anderen in ihrer Klasse schon eins hatten, «und in deinem Fall ja wohl eher ab fünfzehn oder sechzehn.») Und sogar sie selbst hatte den sehr kleinen Bruder an einem drachenlosen Tag schon mal auf ihre Schultern genommen, aber der war ziemlich schwer für einen Vierjährigen … na gut, keine Ahnung, wie schwer Vierjährige sonst sind … Dort oben schaukelte er dann nervig herum oder hüpfte einem mit dem Po im Nacken. Irgendwann ließ er sich wieder absetzen und wanderte weiter. Flitzte weiter. Immer voraus.
«Tüchtig, tüchtig. Schaut ihn an, diesen kleinen Mann!»
Alle Wanderer, die sie trafen, bewunderten ihn ausgiebig für seine Tüchtigkeit.
«Oha, dein kleiner Bruder ist aber tüchtig!»
Tüchtig, auch so ein Wort von vor hundert Jahren. Tüchtig, wie das klingt. Wie der Name Irmgard. Oder Schmalz.
Als ob sie nicht gekonnt hätte. Die anderen waren ihr nicht voraus, sondern sie war hinterher. Weit hinterher. Und warum? Weil sie es so wollte. Hi Leute, da bin ich wieder, und das ist die Wahrheit: Ich hasse es. So war das. Sie hatte einfach keine Lust zu wandern. Wozu in die Berge fahren, wenn man auch schön im eigenen Zimmer sitzen könnte? Im eigenen Zimmer ein ungestörtes, glückliches Leben verbringen? Dort hatte man ja die ganze Welt – ihre eigene Welt …
Stubenhockerin, sagten sie manchmal zu ihr. «Du Höhlenbewohnerin. Geh mal raus.» Bitte sehr. Ging sie halt raus: in die Mall, musste sie nur einmal durch den Park. Das Lustschlösschen-Center, das die Eltern «abgeranzt» nannten, heruntergekommen, die Hälfte der Ladenflächen stand leer. Von wegen, man hat dort alles, was das Herz begehrt. Da könnte sie jetzt abhängen, mit Kunigunde-Marie und Elif und Jacky.
Oder allein. Allein wär am besten.
Stattdessen: mehrtägige Höhentour in Südtirol, von Hütte zu Hütte. Ihr Auto, diesen peinlichen blauen Kia (einen Diesel), hatten sie auf einem Bergparkplatz oberhalb eines Dorfes stehen lassen, zwischen knisternden Nadelbäumen. «Das sind Fichten», hatte ihr Vater gesagt. «Nein, Lärchen», die Mutter. Wen interessiert’s. Nach einer Woche würden sie wieder dort ankommen.
Eine Woche wie ein zähes Jahrhundert.
Warum müssen Kinder wandern, nur weil Erwachsene gern wandern?
Und etwas große und sehr kleine Brüder. Die wandern auch gern. Aber die waren ja gar keine normalen Kinder. Vielleicht war genau das das Problem: dass sie, Jolantha Seyfried, der einzige normale Mensch auf der Welt war.
Begreift ihr das? Dass jemand keine Lust hat? Dass jemand es hasst?
Der Drache. Hi Leute, da ist er wieder.
Und wer trägt mich?
Keine Ahnung, wie es überhaupt wieder zu dem Streit gekommen war. Aber es war ja überhaupt nicht wert und würdig, sich damit zu beschäftigen. Es hatte keinen richtigen Grund für den Streit gegeben, nur ein paar dumme Worte, die die anderen zu ihr gesagt hatten. Und wie sie es sagten. Wie sie es sagten, das war im Grunde schlimmer, als was sie sagten. Spöttisch. Respektlos. Die Scherze des Vaters. Oder wenn er ein Machtwort sprach – peinlich, schlimm. Und die Belehrungen des etwas großen Bruders. Tat so vernünftig, der Typ, obwohl er die ganze Zeit bloß am Handy suchtete oder zu Hause am Computer. Sollte er aufhören, dann jaulte er rum wie früher der sehr kleine Bruder, wenn man ihm den Schnuller wegnahm. Und wenn sie ihn beim Zocken störte, haute er ihr eine rein! Gut, manchmal half er ihr auch bei besonders ekligen Hausaufgaben. Aber sonst … Und hier in den Bergen lief er dann auf einmal wie so ein Wanderweltmeister. Und belehrte sie neunmalschlau, wieder und wieder.
Als wollten die alle sie ständig provozieren. Ihren Drachen von der Leine reißen.
Egal. Na ja, fast egal. Jedenfalls war jetzt etwas anderes wichtiger. Sie griff unter ihre Regenjacke und zog ein Bonbon aus dem Täschchen, das sie immer trug – dieser kleinen gehäkelten Umhängetasche mit Plastikperlen und bunten Fransen, das ihre Mutter den Hippiebeutel nannte. Ah, sie hatte ein gelbes Bonbon erwischt: Geschmacksrichtung Ananas. Betonung auf Richtung, nicht Geschmack.
Das war allerdings auch noch nicht das Wichtige. Das Wichtige geschah, während sie weiterging, über die nasse, rutschige Schotterstraße voller Pfützen: Da hörte sie nämlich wieder dieses seltsame Pfeifen von den Berghängen. Helles Pfeifen. Von weit weg. Und trotzdem ziemlich laut.
Als sie es zum ersten Mal gehört hatte, da hatte sie gedacht, sie bildete es sich bloß ein. Es wäre nur in ihrem Kopf. Sie pfiff ja auch manchmal, auch ziemlich laut, wenn sie allein in ihrem Zimmer war und nicht gerade Youtube schaute. Früher hatte sie auch gern allein im Treppenhaus gespielt, und eigentlich hätte sie das immer noch gern getan, aber jetzt war sie dafür zu groß …
Das heißt, in Wahrheit war sie eben gar nicht allein, sondern im Spiel und in Gedanken umgeben von unsichtbaren Freundinnen. Manchmal auch Feindinnen, natürlich. So oder so leichter mit umzugehen als mit den sogenannten echten Freundinnen und Feindinnen in der Schule. Und vor allem interessanter als die, aufregender.
Wobei: Nichts gegen die echten Freundinnen, sie hatte ein paar, und die waren alle okay auf ihre Weise. Elif zum Beispiel und Kunigunde-Marie und Jacky. Nach den Sommerferien würden ihre Wege sich trennen, wie man so sagt, sie ging auf ein Gymnasium, Elif und Kunigunde-Marie auf ein anderes, Jacky auf eine Realschule. Sie sagten: Wir werden uns nicht aus den Augen verlieren, aber das würden sie natürlich doch, und ihr war’s ehrlich gesagt egal. Für den Rest der Klasse galt das natürlich erst recht. Trotzdem hatte sie auch gegen die andern nichts. Nicht mal gegen die Jungs. Konnten ihr nicht das Wasser reichen, die Knirpse, aber dafür können sie ja nichts. Freundschaft ja, aber alles in Grenzen bitte. Immer wieder zog es sie weg von allen anderen Menschen, auch denen, die beste Freundinnen sind. Kein Bedürfnis nach Umgang, schon gar nicht mit Gleichaltrigen.
Mein Herz ist zu voll, als dass darin noch Platz für andere wäre.
Und manchmal kam es ihr sogar vor, als ob alle anderen Menschen nur Täuschungen wären … Anders als die unsichtbaren Freundinnen. Die Täuschungen sind das Echte. Manchmal unterhielten sie und die Unsichtbaren sich in unbekannten Sprachen, die sie sich in diesen Momenten erst ausdachte. Singende Sprachen. Oder sie pfiff eben, so laut es ging. Irgendwo auf der Welt gab es Pfeifsprachen, darüber war mal was im Fernsehen gewesen. Irgendwelche seltsamen Hirtenvölker, die sich über Berge und Schluchten hinweg pfeifend miteinander verständigten.
«Dieses gottverdammte Gesinge und Gepfeife!», rief dann ihr Vater, der in Ruhe schreiben wollte. Oder Mittagsschlaf halten. Nachdenken nannte er das. (Andere Väter erteilten ihren Kindern Hausarrest, zumindest in Filmen. Ihr Vater hätte ihnen lieber Draußenarrest erteilt. Naturarrest.)
«Alles an dir ist laut und stachelig, Jolantha! Wenn das nicht sofort aufhört, dieses Gesinge und Gepfeife …»
Gesinge und Gepfeife. Was verstand der schon? Was verstanden die alle?
Sie blieb stehen und betrachtete die aufsteigenden Berghänge. Nichts wuchs da mehr, nur verhungertes Gras, darin lauter verstreute und verlorene Steine und ein paar Felsbrocken, wie von Riesen vor Jahrtausenden herumgeworfen. Oder die Berge waren die versteinerten Riesen. Jedenfalls gab’s schon längst keine Bäume mehr in dieser Höhe und nicht mal diese jämmerlichen Murkelbüsche, die das Gebirge sonst im Angebot hat. Warum um Himmels willen dorthin gehen, wo nicht mal Bäume hinwollen! Hinauf zu Hungergras und Steinen und Schotterhängen und weiter bis auf diese verschissenen Gipfel der Alpen, direkt in die Wolken hinein.
Das war also diese Majestät der Berge, von der ihre Eltern sprachen …
Aber von wem oder was das Pfeifen herkam – keine Ahnung.
Sie hatte es schon den ganzen Tag lang gehört, aber seit sie sich in ihrer Wut hatte zurückfallen lassen, war es lauter und deutlicher geworden. Kann auch sein, dass es in Wahrheit nur gleich geblieben war und sie es jetzt einfach besser hörte, weil nicht mehr die ganze Zeit auf sie eingequatscht wurde … eingemahnt und eingemotzt … ah, wie sie das hasste. Herrliche Ruhe seither! Seit die letzten «Komm schon»-Rufe der Familie verhallt waren. Denn nachdem es gekracht hatte und der Drache in ihr wieder los war, da hatten ihre Eltern und ihr etwas großer Bruder sich noch ein paarmal zu ihr umgedreht und geplärrt: «Jolantha, nun beruhig dich doch wieder und komm endlich nach!»
Sogar ihr sehr kleiner Bruder hatte gekräht: «Jolantha, komm schon!»
Da hatte sie, gegen ihren Willen, sogar ein bisschen lachen müssen, und das hatte sie nur noch wütender gemacht. Schrecklich ist das, gegen den eigenen wütenden Willen lachen zu müssen.
Und natürlich hatte sie nicht zu ihnen aufgeschlossen, zu dieser verletzenden, plärrenden Familie. Und endlich, endlich waren sie davongezogen. Sollte sie halt nachkommen, meinten sie.
Und weg waren sie. Himmlische Ruhe.
Wenn auch nicht in ihr. In ihr war keine Ruhe. Nur der Abstand zwischen dieser sogenannten Familie und ihr hielt sie davon ab, wieder loszuschreien. Aber in ihr brodelte und brüllte es weiter. Zu Hause riegelte sie sich in solchen Lagen in ihrem Zimmer ein. Und hätte sich jetzt einer von denen ihr genähert, dann hätte sie ja brüllen müssen. Giftgrünes Drachenfeuer in ihr! Sie sollten ihr bloß fernbleiben, sonst geschähe ein Unglück.
Das wussten die auch. Und der Weg zur Hütte, wo sie übernachten würden, war ja leicht zu finden. Immer geradeaus. Und für die ganz Doofen alle paar Meter ein Wegweiser. Ging sie also weiter im Stop-and-go-Modus: paar Schritte trotten. Stehen bleiben. Stein kicken. Weitertrotten. Mehrmals wurde sie von tüchtigen Wanderern überholt, die alle dieser Berghütte zustrebten. Lauter hochgerüstete deutsche Rentner. Einmal ein rasantes silberhaariges Ehepaar mit einem riesigen zotteligen Hund. Der schaute sie an mit wackelndem Schwanz und wässrigen dummen Augen. Und der eine oder andere Wanderer sagte oder fragte etwas beim Überholen, und sie antwortete dann immer so knapp wie möglich.
«Wanderst du zur Hütte? Haben deine Eltern dich etwa ganz allein gelassen hier oben? Unverantwortlich … Ja weißt du denn, wie du da gehen musst?»
«Ja, ja.» (Immer einen Fuß vor den andern. Für wie blöd hältst du mich, Irmgard?)
«Genau, immer geradeaus, nicht zu verfehlen! Trotzdem, ich muss wirklich sagen …»
Ja, nicht zu verfehlen. Wenn man nicht absichtlich in den Abgrund spränge. Aber dieser popelige Abgrund hier war ja nicht ernst zu nehmen, überhaupt nicht ausreichend für einen Hopser in den sicheren Tod. Mit etwas Glück ein verstauchter Knöchel, mehr war hier nicht drin. Das Tal lag zwar tief, aber es ging nicht direkt hinunter, sondern nur so nach und nach, ein lächerlicher sanfter Hang.
Mit tollem Ausblick aber! Ja, ja. «Toller Ausblick, was?», sagten die Mutter und der Vater ständig, es wurde ihnen einfach nicht langweilig, das dauernd zu wiederholen: «Toller Ausblick, was? Selbst bei diesem Regenwetter.»
«Ja, und die Berge. Irgendwie majestätisch.»
Die Mutter knipste dann das irgendwie Majestätische und den tollen Ausblick mit dem Smartphone, und der Vater sagte: «Auf dem Foto kommt das nicht so zur Geltung.» Die Mutter knipste dennoch.
Ausblick. Wenn man oben ist, kann man runtergucken. Na und? Was soll daran aufregend sein?
Dörfer dort unten, Wälder und Felder, verstreute Kühe. Und Straßen, natürlich. Und nach dem Tal wieder Berge, diese völlig sinnlosen Gebilde. Eine lange Reihe heller Berge in der Ferne, fast bleich, fast weiß auch ohne Schnee auf den Gipfeln. Und irgendwo hinter den Bergen musste diese Autobahn auf Riesenstelzen sein, auf der sie in ihrem blauen Kia hergefahren waren. In die Sommerferien. Sie hatte, wie immer auf Autofahrten, gekotzt, und ihr etwas großer Bruder hatte gegen den CO2-Ausstoß protestiert und ihr sehr kleiner Bruder fast die ganze Zeit geschlafen, und ihr Vater am Steuer hatte gerufen: «Du informiere dich erst mal genauer, andere stoßen ja viel mehr CO2 aus als wir, außerdem fass dir mal an die eigene Nase, allein dein ewiges Gedaddel und Gezocke, was das verbraucht, das geht auf keine Kuhhaut – und du halte die Tüte bereit, das kann ja nicht wahr sein, auf jeder Fahrt diese Kotzerei – nehmt euch alle gefälligst mal ein Beispiel an Mäxchen, der ist immer friedlich!» Und die Mutter versuchte zu lesen. Während immer wieder schwarz verpackte Motorradfahrer an ihnen vorbeidröhnten.
Statt auszublicken auf Berg und Tal, hörte Jolantha jetzt lieber aus. Dem Tal ab-, den Bergen über ihr zugewandt. So lauschte sie auf dieses Pfeifen, das von den Hängen kam. Mehrere kurze, manchmal auch etwas längere Pfiffe – dann eine Pause, als würde auf Antwort gewartet – dann der nächste Pfiff …
Vielleicht kam es ja von irgendwelchen Vögeln. Aber sie sah sie nicht. Wohl segelten dort oben solche pechschwarzen Rabenviecher herum, aber die schrien ja ganz anders, heiser krächzend. Ließen sich dabei in der Luft plötzlich herunterfallen, als plumpsten sie vom Himmel … aber nur ein Stück, und dann werden sie gefangen von einer unsichtbaren Hand.
Unheimliche Kreaturen waren das. Bei der Ankunft an ihrer letzten Hütte gestern Abend hatte einer dieser Vögel, dunkel wie die Dämmerung, auf einem Wegweiser gesessen und sich am Holz den Schnabel gewetzt.
Dieses Rabenviechkrächzen hatte sie schon öfter gehört, nicht nur hier. Man hörte es auch in der Stadt auf den Straßen und im Park, gegenüber der Mall: von den großen Krähen, die es dort gab und die auch etwas Unheimliches, Verhextes hatten. Die waren nicht völlig schwarz, sondern hatten am grauen Leib nur schwarze Flügel und einen schwarzen Kopf kleben und auf der Brust einen schwarzen Zackenkranz wie eine verfluchte Halskette. Ein Druden-Schmuckstück. Wilddruden im Stadtpark. Immer leicht aggro, von denen hält man sich lieber fern. Eine Krähe hatte einmal auf einer Tischtennisplatte gesessen und sie angestarrt mit stechendem Blick, als sie an ihr vorbeilatschten, und Kunigunde-Marie: Kreischattacke! Aber die Krähe war bloß sitzen geblieben und hatte sie weiter angestarrt.
Doch diese Vögel hier waren noch unheimlicher und verhexter als die Stadtparkkrähen. Gelbe Schnäbel, rote Füße, aber die Federn komplett schwarz. Rabenschwarz.
Aber mit dem Pfeifen, das sie interessierte, hatte ihr Krächzen nichts zu tun.
Die Schwester
In diesem Moment fiel ihr die merkwürdige unbekannte Sprache ein, die sie vor einigen Tagen in einem Dorf gehört hatte, bei einigen alten Männern mit grauen Filzhüten und blauen Schürzen. Einer hatte ein ganz zerfaltetes Gesicht gehabt, ein anderer ein hängendes Auge, ein dritter nur ein Bein. Ein Gekrächze voller äs und üs war diese Sprache gewesen. Allerdings kein Türkisch, Türkisch hätte sie erkannt. Türkisch klang ja noch normal. Pädalü, Püderä, so ungefähr war das hier gewesen.
Ihr Vater, der alte Bescheidwisser, hatte ihnen dann mit wackelndem Zeigefinger beim Essen im Restaurant namens Kassianswirt sein Reiseführerwissen zum Besten gegeben: Es handele sich um eine uralte, äußerst seltene Sprache, die nur noch hier in wenigen abgelegenen Tälern von wenigen letzten Menschen, bla, bla, bla … Auch hier standen diese hellen, geradezu bleichen Berge, aufgereiht am Rand des Tals, und auf der Fahrt durch tausend schaukelnde Kurven war ihnen allen schlecht geworden, sogar die Mutter dicht davor, sich zu übergeben, nur der Vater am Steuer wohlauf. Und während er im Kassianswirt seinen Vortrag hielt, hatte ihr etwas großer Bruder ungerührt seine Whatsapp-Nachrichten gelesen, und der sehr kleine Bruder hatte auf der Bank einen Purzelbaum zu schlagen versucht, und Jolantha hatte gebrummt: «Ja, ja», und dann war mal nicht sie, sondern der Vater ausgerastet und hatte gerufen: «Hier interessiert sich ja niemand für irgendwas! Stumpfsinnig bis dorthinaus, alle miteinander! Andere wären dankbar … bitte schön, dann bleibt halt blöd und blind!»
«Machen wir», hatte der etwas große Bruder geantwortet und weitergetippt, ohne aufzuschauen. Da hatte der Vater noch mehr geschnaubt, «Mir reicht’s!», und er war vor die Tür des Kassianswirts gerannt, um erst mal eine Zigarette zu rauchen. Er hatte wohl auch einen Drachen in sich. Der war ja selbst laut und stachelig.
Jolantha aber war in diesem Moment, auch das geschah manchmal, ein Herz und eine Seele mit ihrem etwas großen Bruder.
Jetzt hingegen, beim Wandern, war er wieder ihr Feind. Jetzt hasste sie auch ihn. Ah, wie ich euch alle hasse.
Und an noch etwas (außer an diese merkwürdige Pükälü-Sprache der alten Hut- und Schürzenträger) erinnerte sie sich plötzlich hier auf diesem verschissenen Höhenweg im Nieselregen, mitten im Gras-und-Stein-Nichts: an eine abscheuliche Hochheiligkeit nämlich, die sie im Tal gesehen hatten. In einer kleinen Dorfkirche war das gewesen, vor der ein Kirschbaum stand und Kuhfladen im Gras lagen. Auf der Fahrt in das abgelegene Dorf hatten immer wieder dröhnende Motorradfahrer ihren Kia überholt, wie unangenehme, zottelige Kreaturen kamen die ihr vor, obwohl sie in glattem Leder steckten und Helme mit verspiegelten Visieren trugen, nur fransige Haare wehten heraus und manchmal auch ein zerzauster Bart unter dem Helmvisier. Die hatten bestimmt sogar behaarte Zähne.
Im Innern der kleinen Kirche roch es komisch. Die Kirchen hier fand sie sowieso gruselig, weil da immer diese Beichtstühle drin rumstanden – eigentlich ja winzige Häuschen, und jedes Mal fragt man sich, ob da einer drinhockt und wartet und lauscht. Irgendein schräger Zwerg. Aber in dieser kleinen Dorfkirche hing noch dazu ein Jesus an einem Kreuz, über und über mit Blut beträuft und betrieft, so was Perverses hatte sie noch nie gesehen. Man konnte die Figur kaum erkennen unter dem ganzen Blut, das sogar in Fäden und Fetzen von den Armen runterhing. Auch wenn das wahrscheinlich kein echtes Blut war, egal, trotzdem richtig eklig, dieser Blutfetzenjesus. Also nicht der Jesus, sondern was sie mit ihm gemacht hatten. Als wäre der nicht einfach gekreuzigt (schlimm genug), sondern ein Drache hätte giftiges Feuer auf ihn gespuckt. Da regten die Eltern sich über die albernen Computerspiele ihres etwas großen Bruders auf, aber ließen ihre Kinder solche ekligen Sachen besichtigen!
Die Mutter meinte auch, dieser Jesus sei ja Geschmackssache.
«Ich kann einfach kein Blut sehen», sagte Jolantha.
«Ist aber Wachs», brummte ihr etwas großer Bruder, der alte Belehrer. Der Vater war mit dem sehr kleinen Bruder schon wieder raus zu Kirschbaum und Kuhfladen.
Jetzt schüttelte Jolantha sich wie ein nasser Köter, um nicht mehr an diese abscheuliche Hochheiligkeit denken zu müssen. Aber das Gedankenabschütteln funktionierte nicht, und der Regen wusch auch keine Gedanken ab. Es funktioniert nie. Wenn man an etwas Ekliges unbedingt nicht mehr denken will, denkt man erst recht dran. Blutfetzen, Wutfetzen, Feuergift. Es war alles ganz schrecklich und hoffnungslos.
Lieber wollte sie wieder auf das Pfeifen lauschen, dieses geheimnisvolle Pfeifen, das etwas Verlockendes hatte. Um besser hören zu können, streifte sie die Kapuze ihres Regenponchos ab, da blies ihr der Wind gleich ins Haar, und der Regen tropfte ihr auf den Kopf. Ganz angenehm, wie eine leichte Massage. Sie hörte das Pfeifen nun noch klarer und deutlicher. Und sie hatte (nun aber seltsam undeutlich) das Gefühl, mit dem Pfeifen wäre sie gemeint. Das Pfeifen pfiffe die ganze Zeit ihr zu, nur ihr. Als ob wer nach ihr riefe …
Aber vielleicht lag das alles ja nur daran, dass es in ihr so tobte und dass sie derart genervt war. Mädchen am Rande des Genervtheitszusammenbruchs. Hi Leute. Sie zog noch ein Bonbon aus dem Hippietäschchen und warf’s in den Mund: rot, Geschmacksrichtung Granatapfel. In ihrem Körper steckten zahllose Bonbons und ein Drache. Und sie beschloss, sofort weiterzugehen, denn von hinten näherten sich wieder solche rüstig-tüchtigen Wandersleute. Die sie irgendwas fragen würden. Bloß keine Gespräche. Das Leben drückte sie so schon genug. Da brauchte sie keine nervigen Unterhaltungen auf elenden Bergwanderungen.
Eine Schwester aber, dachte sie manchmal, die hätte sie gern gehabt. Unter den unsichtbaren Freundinnen war ihre liebste die unsichtbare Schwester. Die Zwillingsschwester. Hatte die gleiche Stimme wie sie, war genauso groß wie sie. Und konnte trotzdem tausend verschiedene Gestalten annehmen, jedes Mal anders; und doch Zwilling. Wunschtraum.
Und natürlich hätte sie befürchten müssen, dass sie sich mit der Schwester, wenn es die wirklich gäbe, auch ständig gezofft hätte. Musste man realistisch sein. Vielleicht wäre es mit einer Zwillingsschwester sogar am allerschlimmsten gewesen, denn wenn die ihr in jeder Hinsicht gliche, wäre sie auch laut und stachelig, und in ihr würde ebenfalls ein Drache hausen … giftgrün und will sich losreißen von seiner Leine … Nicht auszudenken!
Und auf einmal der Gedanke, die Ahnung: Das könnte doch ihre Schwester sein, die dort nach ihr pfiff. Ihre unbekannte, allerliebste Schwester.
Jolantha blieb noch einmal stehen, auf die Gefahr hin, dass die rüstigen Wanderer sie einholten.
Wieder ein Pfeifen.
Und da ging sie vom Weg ab, in Richtung des Pfeifens.
Ein paar Schritte. Blieb stehen.
Lauschte.
Würde weitergehen …
«Jolantha!»
Ruckartig wandte sie sich zu der Seite, von wo der Ruf gekommen war. Und sah auf einer letzten kleinen Erhebung schon ihr Tagesziel: die Berghütte, gebaut aus schweren grauen Steinen. Klobig wie ein Bergschuh, der einem Riesen vom Fuß gerutscht ist. Sie hatte gar nicht bemerkt, wie nah sie schon am Ziel war, so sehr war sie in Gedanken versunken gewesen. Der Nieselregen hatte aufgehört, und eine Handbreit über den Bergen kam die Sonne heraus, die sich den ganzen Tag nicht hatte blicken lassen. Von der Hütte aus schlenderte ihr jemand entgegen, winkte und rief immer wieder ihren Namen: «Jolantha!» Und sie erkannte gleich, wer es war. Das Gegenteil ihrer Zwillingsschwester. Ihr Bruder, der etwas große. Er hieß übrigens Valentin.
– ALTER, was ist bloß los mit diesem Mädel? Hat die denn PETERSILIE in den Ohren?!? Versteht sie uns etwa nicht? Warum kommt sie nicht?
– Geduld, Bruder, Geduld … wir wollen weiterrufen …
Glück am Leim
Trug es mit Fassung, der Valentin, dass seine nervige Schwester ohne ein Wort, ohne ihn anzuschauen an ihm vorbeigerauscht war. Dabei war er ihr mit so viel gutem Willen entgegengegangen. Bloß nicht aufregen – er kannte sie ja, seine kleine Schwester. Anlächeln wollte er sie, herzlich anlächeln …
«Na komm schon», hatte er gesagt, «willst du mir nicht deinen Rucksack geben? Das schwere Ding. Ich trag ihn für dich.» Und sie: nicht mal geantwortet. Denn in seinem Gesicht war es wieder gewesen, dieses belehrende halbe Grinsen. Das zündete jedes Mal die Wut in ihr an.
Also war sie allein zur Hütte gepest (Valentin hätte nicht gedacht, dass sie so schnell laufen konnte) und hatte am Eingang nur hastig die klobigen Treter abgestreift, und dann gleich auf den ach so atmungsaktiven Socken die knarzende Holztreppe hinauf in den leicht zu findenden Schlafsaal, mit diesem verschissenen Rucksack auf den Schultern. Dieses mintgrüne Globetrotter-Wunderding mit Reflektoren und belüftetem Tragesystem, das in Wahrheit einfach nur schwer war, elend schwer. Oben sah sie gleich, wo ihre Familie Matratzen belegt hatte, ein Platz für sie frei gehalten. Suchte sie sich also eine freie Matratze so weit weg wie möglich. Lieber neben irgendwelchen Fremden schlafen als neben denen.
Diese Matratzen sollte man besser nicht zu genau anschauen. Dampften bestimmt irgendwas aus. Will man gar nicht wissen, was da drin so lebt und webt und kreucht und fleucht … Bakterien, Viren, unvorstellbares Kleinstgetier … Trotzdem ließ sie ihren Rucksack auf den Boden sinken und sich selbst auf die Matratze. Drehte sich auf den Rücken und breitete die Arme aus. Fühlte sich wie eine Gekreuzigte.
Wow.
Na ja, keine Ahnung, wie Gekreuzigte sich fühlen. Wahrscheinlich eher mies als erhaben. So am Kreuz zu hängen mit durchgenagelten Händen und Füßen und nur noch auf den Tod zu warten … Jedenfalls, so lag sie und starrte die Decke des Schlafsaals an.
Dann streckte sie die Arme in die Luft und hielt sich die Hände übers Gesicht. Wie ulkig, diese beiden gekrümmten kleinen Finger, ihr Kennzeichen seit Geburt. Sie wackelte mit den kleinen Fingern, nur aus Langeweile.
Nein. Einfach: nein. Sie mochte diese Hütte nicht. Alle diese Berghütten. Die ganze Atmosphäre: enges, stickiges Beieinander. Schon diese unappetitlichen Wanderschuhe, die einen in den Regalen gleich hinter der Eingangstür begrüßten. Oder das eiskalte Wasser in den Waschräumen. Bestimmt waren hier auch wieder solche italienischen Hock-Klos, mit einem grausigen Loch im Boden, in das man – nein, bloß nicht dran denken. Ach, und all die Hüttenfexe, diese rüstigen Bergschrate mit ihren Alpenvereinsabzeichen. Schrate, das Wort hatte Valentin gestern benutzt. Keine Ahnung, was es bedeutete, aber gefiel ihr. Knittersäcke in müffelnder Funktionskleidung. Irgendwie sahen die alle gleich aus, die Schrate. Die kamen ihr vor wie Menschen, die besser auf Bäumen leben sollten oder auf Felsen. Alles stank in diesen Hütten, und die Bergschrate verzehrten nach der Ankunft noch in Plattfüßler-Badelatschen ihren mitgebrachten Proviant. Verzehren, auch so ein Wort … oder Latschen. Die hatten bestimmt tüchtig Schmalz auf den Stullen. Und diese Frauen, die die Stullen schmieren, hießen alle Irmgard.
Am Ende zog sie doch zu dem Platz um, den die Familie ihr freigehalten hatte. Lieber zu denen als zu den Schraten.
Fröstelndes Schweigen, zaghafte Lächelversuche, als sie die Stube betrat. Stube … Schmalzstullenverzehrstube! Da saßen die also, ihre sogenannte Familie, ihre Essen vor sich. Wenn sie das sah (und sie sah es oft, denn sie setzte sich immer als Letzte an den Tisch), dann fiel ihr dieses gestickte Bild bei Tante Sofia in Kleinlützow ein, eigentlich Urgroßtante, die sie alle paar Wochen besuchten. Tante Sofia hatte auch was von einer Krähe, aber eigentlich mochte Jolantha sie ganz gern, und sie tat ihr leid, weil sie alt und allein war. Obwohl sie selbst gern allein gewesen wäre … So verwirrend ist das Leben: Man will allein sein, aber mit denen, die allein sind, hat man Mitleid. Wie auch immer, obwohl sie Tante Sofia mochte – die Besuche mochte sie nicht. Auf dem gestickten Bild über dem Sofa stand:
Trautes Heim,
Glück allein.
Genau genommen müsste es ja alleim heißen, damit es sich reimte. Trautes Heim, Glück am Leim …
In der Stube turnte Mäxchen schon vor seinem kaum angegessenen Kaiserschmarren herum, waghalsiger Purzelbaumversuch. Den Kaiserschmarren bestellte er jedes Mal und war jedes Mal nach drei oder vier Bissen schon satt. Die Mutter aß dann auf. Sie bestellte nie ein eigenes Gericht, wegen der vielen Reste bei ihnen und der ganzen Geldverschwendung.
Für die Mama nur einen Räuberteller, scherzte der Vater im Restaurant öfter mal. Niemand lachte, er scherzte trotzdem. So war das bei ihnen: Der Vater und Mäxchen lachten beide über ihre eigenen Witze selbst am meisten; aber beim Vater war das nicht niedlich. Und vielleicht war es mit seinen Büchern genauso. Er war Schriftsteller, aber nicht sehr erfolgreich – ob’s daran lag, dass er viel weniger Bücher las als die Mutter? Stattdessen gab er ständig schlaue oder witzige oder schlauwitzige Lektüreratschläge: Wenn du mal größer bist, hatte er neulich zu Jolantha gesagt, liest du mal die Penthesilea von Kleist, die passt zu dir, sie zerfleischt nämlich den, den sie liebt. Eigentlich könntest du sie jetzt schon lesen, die Penthesilea.
Ansonsten schaute er, statt zu lesen, lieber jeden Abend uralte französische und japanische Filme. Schwarz-weiß bis dorthinaus. Die Mutter aber, die hätte am liebsten immer nur gelesen. Aber leider musste sie die ganze Zeit arbeiten; denn einer muss ja Geld verdienen, und in ihrem Fall war das: eine. Senior Director (was auch immer das sein sollte) bei Europas größtem Duftbäumchen-Versender. Sie hasste ihre Arbeit.
Jetzt saß sie da, auf die Freigabe des kalt werdenden Kaiserschmarrens wartend, eine Hand flach auf dem Buch, das sie gern weitergelesen hätte. Der Vater die grobe Pranke ums Bierglas. Und ringsum diese Hüttengemütlichkeit. Wortschwalle, Kartenspiele.
Würden die alle in dem Schlafsaal pennen wollen? Na, dann gute Nacht.
«Da ist meine Jolantha!», krähte Mäxchen, als er vom Purzelbaum wieder hochkam und sie am Eingang erblickte. «Meine Jolantha!» Er rief so laut, dass alle im Raum sich zur Tür drehten. Wie peinlich war das denn.
Ihr Vater riss sich diesmal zusammen, obwohl er böse Laune hatte. Einer der rüstigen Wanderfexe, von denen sie überholt worden war, hatte ihm nämlich heftige Vorwürfe gemacht, weil er seine «kleine Tochter inmitten der Berge ausgesetzt» hatte.
Ausgesetzt.
Inmitten der Berge.
Die kleine Tochter. (Sie war zwölf! Sah aus wie vierzehn oder fünfzehn!)
«Was möchtest du haben?»
«Speckknödel. Bitte.» Immerhin, die Hüttenwirtin sah ganz nett aus. Sie hatte schon graue Haare, aber ein braun gebranntes Gesicht und wirkte sportlich. Sanft und sportlich. Und dabei glänzende dunkle Augen, die machten Jolantha die Hütte ein bisschen erträglicher und weniger widrig.
«Ich habe es den anderen schon mitgeteilt», begann ihr Vater in seinem Weihnachtsansprache-Ton, nachdem die Wirtin weg war. «Wir werden morgen mal einen Ruhetag einschieben. Es waren drei lange, anstrengende Etappen in den letzten Tagen. Wir können stolz sein auf unsere Leistungen – sogar du, junge Frau! Ja, ich weiß, du willst es nicht hören, aber du kannst stolz sein … Nun sind wir aber alle ziemlich erschöpft. Vielleicht deshalb der Streit vorhin … Zugegeben, ich hätte auch nicht so ausrasten sollen … aber deine explosive Art und immer dieses Laute und Stachlige … Nein, wir wollen jetzt nicht wieder davon anfangen! Außerdem tut der Mama ihr Knie etwas weh. Wohl etwas aus der Übung, haha … Ich bin sicher, ein Tag Erholung wird uns allen guttun.»
«Du meinst, wir sollen den ganzen Tag in dieser Hütte bleiben?»
«Genau.»
«Aber das Wasser im Waschraum ist eiskalt.»
«Macht nichts.»
«Die Klos sind nur ein Loch im Boden.»
«Na und?»
«Hier ist kein Internet», sagte Valentin. «Null Empfang.»
«Ihr habt Bücher dabei. Jeder von euch hat doch ein Buch dabei. Wozu tragt ihr die eigentlich in den Bergen herum? Und Mäxchen kann draußen spielen. Habt ihr den kleinen See neben der Hütte gesehen?»
«Den ganzen Tag lang?»
«Was?»
«Wir sollen den ganzen Tag in dieser Hütte hocken und den See anglotzen?»
«Wir könnten auch einen Gipfel stürmen. Mama bleibt schön mit Mäxchen hier und ruht sich aus, und wir drei stürmen einen Gipfel. Na, wie wär das? Es gibt da wohl eine fabelhafte Tourmöglichkeit, zweitausendneunhundert Meter, ich habe mich schon erkundigt.»
«Okay.» Valentin nickte.
Sie ächzte. «Nicht okay.»
«Jedenfalls ist morgen Ruhetag», sagte ihr Vater, der gleich wieder rappelig wurde. Wer ist hier leicht reizbar? «Wir diskutieren das jetzt nicht, ja, junge Frau? Ich spreche jetzt ein Machtwort. Einmal wird das gemacht, was ich – ich meine, was wir beschlossen haben. Ich und Mama. Mama und ich.»
«Aber …»
«Ein Machtwort, hab ich gesagt!»
Sie aßen ziemlich schweigend, nur Mäxchen plapperte die ganze Zeit. Er wollte unbedingt noch raus zum See. Jolantha schaute sich, während sie Knödelstückchen mit der Gabel aufpikste und in zerlassene Butter tunkte, in der Stube um. Die kauenden Schrate ringsum versuchte sie zu ignorieren. Dort drüben das silberhaarige Ehepaar von vorhin, ihr riesiger Zottelhund zusammengefaltet unter dem Tisch. An einem Ecktisch saß ein Mann und las ein Buch, dabei bewegte er stumm die Lippen, wie die nicht so Schlauen in ihrer Klasse. Auf einem Regalbrett in der Ecke lief ein Fernseher ohne Ton, bescheuertes italienisches Fernsehen: ein uralter Mann im Anzug und eine junge Frau mit breiten Lippen und dickem Busen in einem Studio stumm aufeinander einplaudernd. Und dazu eine seltsame Tonspur, nämlich nicht vom Fernseher, sondern das Gesprächsrauschen der Hüttenstube – Klappern von Geschirr und Besteck und an einem Tisch eine laute brummende Unterhaltung von ein paar alten Männern. In dieser Pükälü-Sprache.
Weiter umschauen. Nicht mit der Familie reden. Familie, Glück am Leim. Durchatmen, essen, umschauen.
An den Wänden Schwarz-Weiß-Fotografien von Wanderern, die bestimmt schon alle tot waren. Und neben einem klapprigen Geschirrschrank das Ölgemälde eines Adlers, der auf einem Vorsprung in einer senkrechten Felswand hockte. So ein Uraltschinken wie in den Trödelläden zu Hause, stark nachgefinstert, sodass die bösartigen gelben Augen des Adlers umso giftiger aus dem Dunkel hervorleuchteten. Lauernder Blick mit bedrohlich abwärtsgespitztem Schnabel.
Ihre Gabel mit dem Knödelstückchen kam Jolantha wie der Adlerschnabel vor. Und sie erinnerte sich wieder an den ekligen Blutfetzenjesus. Das Adlergemälde könnte derselbe Typ gemacht haben, ihrem Gefühl nach. Gut, es war nicht sehr wahrscheinlich, aber so kam’s ihr halt vor.
«Wusstest du, dass die Steinadler in den Alpen am liebsten Hauskatzen fressen?», fragte Valentin. Er hatte bemerkt, was sie anschaute.
«Bin satt», sagte sie und schob den halbvollen Knödelteller zu ihrer Mutter rüber. «Komm, Mäxchen, wir gehen raus an den See! Los!»
«Red mit ihm nicht immer wie mit einem Hündchen», sagte Valentin, aber Mäxchen hüpfte schon von der Bank.
Am Eingang schlüpften sie in ihre Bergschuhe. Sie ließ die Schnürsenkel offen, dann fühlten die Treter sich nicht ganz so klobig an. Mäxchen zog akkurat seine Kletten zu. Die Sonne war schon hinter den Bergen verschwunden, als die beiden Kinder zum See hinübergingen. Majestät der Berge, pah, und dann so was Unmajestätisches darin wie ihre Familie und sie. Und die Menschen überhaupt … Schon ziemliche Abendkälte in dieser Höhe. Mäxchen hatte nur sein rotes T-Shirt an, aber er schien nicht zu frieren.
Jolantha drückte ihm passenderweise ein rotes Bonbon in die Hand, Richtung Granatapfel. «Aber nur ablecken, klar? Nicht in den Mund stecken!»
«Fressen die wirklich Katzen?», fragte Mäxchen und leckte am Bonbon. Sie schaute ihn an und hätte fast gelächelt. Sein Gesicht war so niedlich, das Strubbelköpfchen mit Haarfransen bis über die Augen, weil er es nicht haben konnte, dass man ihm die Haare schneidet. Ihr Mäxchen hatte sie ja lieb wie sonst nichts auf der Welt. Na ja, meistens zumindest.
«Nein», antwortete sie. «Valentin hat Scheiße erzählt.»
«Man darf nicht Scheiße sagen!»
«Stimmt. Aber jedenfalls fressen die bestimmt keine Katzen.»
«Wer denn? Wer frisst keine Katzen?»
«Na, die Adler … Hier, quatsch nicht rum, werf lieber mal einen Stein ins Wasser.»
«Es heißt wirf.» Manchmal war es unerträglich, wie Mäxchen dem Vater alles nachplapperte!
Der See lag wie alles jetzt im Schatten, eine große dunkle Pfütze. Ein Loch in der Erde irgendwohin oder auch nach nirgendwo, jedenfalls ziemlich beunruhigend, fand Jolantha. Mäxchens Blick aber hing sorglos an den sich ausbreitenden Ringen, die von den ins Wasser plumpsenden Steinen ausgingen. Glucksendes Geräusch, wenn sie ins Wasser fielen. Sie aber stellte sich vor, wie es wohl dort war, wo die Steine hinsanken. Der See kam ihr hundert Meter tief vor. Obwohl er wahrscheinlich überhaupt nicht tief war, wahrscheinlich konnte man sogar in der Mitte noch stehen. Nur dass man in dem eiskalten Wasser längst erfroren wäre.
Sie wurde ein bisschen schwermütig, wie sie da so am See standen und das liebe, vertrauensvolle Kind Steine ins Wasser warf. Sie spürte eine Art Mitleid. Ein allgemeines, unspezielles Mitleid mit der ganzen Welt. Und ein spezielles mit dem kleinen Mäxchen, in dieser Riesigkeit und Dunkelheit um ihn herum. Stand da in seinem roten T-Shirt am See, der Kleine, in einer Hand das rote Bonbon, in der anderen den nächsten Stein.
In diesem Moment hörte sie wieder das Pfeifen.
Ein Pfiff, eine Pause, wieder ein Pfiff.
Es kam von dem Hang da drüben, auf der anderen Seite des Sees. Sie schaute hinüber, sah aber nichts. Dann ließ sie ihren Blick zu den schneebedeckten Gipfeln im Westen hinaufwandern. Logisch war das Westen: Wo die Sonne untergeht, da ist Westen. Und immer noch dieses Mitleid in ihr. Selbst die Berge taten ihr leid … dass die Welt solche Beulen und Ausbuchtungen hat, was versteckt sich dort? Mitleid und nun auch Unruhe. Das Ding «Berg» beunruhigte sie, wie der dunkle See.
Auch keine Raben mehr in den Lüften, obwohl das doch solche Abendviecher waren, die hatten sich wohl schon in die Heia verzogen.
«Du bist dran, Jolantha.» Mäxchen sah sie an. «Wirf.»
Aber ihr Blick hing an der Spitze eines Berges fest. Denn dort oben, nah am Gipfel, schienen noch ein paar Menschen unterwegs zu sein. Hatten die etwa gepfiffen? Aber von so weit weg war es nicht gekommen. Um diese Zeit dort oben? Wo es doch gleich dunkel wurde? Sie war allerdings nicht sicher, sie erkannte nur verschwommene Punkte. Kniff die Augen zusammen (hoffentlich brauchte sie keine Brille): doch, kein Zweifel. Da oben waren Menschen unterwegs. Drei oder vier Personen, vielleicht fünf. Schwer zu erkennen, aber doch.
Da wieder das Pfeifen. Auf einmal klang es noch näher.
«Jolantha!»
«Ja, ja … ich werf schon …»
«Was sind denn das für Tiere?», fragte Mäxchen.
«Welche?» Jolantha schaute ihn an, und er deutete auf die andere Seite des Sees.
«Da!»
«Wo?» Sie erkannte nichts. Kniff die Augen wieder zusammen, starrte hinüber, aber erkannte nicht, was er meinte. Doch eine Brille? Mäxchen wurde natürlich gleich wieder ärgerlich, wie immer, wenn jemand nicht sofort begriff, was er wollte.
«Da!», jaulte er auf, stampfte mit dem Füßchen, fuchtelte mit dem Zeigefinger.
Und wieder das Pfeifen. Genau aus der Richtung, in die er zeigte.
«Die Murmeltiere wollen noch nicht schlafen gehen», sagte da eine Stimme hinter ihnen. Jolantha drehte sich um und sah eine ältere Frau. So eine Bergschratin. Eine Irmgard, mit Abzeichen an der Jacke. Sie nickte ihnen zu. Lächelte sie an. Schmunzelte. Na ja, was soll’s, sie schien ganz nett.
«Oh, jetzt sind sie weg», sagte die Frau, die neben die Kinder getreten war. Sie lachte. «Wie putzig die sind, was? Wir haben sie wohl erschreckt.»
– Alter, was soll DAS jetzt wieder?
– Was?
– Na, der Zwerg da. Im roten Wams. Den braucht sie aber nicht mitzubringen. Den können wir nicht gebrauchen!
– Zwerg, Zwerg … Was soll das heißen, Bruder? Du bist selbst nicht der Größte.
– Du auch nicht.
– Stimmt.
– Jedenfalls, Alter, den Zwerg können wir echt nicht gebrauchen. So eine Heulboje, die hätte uns gerade noch gefehlt. Und diese alte Schabracke, die jetzt dazukommt, die auch nicht. Alle unbrauchbar. Wir brauchen nur sie.
– Geduld, Bruder, Geduld. Sie wird’s schon noch schnallen. Auch wenn sie anscheinend nicht die hellste Kerze auf der Torte ist …
– Trotzdem, Alter, wir brauchen sie.
Der Traum
Die Nacht wurde noch übler als befürchtet. Irr und wirr wird man, wenn man sich so herumwälzt. Immer hin und her auf der Matratze, ganz durchgeschwitzt wegen der feuchtwarmen Luft im Schlafsaal – und gleichzeitig furchtbar frieren, brrr. Ganz kalte Füße hatte sie. Und das alles in diesem verschissenen dünnen, ständig sich verdrehenden Hüttenschlafsack.
Am schlimmsten aber war das Gerassel und Geröchel im ganzen Raum. In Schnarchgewittern, schönen Dank, wer soll da ein Auge zutun. Sogar das Mäxchen (im Schlaf halb auf Jolanthas Matratze herübergerobbt) schnaufte sich einen ab. War ja ganz niedlich, dieser helle Atem, aber stören tat’s doch. Und erst die ganzen Schrate! Überall Japsen und Pusten! Grässlich! In einer Ecke schnarchte irgendjemand besonders arg, ein lautes flapperiges Grunzen, und manchmal klatschte darin irgendwas auf: etwa so, als würde eine Wasserbombe platzen oder ein faules Obst, das aus dem zehnten Stock auf die Straße fällt. An Schlaf war natürlich nicht zu denken. Keine Ahnung, wie die anderen hier eingeschlafen waren.
So muss sich Sterben auf einem Elefantenfriedhof anfühlen. Umgeben von verwesenden Dickhäutern. Und dabei selbst verwesen.
Schließlich setzte sie sich mit einem Ruck auf, schob Mäxchen zurück auf seine Matratze und gleich bis rüber an die andere Seite, wo ihre Mutter schlief. Sogar die schnarchte ein bisschen, ihre schöne Mutter. Alles ganz vorsichtig, dieses Mäxchenschieben, denn man sah ja in der Dunkelheit die Hand vor Augen nicht.
Dann rutschte sie vom Bett, griff mit beiden Händen ihre Matratze, schüttelte das Bettzeug runter und zog sie vom Gestell: Wupps, die war nicht so schwer. Sie drehte sich um, streckte die Hände rückwärts und zog die Matratze hinter sich her, während sie auf nackten Füßen zur Tür tapste. Weil es zappenduster war, ging sie ganz langsam, trotzdem stieß sie sich nach ein paar Schritten das Schienbein an einer scharfen Kante. Fluch! Das tat ja richtig weh.
Erst jetzt fiel ihr ein, dass sie ja eine Stirnlampe besaß. Sie legte die Matratze leise ab und tastete sich zurück zu ihrem Rucksack. Von den Wunderreflektoren natürlich nichts zu sehen im Dunkeln. Erst fummelte sie an einem fremden Rucksack herum, bevor sie ihren eigenen fand. Als sie die Lampe endlich entdeckt und eingeschaltet hatte, klatschte das scheußliche Flappergrunzen in der Ecke besonders laut auf; zum Glück wurde niemand wach.
Sie sah jetzt, dass sie sich ihr Schienbein an einem im Gang stehenden Hocker gestoßen hatte. Welcher Esel hatte denn den da hingestellt?!? Sie verfluchte Esel und Hocker, setzte sich die Stirnlampe auf und zog die Matratze hinaus in den Flur. Und weiter bis in den Waschraum. Dort war nämlich gegenüber den Waschbecken ausreichend Platz. Sie warf die Matratze hin und ging noch einmal in den Schlafsaal, um Decke und Kissen zu holen. Und diesen elenden Hüttenschlafsack.
Tschüss, scheußlicher Flappergrunzling, jetzt würde sie hoffentlich schlafen können. Wenigstens ein paar Stunden.
Aber so leicht ging’s dann doch nicht. Wenn man einmal den Einstieg in den Schlaf verpasst hat … stattdessen wieder nachdenken über die grundsätzliche Frage, wie man einschläft. Fast schon philosophisches Problem. Endlich stand sie auf, machte wieder die Stirnlampe um und schaute sich selbst im Spiegel über dem Waschbecken an. Da war sie also. Dieses große, schwierige Mädchen. Sie trug ein schwarzes T-Shirt, das sie immer für die Nacht anzog. Ihr Vater hatte dieses schwarze Shirt einmal von irgendeinem Opernfestival für sie mitgebracht, darauf standen in weißen, schon abblätternden Buchstaben Verse aus irgendeiner Oper, die sie nicht die Bohne interessierte, aber das Shirt mochte sie trotzdem:
Nie sollst du mich befragen,
Noch Wissens Sorge tragen,
Woher ich kam der Fahrt,
Noch wie mein Nam’ und Art!
Sie zuckte mit den Schultern, ihr Spiegelbild tat dasselbe, und dann verschwand ihr Spiegelbild ins Nichts, während sie selbst aufs Klo tapste. Barfuß. Ah, wie sie diese Löcher im Boden hasste … wie man da hocken und zielen musste … Als sie fertig war, wusch sie sich vor Ekel die Füße im Waschbecken, eisig. Und trank dieses eisige Wasser lang aus dem Hahn, weil sie auf einmal furchtbaren Durst hatte.
Erst als sie fertig war, fiel das Licht ihrer Stirnlampe auf ein Schild, auf dem stand:
ACHTUNG/ATTENZIONE
KEIN TRINKWASSER
ACQUA NON POTABILE
Scheiße.
Fluchte, und dann blickte sie auf und zuckte mit den Schultern. Da war wieder ihr Spiegelbild, es zuckte auch mit den Schultern. Würden sie schon nicht sterben, an diesem Wasser, sie und ihr Spiegelbild, und wenn doch, wer weiß, wozu es gut war. Sterben oder Weltberühmtwerden, zwei Möglichkeiten der Rache. Vielleicht würde ihre Familie um sie weinen und jammern, wenn sie stürbe. Sollten sie doch. Nur Mäxchen tat ihr leid. Na ja, und die anderen zumindest ein bisschen.
Verdammt, wieder dieses Mitleid …
Ihre Füße waren nach der panischen Kneippkur im Waschbecken erstklassig durchblutet. Weil sie das Gefühl hatte, jetzt überhaupt nicht mehr schlafen zu können, schaltete sie die Stirnlampe aus und ging zu dem kleinen Fenster am Ende des Waschraums. Sie musste sich auf Zehenspitzen stellen, um raussehen zu können. Draußen komplette Finsternis und eine Unendlichkeit von Sternen. Wow. Sie war nicht mehr sicher, ob die Hütte, in der sie sich befand, überhaupt noch auf festem Boden stand. Beinah kam’s ihr vor, als schwebte sie in einer verschissenen Kapsel durchs Weltall. Und so war’s ja irgendwie auch. Diese Erdkugel unter einem kann man sich leicht wegdenken, die ist nur ein unbedeutendes Anhängsel …
Und man schwebt also da, wo man gerade ist, irgendwie durchs All. In öden Schulstunden hatte sie manchmal schon ein ähnliches Gefühl gehabt. Allein im Weltall. Auf einem wackligen Stuhl oder, wie jetzt, auf den Zehenspitzen.
Und doch war ihr jetzt, als stünde ihr Spiegelbild neben ihr. Natürlich war es nicht zu sehen, in der Dunkelheit.
Nicht zu fassen, wie schwarz die Berge nachts sind. Quasi weg. Unerkennbar, wo Berge aufhören und Himmel anfängt.
Außer an den Sternen, natürlich. Die stehen am Himmel, und dort, wo nur mehr Schwarz ist, sind also Berge.
Da bemerkte sie ein matt und schwach glimmendes Lichtlein in der Gegend, wo Gipfel sein mussten. Dieses Licht gehörte nicht zu den Sternen. Obwohl man hätte glauben können, da wär ein Stern verlöschend vom Himmel gefallen und funzelte noch leicht vor sich hin, bevor er endgültig wegstarb.
Und sie fragte sich, ob das etwa bei den Wanderern war, die sie vorhin vom See aus noch dort oben gesehen hatte. Ein Lagerfeuer oder so was.
Sie öffnete das Fenster, um in die Nacht zu schauen und zu hören. Aber nix. Mucksmäuschenstill alles. Und kalt. Krasse Stummheit des Weltalls.
Auch kein Pfeifen.
Schließlich legte sie sich wieder hin … und irgendwann, einen winzigen Moment später und zugleich eine Ewigkeit: Da hatte sie einen Traum. Also musste sie wohl doch irgendwie eingeschlafen sein. Denn ein Tagtraum war’s nicht. Obwohl es so hell war hier, viel zu hell, kaum auszuhalten. Im gleißenden Sonnenlicht auf weißen Bergen kämpfte ein Murmeltier gegen einen großen Vogel. Was für ein Vogel, wusste sie nicht. Sein Gegner war auch nur so ein pelziges Etwas, aber es gab keinen Zweifel, dass das ein Murmeltier war. Man hätte denken sollen, dass ein lächerliches Murmeltier keine Chance hätte gegen einen großen Vogel, aber so war’s nicht. Es setzte sich ganz erstaunlich zur Wehr mit seinen putzigen, aber kräftigen zwei Nagezähnen und seinen kurzen, aber scharfen Krallen. Immer wieder stieß der große Vogel aus steiler Höhe auf das schon ordentlich zerzauste Murmeltier herab. Goldene Klauen hatte der Vogel, und Feuerflammen kamen aus seinem Schnabel. Aber das Murmeltier, bald auf seinen Hinterbeinen kauernd, bald schlagartig zur Seite springend, hielt dem übermächtigen Angreifer stand. Und mehr als das: Dem großen Vogel waren auch schon einige Federn ausgerupft; und nach einem weiteren Angriff waren Blutstropfen auf seiner Brust zu erkennen.
Unerbittlich war der Kampf, und es schien, als dauerte er schon ewig an und könnte ewig weitergehen. Aber je länger man dem Kampf zusah, desto stärker blendete einen die Sonne; bis es schien, als würde man blind vom Zusehen.
Schließlich verschwand der Vogel. Das erschöpfte Murmeltier aber blieb reglos auf dem Stein hocken, von dem aus es sich zuletzt verteidigt hatte. Und das war auch gut, denn nach langer Zeit tauchte der Vogel wieder auf und griff von neuem an. Noch goldglänzender seine Klauen jetzt, noch flammenzuckender sein Schnabel. Und noch schärfer die Gegenwehr des tapferen Murmeltiers.
Der Kampf spitzte sich zu, es schien nun doch auf eine Entscheidung hinauszulaufen. Aber welche, wusste man nicht. Die Sonne blendete, dass es schmerzte, weiß wurde einem vor Augen, ganz weiß …
Doch was war das? Ein Wasserfall? Der Kampf hatte völlig lautlos stattgefunden, kein Ton war zu hören gewesen. Nun rauschte jedoch auf einmal Wasser: ein mächtiger Gebirgsfluss oder so was, tobend, tosend … und zwar hoch über ihr, als öffneten sich alle Schleusen des Himmels, und die Welt würde jämmerlich ersaufen, Sintflut, schrecklich, entsetzlich …
Von wegen. Jolantha wandte den Kopf zur Seite. Zwei Schrate standen da an den Waschbecken und wuschen sich. Ein Mann und eine Frau, sie mit kreisender Zahnbürste im Mund und im Sport-BH, er mit schwabbeligem freiem Oberkörper, an den er sich eiskaltes Wasser klatschte.
Die Frau nahm die Zahnbürste aus dem Mund. «Guten Morgen», flüsterte sie. «Wir wollten dich nicht aufwecken. Schlaf mal ruhig weiter, kleine Maus, es ist ja erst fünf Uhr früh.»
Bis an den Rand der Welt
Ein Adler, kein Zweifel. Der große Vogel in ihrem Traum musste ein Adler gewesen sein. Jolantha begriff es, als sie – noch im schwarzen Nachtshirt mit den weißen Versen – beim Frühstück wieder den dunklen Ölschinken neben dem Schrank sah.
Sie nahm sich noch eine Semmel aus dem Brotkorb. Mit ihrer Mutter und Mäxchen war sie die Letzte in der Stube. Und, oh Wunder, es hatte an diesem Morgen mal nicht geknallt. Es war leerer gewesen als gestern Abend, die meisten rüstigen Schrate waren wohl schon zu ihren nächsten Etappen aufgebrochen. Ihre Familie war später zum Frühstück gekommen, da sahen sie noch die letzten Wanderer losziehen mit ihren Rucksäcken wie Sträflingsbuckeln. Der Vater war für seine Verhältnisse einigermaßen entspannt gewesen (man schlafe so herrlich tief und fest in dieser reinen Höhenluft, sagte er, und übrigens habe er wunderbar geträumt, wenn auch krauses Zeug). Sogar gelächelt hatte er und gleich nach dem Aufstehen Jolanthas Matratze aus dem Waschraum in den Schlafsaal zurückgetragen. Und am Frühstückstisch fast keine beleidigte Schnute gezogen, als die unwütende Jolantha ihm klargemacht hatte, dass sie selbstverständlich immer noch nicht mitwollte auf diese fabelhafte Bergtour. Sollten er und Valentin gern allein diesen Gipfel stürmen, bitte schön.
Und jetzt waren die beiden schon aufgebrochen, sie aber strich entspannt und leise vor sich hin murmelnd Honig auf die labbrige Semmelhälfte. So klein waren diese Honigpäckchen aus Plastik, dass sie eins für jede Hälfte brauchte. Gut, sie nahm ja immer viel Honig … während Mäxchen auf der Bank wieder Purzelbäume übte. «Kuck mal!», rief er immer wieder. «Kuck mal!»
«Bravo, aber pass immer schön auf», sagte die Mutter flüchtig lächelnd und las dabei weiter.
«Kuck mal, Jolantha!»
«Hmm. Toll. Mach weiter.»
Sie biss in die Semmel, von der der Honig tropfte, und erinnerte sich an ein Gespräch, das sie und ihr Vater vor einiger Zeit geführt hatten. Ebenfalls in einem friedlichen Moment. Das heißt, natürlich hatte auch da der Vater die meiste Zeit geredet. Vor dem Küchenfenster war der Frühlingsregen in den Hof gepladdert, und immerhin hatte der Vater ein paar Schokoladenkekse auf den Tisch gestellt, für lockere Atmosphäre. Erst sprach er über belanglose Sachen, ja er fragte sie sogar dies und das, was er sonst selten tat: nach der Schule und nach ihren Freundinnen. Und was sie denn eigentlich sonst so beschäftige. Allerdings, eine Sache kam noch seltener vor, als dass er etwas fragte: nämlich, dass sie Lust hatte, Fragen zu beantworten. Oder überhaupt auf Knopfdruck zu erzählen – so war das schon bei der Kindertherapeutin gewesen, zu der sie sie eine Zeitlang geschleppt hatten. Immerzu hatte sie der was erzählen sollen.
Dann noch lieber dieser Workshop für anstrengende Mädchen, in den sie sie letzte Osterferien gesteckt hatten. Der Kurs hieß in Wahrheit natürlich anders, aber so nannten ihn die Mädchen, die lustlos dabei waren. (Sie hatte ja schon einige Vereine durch, aber nichts länger als ein paar Wochen ertragen. Tanzen zuerst, dann ein Fußballverein und später Kinder-Taekwondo, das war eher so eine Art Gymnastik gewesen, Knie hoch zur Brust, höher, höher – ein Elend.) Dieser Oster-Workshop für anstrengende Mädchen war ein Kletterkurs gewesen oder tat so wie ein Kletterkurs, immerzu hatten sie Wände mit Knubbeln hochgesollt. Das war ihr überraschend leichtgefallen, da hatte die Trainerin sie Naturtalent genannt und sie gleich wieder in irgendeinen Verein stecken wollen – die Minischrate oder so was. Aber Vereine, nein danke.
Aber alles besser als diese Quatscherei. Und dann noch solche komischen Fragen jetzt vom Vater. Was sie beschäftigte? Wie soll ein Mensch das wissen, was ihn beschäftigt?
Hatte er also weiter selbst geredet, und irgendwann im Lauf des Gesprächs sagte er dann, sie müsse in ihrer lauten Stacheligkeit so etwas wie Barmherzigkeit lernen. Barmherzig sein, sagte er, gegen andere Menschen. Auch gegen ihre Familie. Ihre Brüder, ihre Mutter. Und sogar gegen ihn.
Noch so ein Wort. Irmgard, Schmalz, Barmherzigkeit. Ernsthaft hatte er dieses Wort benutzt. Der Regen hatte Schlieren übers Fenster gezogen, und jedes Mal, wenn sie seither irgendwo das Wort barmherzig hörte (in Religion hatten sie den barmherzigen Samariter), sah sie im Hintergrund des Wortes Regenschlieren über ein Fenster ziehen.
Und auch wenn ihr das alles wie albernes Gerede vorkam, ahnte sie, worauf er hinauswollte. So etwas wie: nicht ausflippen vor der Dummheit und Frechheit der anderen. Denn diese Dummheit und Frechheit der Menschen würde niemals aus ihrem Leben, aus der Welt verschwinden.
Aus dieser trüben bis finsteren Welt.
Na ja, dieses entspannte Gespräch war die Ausnahme gewesen. Ein andermal hatte der Vater in extra ruhigem Ton angefangen, von ihrer «drastischen, verletzenden Sprache» zu reden. Und daraufhin hatte sie – ebenfalls in extra ruhigem Ton – ihm geantwortet (denn er wollte doch Antworten): Wenn sie beispielsweise sage, er sei ein Dreck und solle sich aus ihrem Leben verpissen, dann sei der Grund dafür halt, dass er sich benehme wie ein Dreck, der sich aus ihrem Leben verpissen sollte.
Und irgendwie war dann alles wieder in einem Geschrei geendet. Dabei war sie überhaupt nicht auf Streit aus. Aber wenn jemand sie angriff, bitte sehr, dann sagte sie halt die Wahrheit. Sie wusste sich zu verteidigen. Und dann verselbständigte ihre Wut sich, und der Drache riss sich los.
Es kam ihr vor, als wäre sie das Murmeltier und der Vater der Adler. Oder der Adler, der sie angriff, war die ganze Welt.
Aber das Murmeltier hatte einen Drachen in sich.
Dein Kampfmodus. So nannte ihre Mutter das.
Sie schaute wieder das Adlergemälde in der Ecke an und dachte an den Traum in der Nacht. An den nicht endenden Kampf zwischen dem Adler und dem Murmeltier im gleißend hellen Licht. Sie überlegte, wer den Kampf am Ende wohl gewonnen hatte. Ob überhaupt einer gewonnen hatte. Und worum es eigentlich ging.
Und was hatte eigentlich sie dort gemacht? Wozu war sie dort gewesen? Zum Zuschauen?
Immer noch saß sie am Frühstückstisch, die Mutter und Mäxchen waren schon nach draußen gegangen. Allein in der Stube. Nur die liebe Hüttenwirtin mit den glänzenden dunklen Augen war noch mal kurz hereingekommen und hatte gesagt, sie könne ruhig so lang sitzen bleiben, wie sie Lust habe.
Allein. So ließ es sich fast aushalten in dieser Hütte.
Einmal ging sie ans Fenster der Stube und schaute hinaus. Schöner Tag draußen – was man so schöner Tag nennt. Sie stellte fest, dass die Fenster doppelt verglast waren und sich dadurch die Silhouette der Berge zweimal spiegelte: als existierte über oder hinter dem ersten Berg noch ein anderer. Er hatte genau den gleichen Umriss wie der erste, aber war nicht derselbe. Ein unselber. War ganz matt und lag etwas hinter dem ersten oder darüber oder davor, schwer zu sagen.
Später war sie allein im Waschraum und zog sich die Hose aus, um sich zu waschen. Da entdeckte sie eine lange, dunkelrote Schramme auf ihrem linken Schienbein – genau an der Stelle, an der sie schon zuvor eine kaum sichtbare Narbe gehabt hatte. Woher diese alte Narbe stammte, wusste sie nicht, sie befand sich an ihrem Bein, solange sie denken konnte. Vermutlich von irgendeinem Unfall als sehr kleines Kind. Aber jetzt leuchtete sie rot, und ein paar Tropfen vertrocknetes Blut waren darauf verschmiert.
Sie erinnerte sich, wie sie nachts im Dunkeln an den verschissenen Hocker gestoßen war. Dennoch kam es ihr jetzt vor, als stammte die Schramme von dem Adler, der sie, steil aus der Luft, angegriffen hatte. Der Gedanke verwirrte sie. Alles verwirrte sie gerade. Vorsichtig wusch sie das trockene Blut ab.
Den Vormittag vertrödelte sie. Plauderte ein bisschen mit der netten Hüttenwirtin, Marina hieß die, wie sie jetzt wusste. Marina schaute ihr T-Shirt an und las, etwas stockend, vor:
Nie sollst du mich befragen,
Noch Wissens Sorge tragen,
Woher ich kam der Fahrt,
Noch wie mein Nam’ und Art!
«Schön», sagte sie dann, lächelte und fragte sie, ob sie gern wanderte, Jolantha antwortete: «Geht so», und Marina lachte lieb.
Später kletterte sie allein auf großen Steinen herum. Singend und vor sich hin pfeifend. Schob sich immer mal ein Bonbon aus dem Hippiebeutel rein, ein rotes oder ein gelbes, Granatapfel oder Ananas. Setzte sich hinter die Hütte, wo die frisch gewaschene Wäsche an der Leine im Wind flatterte. Sie mochte diesen Geruch, wenn man sich hinter die Laken und Handtücher stellte und sich den Stoff ins Gesicht wehen ließ.
Eigentlich ging es hier. Wenn man sie nur in ihrem eigenen Takt durch den Tag treiben ließ. Jetzt konnte sie wieder atmen. Endlich wieder Zeit und Raum für sich. Sie schaute zu den Bergen hinauf, die hier draußen – natürlich – nur einen Umriss hatten. Sie waren rappelvoll von Ameisen, das mussten vergnügte Wanderer sein. Glückliche Bergfexe. Welche von diesen Krabblern dort oben mochten wohl Valentin und der Vater sein? Und ging irgendeine dieser fernen Ameisen sie mehr an als die anderen? Sie waren ja alle unbedeutend für sie.
Und in der Luft diese pechschwarzen Rabenviecher, die sich plötzlich fallen ließen und wie von einer Hand aufgefangen wurden. Dohlen waren das, jetzt wusste sie’s wieder, Marina hatte es erwähnt.
«Würdest du vielleicht lieber fliegen, statt zu wandern?», hatte Marina gefragt. «Wie die Dohlen. Stell dir vor, man könnte ihnen nachfliegen bis an den Rand der Welt.»
Rand der Welt, was sollte das sein, darüber dachte sie nach hinter der flatternden Wäsche und auf den Klettersteinen. Und dann, im nächsten Moment, war ihr wieder alles nervig und widrig. Sie dachte an ihr Zimmer zu Hause und an die Mall und die Schule. Na ja, an die Schule weniger. Wenn schon, dann an Kunigunde-Marie und Elif und Jacky. Aber mehr noch an ihre unsichtbaren Freundinnen, mit denen wechselte sie ein paar Worte, das ging auch von hier, und an ihre unsichtbare Zwillingsschwester.
Und an die Trübnis bis Finsterkeit der Welt dachte sie.