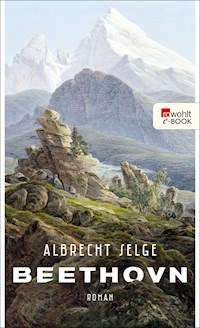
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo ist Beethoven, wer und warum? Wien, in den 1820er Jahren: Ein Student irrt, auf der Suche nach dem Schatten des Komponisten, durchs nächtliche Gassengewirr der Stadt. Eine lebens- und liebeslustige italienische Gräfin gerät in eine Streichquartett-Aufführung im «Wilden Mann». Der Neffe Karl van Beethoven folgt seinem Onkel so verängstigt wie scharfsinnig durch den Wienerwald. Und noch manch andere werfen ihre Blicke aus ungewohnten Winkeln auf den großen B.: seine mürrische Haushälterin; eine um ihre Gesundheit und einen letzten Rest von Glück ringende Prostituierte; der Geist einer flämischen Vorfahrin, die als Hexe verbrannt wurde; und natürlich auch jene geheimnisvolle «unsterbliche Geliebte», deren aufwühlende Lebensgeschichte sich hier wie nebenher entfaltet. Sie alle sind auf der Suche nach diesem fernen Mittelpunkt, dem vertrauten Fremden – und nach ihrem eigenen Leben. Aus dem, was sie finden, entsteht ein eigenwilliges Porträt: Bilder, so vielfältig wie die Schreibweisen seines Namens. Von Beethowen, Bethofn und vielen anderen erzählt Albrecht Selges Roman, stimmungsvoll und bizarr, manchmal todtraurig und immer wieder überraschend komisch. Eine spielerische, respektvolle Annäherung an einen Menschen und seine Musik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Albrecht Selge
Beethovn
Roman
Über dieses Buch
Wo ist Beethoven, wer und warum? Wien, in den 1820er Jahren: Ein Student irrt, auf der Suche nach dem Schatten des Komponisten, durchs nächtliche Gassengewirr der Stadt. Eine lebens- und liebeslustige italienische Gräfin gerät in eine Streichquartett-Aufführung im «Wilden Mann». Der Neffe Karl van Beethoven folgt seinem Onkel so verängstigt wie scharfsinnig durch den Wienerwald. Und noch manch andere werfen ihre Blicke aus ungewohnten Winkeln auf den großen B.: seine mürrische Haushälterin; eine um ihre Gesundheit und einen letzten Rest von Glück ringende Prostituierte; der Geist einer flämischen Vorfahrin, die als Hexe verbrannt wurde; und natürlich auch jene geheimnisvolle «unsterbliche Geliebte», deren aufwühlende Lebensgeschichte sich hier wie nebenher entfaltet.
Sie alle sind auf der Suche nach diesem fernen Mittelpunkt, dem vertrauten Fremden – und nach ihrem eigenen Leben. Aus dem, was sie finden, entsteht ein eigenwilliges Porträt: Bilder so vielfältig wie die Schreibweisen seines Namens. Von Beethowen, Bethofn und vielen anderen erzählt Albrecht Selges Roman, stimmungsvoll und bizarr, manchmal todtraurig und immer wieder überraschend komisch. Eine spielerische, respektvolle Annäherung an einen Menschen und seine Musik.
Vita
Albrecht Selge, geboren 1975 in Heidelberg, aufgewachsen in Westberlin, studierte Germanistik und Philosophie in Berlin und Wien. Sein erster, von der Presse begeistert aufgenommener Roman «Wach» (2011) wurde für den Alfred-Döblin-Preis nominiert und mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis des Harbour Front Literaturfestivals Hamburg ausgezeichnet. Zuletzt erschien der vielgelobte Roman «Fliegen». Albrecht Selge lebt als freier Autor und Musikkritiker mit seiner Familie in Berlin.
… wirklich Geschehenes und bloß Gedachtes nicht immer deutlich unterscheiden …
Franz Grillparzer, Erinnerungen an Beethoven
1822
Beethoven war nicht da.
Weder in einem der Häuser, die der junge Louis Schlösser, im Frühjahr aus Darmstadt gekommen, aufgesucht hatte. Er war, wenn es ihm seine Studien erlaubt hatten, über die breiten Alleen des Glacis mit ihren Linden, Pappeln, bettelnden Kindern hinaus in die Vorstädte gegangen, die ihm genannt worden waren: nach Alt-Lerchenfeld in ein ebenerdiges Haus Zu den zwei Wachsstöcken, wo ihm eine schwitzende, ihn nervös machende Frau gesagt hatte, Herr von Beethowen habe hier nur kurz gewohnt; ins Haus Zum schwarzen Adler in der Landstraßer Hauptstraße, den Ausläufer eines aufgehobenen Augustinerklosters, wo er, den in der Rocktasche steckenden Almanach Aglaja mit der herausgerissnen Seite auf dem Oberschenkel spürend, über die dunkle Hauptstiege in den zweiten Stock gegangen war, um dort vergeblich an der Türklingel zu ziehen; als er tags darauf wiedergekommen war, hatte ihm ein vielleicht vierzehnjähriger, rotköpfiger Knabe die Tür aufgerissen, der aber nichts von einem Bethofn wusste; und ins Schilde’sche Haus in der Windmühler Laimgrubengasse, wo die Hammerschläge eines Glockengießers aus offener Werkstatt gedröhnt hatten und er auf der dunklen, steilen Stiege schon geahnt, dass erneut ein Irrtum vorliegen musste; und er Bethowen in der Tat ebenfalls nicht angetroffen hatte. Das war schon im Herbst gewesen, den Sommer über hatte er nicht gesucht, weil es auf einer musikalischen Soirée geheißen hatte, der Meister verbringe die heiße Jahreszeit in Döbling (Ober oder Unter); oder er sei in Baden.
Noch in der Musikalienhandlung Steiner & Haslinger in der Paternostergasse, wo zur Mittagszeit zu suchen Schlösser von seinem Kompositionslehrer Seyfried geraten worden war; und Schlösser zwar nicht Beethoven gefunden, aber viel gelesen und zwischen den dunkelhölzernen Theken interessante Bekanntschaften geschlossen hatte, unter andern mit einem jungen, allseits beliebten Komponisten, dessen Namen er bereits hier und da erwähnt gefunden hatte, wenn auch niemals mit nachdrücklicher Betonung. Der wirkte naiv und tiefsinnig zugleich, ausgelassen und traurig, so als machte er auf frohe Weise Leichenbittermiene; und hoffte, wie er einmal sagte, als sie, bald vertraulich geworden, beim Wein zusammensaßen, von dem Schlösser nicht viel vertrug: was seine Kunst angehe, im Stillen wohl noch etwas aus sich selbst machen zu können. Beethoven habe er bei Steiner schon öfter gesehen, bestätigte er, und seinen Reden zugehört. Vor einigen Monaten habe er Beethoven einmal eine eigene, ihm gewidmete Komposition in dessen damalige Wohnung überbringen wollen, acht Variationen über ein französisches Lied für Pianoforte auf vier Hände; er habe sich jedoch nicht hineingetraut, sondern schließlich einen Freund vorgeschickt; und seither nichts mehr gehört.
Noch in der Mehlgrube am Neuen Markt zum Eck des Palais Schwarzenberg, die Schlösser gemeinsam mit dem dicken Ignaz Schuppanzigh aufsuchte, der gleich Kugelhupf und österreichischen Gebirgswein bestellte und beteuerte, normalerweise pflege Bethoven hier bei einer Tasse starkem Kaffee die Zeitungen zu lesen. Schlösser fand den berühmten Geiger Schuppanzigh gutmütig, gesellig und auf väterliche Art vornehm (mit seiner Manier, alle zu erzen) und überdies beileibe nicht so einfältig, wie ihm da und dort angedeutet worden war oder auch ins Gesicht gesagt; er fragte sich aber, ob ein unwissender Student wie er den Geist eines bedeutenden Mannes beurteilen könne. Große Geister machten ihn nervös, wie Frauen. Trotzdem sehnte er sich danach, Beethoven kennenzulernen. Schuppanzigh lud Schlösser, um ihn wegen der Enttäuschung über Beethovens Ausbleiben zu trösten, zum Essen ein, und Schlösser trank mehr, als ihm lieb war. Leider habe er Bethoven, wiederholte Schuppanzigh, schon seit längerem nicht mehr gesehen, was aber auch nicht zu verwundern sei, weil er, Schuppanzigh, die letzten Jahre immerfort auf Reisen verbracht habe, mit großem Gewinn, zuletzt in Russland, während Bethoven, allem guten Zuraten und allen Einladungen zum Trotz, ständig in Wien bleibe; jedenfalls stimme es nicht, dass Bethoven so rau und finster, unzugänglich und misstrauisch wäre, wie man Schlösser hier und da hatte weismachen wollen; und erst recht sei es, um das nochmals zu sagen, törichtes Gerede, dass der Meister ein Narr wäre oder seine Schöpferkraft versiegt; wie ja auch die neuen Klaviersonaten in E-Dur und As-Dur zeigten, wiewohl sie, sage man (er selbst sehe Klaviersachen nicht an), nicht leicht zu fassen seien; auch habe Bethoven erst vor kurzem bei der Wiedereröffnung des Henslerschen Josefstädter Theaters ein eigenes Werk dirigiert, die Weihe des Haußes (leider schändlich herabgeleiert vom Orchester); und er wisse auch sicher, dass Bethoven an einer großen Angelegenheit arbeite, und hoffe im Stillen, da er, Schuppanzigh, sich nun wieder in Wien niederlassen wolle, noch auf ein oder das andere Streichquartettchen (das letzte liege Jahre zurück, ein Quartetto serioso in f-Moll, ein widerspenstiges Stück, ebenfalls nicht leicht fasslich), und wäre es nur eine Kleinigkeit! – Dann setzte sich ein Bekannter Schuppanzighs zu ihnen, auch den erzte er, und da drehte sich Schlössers Kopf vom Gebirgswein und das Gespräch der andern beiden um gute alte Zeiten, den eitlen Grafen Rasumofsky etc., und um die Plage der Italiener, von der ganz Wien ergriffen sei; Rossini war gerade in der Stadt, dieser Sudler und Dudler, freilich nicht ohne Genie, aber ohne Geschmack etc. pp.
Schlösser, schwindlig und schläfrig, blickte sich im weiträumigen Kaffeehaus um und fragte sich, was ihm auffiel; denn etwas fiel ihm auf, er wusste bloß nicht was. Ein Herr in gelbgestreifter Hose las die Theaterzeitung. Einem, dessen Kopf in einer Qualmwolke verborgen schien, hatte ein eigentümlich verbogener Hund die Schnauze aufs Knie gelegt. Die türkischen Pfeifen der Raucher reichten auf den Boden wie Kontrafagotte. Eine Uhr in Gestalt eines goldenen Doppelkopfadlers hing mit pendelndem Bürzel an der Wand.
Dann begriff Schlösser, dass, was ihm auffiel, Stille und Lärm war. Es gab nichts dazwischen. Es wurde entweder gelärmt oder geflüstert; oder geschwiegen.
Aber Beethoven kam nicht, es war Schlösser, als ob ihn das Schicksal überall zum Besten haben wollte. Einen Moment lang dachte er, es gäbe Beethoven gar nicht, ein Phantom; dann fiel ihm all die Musik Beethovens ein, die in Darmstadt gespielt worden war, zumal das herrliche Es-Dur-Septett, das er so oft und gern gehört hatte. Schrieb ein Phantom denn Septette?
Am nächsten, bleifarbenen Tag lief Schlösser, den Kopf dick vom Gebirgswein des Vortags, wieder durch die drückenden Gassen der prächtigen Stadt. Im Oktober war der Nordwestföhn über die Stadt gefallen, zu warm und zu windig, man hatte den Staub des Kieselbodens auf der Brust gespürt; jetzt schien oft Nebel. Trotz der Enge war in dem halben Jahr, das er nun bereits in Wien zubrachte, das Herumgehen zu einer seiner Lieblingsbeschäftigungen geworden. Wo er eingeladen wurde, wem er begegnete, all das schrieb er täglich auf in seiner, erfreulich hellen, Wohnung im vierten Stock des Hôtels Erzherzog Carl; aber nicht, was er auf seinen Spaziergängen dachte und fühlte, und auch nicht alles, was er sah. Die erschreckenden, verlockenden unglücklichen Frauen etwa, die nirgends und überall waren. Die sehr nachdrückliche geheime und Straßen-Polizey. Obacht mit den Worten, hier haben die Wände Ohren. Kam er auf den Graben, atmete er Licht und trank Limonade. – Im Sommer war er wochenends öfter im Prater gewesen, dort gab es Weite. Bei schönem Wetter hatte er sich aufs Gras gesetzt und in der Aglaja gelesen. Es waren aus diesem Almanach, den er bald nach seiner Ankunft in Wien gekauft hatte, einige Seiten entfernt, einfach herausgerissen, er hatte es erst beim Lesen bemerkt. Mehrere seiner mitgebrachten Bücher hatte er bei der Polizei vorlegen und schließlich für die Dauer seines Aufenthalts deponieren müssen. Man kann doch nicht wissen –!, hatte der Beamte gesagt, ein freundlicher Mann, der Schlösser vorgekommen war wie ein helläugiger Finsterling.
Im Mai und zum Annentag, im Juli, war er bis zu den nächtlichen Kunst- und Feuerwerken im Prater geblieben, den Feuerdichtungen, wie sie ein schwarzäugiger, mit Worten malender Gymnasiast aus Kremsmünster nannte, den er dort kennengelernt hatte, dem Blumenspucken, den abbrennenden Phantasien, Raketen wie gellenden Tönen, die die Nachtluft durchschnitten. Himmlisch war das; denn bei aller funkelnden Pracht konnte es nicht die beruhigende Ordnung der Sterne durcheinanderbringen.
An manchen Sommertagen aber hatte es in der Stadt nach Fäulnis gerochen. Da war er einige Male, wie besinnungslos, übers vertrocknete Glacis statt in den Prater in irgendwelche unbekannten Vorstädte hinausgelaufen, wo Donauwasser aus Fässern verkauft wurde.
Nun, wieder im Innern, November, fürchtete er bereits sehr den Licht- und Luftmangel des kommenden Winters. Denn die innere Stadt kam ihm vor, als wären in ihr mehrere Städte übereinander gebaut; die Gassen kauerten unter den prunkvoll drohenden Fassaden, die einander zu nahe kamen, wie Schluchten. Und doch schienen ihm diese übereinander gebauten inneren Städte nur wie eine einzige Dimension einer unendlich größeren Stadt, die er sich in einem nicht recht greifbaren Sinne gefaltet dachte. Als Kind in Darmstadt hatte er sich solche riesenhaften, gefalteten Städte in einem märchenhaften China der Zukunft vorgestellt: als mehrere, aus Gegensätzen bestehende Städte, die ineinander lägen, aber nichts miteinander zu tun hätten, einander unsichtbar. Am Schabbat in der Synagoge, die spitzgieblig in der Ochsengasse stand, war er sich, bereits ein junger Mann, öfter wie um den Knick einer solchen Faltung vorgekommen. Dort oder wieder draußen auf der Straße hatte er vor sich hin gestarrt, als könnte man, wenn man nur lang genug starrte, mehrere Schichten der Welt erkennen, verschiedene Wirklichkeiten, die ineinander geschoben waren, aber nichts miteinander zu tun hatten. Menschen liefen einander über den Weg, ohne dass es einen für den andern gab: einer immerfort durch den andern hindurch.
Aber Wien schien doch säuberlich sortiert. Da war die aufgetürmte innere Stadt der Hofmenschen, der Beamten und Glücklichen, ringbewehrt, übers Glacis dann die Vorstädte, und dann jene Vororte, in die er nicht ging, vor denen hatte man ihn gewarnt. Die innere Stadt, die äußere Stadt und das dahinter. Man konnte hingehen und konnte es doch nicht. Aber was ihn verwirrte, war eben das Unsäuberliche: dass auch in den einzelnen Kreisen alle Schichten, alle Lüfte, alle verschiedenen Wirklichkeiten existierten, ineinander geschoben und zugleich einander unsichtbar. Es gab die unglücklichen Frauen und die Dürftigen und gab sie nicht. Sie waren nirgends und überall. Begegnete man dem Bettel, drückte man den Unsichtbaren etwas Geld in die Hand.
Realitätenbesitzer hatte er auf einem Grabstein draußen auf dem Währinger Friedhof gelesen; fragte sich, warum ein so bedeutender Mann wie Beethoven anscheinend kein Haus besaß, sondern zur Miete wohnte; wenn er denn irgendwo wohnte; und geisterte ihm das Wort Möglichkeitssinn durch den Kopf, den es geben müsste, wenn es Wirklichkeitssinn gab, und wenn Realitätenbesitzer, dann auch Eventualitätenbesitzer; aber das alles verwirrte ihn nur noch mehr.
Zur Sicherheit schaute er den Himmel über der Stadt an, in dem sich die Ordnung der Sterne tagsüber verbarg, ohne dass sie verloren wäre: der war sicher nur einer. Bleigrau noch immer, Sprühregen fiel ihm aufs Gesicht, kleine Feuerstiche auf seine Augen, und immer sah er die Oberkörper und Ränder der hohen Häuser in den Himmel ragen.
Er erinnerte sich an seine Anreise, die dumpfe Luft des Eilwagens während mehrerer Tage und Nächte, kein besonderes Vergnügen auch für einen jungen, am Anfang der Zwanziger stehenden Kunstbeflissenen, er hatte zu ersticken geglaubt. Der hessische Großherzog hatte ihn und seinen Freund, den Kunstmahler Wüst, der sich unterwegs mehrmals übergab, freigebig ausgestattet und Louis Spohr ihm Unterrichtszusagen des Geigers Mayseder und des Komponisten Seyfried, eines Mozartschülers, vermittelt; da sollte er also ein Mozartenkelschüler werden; aber wie viel lieber noch wäre er (trotz Spohrs Warnung vor dessen fortwährendem Trübsinn) ein Beethovenschüler geworden, ein Beethovensohn, hatte er, dämmrig geworden in der Eilwagen-Stickigkeit, phantasiert … ein natürlicher Sohn Beethovens … Es war April gewesen, das Wetter herrlich, als sie sich über die grüne Wiese der Stadt näherten. Auf einmal tauchten auf der grünen Wiese große Kästen auf, breite Kanäle und Fabriken; da waren die Felder und Wiesen verschwunden. Ein Mitreisender erklärte Schlösser und Wüst, die hohen Kästen seien Baumwollspinnereien. Als sie durch die Vorstädte kamen, sahen sie einige Klöster; aber sie erfuhren, dass es jetzt Seidenzeugmanufakturen seien.
Die Seide hatte Schlösser dann in den großen Wohnungen der engen inneren Stadt gefunden. Er besuchte Privatmusiken und Poetenversammlungen. Er hörte treffliche Quartette und Aufführungen in den Kirchen. Dort war nichts faulig, neblig, drückend. Kunst war Licht. Musik war Licht.
Doch nach dem gestrigen Fehlschlag mit der Mehlgrube fühlte Schlösser sich verdrossen. Im Nebel und Sprühregen kam ihm Wien noch giftiger vor als ohnedies. Wie er sich nun eben ganz dieser Niedergeschlagenheit überlassen wollte, las er zu seiner nicht geringen Freude an der Straßenecke für denselben Abend die Oper Fidelio angekündigt: im Kärnthnerthortheater, wo doch sonst, seit ein Neapolitaner es aus der Ferne regierte, fast nur noch Italienisches gespielt wurde. Das gab Schlösser einen kräftigen Ruck, so als risse es ihn zurück in die eine, unteilbare Wirklichkeit, die doch der Zweck seines hiesigen Aufenthalts war. Gleich eilte er zum Theater und erdrängelte sich noch eine Karte für einen anständigen Sperrsitz. Das unendliche Stündlein bis zum Beginn verbrachte er bald nervös, bald gemächlich auf und abgehend auf dem Vorplatz des Theaters, vor dem Kärnthner Tor, das aufs Glacis führte. Nun spürte er wieder den Sprühregen und begann zu frösteln, denn beim Hereilen zum Theater war er ins Schwitzen gekommen. Der Vorplatz war hell erleuchtet, dank Wiens neuer Gaslaternen. Die Abschaffung der Dunkelheit; wenn auch aus Gründen der Staatssicherheit, nicht der Vernunft. Mehr Licht! Schlösser freute sich darüber, zugleich kam ihm diese Illuminierung wie ein Eingriff in die Ordnung Gottes vor, ein Hofmeistern im Weltplan.
Wien hustete. Man sollte gar keine Konzerte im November mehr geben, dachte Schlösser. Der ranzige Geruch der Talgkerzen machte die Sache natürlich nicht besser. Und Schlösser bibberte jetzt wieder, nachdem die Wirkung der ersten, bloß scheinbaren Wärme im Saal sich verloren hatte. Erst hätte er sich seines Rocks entledigen, dann einen weiteren überziehen wollen, denn nun wars im Saal elend kalt, an den Zehen zumal. Durch die vielen Leute um Schlösser herum wurde es allmählich um weniges wärmer, aber um vieles stickiger; und der Qualm und Ruß der Kerzen, die zwischendurch immer wieder von Lichtputzern geschneuzt wurden, taten das ihre, so dass ihm wurde, als wär er um einen Knick herum in eine andere Wirklichkeit gelangt.
Und doch wars ihm egal, denn die Aufführung war, trotz der novembrigen Umstände und dreisten Hörstörungen, vortrefflich. Wilhelmine Schröder, dieser aufgehende Stern, sang die Partie der Leonore (ausgezeichnet), Haitzinger den Florestan (lobenswert), Forti den Pizarro (durch die geräuschvolle Instrumentierung mitunter incommodiert, doch feurig in den Hauptmomenten); allein ein junger Bariton namens Nestroy schien Schlösser, bei durchaus erkennbarer darstellerischer Begabung, den nötigen sittlichen Ernst vermissen zu lassen. – Bereits die Ouvertüre war repetiert worden. Alles an dieser schwung- und seelenvollen Musik schien Schlösser Ankündigung, Verheißung, Geheimnis; wenngleich die Bläser des Öfteren fehlten. Verheißung und Geheimnis war ihm auch ein himmlisches Quartett gleich zu Beginn, ein Kanon, der mit den Worten Mir ist so wunderbar begann und in dem dann jede Stimme einen andern Text sang, so dass der Sinn aller, zwar hellklaren und deutlichen, Worte sich in Dunkel auflöste, eine Art Lichtnacht; noch nie hatte er dergleichen gehört, ihm schwirrte der Kopf, die Menschen waren Himmelskörper, die sich in unendlich ferner Harmonie umeinander drehen. – Im weiteren Verlauf hatte freilich der erste Akt mit seiner ernüchternden Kleinhäuslichkeit, Rechnungsdurchsicht etc. Schlössers Begeisterung doch ein wenig erkalten lassen, er war sogar, die stickige Luft mochte dazu beigetragen haben, kurz eingeschlafen; als er wieder aufwachte, fühlte er sich jedoch erquickt, und merkwürdig, gleich darauf hatte er bereits ganz vergessen, dass er geschlafen hatte. Denn wie ein elektrisches Fluidum durchzuckten nun die vibrierenden Töne der Sänger und Instrumentalisten das in allen Räumen vollbesetzte Haus! Das Knarzen der Bässe im Graben und die ideale Tiefe dieser Seelenthöne! Junge Männer weinten vor Entzücken! Niemals glaubte Schlösser einen ähnlichen Jubelsturm des Beifalls erlebt zu haben! Noch trunken vor Entzücken über die Finalhymne, das Hohelied der Gattenliebe, stand er unbeweglich da, kaum bemerkend, dass die Anwesenden bereits das Haus verließen.
Da belferte ihn ein Logenschließer an. Feierabend, der Herr!
Erschrocken eilte Schlösser ins Foyer, wo er sah, wie zu gleicher Zeit drei Herren aus dem Korridor der Parterrelogen traten, von denen der mittlere Arm in Arm mit den beiden andern ging. Und da machte sich im Menschengedränge eine gewisse Bewegung bemerkbar, die Leute zogen sich zur Seite, um den Dreien Raum zu geben. Schlösser sah sie, wenige Schritte entfernt, nur von der Rückseite und konnte nichts Auffallendes an ihnen wahrnehmen. In diesem Moment klopfte ihm jemand ganz leise auf die Schulter, er drehte sich um: und erkannte den fröhlichen Leichenbitterfranz, seinen Freund.
DAS ist Beethoven, und er deutete mit dem Finger auf die drei.
In eben dem Augenblick drehte einer der Köpfe sich herum, der mittlere, der auf breitschulteriger, gedrungener Gestalt saß, der flammende Lampenschein beleuchtete hell das Gesicht; und obwohl Schlösser die Züge durch Stiche und Bilder wohlbekannt waren und er keineswegs erwartet hatte, den Weltgeist auf Erden zu erblicken – wollte er vor Überraschung oder Entsetzen laut aufschreien, denn das dunkle Antlitz im Flackerlicht kam ihm vor wie das Gesicht eines wilden Mannes, eines Nordamerikaners, pockennarbig, durchlöchert.
Schon hatten die drei das Haus verlassen. Schlösser verabschiedete sich hastig vom Freund und beeilte sich, seinen Mantel auszulösen und auf den Vorplatz zu gelangen. O welche Lust, in freier Luft … das Nieseln hatte aufgehört. Die Theaterbesucher verliefen sich schon, und er sah im beinah taghellen Licht der Gaslaternen, wie die drei Männer nach rechts ums Eck des Hauses verschwanden.
Kurzentschlossen ging er ihnen nach, wie ein Schatten.
Die drei Männer bogen bald nach dem Theater in eine kleine Gasse ein, die nur von einigen Laternen mit Talglichtern an den Hauswänden erhellt und so nahezu schummrig war; denn die neuen Gaslaternen standen erst an einigen wenigen, wichtigen Straßen und Plätzen. Schlösser blieb in sicherem Abstand zu den dreien. Der Weg führte durch winkelige Straßen und an hochgegiebelten Häusern vorbei. Nur gelegentlich kreuzte ein später Spaziergänger den Weg. Zwischen zwei Palais stand eine mittelalterliche Kirche, die kam Schlösser besonders dunkel und finster vor. Mehrmals verlor er die Umrisse der drei Männer aus den Augen, aber bald darauf entdeckte er sie wieder. Ein andermal blieben die drei im Licht einer Laterne stehen; doch der gedrungene Mittlere, mit zerzaustem Haar, drehte sich nicht noch einmal um, Schlösser sah ihn nur von hinten, aus etwa zwanzig oder dreißig Metern Entfernung. Dafür konnte er nun die beiden Äußeren genauer erkennen: Sie waren größer als der in der Mitte; der Ältere, rechts, hielt sich beim Mittleren locker eingehakt, während der Jüngere, links, sich an- und einzuschmiegen schien, es hatte etwas Aufdringliches. Beide waren von auffällig aufrechter Haltung; der Rechte sah aus wie ein großer Geist, der Linke wie eine Hopfenstange, er hatte etwas Griesgrämiges.
Schlösser war die Lage jetzt peinlich; er wäre gern zu den dreien gegangen und hätte sie angesprochen, oder genau genommen den Einen, aber es kam ihm ungehörig vor; und er hätte ja, nach dem, was man erzählte, wohl auch lauthals schreien müssen, um sich dem Tauben verständlich zu machen, und das schien ihm zu dieser nächtlichen Stunde ganz und gar unmöglich.
Schließlich gingen die drei weiter, Schlösser setzte die Beschattung fort. Die Gassen der Stadt schienen jetzt völlig verlassen, die Laternen verloschen allmählich, und Schlösser kam sich wie im Dickicht eines Urwalds vor, wie ein Wilder, der andere Wilde verfolgt – mit dem Ziel ihrer Skalpe –, ihre Spur nicht zu verlieren trachtet – und er blickte hinauf über die Wipfel der Palais und sah, dass der Mond hervortrat zwischen der Bewölkung, die doch so bleiern und undurchdringlich gewesen war. Und in eben diesem Moment wars ihm plötzlich, als würde er selbst beschattet und verfolgt. Zuerst dachte er, es wär ein Tier des Urwalds. Er drehte sich um, konnte aber keins und niemand entdecken; fürchtete dennoch um die Kehle oder den eigenen Skalp; die Wände haben Augen und Ohren, wir sind belauscht mit Ohr und Blick, er stützte sich mit einer Hand an die Mauer eines Gebäudes, nahm sie gleich wieder weg. Und fröstelte wieder, wie er jetzt erst spürte, denn sein Mantel war zu dünn für lange Wanderungen in der vorwinterlichen Nacht. Auch hatte er Hunger. In der Rocktasche unter dem Mantel spürte er die Aglaja mit der herausgerissnen Seite wie einen Ziegel oder Tomahawk.
Als er sich endlich beruhigt hatte und umschaute, waren die drei Männer verschwunden.
Schlösser lief noch eine ganze Weile suchend herum, freilich besorgt, was er antworten sollte, wenn jemand ihn zur Rede stellte, die Polizei, oder auch irgendeine Unglückliche ihn anspräche; einmal meinte er, irgendwo jemandes Schritte zu hören, vielleicht der drei, aber es war nur das Echo seiner eigenen. Er fand Beethoven und die Begleiter nicht wieder. In einer Gasse führte eine Stiege nach unten, die ging er hinab und lief weiter. Dabei sann er dem Fidelio nach. Dass dessen Erfolg ein schwerer Schlag für die italienische Mode sei. Der tragische Gedanke, dass der Komponist sein Werk wohl nur im Geiste hatte hören können, wühlte ihn auf. Ob Beethoven wirklich nur noch Kleinigkeiten schreiben würde, wie einige behaupteten, Streichquartette und Klaviersachen? Wiewohl die natürlich keine Kleinigkeiten waren, jedoch … woran er wohl gerade schrieb? Ob er noch eine Oper komponieren würde?
Aber wer könnte ein Buch schreiben, so hoch, dass es Beethovens würdig wäre?
Goethe, antwortete es in Schlösser, nur Goethe. Ach, würde Beethoven den Faust komponieren. Oder gar einer der großen Toten – Homer, Schiller, Shakespeare? Klopstock?
Aber müsste Beethoven – Beethoven! nicht viel mehr als bloß eine weitere Oper schreiben? Eine Art Über-Oper? Alles in Einem? Stattdessen … Kleinigkeiten, durfte das sein? War es überhaupt so? Durfte es?
Erschöpft und durchgefroren, wollte Schlösser endlich nach Hause gehen. Dazu musste er zur Kärnthner Straße zurück; aber die war, verloren im Schluchtengewirr der aufgetürmten Städte, nicht zu finden. Auch kam es Schlösser jetzt erneut vor, als würde ihn wer beschatten, oder was. Ein Wilder, ein Tier. Und allmählich spürte er ein Grummeln unter den Füßen, ein leichtes Beben. Das Hausen der Riesen unter der Erde, dachte er, Gog und Magog. Von denen hatte ihm ein junger Wiener Maler erzählt, den er und sein Freund, Wüst der Kunstmahler, neugierig nach St. Stephan begleitet hatten, um dort die Predigten des fanatischen Zacharias Werner, einstigen Schicksalsdichters, zu hören. Woher denn der Name Riesentor stamme, hatte Schlösser den Wiener Maler gefragt, und der hatte geantwortet, man habe beim Bau von St. Stephan, in dunkler, unwissender Zeit, an der Stelle des Tors riesige Knochen gefunden und für die Überreste biblischer Riesen gehalten.
Heute wusste man es natürlich besser. Cuvier hatte die Menschen von Eiszeiten und Mammuts und Fellnashörnern gelehrt, von Paläontologie. Der eifernde Zacharias Werner auf der Kanzel aber, hatte Schlösser gedacht, der glaubte wohl noch an Gog und Magog. Oder wieder. Weil ers wollte.
Und nun bebte die Gasse unter Schlössers Füßen; als donnerte ein langer, langer Eilwagen, voller eingezwängter Menschen, dumpf und stickig, unter der Stadt entlang. Schlösser sah zwischen den Wänden zum Himmel hoch, es war ganz aufgeklärt: Nun endlich waren Sterne zu sehen, die Ordnung der Sterne, und der Mond leuchtete mit ungehinderter Kraft; überhell aber schien der Himmel, so als könnte es der Menschheit einst gelingen, den Äther selbst zu beleuchten: nicht bloß von Farben zerschnitten wie durch die Feuerdichtungen im sommerlichen Prater, sondern in seiner Gänze illuminiert. Am Ende könnte der Mensch gar die Sterne in Unordnung bringen. – Bis in die Gasse mit ihren verloschenen Kerzen herab gelangte freilich nur wenig vom Mondlicht. Schließlich aber kam Schlösser auf den Graben, von wo der Weg nach Hause leicht zu finden war. Hier war nun so viel Licht, dass Schlösser selbst heller zu werden meinte; er betrachtete staunend seine Hände, die ihm grau schienen, weiß … bröselig … uralt … und ich hatte doch gehofft, zitterte Schlösser, die Erde unter ihm immer noch bebend, oder sogar sicher geglaubt, ich würde noch fünfzig oder sechzig oder gar siebzig Jahre leben. Da war er schon durchsichtig.
1823
Beethoven schlief.
Nebenan, im andern Zimmer. Hinter dieser Tür, die sie mit der luftigen Hand berührt. Sie spürt das Holz, winzige Wimmerln in der, ihr unbekannten, Anstrichfarbe, ist ja kein Palais hier mit blasenlos schleiflackierten Türen, nur eine Vorstadtwohnung im zweiten Stock. Die Farbe der Tür würde wohl auch eine andere jetzt nicht erkennen, es muss Nacht sein. Ihr aber ist die verschlossene Tür kein Hindernis, wenn sie hinein will. Von Zeit zu Zeit seh ich den Jungen gern. Aber kann ihn ja nicht sehen: der beißende Schmerz, wenn sie zu sehen versucht. Aber doch bei ihm sein, in Dunkelheit. ICHBINWASDAIST.
Sie, sein hilfloser Schatten.
Die nicht schläft, niemals.
Denn wer so viel erlitten hat, wie soll die je wieder schlafen können? Überlitten. Ihr von innen zerschnittener Hals, ihre verbrannten Augen. Klar, dass das wach hält. Ungehindert fließt der Kreis innerer Harmonien: doch nie um sie, niemals in ihr. Sie ist ja in immer dauernder Dunkelheit unterwegs, in immer dauernder Mittagsnacht. Immer dauern ist anders als ewig, ewig und unendlich ekeln sie. Alles ist jetzt. Nur nicht die Zukunft: Die kennt Josijne nicht. Sonst aber ist alles da, alles bleibt in ihr, sie vergisst nichts. Und wenn sie auch längst kein volles Menschempfinden mehr hat, so hat sie doch nicht keine Empfindungen. Ein Zwischenbereich, der auch ein bisschen körperlich ist. Kann zwar nicht sehen, aber riechen, schmecken, tasten, all das geht als Geist; und vor allem hören. Und geht durch diese dunkle Welt, wie es ihr einfällt, die Welt ist dunkler Raum und dunkle Zeit. Sie pfeift auf alles Ewige, auch auf die ewige Ruhe. Denn so, wie sich das ewige Glück wohl abnutzen würde und darum das Paradies, welches auch immer, nicht erstrebenswert ist, so nützt auch das ewige Unglück sich ab und ist darum nicht ganz so fürchterlich, wie die Lebenden es sich ausmalen in ihren Höllenbildern, oder besser: ausmalten, denn das Denken an Jenseitse scheint im Lauf der letzten zwei Jahrhunderte arg an Wert verloren zu haben, wie die Gulden und Dukaten während der jüngsten Kriege. Und für sie ist schon gar nichts mehr gemalt. Dafür hat sie manche Sprache gelernt im Lauf der Jahrhunderte und manches andere, und jede Menge gehört: Musik und Vögel. An den windigen Rhein geht sie manchmal, wo sie Weite spürt, die sie nicht sieht. An die muffige Wien und spürt da Enge, die sie nicht sieht. Manchmal auch, aber bloß nicht zu oft, an die kleine Dijle, auf die Wiesen am Elstervelt, wo sie einmal eine Bäuerin war, wohlhabend und angesehen; bis ein gewisser Spoelberch es abgesehen hatte auf sie (oder eigentlich auf ihren Wohlstand). Und geht auch an viele, viele andre Orte – niemals aber nach Brüssel. Niemals auf den schrecklichen Großen Markt, wo sie Egmond enthaupten und wo sie die arme Josyne verbrennen, eine Frau schon am Rand zum Alter, eine Großmutter auf dem Scheiterhaufen, ein herzzerreißender Anblick muss sie gewesen sein, Jozijne van Vasselaer, Josijne, sogar Françoise einmal genannt, in einem Akt über einen Landkauf. Sie. Wer bist du? Verheiratete van Beethoven. Mutter von vier Kindern, die leben, und einigen, die gleich gestorben sind. Urururururgroßmutter Ludwigs des Sechsten. Eine Linie über sechs Punkte verbindet sie mit diesem einen, der hinter der verschlossenen Wimmerln-Tür schläft. Und zahllose Linien verbinden sie mit anderen Punkten. Sie kennt all die Verwandtschaften und Orte, weiß nicht woher, es ist wie mit den weiten Wegen durch die dunkle Welt, die Dinge scheinen zu ihr zu kommen, seit sie nicht mehr lebt; aber nur bestimmte Dinge, ein Teil-Allwissen, sie begreift es nicht und hat längst aufgehört, es begreifen zu wollen. Was aber für sie zählt, ist jeder einzelne Punkt im großen Liniengewirr: das gestorbene Kleinkind ebenso wie der in Öl eingelegte Mann, ihr Urururenkel, Ludwig der Zweite, der Großvater, den sein Enkel Ludwig der Sechste nach





























