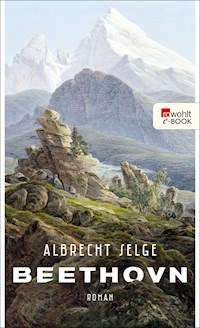19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Abschiede, Neuanfänge, Geheimnisse: ein Mensch in der Mitte seines Lebens oder schon darüber hinaus. Während sein Vater im Sterben liegt, suchen er und seine Frau noch einmal unbeschrittene Wege, nicht nur in der Liebe. Ihre nicht mehr kleinen Kinder entfernen sich zusehends, müssen dabei um ihr eigenes gefährdetes Glück ringen. Alle Menschen sind hier einander unlösbare Rätsel und doch zugleich tief verbunden. Und Rätsel bleiben sie auch sich selbst. Was bleibt vom Gewesenen, wo wollen wir hin? In immer neuen Varianten und Anläufen umkreist «Silence» die einfachen und doch größten Fragen des Lebens. Der Erzähler sehnt sich nach der Schönheit der Stille und fürchtet sich vor dem Verstummen, vor dem Sturz ins endgültige Schweigen. Reisen führen ihn nach Bonn, Prag, Brüssel oder Teheran, zu einer Eremitin und ins eigene Innere, in magisch scheinende Vergangenheiten und in lustvolle Abgründe. Ein Roman voller Trauer und voller Hoffnung, voller Musik, Sehnsucht und Liebe, auch immer wieder von bizarrer Komik – dicht, gedankenscharf, persönlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Ähnliche
Albrecht Selge
Silence
Roman
Über dieses Buch
Abschiede, Neuanfänge, Geheimnisse: ein Mensch in der Mitte seines Lebens oder schon darüber hinaus. Während sein Vater im Sterben liegt, suchen er und seine Frau noch einmal unbeschrittene Wege, nicht nur in der Liebe. Ihre nicht mehr kleinen Kinder entfernen sich zusehends, müssen dabei um ihr eigenes gefährdetes Glück ringen. Alle Menschen sind hier einander unlösbare Rätsel und doch zugleich tief verbunden. Und Rätsel bleiben sie auch sich selbst. Was bleibt vom Gewesenen, wo wollen wir hin? In immer neuen Varianten und Anläufen umkreist «Silence» die einfachen und doch größten Fragen des Lebens. Der Erzähler sehnt sich nach der Schönheit der Stille und fürchtet sich vor dem Verstummen, vor dem Sturz ins endgültige Schweigen. Reisen führen ihn nach Bonn, Prag, Brüssel oder Teheran, zu einer Eremitin und ins eigene Innere, in magisch scheinende Vergangenheiten und in lustvolle Abgründe. Ein Roman voller Trauer und voller Hoffnung, voller Musik, Sehnsucht und Liebe, auch immer wieder von bizarrer Komik – dicht, gedankenscharf, persönlich.
Vita
Albrecht Selge, geboren 1975 in Heidelberg, studierte Germanistik und Philosophie in Berlin und Wien. Sein begeistert aufgenommenes Debüt «Wach» (2011) wurde für den Alfred-Döblin-Preis nominiert und mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis des Harbour Front Literaturfestivals Hamburg ausgezeichnet. Die folgenden Romane «Die trunkene Fahrt» (2016), «Fliegen» (2019) und «Beethovn» (2020) wurden nicht weniger gelobt. 2022 erschien sein Jugendroman «Luyánta – Das Jahr in der Unselben Welt». Albrecht Selge lebt als freier Autor und Musikkritiker mit seiner Familie in Berlin.
Impressum
Dieser Roman entstand mit Unterstützung durch das Ferdinande-Boxberger-Stipendium.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung © Gerhard Richter 2023 (0169)
ISBN 978-3-644-02002-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Ich danke allen Menschen, die in diesem Buch vorkommen
(auch wenn in der Wirklichkeit alles anders ist
[aber nur ein klein bisschen])
wobei ‹wirklich› nur eine andere Unwirklichkeit bezeichnet, eine weniger zufällige, besser gerüstete Unwirklichkeit
(Roberto Bolaño, Lumpenroman)
Der Karthager
Ich saß nachts im Wald, da hatte ich eine konfuse Vision. Vom Tag verbrannt, jedenfalls in der Höhe zu viel Sonne abbekommen, obwohl L mich noch gewarnt hatte (ich höre immer zu wenig auf sie), wir hatten, während die Kinder mit ihrer Tante ins Freibad gefahren waren, zu zweit eine Bergtour gemacht, und unsere Blicke waren über die atemberaubende Schönheit von Bergen und Tälern geschweift und immer wieder auch über Hänge voll abgestorbener Fichten, getötet vom Borkenkäfer, die Baumkadaver standen wie ein Schattenkriegerheer von Giacometti, gespenstischer Anblick. Dafür war dort oben außer viel Sonne auch jede Menge Ruhe gewesen, nur einzelne Vögel und fernes Brummen von Bienen oder Flugzeugen, sacht rauschende Stille, in der das Vorbeiflirren einer Fliege zum Ereignis wird. Jetzt schliefen die müdegeschwommenen, schlappgetobten Kinder bereits im Hotel (oder sie daddelten noch auf ihren Handys, wer weiß), um mich aber war ringsum Dunkelheit. Stockfinsternis, nur über den ahnbaren Wipfeln die Sterne. Wir sahen sie, weil wir auf einer schwarzen Lichtung saßen, L und ich mit zwei Freunden, in einem Rondell aus Steinen. Es war fast still, kein Tier zu hören, nur das eigene Atmen und gelegentlich ein Hauch Sommernachtwind, und etwas unter uns plätscherte leise der unsichtbare Gebirgsbach, an dem entlang wir vom Gasthaus hierherauf gelaufen waren. Man hätte die Welt für heil halten können. Die Taschenlampen auf unseren Mobiltelefonen, mit denen wir uns den Pfad durch den Wald beleuchtet hatten, waren lang wieder ausgeschaltet. Niemand sprach. Mir war, als flöge ein schwarzer Falter im Gebüsch, lautlos. Und auf einmal fühlte ich mich merkwürdig verbunden mit einem mir unbekannten Menschen, der irgendwann genau hier gesessen hatte. Nicht im Steinrondell, natürlich, nicht auf dieser Lichtung an diesem Pfad, die es beide damals nicht gegeben hatte, sondern einfach in diesem Wald (der ebenfalls ganz anders gewesen sein wird, vor langer Zeit – das war egal).
Naheliegend war natürlich ein Bauer oder ein Knecht. Aber ich dachte an einen römischen oder, besser noch, einen karthagischen Soldaten, der mit Hannibals Heer die Alpen überquert hatte (wenn auch gewiss nicht über den Brenner – auch das war egal). Der Karthager hatte hier gesessen, oder gehockt, umgeben von wildfremder Ferne. Darüber war ich in diesem Moment vollkommen sicher. Es gab gar keinen Zweifel. Der Wald war geheimnisvoller und gleichgültiger als der heutige, vielleicht war auch das Lagern des Karthagers hier ohne ein Feuer nicht denkbar. Es gab ja Wölfe, Bären, Ungeheuer. War er auf Posten, auf Kundschaft? Oder versprengt, abgehauen, gar ein entlaufener Sklave? Auch das egal. Ich bin der Wiedergänger oder Wiedersitzer dieses Karthagers, des anderen Schattenkriegers. Was ist damals wohl in seinem Kopf herumgegangen? Ob er spürte, in ebendiesem Moment, dass ich – jemand – da sein würde, irgendwann in der fernen Zukunft? Einer, der an ihn denken wird, genau an ihn?
Gemeinsam hören wir ins All, ins Nichts.
Was um alles in der Welt machen wir hier?
Ich wusste schon, ein vernünftiger Mensch würde allerlei Einwände erheben, vielleicht: dass der Karthager, der vermutlich überhaupt kein «Karthager» war, sondern ein Söldner Hannibals von Gott weiß woher, Numider oder Iberer oder Kelte, sich mehr oder weniger geborgen gewusst habe in einer mythisch geordneten Welt, zumindest eingeordnet in ihr, dergleichen halt. Die Sterne waren bekanntlich für einen Menschen der Antike etwas vollkommen anderes als für einen heutigen Menschen. Ist das so? Und wenn schon. In meiner konfusen Vision sitzt der Karthager einfach ratlos da, wie ich, ein verlorener Tropf. Im Gebüsch derselbe lautlose schwarze Falter. – Dann riss das nächtliche Taldurchdröhnen eines Motorrads mich aus dieser Verbindung. Selbst um diese Uhrzeit? Die Motorisierung ist die Pest des Alpenraums in der Sommerzeit (eigentlich auch in der Winterzeit und überhaupt nicht nur des Alpenraums). Der Falter war fort. Und ich fragte mich, was wohl der Karthager, dessen Knochen irgendwo hier in den Bergen liegen mögen, sein Tod war vermutlich ein qualvoller Graus, wie der eines in freier Wildbahn erbeuteten Tiers: was der von unserer eigenartigen Zeit dächte, der Schattenzeit weit nach ihm.
Das Kind hockte im Schneidersitz in seiner Kammer, die sich in der Luft befindet, nur manchmal durchbrach es die ewige Dunkelheit der Kammer mit seiner Taschenlampe, deren Licht über die mysteriösen Wände wanderte. Lang blieb das Kind dort oben sitzen, so lang, bis die Zeit es verloren hat.
Die Geräusche der Vögel gehören für mich quasi zur Stille. Das fiel mir bei einem Spaziergang durch den Tiergarten auf. Und auch, dass ich das Wort «Singen» nicht mag, das der Mensch taktlos den Singvögeln überzustülpen versucht. Auch all die lyrischen Verben scheinen mir verkehrt, mit denen er die Geräusche der Vögel nachdichten will: zwitschern, tschilpen, tirilieren oder trillern und piepen. Meine Gedanken streiften Olivier Messiaens Vogelstimmenkompositionen, die ich immer fürchterlich anstrengend fand, kaum je hat sich mir ihr Reiz oder gar Zauber erschlossen, und streiften die Birdnet-App zur Vogelbestimmung, streiften den lustigen Familiennamen Kleiber der großen Dirigenten Erich und Carlos.
Eilig überholte ich einen Lastkahn, der langsam auf der Spree fuhr, als triebe er bloß stromab. (Aber wo ist bei der Spree schon stromab und wo stromauf? Sie scheint beinah zu stehen, und im Süden, Richtung Spreewald, so war einmal in der Zeitung zu lesen, fließe sie bisweilen sogar rückwärts.) Bald hatte ich den Lärm und auch das beißende Stinken des lästigen Kahns, das Halskratzen und Augenjucken verursacht, in meinem Rücken, wie eine durchquerte Wand. Zuerst war ich erleichtert. Dann fiel mir ein, dass es in einem Roman von Terry Pratchett der TOD ist, der durch Wände gehen kann, und dass sein junger Helfer daran, dass er unversehens eine Wand durchquert hat, erkennt, dass er selbst zum TOD wird.
Der großglasige Berliner Hauptbahnhof in einiger Entfernung, die Backsteinmauern zu meiner Rechten über einem Grashang: das Einzige, was fest ist auf dieser weitläufigen und unsicheren Welt. All das Lockere aber, all das Lose dazwischen muss sich vorsehen, damit es nicht von der Erdkugel fällt, auch ich, den Riemen der leichten Reisetasche über der Schulter.
Da näherte sich ein Krach in meinem Rücken. Gleichzeitig rollte mir von vorn ein wuschelköpfiges Kind entgegen, es saß mit angewinkelten Knien im von der Mutter geschobenen Buggy und presste sich die Ohren zu. Auch seine Ellenbogen standen spitz ab, wie die Knie, fast verärgert wirkte das wuschlig-spitze Kind über diesen auf es zukommenden Krach, ja empört. Die Mutter ihrerseits schien ein wenig zu beschleunigen, wohl um ihr Kind möglichst schnell daran vorbeizuschieben (und damit zufällig auch an mir).
Das BSR-Reinigungsmobil auf der Fahrbahn, das diesen Krach machte, kam heran, schon war es laut saugend und brausend auf meiner Höhe, ein putziges Kastenauto, dem man so ein Inferno gar nicht zugetraut hätte. Das Kind hatte ganz recht, seine Hände auf die Ohren zu pressen und empört zu sein. Tut man das als Erwachsener, wirkt man gleich wie ein Nervenbündel, bedauernswertes Psychowrack, geschlossne Abteilung in Sicht. Noch ehe das Kind und ich uns auf gleicher Höhe befanden, bog ich also rechts ab, ein fliehender Esel, leider nicht Tauber im Gras, den Minihang hinauf und durch ein Tor in der Backsteinmauer. Dahinter liegt ein Park, der einmal ein Gefängnis war, erst preußisches Zuchthaus, später Folter- und Mordstätte der Nazis. Nach dem Krieg hatte man darüber hinweg jahrzehntelang eine Autobahn geplant, in den unermüdlichen Bemühungen, unsere Städte in Vorhöllen zu verwandeln. Zum Glück wurde diese Autobahn hier niemals gebaut, aber das in den letzten Jahren neu entstandene Viertel um den Berliner Hauptbahnhof ist trotzdem eine elende Automobilgrotte geworden. (Ich muss nur ein wenig aufpassen, was und wie ich wahrnehme und denke und sage, ich bin ständig von Autos derart genervt, dass bei diesem Thema in meiner Familie schon alle die Ohren verdrehen, gleichsam als wäre ich ein Auto und sie wären ich.) – Die Gefängnismauer um den Park ist immer noch hoch. Aber auch über sie hinweg war der Krach des Putzautos zu hören, leiser als draußen natürlich, dennoch unangenehm laut und bald, paradoxerweise, sogar deutlicher als zuvor: Denn nun lärmte es nicht mehr mit und in dem sonstigen Autoverkehrsrauschen, sondern darüber hinweg im Park. Einem eigentlich ganz hübschen Park, wenn auch etwas überkonzeptioniert und nun schon einigermaßen heruntergekommen. Denn hier lagern ja nicht nur die mannigfaltigen Gedenk- und Bauverweise auf die Vergangenheit (angedeutete Zellen, nachgebildete Hofgangwege und so weiter), sondern auch jede Nacht Menschen mit ihrer Notdurft. Obdachlose, wie es mit einem dieser Wörter heißt, die wie Kapseln sind, weil nur in ihnen ein sonst kaum mehr gebräuchlicher Begriff überdauert: Obdach. Was vielleicht tatsächlich zu metaphorisch klingt, metaphysisch gar, weshalb heute stattdessen aus gutem Grund von Wohnungslosengesprochen wird, metafrei nackt physisch und phorisch; ein bisschen schade ist es trotzdem um das Wort, wie um die Lehrlinge, die in den nüchternen Auszubildenden oder Azubis verschwunden sind, oder die von den administrativen Kindertagesstätten oder Kitas verdrängten wundersam-blühenden Kindergärten. (Aber natürlich sind das alles Nebenempfindlichkeiten und Kleinsttraurigkeiten im Vergleich mit den viel größeren, wichtigeren Angelegenheiten der Welt. Ob das Dach über dem Kopf und die Heizung im Winter sich nun Obdach oder Wohnung schimpft und die Kinderbetreuung Garten oder Tagesstätte, ist ja belanglos für diejenigen, die das nicht haben.)
Aber all diese Wahrnehmungen und Gedanken lösten sich von mir, und einen Augenblick lang fühlte ich mich innerhalb dieser hohen Mauern sicher davor, von der Erdkugel zu fallen.
Merkwürdigerweise, denn sie sind ja oben offen, diese Mauern.
Während ich an ihrer Innenseite entlangging in Richtung Südausgang (ich wollte zum Hauptbahnhof, um den Zug nach Bonn zu nehmen zu einer mich interessierenden August-Macke-Ausstellung), vernahm ich auf einmal ein Flüstern. Es kam nicht wie der Putzautolärm über die Mauern hinweg, sondern aus ihnen heraus. Lange rätseln musste ich nicht, mir fiel sofort ein, dass es hier eine Gedenkinstallation gab, Sonette von Albrecht Haushofer, dem musikalischen Geographen, den die Nazis an diesem Ort eingesperrt hatten, wie viele andere, bis sie ihn noch in den letzten Kriegstagen ermordeten. Gibt es, und gab es schon damals, etwas Altmodischeres als Sonette? Gerade darum rühren sie einen ja, mit ihrem disziplinierten Formwollen im Angesicht von Verbrechen und Grauen. Im Flüstern aber löst die Form sich wieder in einzelne Verse auf, Sätze, Wörter: Von allem Leid, das diesen Bau erfüllt … ein Hauch lebendig, ein geheimes Zittern
Neben der allgemeinen Hochachtung empfand ich in diesem Moment auch eine ganz private Wertschätzung für Albrecht Haushofer, fast peinlich zu sagen: weil er denselben Vornamen trägt wie ich und den Nachnamen einer meiner liebsten Schriftstellerinnen. Kurz kam es mir vor, als hätte Marlen Haushofer mich geheiratet. Keine angenehme Vorstellung, um ehrlich zu sein, denn ich kann mir keine gelungene Ehe mit der abgrundtief ehrlichen Haushofer vorstellen. Mit mir, einem anstrengenden Menschen, wahrscheinlich auch nicht; trotzdem bin ich ja schön (ob glücklich, weiß ich nicht) verheiratet. Schön verheiratet, der Ausdruck gefiel mir.
Dann schüttelte ich den Kopf, ich dachte, durch die Stadt zu laufen ist ein ständiges Davonlaufen vor Lärm, auch dem Lärm der eigenen wirren Einfälle, dem Gelärm des Gedankengedärms. Eine Herausforderung, vielleicht auch bloß Eselei, sich nach Stille zu sehnen, wenn man im Zentrum einer Großstadt wohnt und darin eine Familie mit drei Kindern hat. Die feststehenden Mauern aber, Lautsprecherinstallation hin oder her, schweigen einen an, sprachlos und kalt; und ich, in der Hälfte des Lebens oder schon darüber hinaus, ging weiter. Gleich fuhr der Zug nach Bonn, in der kleinen Tasche über meiner Schulter habe ich die nötigsten Dinge: ein Buch, ein Wasserfläschchen, Noise-Cancelling-Kopfhörer, Ohropax.
Nichts zu sagen
Durchatmen, wenn morgens in der Wohnung (die ich schwerlich Obdach nennen würde) Ruhe eingekehrt ist. Oder besser gesagt, die Unruhe ausgekehrt, sobald nämlich das letzte Kind die Wohnung verlassen hat. Am Frühstückstisch sind drei Arten von Unruhe zu erleben, die später, am Abend, wiederkehren werden: Der sechzehnjährige Sohn schweigt und brummt bereits wie ein Erwachsener. Die dreizehnjährige Tochter brüllt immer wieder aus übervoller Seele und zieht sich wütend in ihr Zimmer zurück, das ihre Festung ist, ihr Bunker (oder Labyrinth). Der sechsjährige Sohn plappert stets munter, beinah ohne Pause.
L ist dann schon vom Frühstückstisch aufgestanden und aus dem Haus, um zur Arbeit zu radeln. Zuvor hat sie jedem Kind noch einen Kuss gegeben: Der Große erwidert ihn pflichtgemäß (was keineswegs lieblos bedeutet); ebenso, nur widerwilliger die Tochter (wenn sie sich nicht gerade in Zorn und vielleicht auch Angst im Zimmer verbarrikadiert hat), gelegentlich allerdings schenkt sie sogar impulsiv die intensivsten Umarmungen und würde in so einem Moment anscheinend am liebsten nie wieder loslassen; der Kleine aber erledigt den Kuss und wischt sich danach rasch die Wange ab (er hat Wichtigeres zu tun).
Alles zusammengerechnet, hat sich das frühere blanke, schrille Kinderlärmen in ein allgemeineres, dumpferes Grollen verwandelt, das Grollen des Großseins, das allerdings der nachgekommene Kleine mit seiner fröhlichen Art ein wenig aufhellt. Ich sehne mich dann oft nach dem ZIMMER, das ich seit langem besitze, oder das mich besitzt; nur fürchte ich manchmal, es ganz verloren zu haben oder von ihm verloren worden zu sein. Dann jedoch finde ich es immer wieder, findet es mich, unvorhergesehen, auf unklare Weise. Es geschieht.
Das Grollen hängt nach der Auskehr der Unruhe noch eine Zeitlang in der Luft, auch wenn es die Wohnung physisch verlassen hat, so wie einem früher die Ohren noch klingelten vom hohen Krach. Wie schnell sie groß werden, haben einem alle gesagt, es ist ja einer dieser Lieblingssätze älterer Menschen, überhaupt: wie schnell doch alles gegangen sei. Man will es nicht hören, und hörte man zu, was wollte man mit dieser Erkenntnis schon anfangen? Wenn man es schließlich am eigenen Leben erfährt, bleibt es ja doch unbegreiflich, wie der Tod.
Auch die eingekehrte Ruhe ist manchmal, als hätte man eine durchquerte Wand hinter sich, man wird bald misstrauisch und stellt sich die unbehagliche Frage, worein man sich als so ein Wanddurchquerer zu verwandeln im Begriff sein könnte. «Fremde Kostgänger» nennt die Erzählerin in Marlen Haushofers Wand ihre großgewordenen Kinder. Es ist, wie alles bei ihr, von erdrückender Wahrhaftigkeit; selbst wenn es sich um alles in allem freundliche Gäste handelt. Die soziale Welt, in der sie sich außerhalb der Familie bewegen, Freunde und Gefüge, ist wichtiger als die Eltern, verständlicherweise. Dagegen steht noch die scheinbar absolute Vertrautheit des kleineren Kindes, das in Wahrheit ja ebenso fremd ist; selbst weiß es das noch nicht, aber ahnt es vielleicht manchmal bereits. Sollte man die verwegene oder auch bloß einfältige Idee gehabt haben, sich durch Kinder in der weitläufigen, unsicheren Welt zu verankern oder das Vergehen der Zeit irgendwie erträglicher zu machen, gar der Zeit zu entrinnen: So machen die Kinder einem ihr Vergehen nur umso härter klar.
Und sie leben ja nicht für dich. Es ist nicht ihr Fehler, wenn du unglücklich bleibst. Es ist doch nicht ihre Aufgabe, ihre Eltern glücklich zu machen.
Warum nur, frage ich mich manchmal, verdunkle ich alles? Woher dieser Schwärzzwang, das Zwangsschwarz? Man sollte wohl besser, solange die Kinder klein sind, das Leben in farbenreichen Paradiesbildern malen, wie der Bonner August Macke es mit seiner Familie tat. In einem Leuchten, dessen Kraft nicht auszulöschen ist. Aber die Begabung zur Freude muss einem nun auch gegeben sein (und selbst dann würde sie einen nicht daran hindern, beispielsweise jung totgeschossen zu werden, wie es Macke 1914 erging: als Freiwilliger ins Feld gezogen, einige Wochen lang entsetzt von den Schrecken und der «namenlosen Traurigkeit» des Krieges, schließlich getötet; das hübsche Haus aber, in dem sein idyllischer Familiengarten lag, befindet sich heute im Würgeeck einer vielbefahrenen Kreuzung, einer dieser Ausgeburten der Auto-Ideologie, die das Zerstörungswerk des Krieges fortgesetzt haben). Man bräuchte das Vermögen der Harmoniefähigkeit mit anderen und mit sich selbst, auch wenn geheime Traurigkeiten darunter schlummern mögen, in geronnenem Zustand. Dass diese Traurigkeiten jederzeit wieder rinnen könnten, stachelt vielleicht die Freude erst an. «Gut gelogene Natur», schrieb Macke über sein Kunstwollen, und es wäre doch wohl gut, ein bisschen Rhythmus und Farbflächen ins eigene Leben zu bringen.
Gut gelogene Natur. Und doch, auch bei Macke zeigen die Kinder (selbst wenn es nichts bewusst Abweisendes zu haben scheint) dem Betrachtenden ihre Rücken, man seufzt, man gehört nicht in ihre Welt. Oder ein großes dunkles Tier liegt unauffällig im Vordergrund, der Familienhund, gewiss keineswegs unfreundlich, aber doch irgendwie ein Schatten des Bedrohlichen. Oder das spielende Kind und die gärtnernde Mutter sind im, vielleicht ja auch freundlichen, Schatten.
Das Glück bleibt immer eine Fremde. Alle unsere Kinder sind wohlgeraten, keine Frage, wir können uns nicht über sie beschweren und wollen es auch gar nicht. Ich öffnete das Fenster und schaute den beiden Jungs nach, manchmal nimmt der Große jetzt den Kleinen auf dem Gepäckträger mit und setzt ihn vor der Grundschule ab. An einigen Tagen halten sie an der Ecke kurz an, wenden sich um und schauen zum Fenster herauf, und der Kleine winkt mir dann zu, gelegentlich auch der Große. Es ist ein guter, herzwärmender Anblick, wie sie da halten und winken und dann um die Ecke davonrollen, Elftklässler und Erstklässler. – Als sie fort waren (vorbei auch am blauen Kia, unserem peinlichen Familienauto, das wir immer noch nicht abgeschafft haben, obwohl die Kinder diesen Beitrag zur Weltrettung fordern und auch die Eltern es loswerden wollen), roch ich einen Moment in den Morgen, diese Berliner Mischung aus Frühling und Abgasen. Ich machte den Mund auf, um den Frühling tief einzuatmen, gleichzeitig wollte ich mich verschließen vor der Luftverschmutzung. Ich fürchte, dieser doppelte, widersprüchliche Impuls entspricht meinem Verhältnis zum Leben überhaupt. Im Frühling komme ich mir manchmal fehl am Platz vor, so wie ich mir in meiner Jugend oft fehl am Platz vorkam. Vielleicht ist aber schon der Schritt vom oft zum manchmal einer nach vorn. Oder ein Rückschritt, je nachdem, wie man das Leben betrachtet. – Dann warf ich noch einen Blick auf die nun einsame Straßenecke, schloss das Fenster und ging in die Küche, um den Frühstückstisch aufzuräumen.
Die eben verlassene Küche ist ein unheimlicher Ort. Die Teller, benutzt, stehen noch da. Hier Ordnung zu schaffen ist an guten Tagen minimaldosierte Meditation. Allein geblieben, weitet sich die Perspektive, ich musste an meine schon vor einigen Jahren gestorbene Mutter denken: Sie, glaube ich, empfand das auch gelegentlich so, minimalmeditativ, aber aufs Leben lang war die Küche für sie doch eher Plantage, Gefängnis. Ein sinnloses Zuchthaus, aus dem es niemals ein besserer Mensch herausschaffen wird, nur ein geschaffter. Als Kind aber, das an die Mutter glaubt, verspürte ich Geborgenheit, wenn ich fest zugedeckt im Bett lag und aus der Küche das leise Geschirrklappern vernahm. Als Vater stehe ich selbst in der Küche und höre schließlich das leise, weiche Rattern der Spülmaschine, dieser segensreichen Erfindung, und denke, es klingt wie das Rieseln des Sands in den Lebensuhren in Terry Pratchetts Gevatter Tod. (Ich lese derart konfus, dass es zum Schämen ist, morgens Trakl, abends Pratchett, in schlaflosen Nächten Haushofer oder alles umgekehrt.) Beim Gedanken an Pratchetts Lebensuhren – am Ende des Romans wird eine einzige, im Moment des allerletzten Sandkorns, kurzerhand umgedreht – muss ich lächeln. Außerhalb der Scheibenwelt, in unserer albernen Kugelwelt, aus deren Weitläufigkeit und Unsicherheit man jederzeit zu fallen droht, werden bekanntlich nur in den allerseltensten Fällen Lebensuhren noch einmal umgedreht. Und mein einsames Lächeln in der Küche ist die Art Galgenlächeln, bei dem ich mir nie sicher bin, ob es die Dinge nun leichter macht oder schwerer.
Mir fiel ein Gemälde von Joan Miró ein, das ich einmal in der Fondation Beyeler in Basel gesehen hatte, vor tiefem Blau vereint sich eine verrinnende Sanduhr mit der Gestalt eines Antennenmenschen und zugleich (das Auge eine aufgesteckte Limette) eines Cocktailglases, das eindeutig eher halbleer als halbvoll ist. (Abgesehen davon, erkenne ich auch eine Vulva im Bild; aber das mag nicht am Bild, sondern an mir liegen.) Wieder öffnete ich ein Fenster, diesmal zum Hof, der sich immerhin auf einer Seite öffnet in ein wohltuendes Band von Grün mit einigen Baumwipfeln. Irgendwo aus dem frischen Laub tönte, als wolle es sich übers sanfte Rattern des Geschirrspülers legen, das Rufen einer Türkentaube: hu-huu-hù! hu-huu-hù! hu-huu-hù! Minimalistische patterns. Jetzt stülpe ich selbst den Vögeln Musik über, merkte ich. Das Rufmuster erinnerte mich an Fensterblicke und den Garten meiner Kindheit, ein Grundgeräusch der Vergangenheit. Dass es eine Türkentaube war, hatte ich allerdings erst viel später herausgefunden, mit Hilfe der Vogelstimmen-App. Ich selbst kann so gut wie keine Vögel erkennen (die Verrücktheit bei diesen überbeschreibenden amerikanischen Autoren, wo noch der letzte Hinz-und-Kunz-Erzähler jedweden Zilpzalp, Pirol oder Grauen Fliegenschnäpper am Gesang identifizieren kann!). Die Türkentaube, mittels Birdnet identifiziert, höre ich gern. Eigentümlich, dass sie mir viel feiner vorkommt als die garstige, gewiss auch verleumdete gemeine Straßentaube mit ihrem höfedurchwogenden Schwellton, der aus dem und durch den Hals kommt, nicht aus dem Schnabel; wenn die im Frühling auf den Fensterbrettern flatternd kopuliert, vergeht einem als Mensch alle Lust auf Geschlechtsverkehr. (Mir jedenfalls. L hat eigentlich immer Lust. Darum ist es auch gut, dass sie ihren verlässlichen St hat, einen sympathischen Menschen und funktionablen Liebhaber.)
Während ich mit dem Ohr an den patterns der Türkentaube hing und wider besseres Wissen darauf wartete, dass sie sich allmählich kunstvoll zu verschieben begännen wie bei Steve Reich, kam plötzlich aus einer anderen Richtung ein neues pattern