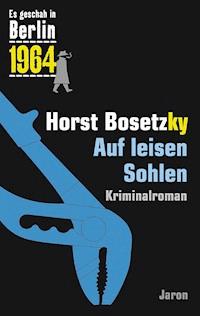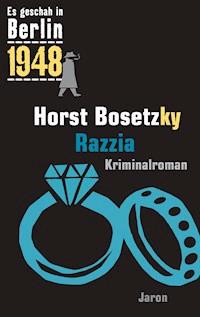Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vergangenheitsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ferdinand Schmidt galt im alten Preußen des 19. Jahrhunderts als umtriebiger "Volkspädagoge" und einflussreicher Schriftsteller. Zumindest letzteres meinte Schmidt von seiner Wenigkeit glauben zu dürfen. Die zeitgenössische Literaturkritik war sich da nicht immer einig, aber darüber konnte man großzügig hinwegsehen, denn wer durfte sich schon anmaßen, die Qualität Schmidtscher Gedanken und Formulierkunst wirklich in voller Größe bewerten zu können? Allenthalben bekannt geworden ist er mit seinem opulenten Werk der "Preußischen Vaterlandskunde für Schule und Haus", erschienen in Breslau 1846. Der schmale Ruhm drohte bereits zu verblassen, als er sich fiebernd seinem neuen Projekt zuwandte: eine Berlinische Geschichte anhand der Biografien zugewanderter Persönlichkeiten, in deren Mittelpunkt der Apotheker und Fabrikant chemisch-pharmazeutischer Präparate Ernst Schering steht (* 31. Mai 1824 in Prenzlau; † 27. Dezember 1889 in Berlin). Schering galt Schmidt als Schlüsselfigur und bewundernswertes Beispiel für den Aufstieg der preußischen Hauptstadt als politische Kraft, aber auch als Zentrum von Industrie und Wissenschaft. Entstanden ist ein ebenso auf- wie anregendes Stück literarischen "Histotainments", der Vermengung von historischer Information mit Unterhaltung. Eine Zeitreise zurück ins Berlin des 19. Jahrhunderts, in dem auch viel geliebt und gelitten wurde. Ein Kaleidoskop des alten Berlin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Mach dein Glück! Geh nach Berlin!
Dokumentarischer Roman über Ernst Schering
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-86408-236-8
Coverabbildung: Schering Archiv, Bayer AG (Porträt Schering); Eduard Gärtner, Berlin, Opernhaus und Unter den Linden, 1845, (gemeinfrei) (Hintergrund)
© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2017
www.vergangenheitsverlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Die besten Gardebataillone der Menschheit sind die Toten, die, biographisch wiederbelebt, unter uns wandeln.
Theodor Fontane
Ein Bilderbuch scheint alles, was vergangen
Joseph von Eichendorff
Prolog
Am Anfang stand die Alchemie
1889
Ernst Schering war ein großer Name in Berlin. Jeder kannte den Königlichen Kommerzienrat und seine „Chemische Fabrik auf Actien“ im Wedding an der Müllerstraße. Als am 27. Dezember 1889 bekannt wurde, dass Schering soeben verstorben war, griffen viele Männer zur Feder, um einen Nachruf auf ihn zu verfassen, so auch der Schriftsteller und Volkspädagoge Ferdinand Schmidt. Dessen Erinnerungen gingen um mehr als fünf Jahrzehnte zurück ...
1837
Das Kloster Neuzelle war im Jahre 1268 vom sächsischen Markgrafen Heinrich dem Erlauchten gegründet worden, um einmal seiner verstorbenen Ehefrau Agnes zu gedenken und um zum anderen den von den polnischen Piasten erworbenen Landstrich zwischen Oder und Schlaube wirtschaftlich besser zu erschließen. Zwischen 1300 und 1330 entstand auf einem Bergsporn, der in die Oderniederung ragte, eine prächtige dreischiffige Hallenkirche. Nach einer wechselvollen Geschichte kam die sächsische Niederlausitz 1814/15 als Folge des Wiener Kongresses an Preußen und wurde von Friedrich Wilhelm III. säkularisiert. Im Waisenhaus des Klosters wurde ein Lehrerseminar eingerichtet.
Hier nun verbrachte Ferdinand Schmidt entscheidende Jahre seiner Jugend. Er war am 2. Oktober 1816 in Frankfurt an der Oder auf die Welt gekommen und hatte seine Jugend im Klosterort Neuzelle verbracht, wo sein Vater die Stelle eines Kornschreibers innehatte. Früh hatte er sich als Pädagoge versucht und war schon im Alter von nur 15 Jahren in einer nahen Oberförsterei als Hauslehrer engagiert geworden. Nach dem Tode seines Vaters hatte er in sein Elternhaus zurückkehren müssen, nun aber besuchte er das evangelische Lehrerseminar, um staatlich anerkannte Lehrkraft zu werden. „Volkspädagoge, das steckt mir so im Blut“, pflegte er zu sagen, doch irgendwie wollte er auch als Schriftsteller reüssieren.
An diesem Vormittag nun galt es, ein Referat über die ebenso unheimliche wie faszinierende Alchemie und die berühmtesten Alchemisten zu halten. Er begann mit schwankender und etwas zu hoher Stimme, wurde dann aber zunehmend sicherer.
„Das Wort Alchemie leitet sich wohl vom Arabischen al-kīmiyā ab, und schon seit Jahrtausenden üben die Alchemie und die Alchemisten eine erhebliche Faszination auf uns alle aus. Gemeinhin wird angenommen, dass es das einzige Ziel der Alchemisten gewesen sei, aus unedlen Stoffen Gold zu machen – Gold, das schon in der babylonischen Philosophie als das Metall der Erlösung gegolten hat. Für diese Umwandlung, auch Transmutation genannt, brauchte man eine besondere Tinktur – das war der berühmte Stein der Weisen.“ Er machte eine Pause, um sich die Lippen zu befeuchten. „Heute würden wir sagen, die Alchemisten seien allesamt Irrwege gegangen und gehörten ins Irrenhaus, aber ihnen verdanken wir die Erfindung des Porzellans, des Bologneser Leuchtsteins und des Schwarzpulvers, jedenfalls was Europa betrifft. Der berühmteste Alchemist in unseren Breiten war wohl Markgraf Johann von Brandenburg, der von 1406 bis 1464 gelebt hat, aber auch unserem Prinzen Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen sagt man diesbezügliche Neigungen nach.“ Jetzt holte er weit aus und kam auf die philosophische Dimension der Alchemie zu sprechen, was aber seine Zuhörer nicht sonderlich interessierte. „In unseren Tagen“, so schloss er nach etwa einer halben Stunde unter dem Gelächter seiner Zuhörer, „sind die Apotheker und die Chemiker an die Stelle der Alchemisten getreten.“
Einige Tage nach diesem Vortrag unternahm das Lehrerseminar einen Ausflug ins uckermärkische Prenzlau. Unten am Ufer der Oder lagen zwei Boote bereit, und auf denen ging es bis nach Schwedt, wo auf Pferdewagen umzusteigen war.
Ihr Mentor war die ganze Zeit über damit beschäftigt, ihre Allgemeinbildung zu verbessern.
„Nennt mir berühmte Männer und Frauen, die in Prenzlau das Licht der Welt erblickt haben?“
„Keinen und Niemand“, kam es aus den hinteren Reihen.
„Doch!“ rief der Mentor und zählte dann einige Söhne und Töchter Prenzlaus auf, die er für Berühmtheiten hielt. „Christian Friedrich Schwan, Verleger und Buchhändler. Jacob Philipp Hackert, Landschaftsmaler. Friederike von Hessen-Darmstadt, Königin von Preußen ...“
„Gott!“ lachte einer. „Die war doch furchtbar unscheinbar und völlig unbegabt.“
„Ruhe! Dann haben wir noch Wilhelmina von Hessen-Darmstadt, Gattin des Zaren Paul I.“
Ferdinand Schmidt meldete sich zu Wort. „Das verstehe ich nicht: Was hat denn Prenzlau mit Hessen-Darmstadt zu tun?“
„Ganz einfach: Die Damen wurden in Prenzlau geboren, weil ihre Väter in preußischen Diensten standen und hier stationiert waren.“
„Ach, haben die Väter sie zur Welt gebracht?“
„Ich verbitte mir diese Scherze!“
Der Mentor fand, dass es einigen der Seminaristen doch erheblich an sittlicher Reife mangele. Der nächste Scherz kam ihm zum Glück gar nicht erst zu Ohren. Beim Stichwort Darmstadt fragte nämlich einer der Zöglinge Ferdinand Schmidt, ob der denn wisse, was ein Furz sei?
„Nein.“
„Eine Botschaft von Pforzheim nach Darmstadt, dass eine Fuhre Dung unterwegs ist.“
Ferdinand Schmidt sah den Kameraden tadelnd an. „An dir ist noch viel zu veredeln, bevor du auf die Jugend losgelassen wirst, sie zu veredeln.“
„Ach, in dem, was aus dem Volke kommt, steckt mehr Kraft drin als in all unserer Gelehrsamkeit.“
„Hm ...“ Ferdinand Schmidt ging mit dem Gedanken schwanger, eine Preußische Vaterlandskunde für Schule und Haus zu verfassen, so sein Arbeitstitel, und da war es vielleicht gar nicht schlecht, Wendungen und Bilder aus dem Alltag zu benutzen, um die Leser zu ködern.
Endlich waren am Horizont die Türme Prenzlaus zu erkennen, und auf dem Marktplatz angekommen, wurde der Wunsch geäußert, in ein Gasthaus einzukehren, denn man sei nach der langen Reise ausgehungert und vor allem durstig geworden.
„Abschlägig beschieden!“, rief der Mentor. „Erst treten wir an zur Stadtbesichtigung.“
Dann ging es los mit den Kirchen: St. Sabini, St. Jacobi, St. Marien, St. Nikolai …
„Und ich komme aus St. Endal“, brummte der Seminarist, der das mit der Fuhre Dung zum Besten gegeben hatte.
„Mein Vater aus St. Uttgart“, fügte ein anderer hinzu.
Ferdinand Schmidt fragte sich, wie seine Kameraden später reagieren würden, wenn ihre Schüler Derartiges zum Besten gaben. Wahrscheinlich würden sie explodieren.
Nun kamen die Türme an die Reihe. „Wir haben den Seiler-, den Hexen-, den Pulver-, den Schwedter-, den Mittel- und den Blindower Torturm.“
„Da möchte man am liebsten türmen“, meinte der Seminarist aus St. Endal.
Das aber wagte keiner, und so trabten sie solange hinter ihrem sehr verehrten Mentor hinterher, bis der selbst am Ende seiner Kräfte war und nach einem Gasthof Ausschau hielt.
„Da ist einer!“ rief er, als er das Schild mit der schönen Aufschrift „Zur Kastanie“ entdeckte. „Inhaber: Christian Friedrich Scheng.“
„Das wird ein Chinese sein“, vermutete der Witzbold vom Dienst.
Ferdinand Schmidt stellte die Sache richtig. „Der Mann heißt Schering. Die Buchstaben r und i sind nur abgefallen. Schering also.“
Sie kehrten ein, das heißt, sie nahmen draußen im Garten Platz und hatten bald herausgefunden, dass Scherings Küche vorzüglich war und auch sein Bernauer Bier nichts zu wünschen übrig ließ. Nur der Mentor war mit seinem Wein nicht so ganz zufrieden und murmelte, dass der wohl nicht vom Rheine käme, wie die Frau Wirtin ihm versichert hatte, sondern eher von der Oder, aus Grünberg vielleicht oder Tschicherzig.
„Soll ich dem Herrn etwas Zucker zum Nachsüßen bringen?“, fragte ein Junge, dessen Alter so zwischen zehn und fünfzehn liegen mochte und der sie schon die ganze Zeit über vom Nachbartisch aus beobachtet und belauscht hatte.
„Du bist ja ein richtiger Spaßvogel“, merkte der Mentor an und wurde dann amtlich. „Wie kommst du denn hierher? Wissen deine Eltern, dass du dich im Wirtshaus herumtreibst?“
„Ja. Ich bin jeden Tag hier“, entgegnete der Knabe so lakonisch, wie es nur ein echter Märker konnte.
„Dann werde ich einmal mit deinen Eltern sprechen“, fuhr der Mentor fort. „Wo kann ich die denn finden?“
„Na, auch hier.“
Als seine Zöglinge das schon längst begriffen hatten, merkte auch er, wen er vor sich hatte: den Filius des Wirts. „Das entschuldigt alles. Und wie heißt du?“
„Ernst Christian Friedrich, aber alle sagen nur Ernst zu mir.“
„Und, Ernst, bist du gut in der Schule?“
Der Junge überlegte. „Ja, aber ich will gar nicht gut sein.“
„Warum denn das?“
„Weil ich dann etwas studieren muss ...“
Weiter konnte sich der Mentor des Jungen nicht annehmen, denn nun kam das Essen – und das hatte absoluten Vorrang. Ernst Schering wurde zudem ins Haus gerufen, um die Herrschaften aus Neuzelle nicht weiter zu behelligen. Nach dem Essen aber ließ ihn der Mentor noch einmal rufen, um seinen Seminaristen weiter vorzuführen, wie man mit einfach gestrickten Jungen wie diesem Gastwirtssohn umzugehen hatte. Er hielt ihm einen Strauß mit Wildkräutern hin, die er vorhin bei einer kleinen Rast für sein Herbarium gesammelt hatte.
„Nun, Ernst, bist du eigentlich ein Kind der Natur?“
„Ja.“
Nun reimte der Mentor sogar. „Dann sag mir doch geschwind, was das hier all für Kräuter sind?“
Mit stoischer Ruhe tippte Ernst auf die einzelnen Pflanzen und benannte sie ohne zu zögern. „Scharfer Hahnenfuß … Wiesen-Bocksbart … Vogel-Wicke … Gemeine Schafgarbe … Acker-Vergissmeinnicht …“
„Das ist nicht zu fassen!“, rief der Mentor.
Ernst Schering war aber noch nicht am Ende und zeigte auf einen gelben Korbblütler. „Das hier ist der Kleinköpfige Pippau ...“
Da brach ein unbeschreiblicher Jubel bei den Seminaristen aus, denn ihr Mentor, der so stolz war auf seinen großen Kopf und das viele Hirn darin, hörte auf den Namen Pippau, Peter Christian Pippau.
Aber nicht nur wegen dieses lustigen Vorfalls sollte sich die Landpartie nach Prenzlau bei Ferdinand Schmidt für immer einprägen, sondern auch wegen einer Szene, die sie auf dem Rückweg zu ihrem Pferdefuhrwerk vor der Holtz´schen Apotheke erlebten. Dort hatte es, wie man ihnen erzählte, in einem Anbau eine Explosion und anschließend einen Brand gegeben. Gerade trug man einen jungen Mann auf einer aus den Angeln gehobenen Tür auf die Straße hinaus und wartete auf ein Pferdefuhrwerk, das ihn ins Krankenhaus bringen sollte.
„Das ist einer meiner Gehilfen, der Friedrich Krumbeck“, diktierte der Apotheker einem Korrespondenten in die Feder. „Der wollte sich ein wenig Geld damit dazuverdienen, dass er Knallerbsen herstellte. Und dazu benötigt man Knallquecksilber. Gibt man nun im Umgang mit diesem nicht genügend Obacht, so wird man langsam vergiftet. Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel stellen sich ein. Von dem muss Krumbeck erfasst worden sein, und da ist er wohl in eine offene Flamme gestürzt.“
„Das ist doch ein Alchemist gewesen!“, rief einer der Nachbarn. „Der hat aus Quecksilber Gold machen wollen.“
Ferdinand Schmidt trat an der Seite des Mentors in den Hof der Apotheke, wo alles lagerte, was man aus dem brennenden Anbau noch hatte retten könnten. Darunter befand sich auch ein Haufen mit Chemikalien der verschiedensten Art, unter anderem ein Tütchen mit der Aufschrift Pottasche.
Der Mentor hob es auf und ließ das weiße Pulver zu Boden rieseln. „Den Mann möchte ich sehen, der aus dieser Asche Gold machen kann!“
Schmidt lachte. „Warten wir´s ab.“
Vor ihrer Rückreise kaufen sie sich noch ein paar Rosinenbrötchen in der Bäckerei Nickholz, die am Anfang der Klosterstraße gelegen war. Komischer Name, dachte Ferdinand Schmidt, und schrieb ihn in ein Büchlein. Er sammelte seltene Namen wie andere Schmetterlinge. Vielleicht würde er einmal einen Roman schreiben, und da brauchte man sicherlich viele einprägsame Namen.
Kapitel Eins
Tage in Prenzlau, unvergesslich
1837
Ernst Schering ging gern zur Schule, was in Prenzlau für einen Dreizehnjährigen recht ungewöhnlich war. Sein Bruder August sagte von ihm, er habe einen wachen Geist, der ständig gefüttert werden müsse. Ja, das stimmte schon, aber er war darüber durchaus nicht glücklich, sondern beneidete die, von denen es in der Bibel hieß „Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihr“. Auch fürchtete er, seine Eltern würden meinen, dass er etwas Besonderes wäre und ihn wie seinen Bruder August zum Studium in die Ferne schicken. Was ihm vorschwebte, war ein einfaches Leben, eines ohne viel Gelehrsamkeit und immer in Gottes freier Natur. Im Gasthof seines Vaters hatte es immer viel Trubel gegeben und da war er oft in die Wälder südlich Prenzlaus geflüchtet, zumindest aber an die Ufer des langgestreckten Unteruckersees.
Nun, bei seinem Vater waren viele interessante Menschen eingekehrt und hatten von ihren Geschäften und ihren Abenteuern berichtet, und er hatte ihnen immer zugehört, mal offen, mal heimlich, weil das viel spannender war als all das, was in seinen Kinderbüchern und seiner Fibel stand. Die vielen Reize, die dabei auf ihn eingedrungen waren, hatten sein Gehirn dahin gebracht, später auch hoch Kompliziertes verstehen zu können. Und so war es gekommen, dass er in der Schule, auch noch auf dem Gymnasium, mit dem Lernen keine Mühe hatte, alles flog ihm nur so zu. Nie strebte er nach etwas, immer geschah es mit ihm, und er staunte nur, wenn er irgendwo angekommen war. Ludwig Kuhz, sein Klassenlehrer, hatte ihn einmal einen Somnambulen genannt, einen Schlafwandler.
Solch Kommentar war für Kuhz sehr ungewöhnlich, denn das Seelenleben seiner Schutzbefohlenen interessierte ihn im allgemeinen herzlich wenig. Hauptsache, sie lernten Gehorsam, die Liebe zum König und dazu ein wenig Lesen und Schreiben sowie das, was im kleinen Katechismus stand. Vornehmlich war er mit sich selbst beschäftigt, denn als junger Mann war er in der Schlacht bei Großbeeren in französisches Feuer geraten und hatte stundenlang in einem Graben ausharren müssen, nur mit dem Körper seines toten Pferdes als Kugelfang. Seitdem spielten seine Nerven immer wieder verrückt, aber er hätte nie daran gedacht, sich vom Schuldienst entbinden zu lassen, denn Fahnenflucht war das Schlimmste für ihn. Heute war das Werden Brandenburg-Preußens zu behandeln, und folglich war er mit besonderer Hingabe bei der Sache.
„Was fällt euch ein, wenn ich den Namen Friedrich nenne?“, fragte er mit leuchtenden Augen.
„Der Friedrich, der Friedrich, das ist ein arger Wüterich“, reimte Gottfried Nickholz, Scherings Freund und Banknachbar, in Vorwegnahme des Struwwelpeters.
So leise er gesprochen hatte, Kuhz waren seine Worte nicht entgangen, und er stürzte nach vorn, riss den Jungen aus der Bank, stieß ihn nach vorn, befahl ihm, sich über das Katheder zu beugen und versohlte ihn mit seiner Haselrute so kräftig, dass es denen noch weh tat, die in der hintersten Reihe saßen. Gottfried Nickholz stieß keinen Schmerzenslaut aus, denn er war von zu Hause aus Prügel gewohnt. Gelobt sei, was hart macht, hieß es dort. Was ihn außerdem noch trug, waren sein Hass auf den Lehrer und die Vorfreude auf den Tag, da er Kuhz alles heimzahlen konnte.
Der Lehrer gab sich alle Mühe, gleichmütig zu wirken. „Zurück zum Vornamen Friedrich. Wer trug in Preußen als Erster diesen Namen?“
In vielen Gesichtern zuckten es, denn es lag den Jungen auf der Zunge zu rufen „Mein Großvater!“, doch sie beherrschten sich gerade noch rechtzeitig, um der Haselrute zu entgehen. Keiner wagte sich zu melden.
Kuhz stieß Gottfried Nickholz die Spitze seiner Haselrute in die Brust. „Nun …?“
Die Antwort kam prompt. „Na, Friedrich der Große.“
Den ins Feld zu führen, konnte nie falsch sein, doch Kuhz verdrehte dennoch die Augen. „Mensch, das ist doch Friedrich II., wie kann denn der Alte Fritz der erste Friedrich sein!? Es muss doch auch einen Friedrich I. gegeben haben …? Schering, na …!?“
Eher gelangweilt kam die Antwort. „Ja, Friedrich I. war unser erster König, König in Preußen, 1701, aber eigentlich war er schon unser dritter Friedrich, das heißt, als Markgraf von Brandenburg war er Friedrich III. Was aber auch wieder nicht so ganz stimmt, denn der erste Hohenzollern in der Mark Brandenburg war ja der Burggraf von Nürnberg, Friedrich VI., und der ist dann in Brandenburg als Markgraf zu Friedrich I. geworden.“
„Hör auf, mir meine Schüler zu verwirren!“, rief Kuhz, sichtlich verärgert, und wandte sich wieder Gottfried Nickholz zu. „Und – wo ist denn Friedrich I. zum König in Preußen gekrönt worden, na!?“
Die Antwort war so einfach, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass jemand so dumm sein konnte, sie nicht parat zu haben, aber Gottfried Nickholz hatte wirklich keine Ahnung von allem. Da flüsterte ihm Ernst Schering „Königsberg“ zu – und wieder hörte es Kuhz.
„Wenn ich etwas hasse, dann ist es das Vorsagen!“, schrie er. „Wenn du glaubst, Gottfried, mich täuschen zu können, dann … ! Du hast mich betrügen wollen – das ist schmählich! Du und der Ernst. Zur Strafe sitzt ihre beide heute eine Stunde nach. Du wegen deiner Untat, Schering, und du, Nickholz, wegen deiner Dummheit!“
Beide waren furchtbar wütend auf Kuhz. Ernst Schering, weil es für ihn ein hoher Wert war, einem Freund zu helfen, und er es furchtbar ungerecht fand, dafür bestraft zu werden, Gottfried Nickholz, weil es ihn schmerzte, als Dämlack gebrandmarkt zu werden. Sein Vater war Bäcker, und er selbst verstand vom Backen mehr als Kuhz von preußischer Geschichte.
Wie auch immer, die beiden Jungen mussten im Klassenzimmer bleiben, als ihre Klassenkameraden nach der letzten Stunde jubelnd aus der Schule stürzten. Kuhz hatte sich eine ganz besondere Strafarbeit für sie ausgedacht: Sie sollten den Psalter durchgehen und sich fünfzehn Verszeilen aus der Bibel heraussuchen, sie abschreiben und danach auswendig lernen. Gottfried Nickholz liebte alles Martialische und wollte mit 3/8 beginnen. „Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott! Denn du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der Gottlosen Zähne.“
Ernst Schering hatte nichts dagegen einzuwenden, auch wenn er fand, es müsste auf „die Backen“ heißen. Er selbst begann mit 37/5: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen.
Nach etwa einer halben Stunde kam Kuhz herein, um zu prüfen, ob sie auch das taten, was ihnen aufgetragen ward. Und er ließ sich auch hinterm Katheder nieder. Einmal, um zu verhindern, dass die beiden sich möglicherweise noch amüsierten, zum anderen aber, weil er den Anblick hübscher Knaben durchaus anregend fand. Sein Vergnügen wurde aber nachhaltig gestört, als es über dem Uckerland plötzlich zu gewittern begann. Was zuerst harmlos erschien, wuchs sich in wenigen Minuten zu einem heftigen Unwetter aus. Blitz und Donner folgten immer rascher aufeinander, und schließlich schlug es zweimal hintereinander in den Turm des Prenzlauer Gymnasiums ein. Ein Wolkenbruch folgte und setzte die Stadt im Nu unter Wasser.
Den beiden Jungen machte all das nichts aus, Ludwig Kuhz aber zitterte am ganzen Körper und betete. „Gott, hilf mir; denn das Wasser geht mir bis an die Seele.“
Gottfried Nickholz grinste. „Das ist der 69. Psalm, Vers zwei.“
Ernst Schering liebte es, nach der Schule in die Gaststube zu treten, sich an einen freien Tisch zu setzen und sich wie ein Herr von und zu bedienen zu lassen. Im Gymnasium waren sie nur darauf aus, ihn zu diminuieren, und da tat es ihm wohl, wenn er sich einmal in der Rolle eines gemachten Mannes gefallen konnte. Meist bekam er nur das vorgesetzt, was die zahlenden Gäste verschmäht hatten, aber das störte ihn wenig. Weil er hatte nachsitzen müssen, war es später als sonst geworden und von den Herren, die ihren Mittagstisch bei Christian Schering einnahmen, waren alle schon wieder gegangen – nur sein Bruder August, der für ein paar Tage aus Berlin heraufgekommen war, saß noch am Fenster und plauderte mit einem der renommierten Söhne Prenzlaus, mit Karl Gottlieb Richter, der seit 1825 als Regierungspräsident in Minden lebte. Ernst Schering konnte große Teile ihres Gespräches verstehen, denn beide Männer waren Juristen und verstanden es, sich in Szene zu setzen.
August Schering hatte vor kurzem sein Studium beendet und war zur Zeit noch Auskultator, befand sich also in Phase eins der dreistufigen Ausbildung zum höheren Justizbeamten, und brachte dem Älteren ein hohes Maß an Verehrung entgegen.
„Wenn ich mir so Ihre Karriere ansehe, Herr Regierungspräsident, dann kann ich nur ausrufen: Chapeau! Wann haben Sie hier in Prenzlau Ihren Schulabschluss gemacht?“
Karl Gottlieb Richter musste einen Augenblick nachdenken. „Im vorigen Jahrhundert noch. 1777 bin ich auf die Welt gekommen – das kann ich mir wegen der drei Sieben noch merken, aber das andere … 1794 muss es gewesen sein. Anschließend habe ich in Halle studiert – Rechtswissenschaften und Theologie. Dann kamen der Gerichts-Referendar und der Gerichts-Assessor – und sie haben mich zur königlichen Kriegs- und Domänenkammer nach Posen geschickt.“
„Es folgten Potsdam, Halberstadt, Breslau und jetzt Minden“, fuhr August Schering fort.
Karl Gottlieb Richter lachte. „Sie sind ja bestens informiert, junger Mann!“
August Schering senkte die Stimme. „Ich habe gestern den Rat belauscht, da ist das alles erörtert worden.“
Der Regierungspräsident tat erschrocken. „Mein Gott – Prenzlau will mich wohl zum Ehrenbürger machen!“
„Wenn es einer verdient hat, dann Sie, und den Roten Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub, den haben Sie ja schon.“
Wie wunderbar musste es sein, ging es Ernst Schering durch den Kopf, von allen so verehrt zu werden und sich wie ein Halbgott fühlen zu dürfen! Die Menschen zogen Hut oder Zylinder, wenn sie an einem vorbeiflanierten, in den Läden machten sie eine Verbeugung, trat man ein, man saß im Theater mit anderen Honoratioren zusammen in der Loge des Königs und durfte hochdekoriert ins Ausland reisen, um Preußens Interessen zu vertreten. Und das Schönste war, dass man solch ein Leben haben konnte, obwohl man nur aus Prenzlau kam. Im Konfirmationsunterricht wie auch bei Ludwig Kuhz hatte er das Vaterunser auswendig lernen müssen: Dein Wille geschehe! Ob es Gottes Wille war, ihn auch so etwas werden zu lassen, wie es Karl Gottlieb Richter geworden war? Oder hatte der HERR seinen ach so tüchtigen Bruder August im Auge und nicht ihn?
Ein Zuruf seiner Mutter riss ihn aus seinen Gedanken: „Ernst, beim Apotheker Holz ist die Köchin erkrankt, du möchtest ihm sein Mittagessen nach Hause bringen!“
„Ja, sofort, ich muss nur noch schnell aufessen!“
Beim Nachwürzen bemerkte er, dass sich wieder einmal schwarze Krümel im Salz befanden. Was immer das war, es ärgerte ihn. Ebenso beim Zucker. Sie schafften es nicht, ihn so herzustellen, dass keine braunen Körner dazwischen waren. Seine Mutter hatte schon geklagt, er habe einen „Reinlichkeitsfimmel“, doch das störte ihn nicht.
Noch mit dem letzten Bissen im Mund trabte er los. In der Tür der Holtz´schen Apotheke wartete schon der Gehilfe Friedrich Krumbeck, der sich von seinem Unfall weithin erholt hatte und alsbald zu einer stadtbekannten Persönlichkeit geworden war. Ernst Schering übergab dem „Alchemisten-Fritz“ das mit einem karierten Tuch abgedeckte Tablett und machte sich schnell wieder auf den Heimweg. Als er am Dominikanerkloster vorbeikam, lief er seinem Freund Gottfried Nickholz in die Arme, der gerade angeln gehen wollte.
„Kommste mit an´n See runter?“
„Ja.“
Ernst Schering hatte die wenigen Schularbeiten schnell gemacht, und bis die Leute zum Abendschoppen kamen und er wieder beim Bedienen helfen musste, hatte er noch ein wenig Zeit. Sie liefen zum langgestreckten Unteruckersee hinunter, und nahe der Stelle, an dem das Flüsschen mit dem Namen Ucker den See wieder verließ, warf Gottfried Nickholz seine Angelrute aus. Den Blick auf die rotweiße Pose gerichtet, unterhielten sie sich leise.
„Oben in Vorpommern heißt die Ucker Uecker“, sagte Ernst Schering. „Weißt du das?“
„Nein, interessiert mich auch nicht.“
„Aber Kuhz könnte mal danach fragen.“
„Dieses Arschloch!“ rief Gottfried Nickholz.
In dieser Einschätzung ihres Lehrers waren sie sich beide einig. Auch darin, dass man ihm mal eins auswischen müsste. Die Idee dazu hatte dann Ernst Schering.
„Haste gesehen, was der für ´ne Angst vorm Gewitter hat.“
Der Freund nickte. „Ja, klar. Meinste, ich bin blind!?“
„Na, wenn er solche Angst vorm Gewitter hat, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass es bei ihm vorm Fenster ein mächtiges Gewitter gibt!“ rief Ernst Schering.
„Pssst!“ zischte Gottfried Nickholz. „Die Fische beißen nicht, wenn de so schreist!“ Dann tippte er sich gegen die Stirn. „Wie willste denn dafür sorgen, dass es ein Gewitter gibt: Vielleicht in die Kirche gehen und beten?“
„Nein“, beharrte Ernst Schering. „Aber wir können doch einen Böller basteln und den bei ihm vorm Fenster losgehen lassen, das ist doch auch wie Blitz und Donner.“
„Gute Idee!“ Gottfried Nickholz war begeistert. „Und das Pulver dafür, das besorge ich mir von Alchemisten-Fritze, den kenn´ ich ganz gut. Wenn ich dem ein paar Fische für sein Abendbrot schenke, dann tut der uns den Gefallen.“
Als Gottfried Nickholz nach einer Stunde ein paar Barben und Elritzen im mitgebrachten Eimer hatte, machten sie sich auf den Weg zur Holtz´schen Apotheke, wo der Alchemisten-Fritze gerade damit beschäftigt war, einem kleinen Jungen das Laufen beizubringen. Sie trugen ihm ihr Anliegen vor.
Friedrich Krumbeck grinste. „Wenn ihr inzwischen auf den Jungen aufpasst, auf den Julius, besorge ich euch, das was ihr braucht, damit es richtig knallt und blitzt.“
Nach ein paar Minuten kam er mit einem Tütchen Schwarzpulver und einer Handvoll roter Tonerde zurück. „Das mischt ihr, steckt es in eine Pappröhre, presst es zusammen, nehmt einen eingefetteten Bindfaden als Lunte und haltet ein Streichholz dran.“
Sie bedankten sich, schlichen sich in den Schuppen der Schering´schen Gastwirtschaft und machten sich ans Basteln. Schwer war das Herstellen eines mächtigen Böllers für zwei geschickte Jungen wie sie nun wahrlich nicht, und sie waren schon fertig, bevor die Sonne nach Templin zu hinter den Kiefern versank.
„Wir müssen warten, bis es halbwegs dunkel geworden ist“, sagte Ernst Schering. „Sonst ist der Effekt nicht eben groß.“
„Nun gut.“
Sie verabredeten sich für 10 Uhr abends, und als die Kirchturmuhren von St. Jacobi und St. Marien fast zeitgleich schlugen, kletterten sie aus den Fenstern ihrer Schlafzimmer und schlichen sich zur Grabowstraße, wo Ludwig Kuhz, ein Hagestolz, also bekennender Junggeselle, allein mit seiner Haushälterin in einem einstöckigen Häuschen wohnte. Wo sein Zimmer lag, das wussten sie, weil er sich gern von seinen Schülern, hatte man eine Klausur geschrieben, die prall gefüllte Tasche nach Hause tragen ließ.
Unter dem Zimmer des Lehrers angekommen, machten sie sich ans Werk. Gottfried Nickholz hielt den Böller in der Hand, Ernst Schering riss ein Streichholz an und hielt die Flamme an die Lunte. Sie fing sogleich Feuer und begann abzubrennen. Mit ein paar schnellen und absolut lautlosen Schritten war er am Fensterbrett und legte den Böller auf das Zinkblech. Dann lief er zurück.
„Drei … zwei … eins“, zählte Ernst Schering.
Gleich würde es blitzen und donnern und Kuhz mit einem Aufschrei hochfahren und sich gar nicht mehr einkriegen.
Doch nichts geschah.
Gottfried Nickholz wartete einen Augenblick, dann sprang er zum Fensterbrett, um den Böller hochzunehmen und zu sehen, warum die Sache nicht funktionierte hatte.
Als er ihn in der Hand hatte, gab es eine mächtige Explosion.
Im Namen des armen Lazarus
1839
In Preußen gab es mit Beginn der Industrialisierung soviel Massenarmut, Pauperismus, wie man damals sagte, dass eine eigene Armutsverwaltung geschaffen werden musste. Tausende Menschen waren nicht mehr in der Lage, für das eigene Auskommen zu sorgen, obwohl sie von frühmorgens bis spätabends schufteten und dabei ihre Gesundheit ruinierten. Im Adel und dem gebildeten Bürgertum fanden sich nur wenige, die sich um die Armen kümmerten. Die einen taten es, weil sie wahre Christen sein wollten, die anderen, weil sie gesellschaftliche Auflösungserscheinungen fürchteten, von der sittlichen Verwahrlosung bis hin zu Unruhen und Revolutionen. Herausragende Persönlichkeiten in diesem Kreise waren Bettina von Arnim, die sich 1831 bei der Choleraepidemie in Berlin für soziale Hilfsmaßnahmen in den Armenvierteln eingesetzt und Kranke gepflegt hatte, sowie schon einige Zeit vor ihr Johannes Rau, geboren 1673 in Perleberg, gestorben 1733 in Berlin, Diakon, Pfarrer und Probst in St. Nicolai, der seit 1699 Armenschulen in allen Quartieren der Residenz gegründet hatte, sowie Stanislaus Rücker. Der war aus Schlesien nach Berlin gekommen, hatte es hier zum preußischen Akzisedirektor gebracht und sich den Ruf eines Wohltäters der Armen erworben. 1733 hatte er das Grundstück Krausenstraße 30, Ecke Lindenstraße mitsamt des Irren- und Krankenhauses „Lazarus“ gekauft und dort nach dem Ausbau die lutherische Armenschule „Zum armen Lazarus“ gegründet.
Hier nun unterrichtete seit einiger Zeit auch Ferdinand Schmidt, den es nicht länger in Neuzelle gehalten hatte. Wer in Preußen etwas werden wollte, der kam nicht umhin, nach Berlin zu gehen.
Da saßen sie nun vor ihm, an die vierzig arme Würstchen, und wenn er in ihre Gesichter sah, schwankte er jeden Tag zwischen Lachen und Weinen, zwischen Hoffen und Verzweifeln. Er hatte seine Kinder, Jungen wie Mädchen, in vier Gruppen eingeteilt. Lieb und drollig waren die der ersten Gruppe, durstig nach Wissen und erfüllt vom Willen, dem Elend zu entrinnen, indem sie tüchtig lernten. Dumpf und ablehnend erlebte er die Schüler der zweiten Gruppe. Sie sahen keine Chance in ihrem Leben, ob sie nun ein wenig lesen oder rechnen konnten. Die Kinder, die zur dritten Gruppe gehörten, waren unrettbar krank, litten an Tuberkulose oder Leukämie, hatten sich schon aufgegeben, und ihr Anblick schmerzte ihn so sehr, dass ihm oft die Tränen kamen. Die vierte Gruppe hingegen ließ Aggressionen in ihm aufschießen, denn er wusste, dass sie es waren, die ihn gefährdeten, hatten sie das nötige Alter erreicht: Das waren die Jungen, die einmal Verbrecher werden würden – und auch wollten. Um die hatte er sich ganz besonders zu kümmern.
Ferdinand Schmidt betrat den Klassenraum der Jungen, und brav schnellten alle hoch. Das wenigstens hatten sie schon gelernt. Klar, man war ja in Preußen.
„Guten Morgen, Herr Schmidt!“, schallte es ihm entgegen.
„Guten Morgen! Setzen!“
Er warf das Klassenbuch und seine Unterrichtsmaterialien auf den Tisch und rief einen nach dem anderen auf. Hier! Hier! Fehlt! Fehlt! Hier! Jeden Morgen dieselbe Prozedur. Wie sagte sein Kollege Strzelczyn immer: „Lehrer werden ist nicht schwer, Lehrer sein dagegen sehr.“ Ja, hier war verloren, der nicht als der geborene Missionar auf die Welt gekommen war.
„Was machen wir heute, Herr Schmidt?“
„Wir kommen heute zum Buchstaben K.“
„K wie Kacke!“, kam es aus den hinteren Reihen.
Ferdinand Schmidt nahm es gelassen. Er stand auf und schrieb den Buchstaben an die Tafel, in seiner großen wie in seiner kleinen Version, dann zog er ein Bonbon aus der Tasche. „Das bekommt der, der einen Satz schreiben kann, in dem die meisten K´s vorkommen. Los, holt eure Tafeln heraus und fangt an.“
Es siegte Heinrich Reinsch mit dem Satz: Konrad Krause kann kleine Küken klauen.
Dass ausgerechnet der das Bonbon gewann, ärgerte die letzte Reihe, und sofort kam von dort der Ruf: „Ist hier jemand, der Reinsch heißt?“, aber so betont, dass es wie „rein scheißt?“ klang.
„Ruhe auf den billigen Plätzen!“, rief Ferdinand Schmidt. Wenn er den Rufer in die Ecke stellte oder vor die Klasse schickte, verhärtete sich dessen Wesen nur, das wusste er. Also ließ er es und lachte mit den anderen mit. Der Heinrich Reinsch war hart genug, der konnte das vertragen. Wer Kackstein oder Hundgeburth hieß, hatte es schwerer.
Als die Stunde langsam zu Ende ging, hatte Ferdinand Schmidt eine Idee. „Morgen bringt jeder mal das Buch von zu Hause mit, das seine Eltern am liebsten lesen.“
Nun lachte alles schallend, und aus der letzten Reihe kam die Frage: „Een Buch, wat issen ditte?“ Es stellte sich alsbald heraus, dass die Eltern seiner Kinder, wenn überhaupt, nur ein Buch besaßen: die Bibel.
Kaum im Lehrerzimmer angekommen, wandte sich Ferdinand Schmidt an Albrecht Strzelczyn. „Du, wir müssen unbedingt etwas unternehmen!“
„Ja, am Sonntag einen Ausflug nach Sanssouci.“
„Unsinn! Etwas, damit die Kinder Bücher in die Hand bekommen. Wer nicht liest, bleibt dumm, und darum müssen wir sie zum Lesen bringen. Und da sich die Eltern keine Bücher leisten können, brauchen wir eine Volksbücherei!“
„Bücher? Woher nehmen? Am besten du schreibst selber welche“, brummte Strzelczyn.
„Das auch, aber das braucht seine Zeit. Bis dahin müssen wir durch die Stadt ziehen und Bücher sammeln.“
„Wir? Du!“
So machte sich Ferdinand Schmidt daran, das zu tun, was man in späteren Zeiten Klinken putzen nennen sollte, veröffentlichte in der Berliner Zeitschrift „Die Biene“ einen Aufruf mit der Bitte um Bücherspenden, und in kurzer Zeit kamen tatsächlich 218 Bände zusammen. Seine Kinder konnten nun Bücher anfassen, aufschlagen und den Versuch machen, sie auch zu lesen.
Aber seine Aktivitäten brachten Ferdinand Schmidt nicht nur Freunde ein, es gab auch Männer, die sein Treiben nicht so gerne sahen, so der Freiherr Albert von Seld und der Stadtschulrath Otto Schulz.
Der Freiherr hatte mit seiner Arbeit über Die Unterrichtsmethode in den preußischen Schulen und verschiedenen juristischen Abhandlungen die besondere Anerkennung des Königs und seines Staatsministers v. Kamptz erworben und war zur Aufsicht über einige Armenschulen bestimmt worden. Dabei war ihm einiges aufgefallen, und er hatte Ferdinand Schmidt zu sich rufen lassen.
„Mir ist zu Ohren gekommen, mein Lieber, dass sie doch sehr arg mit der Disziplin in ihren Klassen zu kämpfen haben und einiges durchgehen lassen, was an sich den Rohrstock verdient hätte.“
Ferdinand Schmidt wusste, dass ihm jetzt nichts anderes blieb als zu buckeln, wollte er seine Stelle behalten und sie keinem überlassen müssen, der niemals einen Zugang zu den Schülern aus den Elendsvierteln finden würde. So gab er sich unterwürfig.
„Sehr wohl, Herr von Seld!“ Es war sehr militärisch, wie er das hervorstieß. „Ich werde mich in Zukunft so verhalten, wie Sie es von mir verlangen.“
Das besänftigte von Seld ein wenig, aber dennoch schnauzte er Schmidt weiterhin an. „Und noch etwas: Sie sollen des öfteren in ganz bestimmten Lokalitäten gesehen worden sein, wo man dem Laster des Branntweintrinkes verfallen ist.“
„Aber nein, um Gottes Willen!“, rief Ferdinand Schmidt, der wusste, dass der Freiherr den Kampf gegen die Trinksucht mit dem Eifer eines Kreuzzüglers verfolgte und schon mehrere Enthaltsamskeitsvereine gegründet hatte. „Ich gehe nur hin und wieder durch die Etablissements, um zu sehen, ob sich welche von meinen älteren Schülern dort herumtreiben und um sie, erwische ich sie, auf den Pfad der Tugend zurückzuführen.“
„Brav, sehr brav, mein Lieber. Und dann noch etwas: Fangen Sie nicht an, ein Dichter werden zu wollen, das lenkt nur von Ihrer Arbeit in der Armenschule ab. Und außerdem: Mit dem aus Werneuchen haben wir schon einen verspotteten Dichter mit Namen Schmidt in Preußen – ein zweiter tut nicht Not.“ Und er erinnerte darin, wie Goethe über den armen Friedrich Wilhelm August Schmidt, genannt Schmidt von Werneuchen, parodistisch hergezogen war. „Liebes Mädchen, laß uns waten / Waten noch durch diesen Quark.“
Diesmal wagte Ferdinand Schmidt sich zu verteidigen. „Ich dichte nicht, Herr von Seld, ich arbeite an einer Preußischen Vaterlandskunde für Schule und Haus.“
„Na, dann ist es ja gut.“
Nach Seld nun der Herr Stadtschulrath. Otto Schulz erinnerte ihn an den „beschränkten Unterthanenverstand“ seiner Schüler und warnte ihn davor, sie mit seinem wirklich oder auch nur eingebildeten Wissen unnötig voll zu schütten und zu überfordern.
Da Schulz über keine große Machtfülle verfügte, konnte es Ferdinand Schmidt in diesem Falle bei der Floskel belassen, sich „alle Mühe geben zu wollen, dass in seinem Klassenzimmer von ihm fürderhin eine leichtere Kost verabreicht werde.“
Wie auch immer, als am 2. Oktober die dritte „Communal-Armenschule“ in der Großen Frankfurter Straße eröffnet wurde, gehörte Ferdinand Schmidt zu den geladenen Gästen.
Waldeinsamkeit
1839
Ernst Schering war mit seinen fünfzehn Jahren alt genug, an den Abenden und am Sonntag in der Gastwirtschaft seines Vaters auszuhelfen. Meist hatte er in der Küche seiner Mutter zur Hand zu gehen, Kartoffeln zu schälen und den Abwasch zu besorgen, manchmal aber durfte er auch vorn in der Gaststube die Suppe oder den Nachtisch servieren und die Teller und Gläser abräumen. Eigentlich war er zumeist in sich gekehrt und vermied jedes überflüssige Gespräch, darin ganz ein Sohn der Mark, doch hin und wieder kam es, dass ihn die Leute ansprachen – und dann wusste er durchaus charmant zu plaudern. Der Oberförster Christian Krafft aus Poratz, der öfter einmal nach Prenzlau kam, um der Küche Wildbret zuzuliefern, hatte geradezu einen Narren an ihm gefressen, wohl weil er es zu fünf Töchtern, aber keinen einzigen Sohn gebracht hatte.
„Na …?“, frozzelte er, als der junge Schering ihm einen neuen Humpen brachte. „Willst du´s eigentlich mal den großen Männern mit Vornamen Ernst nachmachen, die´s auf dieser Welt gegeben hat?“
Ernst Schering starrte ein wenig verlegen auf den Bierfilz. „Leider kenne ich da keinen ...“
Der Oberförster lachte. „Ich kenne auch nur den Grafen Ernst zu Holstein-Schaumburg und noch den heiligen Ernst, den Ernestus, der soll in Rom den Märtyrertod gestorben sein. Nun, es wird Zeit, dass es auch in Preußen einmal einen Ernst gibt, der ein bisschen was hermacht.“
„Hier in Prenzlau …?“ Ungläubig sah der Junge den Forstbeamten an.
Krafft lächelte. „Nein, da magst du recht haben, dass das ein Widerspruch in sich selbst ist, denn nie wird der ein bedeutsamer Mensch werden, der ein Leben lang in Prenzlaus Mauern gefangen bleibt.“
Ernst Schering wagte ihm zu widersprechen. „Ich bin froh und glücklich, dass ich hier auf die Welt gekommen bin.“
„Ja, als Nest mag es großartig sein, aber dann ...“
Ernst Schering konterte mit Goethe, den sie gerade im Gymnasium abhandelten. „Warum denn in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!“
„Ja, und darum ist Marco Polo nach China aufgebrochen, hat Columbus Amerika entdeckt, haben die Spanier in Südamerika nach dem El Dorado gesucht und ist England mit Erfolg dabei, sich ganz Indien untertan zu machen.“
Dafür eine Erklärung zu finden, überforderte den Jungen, und er murmelte nur, dass er nicht einmal Lust habe, nach Berlin zu reisen.
„Aber zu mir ins Forsthaus kommst du doch mal?“
„Wenn mein Vater mitkommt und uns eine Kutsche beschafft.“
„Ich rede mal mit ihm.“
Nun, Christian Schering hatte nichts gegen einen Ausflug nach Poratz, und so saßen sie vierzehn Tage später in einem Zweispänner und fuhren gen Süden. Es ging über Lindenhagen, Gerswalde und Temmen, und sie brauchten etwas über zwei Stunden, ehe sie ihr Ziel erreicht hatten. Das alte Forsthaus, ein massiver zweistöckiger Bau, weiß getüncht, lag am nördlichen Ortseingang.
„Ein Forsthaus habe ich mir immer anders vorgestellt“, sagte Ernst Schering, nachdem der Oberförster sie begrüßt hatte und die ersten Worte gewechselt worden waren. „Eher so mit viel Fachwerk und Geweihen an den Mauern.“
„Nun, mein Forsthaus ist nicht als solches erbaut worden, sondern als Stations- und Zollhaus zwischen Angermünde und Templin, erst später ist es das geworden, was es heute ist: der Mittelpunkt des Forstbetriebes hier zwischen dem Laagen- und Briesensee im Osten, dem Kleinen Päßnicksee im Südwesten, dem Düster- und dem Großen Krinertsee im Norden und dem Dorf Glambeck im Süden. So in etwa jedenfalls. Das ist mein Reich.“
Krafft führte sie nun durch seine Haus und stellte ihnen seine überaus ansehnliche Frau und die vier Kinder vor. Ernst Schering war wie geblendet von allem, immer wieder schoss es ihm durch den Kopf: So möchte ich auch einmal leben! Und lange stand er vor den drei Gedichten, die – edel gerahmt und mit schön verzierten Buchstaben geschrieben – an der Wand des Flures hingen, und las sie mehrmals, jede Zeile genießend.
DAS LIED VOM REIFEN
Seht meine lieben Bäume an,
Wie sie so herrlich stehn,
Auf allen Zweigen angetan
Mit Reifen wunderschön!
Von unten an bis oben 'naus
Auf allen Zweigelein
Hängt's weiß und zierlich, zart und kraus,
Und kann nicht schöner sein.
Und alle Bäume rund umher,
All alle weit und breit,
Stehn da, geschmückt mit gleicher Ehr,
In gleicher Herrlichkeit.
Matthias Claudius
WALDEINSAMKEIT
O Täler weit, o Höhen,
O schöner, grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächtger Aufenthalt!
Da draußen, stets betrogen,
Saust die geschäftge Welt,
Schlag noch einmal den Bogen
Um mich, du grünes Zelt!
Da steht im Wald geschrieben
Ein stilles, ernstes Wort
Von rechtem Tun und Lieben,
Und was des Menschen Hort.
Ich habe treu gelesen
Die Worte schlicht und wahr,
Und durch mein ganzes Wesen
Wards unaussprechlich klar.
Joseph von Eichendorff
WALDEINSAMKEIT
Waldeinsamkeit,
Die mich erfreut,
So morgen wie heut
In ewger Zeit,
O wie mich freut
Waldeinsamkeit.
Waldeinsamkeit
Wie liegst du weit!
O Dir gereut
Einst mit der Zeit.
Ach einzge Freud
Waldeinsamkeit!
Waldeinsamkeit
Mich wieder freut,
Mir geschieht kein Leid,
Hier wohnt kein Neid
Von neuem mich freut
Waldeinsamkeit.
Johann Ludwig Tieck
Alles war Ernst Schering aus dem Herzen gesprochen, und er, der er ungern in die Kirche ging und wenig vom Gläubigsein hielt, dachte: Das kann kein Zufall sein, dass ich heute hier bin, das muss Gott so gewollt haben.
Nachdem sie einen deftigen Imbiss zu sich genommen hatten, führte sie Krafft durch Teile seines Reviers und erklärte ihnen die Arbeit eines Oberförsters.
„Ein Förster muss vielerlei Begabungen haben und sich für vieles interessieren. So geht es nicht ohne Mathematik, Biologie, Zoologie, Botanik, Vermessungswesen und zu guter Letzt auch ein wenig Forstrecht, denn wir haben den Wald und seine Tiere nicht nur zu schützen, zum Beispiel vor Wilddieben und vor Leuten, die sich unerlaubt Brennholz besorgen, sondern wir haben ihn auch zu nützen. Die Besitzer das Waldes wollen, dass gutes Bauholz heranwächst und dass ihren Jagdpächtern prächtige Hirsche vor die Flinte laufen. Aber ansonsten sind wir freie Menschen, denn die Herrschaft sitzt irgendwo in der Ferne in ihren Schlössern oder Rathäusern.“
Anschließend erklärte er den beiden Stadtmenschen kundig und liebevoll alles, was Flora und Fauna seiner Wälder und Seen zu bieten hatten.
„Schade nur, dass ich Ihnen Bär und Wolf, Luchs und Auerochs nicht mehr bieten kann“, schloss er. „Auch an Palmen, Gummibäumen, Kaffeesträuchern und Mangroven gebricht es uns in diesen Breiten. Darum beneide ich ja auch Alexander von Humboldt ein wenig, dass er das alles schauen konnte.“ Er bückte sich. „Aber sehen Sie nur her, was das hier ist: Der rundblätterige Sonnentau – Drosera rotundifolia. Ich hole mal ein wenig weiter aus … Wir unterscheiden bei den fleischfressenden Pflanzen fünf verschiedene Typen von Fallen. Erstens gibt es die Klebefallen, bei denen ein klebriges Sekret die Insekten anlockt, festhält und dann ihre Nährstoffe in sich aufnimmt. Ein Beispiel ist unser Sonnentau hier. Zweitens kennen wir die Klappfallen, wie zum Beispiel bei der Venusfliegenfalle.“
Erich Schering konnte es nicht fassen. „Aber wie merkt denn die Pflanze, dass gerade eine Fliege angekommen ist.“
Krafft lächelte. „Auf den Innenseiten der Blätter gibt es kleine Fühlhaare, und wenn die von der Fliege berührt werden, klappen die Blatthälften blitzschnell zusammen und die Fliege ist gefangen.“
„Gott, was die Natur so alles zaubert ...“, murmelte Ernst Schering.
„Dann haben wir noch die Saugfallen, wie sie bei den sogenannten Wasserschläuchen zu finden sind, was aber nur unter Wasser oder unter der Erde funktioniert. Viertens gibt es die Fallgrubenfallen, wo die Blätter einen Hohlraum bilden, in den die Tiere hineinfallen und nicht mehr hinauskommen, und fünftens dann die Reusenfallen, wo die Opfer mit bestimmten Duftstoffen in die Falle gelockt werden.“
Vater Schering lachte. „Das ist ja das Prinzip, das bei uns die Frauen übernommen haben.“
Als sie am Abend dieses denkwürdigen Tages wieder zurück in Prenzlau waren, stand für Ernst Schering fest, was er werden wollte: Förster und Jäger.
Der Junge mit dem Schweinekopf
1839
Schwedt, auf einer Sandterrasse über dem Odertal gegründet und im Jahre 1265 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, hatte eine bewegte Geschichte hinter sich. Erst hatte es zu Brandenburg gehört, war dann vom Markgrafen Ludwig dem Römer an die Pommern abgetreten worden, 1481 durch Kauf an den Thüringer Johann I. von Hohnstein gekommen, hatte in dieser Ägide einen beachtlichen Aufschwung genommen, dann aber im Dreißigjährigen Krieg gewaltig gelitten, war danach an Dorothea gefallen, der zweiten Gemahlin des Großen Kurfürsten, die mit Hilfe eines holländischen Fachmannes und den im Frühjahr 1686 angesiedelten Hugenotten den uckermärkischen Tabakanbau begründet und der Stadt zu einigem Wohlstand verholfen hatte. Friedrich Heinrich, der letzte Markgraf (1771–1788), machte aus Schwedt eine Kulturstadt und richtete in der Orangerie des Schlosses eines der ersten Theater in Deutschland ein. Von 1770 an war Schwedt Garnisonsstadt, und das hier ansässige Dragonerregiment hatte sich 1815 im Feldzug gegen Napoleon ganz besondere Meriten erwerben können.
In Schwedt nun hatte Gottfried Nickholz nach langer Suche und durch die Vermittlung des Prenzlauer Pfarrers eine Lehrstelle beim Tischlermeister Anton Teichmann finden können. Der selbst gebastelte Böller, der keine Armlänge vor ihm explodiert war, hatte ihm schwere Verletzungen an den Händen und im Gesicht zugefügt, und den Ärzten war es wie ein Wunder erschienen, dass er nicht sein Augenlicht verloren hatte. Es waren gute Chirurgen gewesen, die sich seiner angenommen hatten, der älteste von ihnen hatte schon auf den Schlachtfeldern der Napoleonischen Kriege verwundete Soldaten zusammengeflickt, doch alle ihre Künste hatten nicht ausgereicht, ihn so herzurichten, dass nicht jeder zusammenzuckte, der seiner ansichtig wurde. Die Nasenspitze fehlte ihm, die versengten Augenbrauen hatten sich nicht gänzlich erneuert, die Lippen waren wulstig geworden und die nachgewachsene Haut war von einer unnatürlich fahlen Farbe, und es mischten sich in einzelnen Partien Beige, Rosa, Elfenbein und Weiß. Einer vom Theater lästerte, hätte jemand ein Gruselkabinett einrichten oder ein Roman der Schauerromantik verfassen wollen, wäre ihm der Anblick dieses Gottfried Nickholz sehr hilfreich gewesen. Sicher gab es auch Menschen, die Mitleid mit ihm hatten, doch denen dankte er das nicht, sondern stieß sie von sich, weil auch sie ihn daran erinnerten, dass er so unglaublich verunstaltet war. Am wohlsten fühlte er sich unter denen, die noch schlechter dran waren als er: Krüppel aus den Kriegsjahren, Blinde und Kränkliche aller Art. Aber auch mit entlassenen Zuchthäuslern ließ er sich gerne ein, denn die wurden von den anderen ebenso gemieden wie er.
In der Teichmann´schen Werkstatt wurde er gelitten, mehr nicht, und im allgemeinen zu den niedrigsten Arbeiten herangezogen, etwa dem Auffegen der Späne oder dem Schärfen der Äxte und Sägen. Nur wenn sich Anton Teichmann daran erinnerte, dass Gottfried Nickholz ja auch irgendwann einmal zur Gesellenprüfung anzutreten hatte und sein Versagen dann auch auf ihn zurückfallen würde, ließ man ihn mitmachen, wenn Kunden Tische, Schränke, Bänke, Truhen oder Treppen bestellt hatten. Zwar begriff er schnell, was Sache war und konnte auch gut mit Säge, Hobel und Stechbeitel umgehen, aber wenn es bei Zinken, Nut und Feder und den Dübeln um größte Genauigkeit ging, dann misslang ihm vieles, weil die Nerven in seinen Fingerspitzen zerstört waren und er beim dreidimensionalen Sehen Schwierigkeiten hatte. Auch beim Gebrauch des Zollstocks vertat er sich hin und wieder. So auch heute.
„Mein Gott, die rechte Schranktür hier kann man ja nur noch als Brennholz benutzen!“, tobte Teichmann. „Die ist eine Fingerbreite kürzer als die linke.“
Was blieb Nickholz da Anderes, als auf den Samstag zu warten und im Wirtshaus Trost zu suchen. An der Vierradener Chaussee gab es ein Etablissement, in dem am Abend zum Tanz aufgespielt wurde. Dort war er zwar nicht gern gesehen, aber ihm Hausverbot zu erteilen, hatte man sich nicht getraut.
Gottfried Nickholz öffnete die Tür zum Tanzsaal und hielt Ausschau nach seinen Freunden Franz und Georg. Die hatten so manche Wirtshausschlägerei als Sieger beendet und in deren Beisein wagte sich niemand an ihn heran. Doch die beiden waren noch nicht erschienen, und so ging die böse Frotzelei schon los, kaum dass man ihn gesehen hatte.
„Da ist ja unsere lebende Mumie wieder!“
„Achtung, Schweinekopf ist da!“
Da konnte er nicht mehr an sich halten und stürzte auf den Rothaarigen los, der das gerufen hatte. Und ehe dessen Freunde eingreifen konnte, hatte Gottfried Nickholz ihn gepackt und schlug nun auf ihn ein. Immer wieder mit voller Kraft mitten ins Gesicht.
„Damit du so aussiehst wie ich!“
Alle stürzten nun herbei, um ihn zu überwältigen. Als sie es geschafft hatten, war auch der Gendarm zur Stelle und arretierte ihn.
Anton Teichmann war an sich ein gutmütiger Mensch, und er hätte wohl über diesen Vorfall großzügig hinweggesehen, wenn nicht der Rothaarige, dem Gottfried Nickholz das Nasenbein gebrochen und mehrere Platzwunden im Gesicht zugefügt hätte, sein Neffe gewesen wäre. So aber musste er dem dringlichen Wunsche seines Bruders nachgeben und Gottfried Nickholz am Montag vor die Tür setzen.
Da hänge ich mich lieber auf
1840
Als sie im Frühjahr 1840 im Prenzlauer Gymnasium Schillers Räuber durchnahmen und auch auf den Dichter selbst zu sprechen kamen, fragte der Klassenbeste, der sich das erlauben durfte, ob Friedrich Schiller eigentlich Friedrich Schiller geworden wäre, wenn er schon als Jüngling sicher gewusst hätte, dass er einmal Schiller werden würde.
Bei jedem anderen hätte ihr Professor losgepoltert, bei seinem Lieblingsschüler aber lächelte er milde und suchte nach einer tiefschürfenden Antwort.
„Nun … vielleicht hätte es ihn befeuert, Großes in noch jüngeren Jahren zu Papier zu bringen, möglicherweise aber auch gehemmt, weil man eine schwere Last zu tragen hat, wenn man berühmt ist und nur noch Erlesenes von sich geben darf, also kein leichtes und bequemes Leben hat, sogar in Gefahr geraten kann, zu viel von sich selbst zu verlangen und daran zu zerbrechen. Auch ist nicht auszuschließen, dass er bequem geworden wäre, weil er in der Gewissheit gelebt hätte, dass ja alles von alleine kommt. Kurzum, ich möchte die These wagen, dass Schiller nicht der Schiller geworden wäre, wie er heute auf dem Dichterolymp zu sehen ist, wenn das schon auf seinem Taufzeugnis gestanden hätte.“
Nun, Ernst Schering hatte als Sechzehnjähriger nicht die Spur einer Vorahnung, dass er einmal ein weltberühmter Pharmaunternehmer werden würde, sein großer Traum war es weiterhin, Oberförster in heimischen Gefilden zu werden. Sein Vater fand das allerdings keineswegs erstrebenswert. „Unser Ernst“, hörte man ihn immer wieder sagen, „soll es einmal zu einer gewissen Berühmtheit bringen und den August noch übertreffen.“ Der war immerhin auf dem Wege zum Oberjustizrath, was in Preußen schon eine Menge war. Und um seinen Jüngsten hungrig zu machen, hungrig auf Ruhm und Ehre, hängte er in seiner Gaststube Photographien der Söhne Prenzlaus auf, die es schon zu etwas gebracht hatte. Ernst Schering lief Tag für Tag mehrmals an dieser Galerie vorbei und hatte die Stimme seines Vaters im Ohr: „Da nimm dir mal ein Beispiel dran. Was die können, kannst du schon lange.“ Vier Männer waren es, die da hingen:
Karl Gottlieb Richter, geboren 1777 in Prenzlau, hatte das dortige Gymnasium besucht, dann in Halle Theologie, Rechtswissenschaften und Cameralia studiert, um eine Justizkarriere zu beginnen. In Berlin, Posen, Potsdam, Halberstadt und Breslau hatte er hohe Ämter innegehabt, jetzt war er Regierungspräsident in Minden.
Albert von Schlippenbach, 1800 in Prenzlau auf die Welt gekommen, hatte ebenfalls Jura studiert, dann aber keine Karriere in der preußischen Justizverwaltung gemacht, sondern das verschuldete Gut seines Vaters in Schönermark übernommen und wieder saniert. Berühmt geworden war er als Liederdichter. Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein und Nun leb´ wohl, du kleine Gasse, vertont von Franz Theodor Kugler beziehungsweise Friedrich Silcher, waren buchstäblich in aller Munde.
Wilhelm Grabow, geboren 1802 in Prenzlau, war ebenfalls Schüler jenes Gymnasiums, dessen Bänke auch von Ernst Schering gedrückt wurden, und Jurist wie Richter und Schlippenbach, hatte in Berlin Jurisprudenz studiert und war dort Referendar am Kammergericht gewesen, ehe er als Richter in Spandau, Perleberg und am Berliner Stadtgericht gewirkt hatte, um 1836 Hofgerichtsrat und Universitätsrichter in Greifswald zu werden. Vor zwei Jahren war er als Bürgermeister nach Prenzlau heimgekehrt.
Adolf Stahr fiel ein wenig aus dem Rahmen, denn zwar war auch er ein echter Prenzlauer Junge, geboren 1805, und Besucher des vorgenannten Gymnasiums, doch er hatte sich nicht der Juristerei zugewandt, sondern hatte in Halle Philologie studiert und war Lehrer am Königlichen Pädagogium in Halle und Konrektor und Professor am Gymnasium in Oldenburg geworden, wo er sich als Förderer des dortigen Theaters wie als Theaterkritiker einen Namen gemacht hatte.
Immer wenn Ernst Schering in die Gesichter dieser Männer sah, empfand er nichts als Langeweile, denn die Ruhmessucht war ihm völlig fremd. War das vor einiger Zeit noch ganz anders gewesen, so dachte er jetzt: Was hatte man davon, wenn einen die Leute auf der Straße ehrfürchtig grüßten – man musste nur den Zylinder ziehen und brachte seine Haare durcheinander. Was hatte man davon, wenn man für die Journaille so interessant war, das sie von allem Kenntnis nahm, was man tat und unterließ – man hatte nur andauernd auf der Hut zu sein. Was hatte man davon, wenn man Regierungspräsident oder Bürgermeister war – man hatte nur vor seinem Vorgesetzten zu buckeln und in einem fort das zu tun, was einem contre cœur ging. Nein, nicht mit ihm. Er wollte nichts anderes als Förster werden und mit sich allein durch die Wälder streifen.
Ach ja, es gab in vielem keinen besseren Philosophen als den Volksmund, und bei dem hieß es: Der Mensch denkt, Gott lenkt. Und so lenkte er am Sonntag, dem 14. Juni, den Apotheker Friedrich Appelius nach Prenzlau. Der war alter Märker, geboren am 11. August 1796 in Potsdam, und schon lange vor Fontane auf die Idee gekommen, durch Brandenburg zu wandern. In der Uckermark waren er und seine Freunde schon öfter gewesen, in Prenzlau aber noch nie. Sie hatten die Uckerseen umrundet und saßen nun im Schering´schen Biergarten, um auf ihr Essen zu warten. Da auch der Besitzer der „Grünen Apotheke“ in Prenzlau mit seiner Familie zu Gast war und man sich von einer Tagung her kannte, kam schnell ein munteres Gespräch in Gang, an dem sich auch der Wirt beteiligte. Ernst Schering, der das Bier und die Bestecke zu bringen hatte, machte große Ohren.
„Es ist eine große Freude für uns, Herr Hofapotheker, dass Sie uns mit Ihrem Besuch beehren“, sagte einer der Prenzlauer.