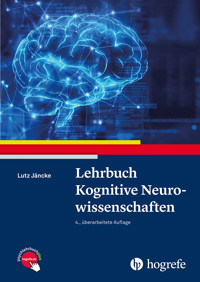32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
'Musik macht schlau' ist eine typische Pressemeldung, die dem Laien den Eindruck vermittelt, dass Musikhören und Musizieren das Lernen quasi auf geheimnisvolle Art und Weise verbessern würden. Allerdings sind die Wirkungen von Musik auf das Lernen viel differenzierter, als es diese einfachen Pressemeldungen glauben lassen. Erstmals werden im Rahmen dieses Buches die in den letzten 20 Jahren erzielten Befunde bezüglich der neurowissenschaftlichen und kognitiven Grundlagen des Musizierens und des Musikhörens dargestellt und bewertet. So werden neben dem berühmten 'Mozart-Effekt' auch die aktuellen Längsschnitt- und Querschnittstudien besprochen, die sich mit den Zusammenhängen zwischen Musiktraining und schulischen Leistungen oder allgemeinen kognitiven Leistungen auseinandersetzen. Besondere Beachtung findet die Besprechung des Themas Musik und Gehirn, denn nur durch das Verständnis der hirnphysiologischen Grundlagen wird es möglich, auch die Wirkung von Musik auf andere Funktionen besser zu verstehen. Einen besonderen Schwerpunkt findet dieser Teil in der Besprechung der Hirnplastizität im Zusammenhang mit dem Musizieren und dem damit zusammenhängenden Training. Schließlich werden zwei wichtige und relativ neue Aspekte erörtert. Zunächst wird der neu entwickelte Zusammenhang zwischen Musik und Sprache mit seinen möglichen Auswirkungen auf klinisch-therapeutische Anwendungen besprochen. Abschließend werden mögliche Einsatzmöglichkeiten der Musik und des Musizierens im Zusammenhang mit dem Alter thematisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Lutz Jäncke
Aus dem Programm Verlag Hans Huber
Macht Musik schlau?
Psychologie Sachbuch
Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Dieter Frey, München
Prof. Dr. Kurt Pawlik, Hamburg
Prof. Dr. Meinrad Perrez, Freiburg (CH)
Prof. Dr. Franz Petermann, Bremen
Prof. Dr. Hans Spada, Freiburg i. Br.
Im Verlag Hans Huber sind außerdem erschienen – eine Auswahl:
Norbert Herschkowitz
Das vernetzte Gehirn
Seine lebenslange Entwicklung
152 Seiten (ISBN 978-3-456-84264-6)
Ulrike Stedtnitz
Mythos Begabung
Vom Potenzial zum Erfolg
Mit einem Vorwort von Prof. Lutz Jäncke
211 Seiten (ISBN 978-3-456-84445-9)
Informationen über unsere Neuerscheinungen finden Sie im Internet unter: www.verlag-hanshuber.com
Lutz Jäncke
Macht Musik schlau?
Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften
und der kognitiven Psychologie
Mit einem Vorwort
von Prof. Dr. med. Eckart Altenmüller
Verlag Hans Huber
Prof. Dr. Lutz Jäncke
Universität Zürich
Institut für Psychologie
Neuropsychologie
Binzmühlestrasse 14/Box 25
CH-8050 Zürich
Lektorat: Monika Eginger, Gaby Burgermeister
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Verlag Hans Huber
Hogrefe AG
Länggass-Strasse 76
CH-3000 Bern 9
Tel: 0041 (0)31 300 45 00
Fax: 0041 (0)31 300 45 93
1. Auflage 2008
© 2008 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
EPUB-ISBN: 978-3-456-74575-6
Inhaltsverzeichnis
Vorwort (Eckart Altenmüller)
1. Einleitung
Von Kognitionen, psychischen Funktionen und Genen
Transfer
Wunderwelt der Neuroanatomie und Bildgebung
Von Zeitschriften und Büchern
Die Geschichte dieses Buches
Abschließende Bemerkungen
2. Der Mozart-Effekt – Beginn eines Mythos
2.1 Der Beginn
2.2 Die Folgen
2.3 Replikationsversuche
2.4 Weiterführende Experimente
2.5 Der Einfluss der Stimmung und der Musikpräferenz
2.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung
3. Längsschnittstudien
3.1 Allgemeines
3.2 Internationale Längsschnittuntersuchungen
3.3 Deutschsprachige Längsschnittstudien
3.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung
4. Querschnittuntersuchungen
4.1 Musik und Gedächtnis
4.2 Musikgedächtnis
4.3 Visuell-räumliche Leistungen
4.4 Rechenleistungen
4.5 Spielen vom Notenblatt
4.6 Motorische Leistungen
4.7 Musikwahrnehmung
4.8 Musiker und Nichtmusiker
4.9 Zusammenfassung und kritische Würdigung
5. Lernen und passives Musikhören
5.1 Suggestopädie
5.2 Ergebnisse aus dem Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching
5.3 Ergebnisse aus Zeitschriften, die von Fachleuten begutachtet werden
5.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung
6. Musik und Emotionen
6.1 Preparedness
6.2 Wir mögen, was wir häufig hören
6.3 Heute «hü» morgen «hott» – wechselnde emotionale Musikwirkungen
6.4 Hirnaktivität und emotionale Musik
6.5 Emotionen bei Profimusikern
6.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung
7. Wie verarbeitet das Gehirn Musik?
7.1 Zusammenfassung
8. Musik und Hemisphärenspezialisierung
8.1 Amusie
8.2 Amusien bei Musikern
8.3 Zusammenfassung
9. Wie produziert das Gehirn Musik?
9.1 Motorische Kontrolle
9.2 Sequenzierung
9.3 Gedächtnis
9.4 Aufmerksamkeit
9.5 Musizieren – Kreativität
9.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung
10. Verändert Musizieren das Gehirn?
10.1 Wiederholen ist die Mutter des Lernens
10.2 Expertise – Üben, Üben, Üben
10.3 Gehirne wie Knetmasse
10.4 Reifung und Hirnplastizität
10.5 Plastizität nicht nur bei Musikern
10.6 Zusammenfassung
11. Musik und Sprache
11.1 Funktionen und Module
11.2 Von Tönen und Sprache
11.3 Fremdsprachen und Musik
11.4 Syntax und Semantik
11.5 Klingt Musik französisch, deutsch oder englisch?
11.6 Musik und Lesen
11.7 Musik und Sprachstörungen
11.8 Zusammenfassung
12. Musik und Alter
12.1 Zusammenfassung
13. Schlussfolgerungen
Macht das Hören von Mozart-Musik schlau?
Hat Musikunterricht einen günstigen Einfluss auf Schulleistungen und kognitive Funktionen?
Worin unterscheiden sich Musiker von Nichtmusikern?
Lernt man besser, wenn man gleichzeitig Musik hört?
Beeinflusst Musik die Emotionen?
Wird Musik in bestimmten Hirngebieten verarbeitet?
Wie produziert das Gehirn Musik?
Verändert Musizieren das Gehirn?
Besteht ein Zusammenhang zwischen Musik und Sprache?
Ist es gut, wenn man im fortgeschrittenen Alter musiziert?
Soll man in der Schule musizieren?
14. Dank
15. Literatur
Sachwortregister
Personenregister
Vorwort
Mit Mozart-CDs zum intelligenten Kind? Führt intensivierter Musikunterricht zum «explosionsartigen» Anstieg der Intelligenz? Mit Musik schneller lernen? Oder mit Musik der Alzheimer-Krankheit vorbeugen?
Das sind Fragen, die in den letzten 15 Jahren die Öffentlichkeit bewegt haben und die anhaltend heiß diskutiert werden. Startschuss war der «Mozart-Effekt», der die vorübergehende Verbesserung von räumlichen Intelligenzleistungen nach dem Hören einer Klaviersonate von Mozart zu belegen schien. Seither sind hunderte von guten und weniger guten Arbeiten zur Wirkung von Musik auf Intelligenzleistungen, auf Gedächtnis, auf Hirnvernetzung und auf die Hirnstruktur erschienen. Wie steht es aber wirklich mit der «Macht der Musik?»
Lutz Jäncke, einer der Forscher der ersten Stunde auf dem Gebiet der «Musik-Neurowissenschaft», beantwortet diese Fragen kurzweilig, aber dennoch umfassend und kompetent. Seit Beginn der 1990er-Jahre befasst er sich mit den Themen des Buches. Er gehört zu den Wissenschaftlern, die selbst von Grund auf die Forschung auf diesem Gebiet vorangetrieben, mühsam die Methoden entwickelt und kritisch die Befunde überprüft, verworfen und bestätigt haben. Kurz, Lutz Jäncke ist im wahren Sinne des Wortes ein «intimer Kenner der Materie».
An dieser intimen Kenntnis des Themas lässt Lutz Jäncke den Leser teilhaben. Er erklärt in vorbildlicher Weise sehr komplizierte Sachverhalte in klarer Sprache, er versteht es meisterhaft, durch Vergleiche und Bilder Abstraktes anschaulich zu machen, und er erzieht den Leser zur kritischen Analyse der Fakten, ohne als Oberlehrer aufzutreten.
In dem Buch lernt der Leser nicht nur die vielfältigen Wirkungen von Musik auf Intelligenzleistungen, auf Gedächtnis, auf das Lernen, auf Emotionen, auf Hirnvernetzung und Hirnstruktur richtig zu einzuschätzen. Es wird nicht nur – endlich einmal fundiert und auch kritisch – die These «Musik macht schlau» auf Herz und Nieren geprüft, sondern dieses Buch ist auch ein Buch über die Methoden der Psychologie und der Hirnforschung.
Ein Beispiel dafür: So ganz nebenbei erfährt der Leser, dass die Ergebnisse von Forschung nur dann wirklich zählen, wenn anerkannte Experten die Durchführung der Experimente und die Analyse und Deutung der Ergebnisse überprüft haben. Dies geschieht in dem «Peer-Review»- Verfahren der internationalen Zeitschriften. Eine Untersuchung wird in diesen angesehenen Fachjournalen nur dann veröffentlicht, wenn sie die strenge Prüfung überstanden hat. Es ist ein Grundsatz des wissenschaftlichen Arbeitens, dass durch gegenseitiges kollegiales Überprüfen der Arbeiten die Qualität und Stichhaltigkeit der Ergebnisse sicher gestellt wird oder Schwachstellen durch Kontrollexperimente korrigiert werden.
Viele Untersuchungen zur Wirkung von Musik haben diese Hürde nicht genommen, werden aber trotzdem von den Medien weiterverbreitet. Hier scheidet Lutz Jäncke die Spreu vom Weizen, ohne pharisäerhaft die Bemühungen der Kollegen, die nicht international veröffentlichen, zu entwerten. Das Buch ist zugleich eine wunderbare Einführung in die Kunst, wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen und auszuwerten. Mit viel Humor zeigt Jäncke die Fehler in der Planung von Experimenten zur Wirkung von Musikunterricht auf, die zu unklaren Ergebnisse führen. Welche Schlussfolgerungen man aus solchen Untersuchungen ziehen darf, aber vor allem, welche nicht, wird so für jeden einfach nachvollziehbar. Auf charmante und engagierte Weise erhält der Leser auch Einblicke in die hohe Kunst, mit Statistik Unsinn zu treiben. Dabei wird deutlich, dass derartige, falsch angewandte Methoden schnell aus einer kultur- und schulpolitisch gewünschten Meinung harte «wissenschaftliche» Belege entstehen lassen. Es ist diese Form der Pseudowissenschaft, die letztlich dem Anliegen der ernsten Förderer von Musik und Musikunterricht mehr schadet als nützt.
Dieses Buch ist dringend notwendig. Es ist ein aufklärerisches Buch, das dem hohen Ideal des soliden wissenschaftlichen Arbeitens verpflichtet ist. Das Buch ist eine Orientierungshilfe für die Leser. Es schafft Ordnung in einem diffusen, oft von Meinungen und Interessen und weniger von Fakten dominierten Gebiet. Mancher Leser mag enttäuscht sein, dass lieb gewordene Slogans wie «Musik macht schlau» hinterfragt und teilweise sogar widerlegt werden. Aber zugleich werden auch die Wege aufgezeigt, in welche Richtung Pädagogik und Forschung zukünftig gehen müssen, um die Potenziale von Musik und Musikerziehung voll auszuschöpfen. Denn es bleibt bei allen kritischen Kommentaren doch auf jeder Seite spürbar: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.
Ich möchte daher allen musikbegeisterten und noch nicht musikbegeisterten Eltern, allen Pädagogen, Musikern und Kollegen der Fachdisziplinen dieses Buch ans Herz legen. Ich beglückwünsche Lutz Jäncke zu seinem Wurf und wünsche dem Buch eine weite Verbreitung.
Hannover, Juli 2008 Eckart Altenmüller
1 Einleitung
Warum dieses Buch? Sie werden vielleicht denken, dass ist ein langweiliger Beginn einer Einleitung, aber ich schreibe diese Einleitung, nachdem ich praktisch das gesamte Buch geschrieben habe. Insofern stelle ich mir hier noch einmal die Frage, warum ich mich überhaupt diesem Projekt unterworfen habe. Ein wesentlicher Grund für dieses Buch ist das zunehmende Interesse, das ich in den letzten fünf Jahren im Zusammenhang mit diesem Thema verspürt habe. Nicht nur Neurowissenschaftler und Psychologen interessieren sich derzeit für den Zusammenhang zwischen Musik und Gehirn, sondern Musikwissenschaftler, Musiklehrer, Eltern, Musiker und neuerdings auch Lehrer, Bildungsforscher und Bildungspolitiker. Was ist passiert bzw. was hat zu diesem Interessenwechsel geführt? Ich kann dies nicht wirklich beantworten, aber ich habe den Eindruck, dass neue Erkenntnisse aus den kognitiven Neurowissenschaften – insbesondere aus dem Bereich der Lernforschung – schnell (vielleicht allzu schnell) Bestandteil der Bedürfniswelt von Lehrern, Schülern und Eltern werden. In diesem Kontext wird immer wieder die Frage gestellt: Wie kann ich effizienter und damit schneller und besser lernen? Wenn dann in diesem Zusammenhang berichtet wird, dass Musizieren Kinder «schlauer» machen würde und das Lernen von schulischen Inhalten fördere, dann werden natürlich nicht nur Fachleute, sondern insbesondere auch Laien hellhörig. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als die kognitiven Neurowissenschaften sich zu etablieren begannen (Anfang 1990). In dieser Zeit war das öffentliche Interesse an Hirnforschung eher mäßig und eher auf klinische Fragen im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen ausgerichtet. Heute interessiert man sich vermehrt für das gesunde Gehirn, vor allem im Zusammenhang mit Lernen und Gedächtnis.
Das große Interesse an dem Zusammenhang zwischen der Hirnforschung und der Musik hat letztlich auch dazu geführt, dass ich in den letzten fünf bis sechs Jahren sehr viele Vorträge vor Laienpublikum gehalten habe, dessen Motivation, zu meinen Vorträgen zu kommen, ganz unterschiedlicher Natur war. Häufig waren es Musiklehrer oder Leiter von Musikschulen, die aus Sorge vor drohenden Kürzungen staatlicher Subventionen einen kompetenten Verbündeten zu finden glauben. Andere waren einfach daran interessiert zu erfahren, ob die in der Laienpresse häufig übertrieben dargestellten Befunde sich aus dem Munde eines «Datenproduzenten» anders anhörten bzw. anhören. Gerade diese Vorträge haben mir aber gezeigt, dass ein enormer Wissensdurst bzgl. des Zusammenhangs zwischen Gehirn und Musik im Speziellen und zwischen Gehirn und Lernen im Allgemeinen herrscht. Häufig wurde ich nach meinen Vorträgen gefragt, ob ich meinen Vortrag niedergeschrieben habe und wo man ihn nachlesen könne. Eigentlich bin ich mit diesem Buch genau diesen Wünschen jetzt nachgekommen. Bei der Zusammenfassung bin ich natürlich weit über das hinausgegangen, was ich in meinen Vorträgen vorgetragen haben. Allerdings bin ich immer einem roten Faden gefolgt, der hoffentlich auch für den Leser dieses Buches nachvollziehbar ist. Der rote Faden ist durch folgende Fragen definiert:
1. Hat Musikhören und Musizieren einen Einfluss auf das Lernen?
2. Gibt es spezifische Transfereffekte vom Musizieren zu anderen geistigen Tätigkeiten, die oberflächlich nichts mit der Musik gemein haben?
3. Wie wird Musik im Gehirn verarbeitet und wie gelingt es unserem Gehirn, die komplexen Mechanismen des Musizierens zu bewerkstelligen?
Diesem roten Faden folgend stößt man auf interessante Ergebnisse, aber auch auf viele offene Fragen. Ohne die Inhalte vorwegzunehmen, kann festgestellt werden, dass immer mehr Querverbindungen zwischen verschiedenen Aspekten der Musik und der menschlichen Kognition festgestellt werden. Allerdings sind die Beziehungen meist komplizierter und manchmal subtiler als bislang gedacht. Insofern werden die oben gestellten Fragen nicht mit einfachen plakativen «Jas» und «Neins» oder – im Fall der dritten Frage – mit einer eindeutigen Erklärung beantwortet, sondern differenziert dargestellt werden. Ich habe mich bemüht, eine allgemeinverständliche Sprache zu finden, um damit auch Nichtfachleute anzusprechen. Deshalb habe ich versucht, an vielen Stellen des Buches die Fachbegriffe in alltagstaugliche Begriffe umzuwandeln. Wenn mir kein Begriff diesbezüglich eingefallen ist, habe ich die Fachbegriffe dann in Fußnoten erläutert. Bevor ich allerdings mit der faszinierenden Reise in die Welt der Forschung beginne, erlaube ich mir, einige grundlegende Begriffe zu erläutern, um das Verständnis für die Inhalte des Buches zu fördern.
Von Kognitionen, psychischen Funktionen und Genen
Im Verlauf dieses Buches werde ich häufig die Begriffe «Kognition», «kognitive Funktionen» oder auch «psychische Funktionen» verwenden. Unter dem Begriff der Kognition fassen wir die psychischen Funktionen Denken, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis und Handlungskontrolle zusammen. Diese Funktionen zu erforschen, ist Gegenstand der kognitiven Psychologie. Die kognitive Psychologie ist auch ein relativ junges Forschungsgebiet, das sich erst in den 1960er-Jahren etabliert hat. Den Zusammenhang zwischen den Kognitionen und dem Gehirn erforscht das neue Forschungsfeld der kognitiven Neurowissenschaften. Dieses Forschungsgebiet interessiert sich für die Verankerung der Kognitionen im Gehirn. Hier geht es zum Beispiel um die Frage, welche Hirngebiete mit den entsprechenden Kognitionen betraut sind und wie das Gehirn diese Kognitionen kontrolliert. Die kognitiven Neurowissenschaften benötigen das theoretische Inventar der kognitiven Psychologie. Sie nutzen Modelle, Theorien und Techniken aus der kognitiven Psychologie. Im Zusammenhang mit vielen Befunden aus dem Bereich der kognitiven Neurowissenschaften wird immer wieder der Einfluss der Gene auf unser Verhalten thematisiert. Gene sind zweifellos wichtig, aber sie interagieren immer mit Umweltreizen. Unser Gehirn entfaltet sich nur in Abhängigkeit von den spezifischen Erfahrungen. Insofern ist auch unsere Intelligenz und Lernfähigkeit nur teilweise durch genetische Einflüsse determiniert. Es wurde viel darüber spekuliert und diskutiert, welchen konkreten Einfluss die Gene auf unser Verhalten haben. Derzeit besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass unsere psychischen Leistungen durch eine Wechselwirkung zwischen Anlage, Umwelt und Trainingsmöglichkeiten bestimmt wird. Ich versuche diese Wechselwirkung durch eine einfache Formel deutlich zu machen:
Transfer
Ein zentrales Thema dieses Buches ist ja die Frage, ob Musizieren oder gar Musikhören einen günstigen oder weniger günstigen Einfluss auf das Lernen und Gedächtnis haben könnte. Solche Übertragungseffekte sind für die Lern- und Gedächtnispsychologie von herausragender Bedeutung. Wenn das Erlernen oder Üben einer Aufgabe zu einem Lerneffekt bei einer anderen Aufgabe führt, spricht man von Mitübung, Übungsübertragung oder Transfer. Man unterscheidet verschiedene Formen des Transfers. Im Hinblick auf das Lernergebnis unterscheidet man positiven von negativem Transfer. Positiver Transfer erleichtert das nachfolgende Lernen, während negativer Transfer das nachfolgende Lernen erschwert. Wenn kein Lerneffekt vorliegt, spricht man auch von einem Nulltransfer. Wenn nicht das Ergebnis, sondern Lernprozesse im Vordergrund stehen, spricht man proaktiver respektive retroaktiver Hemmung. Während die proaktive Hemmung das Behalten oder die Wiedergabe des späteren Inhalts beeinträchtigt, bezeichnet retroaktive Hemmung eine Beeinträchtigung eines früher gelernten Inhalts durch den späteren Inhalt. Eine etwas andere Beschreibung von solchen Übertragungseffekten bezieht sich auf die Ähnlichkeit des Gelernten. So kann man einen lateralen von einem vertikalen Transfer unterscheiden. Unter lateralem Transfer versteht man die Anwendung einer erlernten Fertigkeit auf ähnliche Situationen des gleichen Komplexitätsniveaus. Als vertikalen Transfer bezeichnet man die Übertragung bzw. das Anwenden von gelernten einfachen Fähigkeiten auf das Erlernen höherer (komplexerer) Fähigkeiten. Die neurophysiologischen Grundlagen von solchen Transfereffekten sind bislang noch nicht eindeutig bekannt. Man kann sich allerdings sehr gut vorstellen, dass ähnliche Reize im Gehirn durch die gleichen Hirngebiete verarbeitet werden. Ein Ton und ein Vokal haben ähnliche physikalische Anteile. Insofern ist es einsichtig, dass Töne und Vokale teilweise von ähnlichen Hirnstrukturen verarbeitet werden. Ähnlichkeiten finden sich nicht nur auf den untersten Ebenen der Reizverarbeitung, sondern zunehmend auch auf übergeordneten Verarbeitungsebenen. So wird auch die zeitliche Abfolge von Tönen, Lauten aber auch Bewegungen durch die gleichen Hirnstrukturen kontrolliert. Neben den beteiligten Hirnstrukturen und psychologischen Prozessen sind auch die gelernten Assoziationen (Verbindungen) zwischen verschiedenen Lerninhalten wesentlich für das Zustandekommen von Transfereffekten. Wenn z.B. ein Reiz mit einer ganz bestimmten Reaktion gekoppelt ist, dann wird es schwierig sein, zu lernen, dass dieser Reiz mit einer ganz anderen Reaktion in Verbindung zu bringen ist. Die zweite Reaktion wird nur anbindbar sein, wenn sie der ersten sehr ähnlich ist. Ähnlich wird es auch beim Ankoppeln von verschiedenen Gedächtnisinhalten sein. Besteht eine fest etablierte Verbindung zwischen zwei Inhalten, dann wird es schwierig sein, einen neuen Gedächtnisinhalt einzufügen, der überhaupt keinen Bezug zu den angebundenen Informationen hat. Die Frage, ob und wie viel Lernübertragung von einem Lerninhalt auf einen anderen besteht, wird vor allem im pädagogischen Kontext im Hinblick auf die Bedeutung formaler Bildung sehr intensiv diskutiert. So wird zum Beispiel diskutiert, dass die Inhalte der Schulfächer für sich genommen eigentlich nicht wichtig seien, sondern die Lernübertragung von dem jeweiligen Schulfach auf andere Lernsituationen. So sei beispielsweise Latein für sich genommen als Sprache eigentlich nicht wichtig, sondern der Schüler lerne durch die Beschäftigung mit lateinischen Texten, logisch zu denken, Texte zu interpretieren und vieles mehr. Ob dies der Fall ist, ist bislang nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden. Aber man darf davon ausgehen, dass solche übergeordneten Lerntransfers wirklich stattfinden. Wahrscheinlich werden solche übergeordneten Lerntransfers auch durch den Musikunterricht ausgelöst.
Wunderwelt der Neuroanatomie und Bildgebung
An einigen Stellen des Buches werde ich nicht umhin können, neuroanatomische Begriffe zu verwenden. Für den Laien sind diese Begriffe nicht unmittelbar verständlich. Meistens sind sie in lateinischer oder griechischer Sprache. Gelegentlich werden sie auch noch abgekürzt und wirken für den Laien dann noch unverständlicher. Wenn es möglich ist, habe ich deshalb deutsche Begriffe verwendet. Eine Übersicht über die anatomische Einteilung des Gehirns habe ich in Abbildung 1 dargestellt.
Wenn ein Baby zur Welt kommt, beträgt das Hirngewicht ungefähr 400 Gramm. In den ersten fünf bis sechs Jahren des menschlichen Lebens passiert etwas Wunderbares und Erstaunliches. Das Gehirn wächst bis zirka zum 6. Lebensjahr um das Dreifache, von 400 Gramm auf 1200 Gramm. Danach kommt es zu einigen kleinen aber durchaus markanten internen Veränderungen des Gehirns, aber das Hirngewicht ändert sich dann nicht mehr so dramatisch. Das erwachsene Gehirn wiegt etwa 1,3 bis 1,4 Kilogramm, und man schätzt, dass es aus etwa 100 Milliarden Gehirnzellen besteht. Diese Gehirnzellen werden auch Nervenzellen oder Neurone genannt. Neurone haben einen Zellkörper und kurze und lange Fasern, die mit den Zellkörpern und Fasern anderer Neurone Kontakt aufnehmen. Die Fasern, die Informationen zum Nervenzellkörper übermitteln, werden Dendriten genannt, jene Fasern, welche Informationen vom Nervenzellkörper fortleiten, nennen wir Axone. Diese Fasern kann man auch in Analogie zur Telefontechnik als Kabel bezeichnen. Über diese Verbindungen wird ein gigantisches Netzwerk aufgebaut. Man schätzt, dass rund eine Million Milliarden (1015) Verbindungen zwischen den Nervenzellen existieren. Unser Gehirn schaltet immer Gruppen von Nervenzellen zusammen, um bestimmte Aufgaben zu bewältigen, nie sind nur einzelne Nervenzellen aktiv. Über diese Kabelsysteme werden elektrische Informationen übermittelt. An den jeweiligen Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen wird in Abhängigkeit der elektrischen Erregung ein chemischer Botenstoff ausgeschüttet (Transmitter), der über den kleinen Spalt zwischen den Kontaktstellen «hinüberwandert» und auf der anderen Seite wieder elektrische Erregungen auslöst. Die elektrische Aktivität des Gehirns kann mit speziellen Verfahren gemessen werden. Dazu gehört die Elektroenzephalographie (EEG). Hierbei werden auf dem Kopf der Versuchspersonen Elektrodenkappen angebracht, welche die kleinen elektrischen Spannungsschwankungen des Gehirns messen. Das EEG ist besonders gut geeignet, um elektrische Hirnaktivität mit hoher zeitlicher Auflösung zu messen. Man kann mittlerweile anhand der Verteilung der elektrischen Aktivität an der Schädeloberfläche recht gut auf die zugrundeliegenden Quellen zurückschließen. Allerdings ist die Genauigkeit der Schätzung im Vergleich zu anderen Verfahren nicht besonders hoch. Eine etwas komplexere Methode misst die durch die elektrische Aktivität entstandenen Magnetfelder an der Kopfoberfläche. Dieses Verfahren nennen wir Magnetenzephalographie (MEG). Sehr beliebt ist die Magnetresonanztomographie (MRT). Dieser komplizierte Name wird für eine sehr beliebte Methode der kognitiven Neurowissenschaften verwendet, mit der man sehr präzise anatomische Bilder des menschlichen Gehirns anfertigen kann. Diese Methode ist völlig nichtinvasiv und kann wiederholt eingesetzt werden. Eine Spezialvariante ermöglicht das Messen der Hirndurchblutung. Man nennt diese Methode funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), da prinzipiell ähnliche physikalische Grundlagen wie bei der MRT-Technik zur Anwendung kommen. Die räumliche Auflösung dieser Methode ist hervorragend (ca. 3 mm3), während die zeitliche Auflösung eher mäßig ist, denn die Durchblutungsveränderung erreicht zirka sechs bis acht Sekunden nach Reizdarbietung ihr Maximum. Im Vergleich dazu verfügt das EEG und MEG über eine zeitliche Auflösung im Millisekundenbereich. Bei den MRT-Methoden müssen die Versuchspersonen in eine «Magnetröhre» geschoben werden. Bei zirka acht bis zehn Prozent der Versuchspersonen kann man dann Engegefühle beobachten. Gerade empfindliche Musiker haben gelegentlich Probleme mit den fMRT- und MRT-Messungen. Das EEG ist demgegenüber wesentlich unproblematischer, weil es eleganter in Versuchen bei unterschiedlichen Versuchspersonen eingesetzt werden kann (z.B. Kinder und sensible Personen).
Abbildung 1: Schematische Darstellung wichtiger Hirnstrukturen. A. Frontalkortex (Stirnhirn), B: Temporalkortex (Schläfenlappen), C: Parietalkortex (Scheitellappen), D: Occipitalkortex (Hinterhauptlappen), E: Cerebellum (Kleinhirn).
Von Zeitschriften und Büchern
Der berühmte und allseits geehrte Psychologe Gustav Lienert hat einmal gesagt, dass Wissen eine «Ware» sei, die den Wissenschaftlern angeboten werden müsse. Ob Wissen nun wirklich eine Ware im Sinne betriebswirtschaftlicher Überlegungen ist, kann man durchaus diskutieren. Unbestritten ist allerdings, dass man Wissen – vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse – verbreiten und bekannt machen muss. Deshalb veröffentlichen Wissenschaftler ihre Erkenntnisse in spezialisierten Zeitschriften oder in Büchern. Bei wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es mittlerweile üblich, dass die Erkenntnisse zunächst in spezialisierten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden. Diese Zeitschriften verfügen in der Regel über ein so genanntes Peer-Review-System. Das bedeutet, dass die Arbeiten vor der Veröffentlichung von Fachleuten (den peers) begutachtet werden. Man muss sich das ungefähr so vorstellen: Weltweit wird nach fachkundigen Kollegen gesucht, die als Editoren und Herausgeber der jeweiligen Fachzeitschrift wirken könnten. Übergeordnete wissenschaftliche Fachverbände, aber auch einzelne Wissenschaftler können für diese Positionen Fachkollegen vorschlagen. Aus der Gruppe der vorgeschlagenen Wissenschaftler werden dann einige als Editoren und Gutachter gewählt. Diese Fachleute verrichten ihre Arbeiten ehrenamtlich. Insofern werden diese Tätigkeiten von den Wissenschaftlern nicht nur als Last, sondern auch als Ehre empfunden, denn in der Regel werden ja nur besonders ausgewiesene Fachleute als Gutachter und Editoren von den Kollegen akzeptiert. Wird nun eine Arbeit bei der entsprechenden Zeitschrift eingereicht, entscheidet der zuständige Editor, wer die Arbeit zu begutachten hat. Häufig werden weltweit Fachleute angesprochen. Die lesen die Arbeit und entscheiden dann, ob sie für die Zeitschrift geeignet ist und bestimmten wissenschaftlichen Standards genügt. Hierzu fertigen sie teilweise umfangreiche Gutachten an, in denen sie auf Mängel und Probleme hinweisen. Wenn die Arbeit als geeignet bewertet wird, sind die Autoren in der Regel angehalten, den Änderungswünschen der Gutachter nachzukommen. Die revidierte Fassung wird dann wieder neu eingereicht und die Gutachter beginnen erneut, an der eingereichten Arbeit zu arbeiten. Das geht so lange weiter, bis die Arbeit zur Publikation angenommen respektive abgelehnt wird. Prinzipiell kann man festhalten: Je angesehener die wissenschaftliche Zeitschrift, desto schwieriger ist es, dort eine wissenschaftliche Arbeit zu veröffentlichen. Die Güte einer Zeitschrift drückt sich in verschiedenen Kennwerten aus, auf die ich an dieser Stelle nicht näher eingehen möchte. Wichtig ist aber, dass die jeweiligen wissenschaftlichen Zeitschriften aufgrund ihres Ranges natürlich unterschiedlichen «Wert» haben. Science, Nature, Nature Neuroscience, Neuron, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States oder Psychological Science sind sehr geachtete Zeitschriften. Die Ablehnquoten für dort eingereichte Arbeiten sind sehr hoch (ca. 80 %). Zeitschriften, die kein Peer-Review-System haben, sind mit «Vorsicht zu genießen», ebenso Zeitschriften mit niedrigem wissenschaftlichem Qualitätsstandard. Vor allem im Kontext dieses Buches ist es von besonderer Bedeutung darauf hinzuweisen, denn zum Thema dieses Buches finden sich in allen möglichen Publikationsformen Beiträge. So ist z.B. das Internet voll mit Webseiten, welche die fördernde Wirkung von Musik auf das Lernen und Gedächtnis thematisieren. Man muss auch ein wenig «gewappnet» sein, wenn man sich mit Buchpublikationen auseinandersetzt. Es existieren einige Buchpublikationen, in denen experimentelle Befunde publiziert worden sind, die keinem strengen Peer-Review-Verfahren ausgesetzt waren. Insofern muss man immer genau hinschauen, wo die Befunde publiziert worden sind. Im Grunde genommen kann man festhalten, dass eine nichtkontrollierte oder wenig kotrollierte Publikation immer weniger Gewicht haben sollte, als streng begutachtete Veröffentlichungen.
Die Geschichte dieses Buches
Das Buch beginnt mit dem «Mozart-Effekt», der wie kaum ein anderer Befund in den letzten 20 Jahren gerade bei Nichtfachleuten für Furore gesorgt hat. Im Grunde ist ein Großteil der Aufmerksamkeit, welche die experimentelle Musikforschung genießt, auf diesen «Effekt» zurückzuführen. Der Originalartikel wird in der wissenschaftlichen Literatur zwar relativ häufig besprochen (von 1992 bis 2007 ca. 140mal) hat aber bemerkenswerterweise mehr «Erfolg» beim Laienpublikum. Insofern ist eine differenzierte Betrachtung dieses «Effektes» durchaus angebracht.
In Kapitel 3 werde ich mich den Längsschnittstudien widmen, in denen überprüft wurde, ob ein formales Musiktraining über einen längeren Zeitraum hinweg günstige oder vielleicht auch negative Einflüsse auf verschiedene Kognitionen oder Schulleistungen haben kann. Eigentlich sind Längsschnittstudien wichtige Erkenntnisquellen, um mögliche Transfereffekte zu überprüfen. Es sind allerdings nicht viele Arbeiten diesbezüglich publiziert worden. In diesem Kapitel bespreche ich auch die im deutschsprachigen Raum so intensiv diskutierte Bastian-Studie.
Die meisten Arbeiten, welche zum Thema publiziert worden sind, sind Querschnittuntersuchungen (Kap. 4). Mit diesem Untersuchungsansatz werden Musiker mit Nichtmusikern hinsichtlich verschiedener Leistungsmaße verglichen. Man misst beide Gruppen zu einem bestimmten Zeitpunkt und nicht wiederholt. Mit diesem Versuchsansatz sind einige methodische Probleme verbunden, die ich auch ansprechen werde.
Passives Hören von Musik ist sicherlich eines der interessantesten Themen. Immer wieder wird diskutiert, ob man während des Musikhörens besser oder schlechter lernt (Kap. 5). Oft wird auch die Frage diskutiert, ob passives Musikhören einen Einfluss auf Autofahren oder die Bewegungsgenauigkeit bei verschiedenen Bewegungen hat.
In Kapitel 6 wird ein zentraler Aspekt dieses Buches behandelt. Hierbei geht es um den Zusammenhang zwischen Musik und Emotionen. Unter welchen Umständen bestimmte Emotionen durch das Hören von Musik ausgelöst werden, wird in diesem Kapitel dargestellt werden. Dabei werden auch Querbezüge zu den Inhalten anderer Kapitel gezogen, denn letztlich haben die Emotionen auch erhebliche Einflüsse auf das Lernen und das Gedächtnis.
Wie das Gehirn Musik verarbeitet, ist das Thema des siebten Kapitels. Hierbei werden neue Erkenntnisse aus den kognitiven Neurowissenschaften verarbeitet.
Es folgt dann ein Kapitel, in dem die Veränderbarkeit (in der Fachsprache als Plastizität bezeichnet) des Gehirns in Abhängigkeit des Musiktrainings thematisiert wird. Hierbei werden auch durchaus kontroverse Themen und Interpretation angeschnitten. Insbesondere wird in diesem Kapitel auch die Frage erörtert, ob vielleicht Wolfgang Amadeus Mozart eher als ein «Produkt» intensiver Lernbemühungen aufzufassen ist.
Neuerdings wird Musik sehr stark mit sprachlichen Fertigkeiten in Verbindung gebracht. Die derzeit bekannten Zusammenhänge zwischen Musik und Sprache werden in Kapitel 11 mit dem Titel Musik und Sprache thematisiert. Hierbei werden auch mögliche Anwendungsmöglichkeiten von Musik zur Verbesserung von Sprachfunktionen angedacht.
In Kapitel 12, Musik und Alter, wird die These vertreten, dass auch ältere Menschen durch Musizieren aber auch konzentriertes Hören von Musik profitieren können.
Abschließende Bemerkungen
Abschließend erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass ich mich bemüht habe, den aktuellen Wissensstand so präzise wie möglich darzustellen. Es mag sein, dass ich die eine oder andere Arbeit nicht referiert oder auch nicht genug gewürdigt habe. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ein solches Buch beruht immer auf persönlichen Gewichtungen. Es mag auch durchaus möglich sein, dass in Zukunft einige Befunde relativiert werden. Andere werden wahrscheinlich erhärtet oder erweitert. Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn befindet sich in einem ständigen Fluss. Um dem gerecht zu werden, habe ich mich bemüht, die Befunde so sachlich wie möglich darzustellen.
2 Der Mozart-Effekt – Beginn eines Mythos
Ein alter Traum der Menschheit ist es, einfach und bequem zu lernen. Schon in der griechischen Philosophie ist dieses Thema sehr beliebt gewesen. In der griechischen Mythologie gibt es sogar eine Göttin für das Gedächtnis. Mnemosyne wurde sie genannt und galt bei den Griechen als die Mutter aller Musen. Neben der Göttin des Gedächtnisses gab es auch noch Lethe, den Fluss des Vergessens. Aus ihm tranken die Seelen der Verstorbenen, um die leidvollen Erinnerungen an das irdische Leben zu vergessen. Die griechischen Philosophen haben auch die ersten systematischen Methoden zur Steigerung von Gedächtnisleistungen erfunden. Trotz aller Techniken zur Verbesserung des Lernens und des Gedächtnisses ist es dem Menschen bislang noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, die es ihm erlaubt, ohne Anstrengung etwas zu lernen. Im späten Mittelalter hatte sich der Begriff des «Nürnberger Trichters» verbreitet, mit dem die Vorstellung verbunden war, dass Schüler etwas «eingetrichtert» bekommen und fast ohne Aufwand und Anstrengung sich etwas aneignen könnten. Allerdings offenbarte diese eher scherzhafte Vorstellung keine vernünftigen didaktischen Maßnahmen. Einen künstlerischen Ausdruck gewann der Wunsch, ohne Mühe zu lernen, in verschiedenen Kinofilmen. Die bekanntesten dieser Art sind «Projekt Brainstorm» und «Strange Days». Obwohl beide Filme in kommerzieller Hinsicht Flops waren, haben sie in beeindruckender Art und Weise das Thema des Lernens und «Überspielens» von Gedanken und Empfindungen von einem Menschen auf den anderen künstlerisch verarbeitet. Im Wesentlichen geht es um die Aufzeichnungen von Erfahrungen und Gefühlen anderer Menschen mittels spezieller Apparaturen. Diese Apparaturen erlauben das «Überspielen» der so gespeicherten Informationen auf andere Personen. Auf diese Art und Weise können Personen ohne Mühe in den Genuss von Erfahrungen anderer Menschen kommen. Obwohl in diesen Filmen beeindruckend dargestellt, sind wir bis heute zu solchen technischen Kabinettstücken nicht fähig. Allerdings offenbaren diese Themen eindrücklich einen der geheimsten Wünsche des Menschen, nämlich ohne Mühe Erfahrungen zu erwerben. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, das die Öffentlichkeit hellhörig wird, wenn in einer berühmten und hoch angesehenen Zeitschrift berichtet wird, dass das mühelose Hören einer Mozart-Sonate für die Dauer von höchstens 10 Minuten räumliche Wahrnehmungsleistungen steigern würde. Wird hier ein alter Menschheitstraum wahr? Kann man wirklich ohne Mühe seine Wahrnehmungsleistungen steigern? Vielleicht kann man auf diese Art und Weise auch andere Denktätigkeiten verbessern? Sicher das wäre ein bemerkenswerter Durchbruch, sie hören Robbie Williams und lösen danach Intelligenztestaufgaben schneller und effizienter. Bevor wir hier zu euphorisch werden, wenden wir uns zunächst einmal den Befunden zu.
2.1
Der Beginn
Unter dem Begriff «Mozart-Effekt» wird ein kurzzeitig fördernder Einfluss passiven Hörens von zehn Minuten Mozart-Musik (genauer: der Sonate KV 4481) auf verschiedene intellektuelle Leistungen zusammengefasst. Die erstmalige Erwähnung dieses Begriffes wird Alfred A. Tomatis zugeschrieben, der damit zum Ausdruck bringen wollte, dass bei Kindern unter drei Jahren eine vermeintliche Steigerung der Hirnentwicklung ausgelöst werden könne, wenn Kinder Musik von Wolfgang Amadeus Mozart hören würden. Obwohl diese Annahme wissenschaftlich überhaupt nicht begründet war, hat sich dieser Begriff (wie auch die von Tomatis begründete und gleichsam wissenschaftlich nicht belegte Tomatis-Therapie2) insbesondere in der populärwissenschaftlichen Presse und Literatur gehalten. Die Ideen und Spekulationen der Tomatis-Therapie wurden nie ernsthaft einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Aus diesem Grunde liegt auch bis heute nicht eine wissenschaftliche Publikation in einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitung vor (!), welche die Wirksamkeit der Tomatis-Therapie und des von Tomatis angenommenen Effektes des Musikhörens auf die kindliche Hirnentwicklung belegt.
Anders verhält es sich mit einem in der Folge ebenfalls als «Mozart-Effekt» beschriebenen Phänomens, das prinzipiell nichts mit der von Tomatis beschriebenen Spekulation gemein hat. Dieses Phänomen beruht auf einer Publikation der Psychologen Frances Rauscher und Kim Ky sowie des Physikers Gordon Shaw in der angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift Nature aus dem Jahr 1993 (Rauscher, Shaw und Ky, 1993). Grundlage dieser Publikation ist ein Modell, das der Physiker Gordon Shaw bereits in anderen nicht minder angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht hatte (Shaw, Silverman und Pearson, 1985). Zentrale Annahme dieses Modells ist, dass eine Reihe von Denk- und Wahrnehmungsprozessen mit ganz spezifischen Aktivierungsmustern im Gehirn gekoppelt seien. Diese Aktivierungsmuster sollen im Hinblick auf ihre räumliche Verteilung (symmetrisch um den Aktivierungsfokus) und ihre zeitliche Entwicklung spezifisch sein. Diese Überlegung wird anhand des von Shaw vorgeschlagenen Trionen-Modells mit Grundprinzipien der menschlichen Neuroanatomie in Verbindung gebracht.
Grundannahme dieses Modells sind die «Trione». Der Begriff «Trione» wurde ursprünglich von Gordon Shaw geprägt und soll Teile von kortikalen Kolumnen beschreiben. Kortikale Kolumnen sind senkrecht angeordnete Säulen in der Hirnrinde, in denen die Nervenzellen zu funktionellen Einheiten zusammengeschaltet sind. Die einzelnen Trione sind wiederum zu größeren Netzwerken (Trionennetzwerken) zusammengeschlossen. Diese Gruppe von Kolumnen kann viele raum-zeitliche Aktivierungsmuster annehmen. Damit ist gemeint, dass durch unterschiedliche Aktivierungsmuster verschiedene Trione zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktiv werden können. Nicht nur das raum-zeitliche Aktivierungsmuster kann sich ändern, sondern auch die Aktivitätsstärke. So sollen mindestens drei Aktivitätsstärken, nämlich durchschnittlich, unterdurchschnittlich und überdurchschnittlich, möglich sein. Je nach Aktivierungsmuster sollen verschiedene Gedächtnisfunktionen mehr oder weniger besser ablaufen. Shaw geht davon aus, dass für verschiedene intellektuelle Leistungen bestimmte Aktivierungsmuster von Trionennetzwerken typisch seien. Je nach durchgeführter intellektueller Leistung sollen diese neuronalen Aktivierungsmuster in ganz bestimmten Hirngebieten auftreten. Grundsätzlich werden im Rahmen dieses Modells zwei unterschiedliche Typen des Denkens bzw. von intellektuellen Funktionen unterschieden, die jeweils mit unterschiedlichen raum-zeitlichen Hirnaktivierungsmustern einhergehen sollen: (1) das so genannte räumlich-zeitliche (spatialtemporal: ST) und (2) das sprachlich-analytische (language-analytic: LA) Denken. Beide Denktypen sollen grundlegend für unser Problemlösen und unsere Kreativität sein. Hierbei sollen beide Denktypen abwechselnd als Strategien eingesetzt werden. Die sprachlich-analytische Strategie soll vor allem dann eingesetzt werden, wenn wir Probleme lösen und zu quantitativen Ergebnissen kommen. Die Strategie des räumlichzeitlichen Verarbeitens soll dann zum Einsatz kommen, wenn wir mentale Bilder verarbeiten und diese auch zum Lösen von zukünftigen oder gegenwärtigen Problemen nutzen (z.B. beim Schach, wenn mehrere Züge im Voraus geplant werden).
Die interessante (allerdings vereinfachende) Annahme von Shaw ist, dass räumlich-zeitliche Verarbeitungsmuster grundlegend für einige kognitive Prozesse seien. So sollen mathematisches Schlussfolgern, logisches Denken und die Verarbeitung bzw. Wahrnehmung bestimmter Musikstücke eher durch ganz bestimmte räumlich-zeitliche Aktivierungsmuster in bestimmten Hirnregionen gefördert werden. Der Kern der Überlegung ist, dass diese jeweils spezifische Hirnaktivierung zu eher bildhaften Verarbeitungsstrategien (wie Vorstellung, Visualisierung etc.) führt. Um dies zu erläutern, führt Shaw Beispiele von außergewöhnlichen Menschen an, die infolge ihrer besonderen Fähigkeit mit solchen visuellen Vorstellungsstrategien außerordentliche Leistungen erbracht hätten. So wird eine Autistin dargestellt, die aufgrund ihrer hervorragenden Fähigkeit, sich mental Bilder vorzustellen, zu bemerkenswerten neuen Erkenntnissen in der Viehhaltung gekommen sei, weil sie sich in die Lage habe versetzen können, quasi virtuell als Tier durch die Tierhaltungsanlagen zu streifen. Im Zuge solcher Darstellungen kommt Shaw zu dem Schluss, dass Mathematik und Musik Gemeinsamkeiten hätten. Als Beleg führt er unter anderem an, dass die «alten» Griechen Musik als einen der vier Zweige der Mathematik aufgefasst hätten. Des Weiteren gibt er an, dass schon bekannt sei, dass eine Korrelation zwischen Musik- und Mathematikleistungen bestehe. Durch diese inhaltliche Nähe führe die Stimulation mit Musik zu einer räumlich-zeitlichen Hirnaktivierung, die ähnlich jener sei, welche auch beim optimalen Lösen von Mathematikaufgaben vorteilhaft ist. Aber warum gerade Mozart-Musik?
Shaw gibt an, deshalb gemeinsam mit Frances Rauscher Mozart-Musik gewählt zu haben, weil Wolfgang Amadeus Mozart bereits im Alter von vier Jahren komponiert habe, ohne eine Note seiner Niederschriften zu korrigieren. Offenbar wird dies als Hinweis auf seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Hinblick auf die Visualisierung von Noten und die daraus abgeleitete Lern- und Speicherfähigkeit herangezogen. Aus diesem Grunde sind sie offenbar davon ausgegangen, dass die vermuteten außergewöhnlichen visuellen Fähigkeiten von Wolfgang Amadeus Mozart sich auch in der von ihm komponierten Musik niedergeschlagen hätten. Des Weiteren sollte wohl diese Musik wiederum die gleichen Hirnaktivierungen beim Hörer hervorrufen, welche bei Mozart vorlagen, als er die Musik komponierte. Rauscher und Shaw haben zwar nie explizit den Bezug zu Mozarts Hirnaktivierungen gezogen, aber aus den wenigen ihrer diesbezüglichen Zitate ist für mich nur diese logische Schlussfolgerungskette (Shaw, 2001) nachvollziehbar: «Frances Rauscher and I chose Mozart since he was composing at age 4 and could write down an entire composition without changing a note. Thus we felt that Mozart was the prime candidate for his music to resonate with the innate columnar cortical structure.»
Aufgrund dieser Überlegungen kam es zu der ersten Studie, in der die kurzfristige Wirkung des Hörens einer Mozart-Sonate auf das Lösen von räumlichen Aufgaben untersucht wurde. In dieser Publikation berichten Rauscher und Kollegen über ein Untersuchungsergebnis, das bis heute insbesondere die populärwissenschaftliche Presse interessiert. Die Forscher hatten insgesamt 36 College-Studenten untersucht, die drei unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt waren: In einer Bedingung hörten die Versuchspersonen die ersten zehn Minuten von Mozarts Sonate für zwei Klaviere in D-Dur (KV 448). In einer zweiten Bedingung hörten die Versuchspersonen Entspannungsinstruktionen und in der dritten Bedingung saßen die Versuchspersonen in völliger Stille und hörten demnach nichts. Unmittelbar nach jeder Versuchsbedingung waren die Versuchspersonen angehalten, jeweils einen Untertest des Stanford-Binet-Intelligenztestes zu bearbeiten. Hierbei handelte es sich um einen Test, der insbesondere räumlich-intellektuelle Leistungen erfasst (Musteranalyse, Matrizentest und ein so genannter Papierfaltetest). Rauscher und Kollegen stellten eine vorübergehende Steigerung des räumlichen Denkens nur nach der Darbietung der Mozart-Klaviersonate fest. Konkret konnten sie zeigen, dass die Leistungen in diesen Untertests nach der Präsentation der Mozart-Sonate 119 IQ-Punkte betrug, während nach dem Hören der Entspannungsinstruktion ein IQ von 111 und in der Ruhebedingung ein IQ von 110 erzielt wurde. Die unterschiedlichen Messwerte wurden dann noch einer statistischen Analyse unterzogen, wobei sich ergab, dass die räumlichen Leistungen nach der Präsentation der Mozart-Sonate signifikant höher ausgefallen waren als die räumlichen Leistungswerte nach der Entspannungsinstruktion und der Ruhebedingung. Die Leistungskennwerte nach der Ruhebedingung und nach der Entspannungsinstruktion waren identisch und unterschieden sich demzufolge auch statistisch nicht voneinander. Zur Kontrolle der allgemeinen vegetativen Erregung haben die Forscher noch die Pulsrate (also die Herzschlagfrequenz) jeweils vor und nach den Versuchsbedingungen gemessen. Die Pulsraten unterschieden sich nicht für die drei Versuchsbedingungen. Daraus schlossen die Forscher, dass die grundlegende Erregung in allen drei Bedingungen identisch war und demzufolge die unterschiedlichen kognitiven Leistungen nicht auf einen allgemeinen und damit unspezifischen Erregungseffekt zurückzuführen sind. Die Autoren vermerken noch, dass die Verbesserung der kognitiven Leistungen nur temporär und nach zehn bis 15 Minuten wieder verschwunden sei.
Soweit die kurze Darstellung der Publikation und der darin berichteten Befunde (siehe hierzu auch Abb. 2). Es muss noch erwähnt werden, dass die Publikation als «Scientific Correspondence» in Nature erschien und demzufolge nur wenig Raum zur Beschreibung der Einzelheiten zur Verfügung stand. Insofern sind wichtige Informationen, die für die Bewertung der Befunde notwendig wären, nicht aufgeführt. Wir wissen demnach nichts über das Alter und Geschlecht der College-Studenten, auch wissen wir nichts über die grundlegenden intellektuellen Fähigkeiten dieser Studenten. Unbekannt ist auch, ob die Testpersonen musikalische Vorerfahrungen hatten, ob sie ein Instrument spielten, welche Musikpräferenzen sie pflegen oder in welcher Stimmung sie sich zum Zeitpunkt der Untersuchung befanden. Es sind noch viele Fragen offen, die aber hier aus Platzgründen nicht weiter erörtert werden sollen. Wichtiger ist allerdings ein anderer Aspekt, der in dieser Arbeit nicht explizit thematisiert wurde, nämlich ob alle Versuchspersonen die drei Bedingungen in der gleichen Abfolge absolviert haben. Obwohl die Autoren erwähnen, dass sie keine Reihenfolgeeffekte feststellen konnten, wird an keiner Stelle der Publikation erwähnt, ob die Abfolge der Versuchsbedingungen kontrolliert wurde. Üblicherweise werden in solchen Experimenten die Versuchsbedingungen entweder per Zufall dargeboten oder nach bestimmten Plänen realisiert. Bei einer zufälligen Darbietung der Bedingungen wird vor der Untersuchung jeder Versuchsperson die Abfolge der Bedingungen per Zufall ermittelt. Dadurch kann man ausschließen, dass die Ergebnisse einer Bedingung die Ergebnisse der anderen Bedingung beeinflussen. Im Falle der Untersuchung muss man allerdings aufgrund der in der Publikation vorliegenden Informationen davon ausgehen, dass dieser Reihenfolgeeffekt nicht überprüft wurde, demzufolge kann gar nicht eindeutig darauf geschlossen werden, dass die Verbesserung der kognitiven Leistungen durch das Hören der Mozart-Sonate bedingt war.
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Befunde aus der Originalarbeit von Rauscher et al. (1993). Dargestellt sind die Testleistungen in dem verwendeten visuell-räumlichen Test als IQ-Werte. Ein IQ-Wert von 100 entspricht dem Durchschnitt.
In einer Folgestudie, die 1995 in der Zeitschrift Neuroscience Letters publiziert wurde, konnten Rauscher und Kollegen ihren Befund replizieren und ergänzen (Rauscher, Shaw und Ky, 1995). In dieser Arbeit untersuchten sie die räumlichen Fertigkeiten von 79 Studenten. Zur Untersuchung der räumlichen Fertigkeiten kamen 16 Strichzeichnungen zur Anwendung, wonach die Testpersonen erschließen mussten, welche Objekte aus diesen Zeichnungen faltbar sind (so genannte Papierfaltetests). Zusätzlich kam noch ein Kurzzeitgedächtnistest zur Anwendung, der von den Autoren deshalb gewählt wurde, weil sie davon ausgingen, dass die gewählten 16 Testaufgaben (exemplarischer Reiz, der zu lernen war 9!B2?N%) nicht positiv durch die rhythmische Musik oder durch die anderen Bedingungen beeinflusst werden könnten. Das Versuchsdesign war wie folgt angelegt:
1. Zunächst mussten alle 79 Testpersonen im Rahmen einer Kontrollmessung die 16 unterschiedlichen Papierfalteaufgaben absolvieren.
2. Danach erfolgte die Aufteilung der Testpersonen auf drei Versuchsgruppen, wobei darauf geachtet wurde, dass die Ausgangsleistungen in den visuell-räumlichen Aufgaben zwischen den drei Gruppen gleich waren.
Gruppe 1 (Ruhe) saß an vier aufeinanderfolgenden Tagen für jeweils 10 Minuten in völliger Stille; Gruppe 2 (Mozart-Gruppe) hörte an den vier aufeinander folgenden Tagen jeweils für zehn Minuten die bereits in der ersten Studie verwendete Mozart-Sonate und Gruppe 3 (gemischt) hörte an den darauf folgenden Tagen jeweils zehn Minuten ein anderes Musikstück. Am 2. Tag hörten diese Versuchspersonen ein einfaches Musikstück (von Philip Glass), am 3. Tag eine auf Band aufgenommene Geschichte und schließlich am 4. Tag einen zehn Minuten dauernden Ausschnitt eines Trancestückes. Nach jeder experimentellen Bedingung mussten die Testpersonen die 16 Papierfalteaufgaben bearbeiten, wobei die erzielte Leistung dokumentiert wurde. Am 5. Tag wurde noch ein Kontrollexperiment eingeführt, bei dem eine Aufteilung der Gruppe 3 (gemischt) in zwei Gruppen erfolgte. Eine Teilgruppe hörte die Mozart-Sonate, die andere hörte nichts (Ruhebedingung). Nach dieser Exposition mussten diese Testpersonen noch einmal die Kurzzeitgedächtnisaufgaben bearbeiten. Es zeigte sich kein Unterschied im Hinblick auf die Kurzzeitgedächtnisleistungen beider Gruppen, was die Autoren veranlasste, zu vermuten, dass Gedächtnisleistungen durch das passive Hören der Mozart-Sonate nicht beeinflusst würden.
Im Hinblick auf die Leistungen in den visuell-räumlichen Aufgaben konnten die Autoren allerdings feststellen, dass die Versuchspersonen, welche die Mozart-Sonate hörten, unmittelbar nach dem Hören der Musik an den Tagen 2 und 3 erheblich bessere Leistungen in der Papierfalteaufgabe aufwiesen als während der Kontrollmessung (siehe auch Abb. 3 bis 5). Die Versuchspersonen der anderen Gruppen zeigten über die Tage hinweg durchgehend gleich bleibende Leistungen. Besonders heben die Autoren einen Teilbefund hervor, wonach diejenigen Testpersonen, die in der Baselinemessung (Messung vor der Stimulation) niedrige Messwerte erzielt hatten, ihre räumlichen Leistungen erheblich verbesserten, nachdem sie die Mozart-Sonate gehört hatten. Die Verbesserungen betrugen bei der Mozart-Gruppe 62 % von Tag 1 auf Tag 2, während die Ruhe-Gruppe ihre Leistung um 14 % und die Gruppe 3 um 11 % steigerte.
Rauscher und Kollegen weisen explizit darauf hin, dass die Papierfalteaufgabe keine einfache räumliche Aufgabe sei, sondern dass insbesondere die zeitliche Aufeinanderfolge der 16 Aufgaben von wesentlicher Bedeutung sei. Dabei gehen sie davon aus, dass bei jedem Stimulus ein bestimmtes Hirnaktivierungsmuster vorlag. Die Bearbeitung dieser zeitlich-räumlichen Aufgaben soll durch das Hören der Mozart-Sonate optimiert werden. Gemäß ihrer Auffassung soll während des Hörens der Mozart-Sonate ein ganz bestimmtes Hirnaktivierungsmuster erzeugt werden, das letztlich die optimale neuronale Grundlage für das Lösen von räumlichen Aufgaben diesen Typs sei. Sie schlagen zwei Erklärungsmöglichkeiten für den von ihnen gefundenen Effekt vor:
Abbildung 3: Ergebnisse der zweiten Studie von Rauscher et al. (1995). Man erkennt, dass jene Versuchspersonen, welche Mozart-Musik gehört hatten, etwas bessere Leistungen in der Papierfalteaufgabe erzielten. Dieser Unterschied ist auch statistisch signifikant.
Abbildung 4: Teilergebnisse der zweiten Studie von Rauscher et al. (1995). Dargestellt sind die Ergebnisse für die Versuchspersonen, die in der Ausgangsmessung die schlechtesten Testleistungen erzielt hatten. Man erkennt, dass jene Versuchspersonen, welche Mozart-Musik gehört hatten, etwas bessere Leistungen in der Papierfalteaufgabe erzielten. Dieser Unterschied ist auch statistisch signifikant.
1. Passives Hören der Mozart-Sonate würde helfen, die kortikalen Aktivierungsmuster vorzubereiten (räumlich-zeitliche Aktivierungsmuster gemäß dem Trionen-Modell) und zu festigen, die für die Bearbeitung der nachfolgenden räumlichen Aufgaben optimale Voraussetzungen liefern würden. Insbesondere wird vorgeschlagen, dass durch das Musikhören die rechtsseitigen Hirnareale, die für räumliche Wahrnehmungsfunktionen spezialisiert seien, durch die Musik (insbesondere durch die Mozart-Sonate) vorbereitet würden.
2. Als zweite Erklärungsmöglicheit wird vorgeschlagen, dass Mozart-Musik wie eine Art «Übung» wirke, mit der die kognitiven räumlichen Funktionen passiv trainiert würden. Diese «Übung» könne man sich wie eine Vorerregung der an der Lösung der räumlichen Aufgaben beteiligten Aufgaben auffassen.
In der Folgezeit wurden einige weitere, über die ursprünglichen Befunde hinausgehende Ergebnisse von der gleichen aber auch von anderen Arbeitsgruppen publiziert. So wird berichtet, dass Patienten, die unter der Alzheimer-Erkrankung litten, nach dem Hören der Mozart-Sonate kurzfristige Leistungssteigerungen in räumlichen Aufgaben aufwiesen (Johnson, Cotman, Tasaki und Shaw, 1998). Ebenfalls führte die Präsentation der Mozart-Sonate zu reduzierten pathologischen Entladungen bei epileptischen Patienten (Hughes, 2001; Hughes, 2002), und Langzeitbeschallung mit der Mozart-Sonate führte bei Ratten zu besseren Orientierungslernleistungen in künstlichen Labyrinthen (Rauscher, Robinson und Jens, 1998). Erwähnenswert ist, dass dieser Effekt für zirka vier Stunden anhielt. Ist damit der Weg geebnet worden, um Mozart-Musik nun auch im Sinne eines «Medikamentes» oder einer «Therapie» einzusetzen?
2.2
Die Folgen
Die Wirkung insbesondere in der Öffentlichkeit war und ist enorm. Während die Wissenschaftskollegen quasi «staunend» verharrten, reagierte die Öffentlichkeit mit überschwänglichen Pressereaktionen. Eltern und Lehrer griffen diese Befunde, auf der immer währenden Suche noch Optimierungsmöglichkeiten bei der Kindererziehung, begierig auf. Schlagzeilen wie «Musik macht schlau» oder «Babys steigern IQ mit Mozart um 100 %» sind typische Schlagzeilen, die gelegentlich den Blätterwald beherrschen und die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich ziehen. Mittlerweile ist eine Polarisierung in der Öffentlichkeit zu bemerken, wobei einige von der Wirkung überzeugt sind, während andere sich negativ oder gar lächerlich machend über diese Befunde äußern. Es gibt sogar mehrere Webseiten, die neue Befunde und Diskussionsbeiträge publizieren, welche angeblich den «Mozart-Effekt» bestätigen (als Beispiel sei die kurioseste Variante hier erwähnt: http://www.mozarteffect.com/).
Shaw und Rauscher wurden eher zu Spielbällen der Presse und Öffentlichkeit, wobei sie eigentlich, von der enormen Publikumsresonanz getrieben, sich bis heute verteidigen müssen. Einer der Autoren, Gordon Shaw, hat ein Institut mit dem Namen «Music Intelligence Neural Development – M. I. N. D.» gegründet, welches sich der Erforschung und Vermarktung der von ihnen erzielten Befunde widmet. Im Rahmen dieses Institutes werden neue Unterrichtsmethoden insbesondere für den Mathematikunterricht entwickelt und Lehrer ausgebildet, die diese Methoden einsetzen. Hierbei wird Musik und insbesondere Mozart-Musik teilweise als unterstützende Methode eingesetzt. Des Weiteren wird Musizieren, Musikhören aber auch der Umgang mit ausgesuchten Videospielen als didaktisches Hilfsmittel eingesetzt, um das Lernen von Mathematik zu fördern. Im Vordergrund stehen am Institut entwickelte Computerprogramme und didaktische Strategien, die darauf abzielen, mathematische Probleme für Kinder im Vorschulalter und für die unteren Klassen visuell und konkret fassbar zu machen.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass insbesondere Gordon Shaw in mehreren Interviews immer darauf aufmerksam gemacht hat, dass mehr Forschung notwendig sei, um den fördernden Effekt von Musik auf räumliche Funktionen und andere Kognitionen besser verstehen zu können. Ausdrücklich erwähnt er immer wieder, dass nicht nur Mozart-Musik fördernde Effekte habe, sondern dass auch andere Musik solche Einflüsse ausüben könne. Allerdings sei dies bislang noch nicht ausgiebig erforscht worden. So betonte Shaw bis zu seinem Tode im Jahr 2005, dass die Wahrnehmung von Musik eine elementare Form der Wahrnehmung sei, die quasi als Basis für andere höhere kognitive Funktionen diene.
Während Shaw und Rauscher noch mehr oder weniger seriös mit diesem Thema umgehen bzw. umgegangen sind, haben sich die Massenmedien dieses Themas mit großer Vehemenz angenommen. Des Weiteren hat sich eine Gruppe von Personen gebildet, die aus dem Mozart-Effekt eine Art Alternativmedizin und Alternativpädagogik entwickelt haben. Bemerkenswert ist die Vereinfachung und Abstrahierung der Befunde, die dann in der Folge auch zu negativen Ausstrahlungseffekten in der wissenschaftlichen Kollegenschaft führt.
In diesem Zusammenhang werden übertriebene und teilweise irreführende Behauptungen über die Musik formuliert. Ein interessantes Beispiel ist Don Campbell, der die Tendenz hat, die Arbeiten aus diesem Bereich teilweise maßlos aufzubauschen. Er ließ sich sogar den Begriff «Mozart-Effekt» patentieren. Campbell behauptet, er habe durch Summen, Beten und die Selbst-Suggestion von einer vibrierenden Hand an der rechten Seite seines Schädels ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn verschwinden lassen. Unkritische Anhänger der alternativen Medizin hinterfragen seine Behauptung nicht einmal, zumal es sowieso eine dieser wohlfeilen Behauptungen ist, die weder bewiesen noch widerlegt werden können. Er könnte genauso gut behaupten, die Engel hätten sein Blutgerinnsel entfernt. Man fragt sich allerdings: Wenn Musik so gesundheitsfördernd ist – warum hat er dann überhaupt erst ein Blutgerinnsel entwickelt? Hat er vielleicht versehentlich Rap gehört? Auch die Politik hat sich dieses Themas eifrig angenommen. So haben die Gouverneure der US-Staaten Tennessee und Georgia Programme gestartet, mit deren Hilfe jedes Neugeborene eine Mozart-CD erhält. Hunderte von Krankenhäusern wurden im Mai 1999 von der National Academy of Recording Arts and Sciences Foundation mit kostenlosen CDs mit klassischer Musik beschenkt. Das sind gut gemeinte Gesten – aber basieren sie tatsächlich auf stichhaltigen Forschungsbeweisen, die dafür sprechen, dass klassische Musik die Intelligenz eines Kindes oder den Heilungsprozess eines Erwachsenen ankurbelt?
2.3
Replikationsversuche
Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie ich 1995 bei meinem Freund und Kollegen Gottfried Schlaug am Beth Israel Hospital an der Harvard Medical School weilte und wir über den Mozart-Effekt diskutierten. Wir waren fasziniert, da wir selbst gerade heftig mit der Gestaltung von Musikexperimenten beschäftigt waren. Wir versuchten dann, wie wahrscheinlich viele Kollegen weltweit, ähnliche Versuche zu gestalten. Hierbei haben wir dann für unsere Planungen nicht auf die in den ursprünglichen Untersuchungen von Rauscher und Kollegen genutzten Papierfaltetests zurückgegriffen, sondern andere Tests genutzt, die in vielen psychometrischen Untersuchungen typischerweise mit grundlegenden räumlichen Funktionen in Verbindung gebracht werden. So haben wir mit dem mentalen Rotationstest und dem berühmten Blockdesign-Test aus dem Wechsler-Intelligenztest gearbeitet. Allerdings haben wir die Versuche von Rauscher und Shaw nie exakt reproduziert, sondern uns eher Gedanken darüber gemacht, ob Musiker grundsätzlich bessere oder einfach anders organisierte räumliche Fertigkeiten besitzen (auf diese Befunde werde ich in den folgenden Kapiteln noch eingehen).
Der Königsweg innerhalb der experimentellen Wissenschaften, um einen Effekt zu bestätigen, ist die Wiederholung der Experimente, um zu überprüfen, ob bei der Versuchswiederholung die gleichen Ergebnisse erzielt werden. Solche Replikationen können mittels unterschiedlicher methodischer Ansätze bewerkstelligt werden. Diese Replikationen müssen dann miteinander verglichen und zusammengefasst werden. Diese Zusammenfassung erfolgt im Rahmen von so genannten Metaanalysen. Wichtig hierbei ist, dass zwischen den Autoren und Forschungsrichtungen keine direkten Beziehungen im Hinblick auf die zu untersuchende Frage bestehen. Das bedeutet, dass die Arbeiten angefertigt wurden, ohne dass es das Ziel war, sie jemals in einer Metaanalyse weiter zu verarbeiten. Im Rahmen einer anderen Strategie, die als Multicenter-Studie bezeichnet wird, schließen sich verschiedene Forschergruppen zusammen, entwickeln die gleiche Fragestellung und untersuchen gemäß einem gemeinsam entwickelten Versuchsplan simultan an unterschiedlichen Orten das interessierende Phänomen. Im Hinblick auf den Mozart-Effekt wurden 1999 die Ergebnisse von beiden Replikationenstypen in der Zeitschrift Nature publiziert (Chabris, 1999; Steele et al., 1999).
Jeder Forschungsansatz hat seine Schwächen und Stärken, die insbesondere bei psychologischen und pädagogischen Experimenten besonders stark zum Tragen kommen. Bei der Metaanalyse besteht die Gefahr, dass man Arbeiten unterschiedlicher Qualität kombiniert. Das ist durchaus problematisch, denn nicht immer ist aus den Publikationen die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit ablesbar. So besteht die Möglichkeit, dass die Experimente unter ungünstigen oder günstigen Bedingungen (Tageszeit, Ernährungszustand, unterschiedliche Laborausstattung etc.) durchgeführt wurden, die Versuchspersonen sich hinsichtlich nicht kontrollierter Aspekte unterschieden, oder die Versuchsleiter unbewusst auf die Versuchspersonen und deren Leistung Einfluss nahmen. Diese Aspekte darf man nicht unterschätzen, denn sie wirken subtil und können erhebliche Auswirkungen haben (siehe weiter unten). Bei Multicenter-Studien können sich die Forschungseinrichtungen im Hinblick auf bestimmte Versuchsstandards besser synchronisieren und deshalb eine bessere Vergleichbarkeit der experimentellen Bedingungen realisieren. Das Hauptproblem von Multicenter-Studien besteht darin, dass sich prinzipiell Forscher mit dem Ziel zusammenschließen können, um den Nachweis zu erbringen, ein bestimmtes Ergebnis zu widerlegen oder zu bestätigen. Das soll nicht bedeuten, dass die Wissenschaftler die Daten wissentlich beeinflussen, doch es ist belegt, dass selbst subtile Einstellungen und Instruktionsvariationen der Versuchsleiter die Art und Weise beeinflussen können, wie Versuchspersonen die ihnen gestellten Aufgaben bearbeiten. Hierbei ist zu bedenken, dass gerade in psychologischen und pädagogischen Experimenten solche Einflüsse nachgewiesen sind. Vor dem Hintergrund dieser zu bedenkenden Aspekte sollen im Folgenden die Ergebnisse der Metaanalyse und der Multicenter-Studie dargestellt werden.
In die hier zu besprechende Metaanalyse (Chabris, 1999) wurden 16 Arbeiten einbezogen, die in den Jahren von 1993 (der Erstpublikation von Rauscher und Kollegen) bis 1998 den kurzeitigen Einfluss von Mozart-Musik auf kognitive Leistungen untersucht haben. Diese Arbeiten wurden in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert, die hinsichtlich ihres Qualitätsstandards und des wissenschaftlichen Renommees sehr unterschiedlich sind. In diesen wissenschaftlichen Publikationen werden insgesamt 20 experimentelle Vergleiche von «Mozart- vs. Ruhebedingungen» beschrieben. In der «Mozart-Bedingung» kam immer die Mozart-Sonate zur Anwendung (10 Minuten Präsentation), die auch in der Originalpublikation von Rauscher und Kollegen verwendet wurde. Diese Metaanalyse berücksichtigt Daten von insgesamt 714 Versuchspersonen, wobei auch die beiden oben dargestellten Arbeiten von Rauscher und Kollegen Berücksichtigung fanden. Die in den 16 Studien verwendeten kognitiven Tests umfassten den Papierfaltetest aus dem Stanford-Binet-Intelligenztest (in teilweise leicht unterschiedlichen Darbietungs- und Auswerteformen), andere Tests, die räumliche Funktionen testen (Minnesota-Paper-Form-Board, Labyrinthtests, Musteranalysetests aus dem Stanford-Binet-Intelligenztest), Tests zur Messung der non-verbalen Intelligenz (Raven’s Matrizentest, der Matrizentest aus dem Stanford-Binet-Intelligenztest), einfache Arbeitsgedächtnisaufgaben3 (Zahlenspanne-Test) oder einfache Kurzzeitgedächtnistests (Lernen von Buchstabenfolgen).
An der 1999 publizierten Multicenter-Studie (Steele et al., 1999) nahmen drei universitäre Forschungsinstitute teil (die psychologischen Institute der Universität Montreal (UM), der Appalachian State University (ASU) und der University of Western Ontario (UWO)), die insgesamt 217 erwachsene Personen untersuchten. Die Autoren geben explizit an, die Nichtexistenz des Mozart-Effektes nachweisen zu wollen. In den drei Forschungseinrichtungen kam jeweils das gleiche Mozart-Stück zur Anwendung wie in den Originalarbeiten von Rauscher und Kollegen. Die Messung der kognitiven Leistungen erfolgte mittels der gleichen räumlichen Aufgabe wie in den Originaluntersuchungen (also die gleichen Falt- und Schneideaufgaben aus dem Stanford-Binet-Test), wobei auch 16 bzw. teilweise 18 Aufgaben zum Einsatz kamen. Die Kontrollbedingungen waren entweder völlig identisch oder etwas verändert, um mögliche Schlussfolgerungen aus den experimentellen Befunden zu erweitern. Insofern kam neben der Ruhe- und Entspannungsbedingung gegebenenfalls noch eine weitere Bedingung zur Anwendung, mit der der Einfluss des passiven Hörens einer anderen Musikvariante auf die kognitiven Leistungen überprüft werden sollte. Die Forscher wählten Musikstücke, die sie als «minimalistische Musikstücke» bezeichneten, also Musik, welche in ihrer Struktur und Komplexität wesentlich einfacher gestaltet war, als die Mozart-Sonate, die in der experimentellen Bedingung verwendet wurde (z.B, Music with Changing Part von Philip Glass oder Entspannungsmusik wie The Shining Ones von Phil Thornton). Eine Abweichung gegenüber dem Originalexperiment ergab sich an der Appalachian State University. Dort wurden die Testpersonen zunächst mit dem Test für räumliche Funktionen getestet. Nach 48 Stunden hörten sie passiv die Mozart-Sonate und absolvierten danach wieder den Test für räumliche Funktionen.
«A requiem may therefore be in order.»
(Ein Requiem wäre deshalb angezeigt.)
Die oben dargestellten Replikationsversuche waren insgesamt nicht besonders erfolgreich. Allerdings kann man ihnen vorhalten, dass es